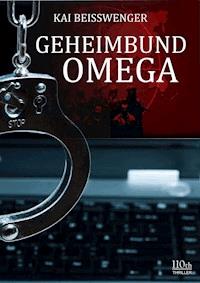4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Frank wartet im Gleisbett auf den nächsten Zug, der ihn ins Jenseits befördern soll. Unvermittelt ergreift er sein Handy und erkennt, wie kompliziert das Sterben ist, wenn ihm das Leben ständig ungefragt dazwischenfunkt … Eine mysteriös-fantastische Geschichte über das Schicksal, über Sinn und Unsinn des Lebens – wie es war und ist, wie es hätte sein können, wie es spielt und spielen könnte. Das Titelbild stammt von Sonja Graus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kai Beisswenger
Finger im Spiel
Action, Thriller, Mystery 12
Kai Beisswenger
FINGER IM SPIEL
Action, Thriller, Mystery 12
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Dezember 2017
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Sonja Graus
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN: 978 3 95765 113 6
Drei Jahre später
Ich blickte nach links, erschrak und zuckte zurück. Träumte ich? Um mich vom Gegenteil zu überzeugen, linste ich noch mal hin und erhielt die Quittung für meine Untat vor drei Jahren. Das Strafregister vergisst nichts. Meins schon gar nicht. Wie ein Blitz fuhr ein übles Gefühl durch meinen Bauch und einen Augenblick später klarte mein Gedächtnisnebel auf. Ohne Zweifel, die Frau am Nebentisch war Louisa. Zögerte sie? Nein, sie hatte mich auch erkannt. Ich guckte wieder hin und tat, als wüsste ich nicht, wer sie wäre und schaute weg. Sogleich verstärkte sich das miese Gefühl. Klar, sie wusste, wer ich war, doch sie ließ sich nichts anmerken. Verstohlen spähte ich noch mal zum Nebentisch hinüber. Der Typ an ihrer Seite passte zu ihr. Er war kleiner als ich, sofern ich einen sitzenden Menschen einschätzen konnte, etwa so groß wie sie, hatte schwarze Haare und einen tätowierten Arm. Beide waren schwarz gekleidet. Sie wirkten wie ein vertrautes Paar.
Zwei Minuten zuvor hatte ich mich noch als Held des Tages gefühlt.
Marie und ich saßen im »Zum Gemalten Haus« in Frankfurt und unterhielten uns. Nein, ich unterhielt sie, denn ich breitete meinen Stolz vor ihr aus und sie ließ mich dozieren.
»Läuft bei dir!«, sagte sie und nährte mein Hochgefühl.
»Ja, wunderbar. Der Verlag hat zwei Preisträger, wir haben das höchste Wachstum in der Branche und endlich kommt auch Kohle rein.« Sie munterte mich auf, fortzufahren.
»Unser Konzept hat Zukunft. Nächstes Jahr will Jan sich zurückziehen, er hat ein neues Projekt, ich zahle ihn in Raten aus und in zwei Jahren gehört der Laden mir.«
Der Ungnade-Verlag verlegte verfemte Autoren und zwar solche der gesamten politischen Bandbreite, die In- und Ausland hergaben. Eine Woche zuvor hatte ich mir die Rechte eines türkisch-deutschen Autoren gesichert, dessen Verträge von seinen Verlegern gekündigt worden waren, weil er plötzlich als Rechter galt. Er schrieb harmlose Hunderomane, und wenn er nicht am Schreibtisch saß, gebärdete er sich als Macho oder treffender ausgedrückt als Vollpfosten, doch ein Rechter war er nicht. Egal, schließlich profitierten wir von der politischen Korrektheit und ich schwebte auf Wolke sieben.
Zurück zur Ursache des Stichs, der sich unbarmherzig durch meinen Bauch zog. Hätte ich besser mal nicht meine Augen über die Nebentische schweifen lassen. War es Schicksal oder Zufall, dass sie gerade jetzt wenige Meter von mir entfernt saß? Keine Ahnung. Jedenfalls fühlte ich mich von einem Augenblick auf den anderen wieder als Feigling, der ich vor drei Jahren tatsächlich gewesen war.
Ich hatte mich Louisa gegenüber wie ein Arschloch benommen und doch konnte ich damals nicht anders, obwohl ich mich dabei schäbig gefühlt hatte. Ja, einfach abtauchen war erbärmlich, aber mir blieb nur die Flucht, auch wenn ich mir anschließend kaum in die Augen sehen konnte. Deshalb wollte ich sie aus meinem Kopf und aus meinem Leben verbannen. Mich aus ihrem Sein und sie aus meinem ausradieren. Monatelang litt ich darunter, weil ich nicht den Mut hatte, ihr zu erklären, dass ich einen Fehler gemacht hatte, dass ich sie überhöht hatte, dass sie nicht mein Typ war, dass ich mich getäuscht hatte. Ja, dass ich bestenfalls geil auf das war, was sie verkörperte. Ich hatte nicht den Arsch in der Hose, ihr das unverblümt zu sagen. Noch nicht einmal eine E-Mail hatte ich ihr schreiben können. Dabei hätte ich sie doch anrufen können und sagen: Du, ich finde dich total nett, aber ich will dich nicht wiedersehen, weil ich glaube, es werde sich nichts entwickeln zwischen uns. Aber ich hätte sie vermutlich noch häufiger sehen müssen. Das hätte ich nicht ertragen können, dazu strebte ich zu sehr nach Harmonie. Wobei sie es genauso gut achselzuckend hätte akzeptieren können. Doch diesen Gedanken wollte meine Eitelkeit nicht zulassen. Hinzu kam die Sucht nach einem Abenteuer. Mich aus einem Leben herausschneiden, ohne Spuren zu hinterlassen. Diese Fantasie hatte ich schon als Teenager. Womöglich war das ein Ausdruck meiner Bindungsangst. Meine Eltern hatten ihren Krieg vor mir ausgelebt und die Erinnerungen daran verfolgten mich heute noch im Traum. Eine ähnliche Beziehungsschlacht wollte ich mir als Erwachsener ersparen, weshalb meine Liebschaften bestenfalls ein paar Monate dauerten. Ob das die einzige Erklärung war? Jedenfalls meinte das mal ein Psychologe, doch den Psychos habe ich nie getraut. Sie diagnostizieren eher ihre eigenen Fehler und projizieren sie auf ihre Patienten.
Hätte ich es heute anders gemacht? Als ich Louisa schäbig behandelt hatte, war ich zweiundvierzig, am Tage unseres unvermuteten Treffens war ich fünfundvierzig. Nein, inzwischen war ich gereifter. Marie würde ich nicht so behandeln. Als ob sie mitbekommen hatte, worüber ich nachdachte, musterte sie mich eindringlich. Wahrscheinlich schon seit einer Weile. Frauen bleibt nichts verborgen. Sie ergriff meine Hände.
»Was hast du? Kennst du die Frau? Oder den Typen?«
»Nee, nie gesehen. Alles in Ordnung, wir wollten doch gehen, lass uns zahlen!«
Ich wurde das schlechte Gefühl nicht los. Und ich ärgerte mich, wie schnell ich vom Winner zum Loser geworden war und obendrein, dass ich die Übelkeit nicht verdrängen konnte, die sich in meinem Body ausbreitete. Meine Laune war längst gekippt und ich musste mich beherrschen, damit Marie nichts auffiel. Das machte mich noch wütender. Sie hatte es nicht verdient, im Unklaren gelassen zu werden. Als wir zu Hause angekommen waren, gab ich mir einen Ruck, erzählte ihr die ganze Geschichte und ließ nichts Wesentliches aus. Marie hörte aufmerksam zu, umarmte mich und bedankte sich, dass ich so ehrlich zu ihr war. Es war befreiend, aus dieser Sache etwas gelernt zu haben, zumindest nahm ich mir vor, Konflikten nicht mehr aus dem Weg zu gehen und bei Problemen das Gespräch zu suchen. Manche können das schon mit zwanzig, ich würde es erst jetzt allmählich lernen. Immerhin.
Einen Tag später
Nachdem ich Louisa gestern wiedergesehen hatte, ging sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich schämte mich immer noch und im Grunde hatte ich die Stiche in der Magengrube auch verdient. So schlagartig, wie sie damals in mein Leben getreten war, hatte ich mich von ihr verabschiedet und so unvermutet war sie mir gestern wieder begegnet. Und doch war sie es, sowie meine Erfahrungen mit ihr, was meinem Leben eine neue Richtung gegeben hatte.
Vermutlich wäre die erste Hälfte meines Lebens eintönig geblieben, wenn nicht diese Geschichte mit dem Buch gewesen wäre, die sich, aus welchen Gründen auch immer, in mein Dasein gemogelt und mir den entscheidenden Kick gegeben hatte, mein Leben zu ändern und auf die Erfolgsspur zu wechseln und zumindest die folgenden Jahre nicht allzu unglücklich zu verbringen. Was für einen Blödsinn dachte ich da?
Es war nicht nur ein einziges Buch, was ich geschrieben hatte. Insgesamt waren es drei und ich hatte etwa zweihundert Stammleser, wenn ich die Rezensenten mitzählte, doch letztere hatten meine Bücher bestenfalls überflogen. Meine Bücher! Die ersten beiden bewegten sich im Bereich der Liebelei. Das erste wurde genauso hochgelobt wie kaum gekauft. Nach zwei Jahren hatte der Verleger seinen Glauben daran verloren, mir hundert Stück zu einem Euro pro Stück aufgedrängt und den Rest verramscht. Natürlich wollte er von meinen Ergüssen nichts mehr wissen und ich suchte mir einen ähnlich erfolglosen Kleinverlag, mehr war leider nicht drin, um mein zweites zu veröffentlichen, das noch erfolgloser war als das erste. Mein drittes Baby sollte mein erfolgreichstes werden, auch wenn nur ein paar Hundert mehr verkauft worden waren als vom ersten.
Inzwischen hatte ich das Schreiben an den Nagel gehängt. Dafür gab es viele Gründe. Ich war zu faul, an den Figuren zu feilen und mich mit den unendlich langen Korrekturen zu beschäftigen, die wenig brachten, denn am Ende hatte ich das Produkt meines Schaffens meist verschlimmbessert. Zweitens gab es tausend andere Schreiberlinge, die ebenso am Hungertuch nagten und besser schreiben konnten als ich. Drittens wurde der Markt immer kleiner, das Smartphone hatte das Buch fast ersetzt, hinzu kamen die Selfpublisher, die ja auch gelesen werden wollten. Viertens bediente ich einen Nischenmarkt. Fünftens wusste ich nicht genau, wie die Menschen tickten, also konnte ich nur wenig über sie schreiben. Sechstens waren meine Dialoge mittelmäßig. Siebtens hatte ich mich erschöpft. Alles war gesagt oder besser: Alles war geschrieben. Und last, but not least war ich erfolglos. Trotzdem musste ich drei Bücher schreiben, um das zu begreifen. Aber das Schreiben war nicht völlig für die Katz, weil ich Kontakte geknüpft hatte, weil ich gelernt hatte, wie das Verlagswesen funktionierte, wie Autoren, Korrektoren und Lektoren dachten und wie man ein Buch machen musste, damit es zumindest eine Chance haben könnte. Und das Wichtigste: Jede Erfahrung ist für etwas gut – man muss sie nur ausschlachten.
Wie fing mein Techtelmechtel mit Louisa an? Ich war nach Düsseldorf gekommen, weil ich einen Tapetenwechsel brauchte. Deshalb heuerte ich bei einem Fachverlag an. Den Job als Lektor hätte ich auch in Frankfurt erledigen können, allerdings hatte ich für diesen Laden noch nicht gearbeitet, und wir wollten uns erst einmal beschnuppern. Besagter Verlag bot sich an, außerdem sollte mir eine Luftveränderung guttun. Geld für solche Eskapaden hatte ich nicht, aber das war sowieso ein generelles Problem. Ich kam gerade so rum mit meiner Kohle. Vom Schreiben, Lektorieren, Korrigieren, Übersetzen, Lesungen und ab und zu einen Artikel in einer Zeitung zu veröffentlichen, konnte ich nicht leben. In manchen Monaten bekam ich kaum die Beiträge für die Künstlersozialkasse plus Miete zusammen. Ich hatte Existenzangst. Nachts wachte ich auf und wälzte mich im Bett herum. Meine Freunde hatten mit vierzig schon einiges erreicht. Ich hingegen hatte nichts auf dem Bankkonto und lebte von der Hand in den Mund.
Mit einem Telefonanruf änderte sich alles. Ein Traum ging in Erfüllung, den ich schon fast vergessen hatte. Schlagartig fiel mir ein, dass auch ein einziger Anruf über Leben und Tod entschied in meinem letzten Buch. Der Zufall spielte die Musik im Leben, darum ging es und das war auch mein Kernthema, um das sich alles drehte, was ich je geschrieben hatte.
Meine Gedanken schweiften ab. Vor drei Jahren hatte ich meine Wohnung für vier Monate untervermietet und mir eine Bude in Düsseldorf gesucht. Mein Vertrag war befristet auf zwölf Monate und der Verlag hatte mir bei der Suche nach einem möblierten Zimmer geholfen. Das war in Düsseldorf nicht so schwierig, denn es gab viele Fachkräfte, die vorübergehend dort arbeiteten, und die für eine begrenzte Zeit in einem möblierten Zimmer hausen mussten. In der Mittagspause pflegte ich abzuschalten und das konnte ich am besten im Fitnessstudio.
Niemand weiß, was den Betreiber des Fitnessstudios bewogen hatte, drei oder vier Exemplare meines neuesten Werkes auf die Theke zu stellen. Als ich mich anmeldete, hatte ich ihm gesagt, dass ich im Verlagswesen arbeitete und ein paar Bücher veröffentlicht hatte. Ich vermutete, anschließend hatte er mich gegoogelt, denn anscheinend stellte er fest, dass mein aktuelles Buch gute Kritiken erhalten hatte. Dann hatte er Nägel mit Köpfen gemacht. Vielleicht wusste er nicht, dass ich ein unbeschriebenes Blatt war und er hatte gedacht, dass man ein Buch nur dann veröffentlichen könne, wenn man blitzgescheit sei. Doch ich wollte mich nicht weiter mit seiner Motivation beschäftigen. Jedenfalls fragte er mich, ob ich ihm ein paar Exemplare des Produktes meines unerheblichen Schaffens überlassen könne. Auf der einen Seite empfand ich die Zurschaustellung meines Daseins schon immer als anmaßend, auf der anderen wollte ich das, was alle Autoren wollen: Verkaufen. Also nahm ich die Scham vor dem Sitz auf dem Präsentierteller hin und sagte zu.
Und wie der Zufall es wollte, gab es doch ein paar weibliche Wesen, die mein Werk zur Hand nahmen, ein paar Zeilen lasen, schmunzelten oder auch nicht, und das Buch wieder zurücklegten. Zumindest bildete ich mir das ein.
Was ich nicht wusste, dass Louisa bereits das erste Kapitel meines Werkes »Das Leben und wie es hätte sein können« gelesen hatte, als ich sie kennenlernte. Doch der Reihe nach. Am Vortag hatte ich gerade das Studio betreten, und als ich am Tresen vorbeikam, fiel mir der Aufsteller mit meinen Büchern ins Auge, der neben den Pillen für die Bodybuilder stand. Bücher? Hier, im Studio für Pumpweltmeister? Ich bemerkte mal wieder, wie unpassend das war. Und der Titel passte schon gar nicht. Wieso hatte Micha keinen Krimi hingestellt? Den hätte man wenigstens zur Kenntnis genommen. Auf dem Cover war ein Gleis abgebildet, auf dem jemand steht, von dem man nur die Schuhe sieht. Das interessierte weder Fitnesstypen noch Bodybuilder. Überraschung: Ich stellte fest, dass ein Buch fehlte. Wahrscheinlich hatte es jemand als Toilettenpapier missbraucht. Ich griff nach meinem Eiweißshake und sprach Andy an, den Mann hinter der Theke:
»Wow, ein Buch ist ja schon verkauft. Du solltest Bücher verkaufen, statt Drinks zu mixen!«
»Ich mach beides lässig mit links, Mike.«
Ich lachte und sagte: »Ich tippe auf eine Fünfzigjährige, Typ Lehrerin für Geschichte oder Sozialkunde.«
Andy schüttelte den Kopf.
»Nee, Louisa, knapp dreißig und ein heißer Feger!«
»Entzückend, wann war das?«
»Vorgestern.«
»Kannst du sie mir beschreiben?«
»Dunkelhaarig, eine Handvoll Brüste, knackig, mittelgroß und immer gut gelaunt.«
»Aha, also so, wie man sich seine Traumfrau vorstellt.«
»Genau so«, beendete er das Männergespräch und stellte den Mixer an.
Während ich das Glas leerte, stellte ich mir vor, wie der heiße Feger, den ich nicht kannte, jetzt zu Hause saß und die ersten Seiten las. Vermutlich hatte sie sich gerade einen Tee gemacht und setzte sich mit Tasse und Schokoriegel beladen in ihren Lieblingssessel und fing an zu lesen …
Das Leben und wie es hätte sein können
I. Das Leben, so wie es war
1. Vor dem Ende eines Lebens?
Ich schreckte auf und eine Frage schoss mir durch den Kopf: Wie lange war ich schon hier? Ich wusste es nicht. Es nieselte. Der Abend kündigte sich an, aber es war noch angenehm warm. Neben mir stehend beobachtete ich mich. Für meine vierzig Jahre sah ich noch gut aus. Was maßvolles Essen, dreimal in der Woche Eisenverbiegen im Fitnessstudio und Mountainbike fahren am Wochenende alles ausmachten. Doch wofür? Komisch, ich war am Ende und mir fiel ein, dass ich gut aussah. Für wen?
Die Therapie hatte nichts gebracht. Viel zu viel hatte ich dafür bezahlt und was hatte ich nicht alles getan, um sie vor Antje zu verheimlichen. Irgendwie konnte ich es nicht zugeben. Dass ich schwach war, viel schwächer als sie. Eigenartig, das hatte ich erst letzte Woche festgestellt: Seitdem wir zusammenlebten, waren wir in einem unsichtbaren Wettbewerb verstrickt. Nie hatten wir darüber gesprochen, aber das Zusammensein war immer anstrengend und aufreibend. Vielleicht verstärkte das meine Depressionen sogar noch.
Antje, meine Frau. Inzwischen kannten wir uns achtzehn Jahre und seit sechzehn Jahren waren wir verheiratet. Die große Liebe erlosch, als wir keine gemeinsamen Ziele mehr finden konnten. Unsere Tochter Laura war gerade fünfzehn geworden. Seit sie in den Kindergarten ging, hatten wir uns nur noch die Klinke in die Hand gegeben. Der tägliche Kampf um die Aufgaben: Wer holte sie ab? Wer passte auf sie auf, während der andere abends zum Sport ging? Wie organisierten wir Geschäftsreisen? Seit dieser Zeit kam mir der Alltag so sinnlos vor, mir machte nichts mehr Spaß, ich empfand keine Freude mehr; ich war unmotiviert und konnte mich zu nichts aufraffen. So richtig gefreut hatte ich mich zuletzt vor fünfzehn Jahren, als Laura geboren wurde.
In den letzten Monaten war mein Trübsinn extremer geworden. Wie oft kam ich zu spät zur Arbeit, weil ich erst gegen Morgengrauen einschlafen konnte? Wieso befasste ich mich noch damit? Alles aus und vorbei. Nichts zu machen, ich konnte die quälenden Gedanken einfach nicht abstellen.
Ich versuchte mich abzulenken, was mir nur halbwegs gelang, denn nun grübelte ich darüber nach, wie es so weit kommen konnte.
Der Auslöser, warum ich hier stand? Schwer zu sagen, da kamen viele Dinge zusammen, doch eine wesentliche Ursache war zweifellos mein neuer Chef. Als er vor einem Jahr ankam, brachte er seine Leute mit. Speichellecker, die bei uns nicht richtig reinpassten. Mit ihnen verbrachte er ganze Vormittage, für mich hatte er keine Sekunde übrig. Für mich gab es keinen Platz mehr. Mich in eine Eselsecke abgeschoben und mein Gehalt gekürzt hatte er schon. Das reichte ihm nicht. Er wollte mich zum Abschied zwingen. Meine innere Kündigung war ihm zu wenig, er wollte auch meine äußere. Gestern im Vertriebsmeeting hatte er eine private E-Mail vorgelesen und mich bloßgestellt. Vor allen Kollegen. Ich konnte einpacken. Mit vierzig eine neue Stelle?
Ja, aber nur wenn ich auf monatlich tausend Euro verzichtet und einen langweiligen Job angenommen hätte. Wie hätte ich den Hauskredit abbezahlt? Und Antje und Laura? Sie hätten in mir endlich den Loser gesehen, der mich schon lange gequält und den ich unter der Maske meines falschen Selbstbewusstseins kaschiert hatte. Das wollte ich uns ersparen.
Mir fiel ein, wie ich heute Morgen aufstand und mein Bauch grummelte. Stimmt, nach dem Frühstück war ich dreimal auf der Toilette gewesen. Lustlos quälte ich mich in die Firma, und als ich schließlich am Schreibtisch saß, umschlich mich ein schlechtes Vorgefühl, das sich alsbald realisieren sollte.
Nach der Mittagspause bestellte mich mein Chef in sein Büro und kanzelte mich wegen einer Nichtigkeit ab. Seine Worte drangen in ein Ohr rein und durchs andere wieder raus. Ich wollte es schon abhaken, doch dann entdeckte ich eine Winzigkeit, die mich umstimmte. Es war dieser ironische Blick meines Chefs, durch den ich mich selbst gesehen hatte. Wertlos, überflüssig. Ein Nichts. Noch während er durch mich hindurchdrang, drehte ich mich wortlos um und verließ sein Kabuff. Ich schleppte mich durchs Großraumbüro und spürte, wie meine Kollegen mich musterten. Jemand sprach mich an, doch ich hörte nicht hin. Ich schnappte meine Jacke und stolperte zur Tür. Die Teamsekretärin rief mir hinterher: »Herr Kleinmann, Sie müssen sich doch ausstempeln!«
Ich ignorierte sie und verließ die Firma, die mir in den letzten Wochen so verhasst geworden war. Mechanisch setzte ich einen Fuß vor den anderen und hatte dabei das Gefühl, als ob ich neben mir zum Bahnhof gegangen wäre. Dort stieg ich in die nächste S-Bahn, setzte mich in ein freies Abteil, fuhr etwa fünf Stationen, stieg aus und lief ein paar Hundert Meter bis zu einer Brücke, die die Gleise querte und ging den verbotenen Treppenweg hinunter. Seitdem stand ich auf den Gleisen und fühlte mich beschissen. Nicht nur in diesem Moment.
Ständig war ich müde, niedergeschlagen und teilnahmslos. Nichts interessierte mich, ich war völlig apathisch. Die anderen, selbst die, die mir nahe standen, bedeuteten mir nichts mehr. Seit Jahren konnte ich mich über nichts mehr freuen. Nichts wollte gelingen. Und über allem stand die Angst. Vor meinem Scheitern. Vor meiner Niederlage. Ich wiederholte mich. Meinen Gedanken fehlte die Struktur. Mein Ich langweilte mich. Bis zum letzten Atemzug?
Laura und Antje wollte ich nicht wehtun. Aber sollte ich weiterleben, damit sie weder trauerten, noch von Gewissensbissen geplagt wurden? Mich opfern? Wem wäre damit gedient? Ich war überzeugt, es gab keinen Grund für ein endloses Leiden im falschen Leben. Nein, es ging nicht mehr.
Ich hoffte, meine Familie könnte mir vergeben und verstehen, dass der ständige Schmerz mein Leben unerträglich gemacht hatte. Ich konnte andere Menschen täuschen, aber nicht mich selbst. Und ich wollte mir nicht länger was vormachen. Jetzt musste ich es endlich tun.
Hatte ich mein Handy mitgenommen? Wieso kümmerte mich das jetzt? Um Antje eine Abschieds-SMS zu schicken? Man musste ja mit der Zeit gehen, ähm sterben. Besser nach einer WhatsApp-Nachricht umkommen, schließlich war ich ein moderner Mensch. Sollte ich sie losschicken, kurz bevor der nächste Zug kam? Was dachte ich da für eine Scheiße? Wo war das Ding, das ständig nervte? Es war eben noch in meiner Jacketttasche.
Ich strich über meine Brusttasche, um mich meines Smartphones zu vergewissern. Spontan und gedankenverloren. Ich wusste doch, dass es dort war.
Sollte ich ein Selfie machen: Ich, eine Minute vor meinem Tod? Oder Sekunden davor den ankommenden Zug knipsen und das Foto noch schnell auf Facebook stellen? Der Zug, mein Freund und Totschläger. Eine Schnapsidee! Darauf hätte auch Leon kommen können. Leon, wie kam ich jetzt auf ihn?
Verdammt, Leon! Was er wohl machte? Mit Sicherheit stand er nicht auf Bahngleisen rum, um dem Tod ins Auge zu blicken. Leon und seine mir so unerträgliche Leichtigkeit des Daseins. Er ruhte in sich selbst, war ehrlich, offen und seine größte Stärke war sein unerschütterlicher Gleichmut. In Situationen, in denen ich mich geschämt hatte, blieb er ruhig und gelassen. Noch nicht mal rot war er geworden. Dafür bewunderte ich ihn, doch insgeheim war ich oft neidisch. So wäre ich auch gerne gewesen.
Und plötzlich, warum auch immer, erinnerte ich mich an seine unfassbare Ruhe und Lösungskompetenz einst im Mai.
Wir waren in der Taberna, unserer Studentenkneipe, als plötzlich die Tür aufging und vier Rocker reinkamen. Sie stürmten auf unseren Kommilitonen Horst zu. Die Situation wurde immer bedrohlicher. Als einer anfing zu rempeln und Horst in eine Ecke drängte, ging Leon seelenruhig an die Theke und griff nach einer leeren Bierflasche. Als nächstes registrierte ich, wie einer der vier Typen ihn aus den Augenwinkeln beobachtete. Doch bevor jemand reagierte, schlug Leon die Flasche auf den Tresen, drehte sich um und hielt den zertrümmerten Flaschenhals dem Rempler entgegen. Dieser blieb stehen und starrte ihn entgeistert an.
»Verpiss dich und lass dich hier nicht wieder blicken, ich meine es ernst!«
Alle im Raum erstarrten. Leon war zwar nicht besonders kräftig, aber groß und zäh. Was ihm der Rempler an Umfang voraushatte, machte Leon mit seiner Statur und seinem entschlossenen Blick wett. Vielleicht wäre es nicht so glimpflich ausgegangen, wenn nicht – wie auf Kommando – fünf Studenten einen Halbkreis um die Typen gebildet hätten. Der Rempler schaute sich um und sah Leon an. Dann fuhr er Horst an: »Wir sprechen uns noch!« Einen Moment später nickte er seinen Kumpel zu und flugs waren sie draußen.