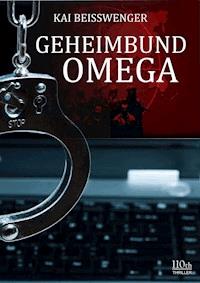Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kurz vor der Rente verwandelt sich der gewöhnliche Alltag des braven Angestellten Ernst Richter in einen Höllentrip. Plötzlich steht er im Mittelpunkt dunkler Mächte. Warum wird er gejagt, überwältigt und entführt? Weshalb soll er für ein unglaubliches Experiment missbraucht werden? Welches unfassbare Geheimnis ist mit ihm seit seiner Geburt verknüpft? Nach der fantastischen Reise durch eine Parallelwelt kommt Ernst Richter dem Rätsel auf die Spur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nichts ist besser als das Leben
von
Kai Beisswenger
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: fotolia.de
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-288-0
MOBI ISBN 978-3-95865-289-7
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Vorrede
Je länger ich über meinen spontanen Ausflug nachdenke, umso mehr zweifle ich an meinem Verstand. Warum bin ich heute Morgen mit dem Intercity von Düsseldorf nach Frankfurt gefahren? Weshalb sitze ich in einem Wirtshaus, das ich in einem Film entdeckt habe, dessen Drehbuch auf meinen fragwürdigen Träumen basiert? Die Vorgeschichte ist so merkwürdig, dass ich mit dem Kopf schüttle, was der junge Mann am Nebentisch, der mich für einen einsamen alten Kauz halten mag, mit einem Stirnrunzeln quittiert. Ich proste ihm zu, doch er winkt ab. Ich kann es kaum glauben. Ich bin hier, weil mein Zwillingsbruder, der nie geboren wurde, in diesem Lokal, allerdings in einer anderen Welt, einige Sternstunden seines Lebens verbracht hat. Heute ist Samstag, der 30. Januar 2010 und just in diesem Moment könnte mein Bruder an meiner statt auf diesem Stuhl hocken, allerdings in einem anderen Universum. Jeder normale Mensch muss denken, ich sei ein Fall für die Klapse.
Obwohl ich die Kneipe nur im Film gesehen habe, fühle ich mich, als ob ich Stammgast wäre. Vor meiner Abreise überprüfte ich, ob die Gaststube auch in meiner Welt vorhanden ist. Und siehe da: Die Stalburg im Frankfurter Nordend ist eine Apfelweinwirtschaft aus dem Jahre 1876, die in dritter Generation der Familie Reuter gehört. Am Tisch hinter dem Kanonenofen habe ich mich niedergelassen, vor mir das zweite Bier, denn mit Äbbelwoi konnte ich mich nie anfreunden. Wie kann man so etwas mögen?
Nebenan strömen Besucher in ein kleines Theater und ich lache in mich hinein, denn im Augenblick fühle ich mich nicht nur als Gast, sondern auch als Darsteller eines Schauspiels. Also noch mal, ganz langsam: Ich bin an einem Ort, wo ich noch nie war, und fühle mich so heimisch, als wäre ich mein ganzes Leben hier ein und aus gegangen.
Da stellt sich einem doch augenblicklich die Frage, ob ich überhaupt weiß, wo ich hingehöre. Wo bin ich wirklich? Ich rekapituliere: Mein Name ist Ernst Richter, ich bin fünfundsechzig Jahre alt und fühle mich wie ein altes Eisen, das bald eingeschmolzen wird.
Gut, gehen wir chronologisch vor. Den ersten Schock erlebte ich schon vor meiner Geburt, als mein Zwillingsbruder, der ein paar Minuten vor mir das Licht der Welt erblicken sollte, seine Geburt verweigerte. Also musste ich den Sprung alleine wagen, in eine Welt hinein, die vor dem Untergang stand. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt, denn er fiel fürs Tausendjährige Reich, tragischerweise, kurz bevor es nach zwölf Jahren endlich unterging. Meine Kindheit verbrachte ich dreißig Kilometer nördlich von hier, im Haus meiner Großeltern in einem urigen Taunusstädtchen. Vor meinem achten Geburtstag packten wir unsere Habseligkeiten zusammen und zogen nach Düsseldorf, denn mein Stiefvater hatte 1952 einen Job bei Henkel gefunden. Er war Koch und brachte es später noch zum Chefkoch der Betriebskantine. Wenige Wochen nach seiner Beförderung starb er an einem Herzinfarkt.
Ich war kein guter Schüler. Die Note „sehr gut“ hätte ich nur im Fälschen der Unterschrift meiner Mutter verdient, die ich schon in der dritten Klasse besser hinbekam als sie. Mit viel Mühe schleppte ich mich zur Mittleren Reife. Ich hatte Pech, denn ich wurde für achtzehn Monate in eine Uniform gesteckt, während meine Kameraden, die etwas älter waren als ich, nur ein Jahr oder fünfzehn Monate dienen mussten. Doch beklagen konnte ich mich wirklich nicht, denn die Schrecken eines Krieges, die meinem Vater den Kopf kosteten, blieben mir zum Glück erspart. So leistete ich meinen Wehrdienst bei den Pionieren in Hannoversch Münden, einem Kaff zwischen Kassel und Göttingen. Zum Mann wurde ich erst, als ich in einem Soldatenpuff meine Unschuld verlor, was Anfang der sechziger Jahre nicht unüblich war. Nach dem Bund, wie er genannt wurde, absolvierte ich in Düsseldorf eine Ausbildung zum Kaufmann. Mit Glück und Beharrlichkeit arbeitete ich mich unaufhaltsam nach oben. Bis vor sechs Monaten war ich leitender Angestellter eines kleinen japanischen Unternehmens, dann wurde ich wohl oder übel in die Rente abgeschoben. Man könnte meinen, ich habe ein stinknormales Leben geführt, zumindest bis zum vierundsechzigsten Geburtstag. An jenem Tag erlebte ich meine zweite Geburt, denn notgedrungen musste ich den ungewöhnlichsten Nebenjob der Welt annehmen, seltsamerweise kurz vor dem Ruhestand. Genau genommen war es auch keine Beschäftigung, die dem Broterwerb diente, es war eher ein außergewöhnliches Abenteuer.
Was habe ich gelernt in meinem Leben? Dass Zufälle die Geschichte bestimmen könnten? Dass wir in verschiedenen Welten leben würden, was bedeutet, dass sich mein Leben jetzt hier realisierte, während weitere meiner Lebenszeiten auch in anderen Sphären abliefen? Und dass ein einziges unbedeutendes Ereignis ein Leben komplett umkrempeln kann? Vor zwei Jahren hätte ich mir diese Fragen so nicht gestellt. Heute sehe ich die Welt mit anderen Augen. Ein Mensch, den man aus dem Spiel des Lebens entfernt, indem man ihm verbietet, über Los zu gehen, verändert alles, die Geschichte jedes Menschen in allen Welten. Das mag seltsam klingen, doch der Leser sollte sich noch etwas gedulden mit seinem abschließenden Urteil, zumindest so lange, bis ich meine Erzählung vorgetragen habe.
Noch ein paar Worte zu meiner Person, bevor wir uns in meine unglaublichen Erlebnisse stürzen. Ich war nur wenige Jahre mit einer Frau verheiratet, die von Anfang an nicht zu mir passte. Die vornehme Dame, mit der ich gerne meine Rente verbringen wollte, hat mich verschmäht. Und das unerreichbare Wesen, das ich auf Händen getragen hätte, hat meinen Bruder in der Parallelwelt geheiratet.
Warum bin ich an diesem Ort? Weil ich glaubte, die beiden Welten träfen sich hier am gleichen Tag zur selben Zeit und ich würde meinem ungeborenen Bruder wieder begegnen? Dachte ich wirklich, ich könnte ihm verzeihen, weil er meinen frühen Tod in seiner Welt verursacht hat? Würde ich meinem Bruder, den ich hier nie gehabt hatte, endlich vergeben, dass er mich in den Tod getrieben hat, allerdings in einem anderen Universum? Wie naiv bin ich denn? Nein, es war eher ein sentimentales Gefühl, das mich hierherführte, das weiß ich jetzt. Trotzdem bin ich froh, dass ich hier sitze und zum ersten Mal bin ich wirklich stolz auf mich. Richtig gelebt habe ich nur die letzten achtzehn Monate und ich habe auf unglaubliche Weise meinen verlorenen Zwillingsbruder wiedergefunden. Ich trinke mein Glas leer und lasse meinen Blick durch die Schenke schweifen, die so gar nicht in die heutige Zeit passt. Schließlich bleibt er an dem beleibten Mann hinter dem Tresen hängen. „Herr Reuter, noch ein Starkbier!“
Der Wirt schaut von der Theke auf, zapft ein Bier, stellt es auf meinen Tisch und mustert mich. „Woher kennen Sie mich?“
Kapitel 1 Der Überfall
1
Düsseldorf, Immermannhof, Freitagabend, 18.07.2008
Warum arbeite ich noch, ich könne es mir doch gemütlich machen? Mit vierundsechzig Jahren habe ich den Ruhestand redlich verdient, jetzt sei ein guter Zeitpunkt, die Jungen ranzulassen, man werde auch ohne mich auskommen, ohnehin komme mein Abschied spätestens in einem Jahr, da könne ich auch sofort Nägel mit Köpfen machen, schließlich sei ein Ende mit Schrecken immerhin besser als ein Schrecken ohne Ende. Mein Kollege, verantwortlich für die kaufmännische Leitung, mit dem ich als Vertriebsleiter nicht immer an einem Strang ziehe, wie er es auszudrücken pflegte, vermieste mir lustvoll die Laune, weil er etwas offenbarte, an dem ich schwer zu knabbern hatte. Es fiel mir schwer, zu akzeptieren, dass ich für unseren zwanzigjährigen Auszubildenden bereits ein alter Sack war. Lag es an dem Sekt, den ich meinen Kollegen am
Freitagnachmittag anlässlich meines vierundsechzigsten Geburtstages kredenzt hatte, oder spürte ich bereits das Unheil, das sich über mir zusammenbraute? Mit einem Schlag war mir flau im Magen.
Ich würde sie vermissen. Meinen japanischen Chef, der als Aufpasser und Sprachrohr zur Zentrale fungierte, die Geschäfte jedoch meinem Kollegen, der mich am liebsten sofort loswerden wollte, und mir überließ, um sich auf die Verbesserung seines Golfhandicaps zu konzentrieren. Meine Vertriebsmannschaft, die Damen vom Innendienst und die Jungs der Service-Abteilung - sie alle würden mir fehlen. Ich schob meine melancholischen Gefühle beiseite, trank mein Glas leer, verabschiedete mich und eilte vom Besprechungsraum ins Großraumbüro. Dort schaltete ich den Computer ab, warf mein Jackett über und nahm den Aufzug in die Tiefgarage. Unten angekommen, drückte ich auf die Fernbedienung. Der Wagen öffnete sich und ich stieg ein.
Ich wollte gerade den Motor anlassen, da zuckte ich zusammen. Reifen quietschten und eine Limousine kam quer vor meinem Toyota zum Stehen. Zwei identische Typen in dunklen Anzügen, die Gesichter hinter Sonnenbrillen versteckt, fixierten mich. Auf der Stelle fühlte ich mich bedroht. Der Beifahrer stieg aus und tänzelte geschmeidig um die Front des Wagens herum meiner Fahrertür entgegen. So bewegt sich ein Einzelkämpfer, schoss es mir durch den Kopf. Der Typ war nicht harmlos, der führte bestimmt Böses im Schilde. Unerwartet kaltblütig schlüpfte ich aus dem Auto. Als der Mann einen halben Meter von mir entfernt war, rammte ich ihm meinen Aktenkoffer in den Bauch. Er schrie auf und stürzte zu Boden. Ich ließ den Koffer fallen und rannte so schnell ich konnte zum Ausgang. Dabei zog ich meine Chipkarte aus der Jacketttasche. Vor der Tür drehte ich mich um. Unterdessen war der Fahrer ausgestiegen und mein Opfer rappelte sich auf. Mit zitternden Händen presste ich die Karte auf den Kartenleser und zählte die Sekunden. Zum Glück summte es sogleich. Ich riss die Stahltür auf, stürzte hindurch und drückte die Aufzugtaste. Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Einer der beiden Verfolger hämmerte dagegen und fluchte. Ich faltete meine Hände und flehte um einen Aufzug. Es tat sich nichts. War der zweite Lift wie so oft außer Betrieb? Warum dauerte es so lange? Das Hämmern erstarb. Ich hörte Schritte, die sich entfernten. Endlich blinkte der Pfeil nach oben auf, der Fahrstuhl öffnete sich und ich stieg ein. Allein im Lift. U1, fahr doch schneller, nach einer Ewigkeit leuchtete EG auf. Der Fahrstuhl öffnete sich ganz langsam. Niemand stand davor. Ich lugte zur Eingangstür hinüber. Keine verdächtigen Personen in Sicht. Ich hetzte nach draußen, überquerte den Konrad-Adenauer-Platz und lief den Straßenbahngleisen entgegen. Aus den Augenwinkeln erspähte ich den Wagen der zwielichtigen Gestalten. Dass nur Busse und Taxis die Straße befahren durften, kümmerte sie nicht. So verhielten sich Profis. Das erste Gleis überquerte ich einen Moment, bevor eine Tram darüber hinwegfegte. Gleis zwei und Gleis drei konnte ich mühelos passieren, doch am vierten fuhr gerade eine Bahn an. Trotz des schrillen Warnsignals wagte ich, über die Gleise zu springen. Der Fahrer bremste, klingelte, schimpfte und drohte, während ich weiterflitzte. Ich schaute zurück und sah, wie einer der Schergen bereits die Limousine verlassen hatte und die Verfolgung aufnahm. Ich rannte zwei Jugendliche über den Haufen, die obszöne Verwünschungen hinter mir herriefen, und hetzte durch den Bahnhofsnordtunnel an einer Bäckerei vorbei. Unentschlossen blieb ich stehen. Ich schaute nach links zur Treppe hinauf auf den ersten Bahnsteig. Dort fuhren Züge nach Venlo oder nach Kleve. Aber leider erst später. Ich rannte weiter und ließ die nächsten beiden Bahnsteige hinter mir. Auch dort wollte kein Zug sofort abfahren. Am Gleis dreizehn eilten Passanten die Treppe hinunter. Gutes Zeichen! Ich spurtete hinauf. Als ich an der S-Bahn ankam, schlossen sich gerade die Türen. Ich drückte auf den Türknopf. Nichts tat sich. Ich klopfte ans Fenster. Im Abteil erbarmte sich ein Fahrgast und betätigte den Türöffner. Die Tür ging auf, ich schlüpfte hinein und die Bahn fuhr ab. Als ich mich umdrehte, sah ich das enttäuschte Gesicht von einem der Verfolger. Er kam fünf Sekunden zu spät. Gerne hätte ich ihm eine lange Nase gezeigt, aber ich war ja kein Kind mehr. Also setzte ich mich hin und schaute mich im Abteil um.
Ich sei unterwegs in der S11 zum Flughafen, bestätigte mir eine ältere Dame mit Hut und einem Pudel auf dem Schoß. Zwölf Minuten später kam ich am Flughafen-Terminal an. Ich rannte durch die Ankunftshalle zum Taxistand hinüber. Während ich mich vordrängelte, erntete ich das Kopfschütteln einer kleinen Dicken, die mit einem Regenschirm bewaffnet war. Ich ignorierte sie, zwängte mich in einen freien Wagen und rief dem Fahrer meine Adresse zu. Das hatte ich fürs Erste geschafft.
Ich zitterte, spürte mein Herz pochen und der Schweiß rann mir den Nacken hinunter. Wer bin ich?, fragte ich mich. Wieso hatte ich jemanden attackiert, von dem ich überhaupt nicht wissen konnte, ob er mich wirklich bedrohte? Warum reagierte ich wie ein Einzelkämpfer, obgleich ich es nur bis zum grünen Gürtel in Karate geschafft hatte? Allerdings vor einer Ewigkeit, denn ich hatte den Anzug samt Gürtel schon vor fünfzig Jahren an den Nagel gehängt. Ich fühlte mich wie eine ferngesteuerte Kampfmaschine und registrierte nun auch noch ein unbestimmtes Bauchflimmern. Intuitiv ahnte ich, dass sich mein Leben ab heute grundsätzlich ändern würde. Während ich aus dem Fenster schaute, fiel mir ein, dass ich am nächsten Morgen schon wieder am Flughafen sein musste. Ich wollte nach Palma de Mallorca fliegen, um anschließend eine Woche lang mit dem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer zu schippern. Seitdem ich geschieden war, machte ich jedes Jahr eine Tour mit der Aida. Letztes Jahr war ich im März in der Karibik gewesen. Bisher hatte ich immer ein nettes Mädel kennengelernt. Einsame Herzen, meist Kleinunternehmerinnen mit wenig Zeit und viel Geld, die auf rüstige Jungsenioren standen, gab es zuhauf. Das Handy klingelte, es war Kollege Erbsenzähler aus der Buchhaltung. „Hallo Klaus, was gibt es?“
„Ist dir etwas passiert, Ernst?“
Ich war überrascht, wie schnell meine Kollegen auf dem Laufenden waren, und antwortete zögernd: „Wie kommst du darauf?“ Klaus ließ mich einen Moment zappeln, bevor er mit ironischem Unterton zur Sache kam.
„Dein Aktenkoffer liegt vor deinem Wagen auf dem Boden und die Fahrertür steht offen! Beginnen so alle zukünftigen Rentner ihren letzten Urlaub?“
Was für ein Blödmann, dachte ich, bevor ich säuselte: „Nein, keine Sorge, werter Kollege! Kannst du bitte die Fahrertür zumachen und den Aktenkoffer in meinem Schrank einschließen?“
„Ja natürlich, aber dafür versprichst du mir, nicht alles stehen und liegen zu lassen, wenn du das nächste Mal verreist!“
„Selbstverständlich, das kommt nicht mehr vor. Ich erkläre dir alles nach meinem Urlaub, ich danke dir!“
„Schönen Urlaub, ich glaube, die Erholung wird dir guttun.“
Klaus Weißbengert, oberschlauer Sesselpupser und Höfling meines Chefs; gerade er musste den Koffer finden, das war ja mal wieder typisch. Wer weiß, was er nach dem Telefonat in der Firma herumposaunte. Wenn ein Unglück nahte, dann überfiel es mich gleich knüppeldick. „Hant Ehr wat verjesse?“ Der Fahrer, ein gemütlicher Mann mit Käppi, fixierte mich im Rückspiegel.
„Nein, alles in Ordnung, fahren Sie bitte weiter!“
Der Mann nervte. Ich brauchte Ruhe zum Nachdenken, doch er wollte unbedingt seine Theorie an den Mann bringen, wie man in wenigen Minuten die Nationalität eines Fahrgastes erkennen könnte. Überzeugend war er nicht, denn er hielt mich für einen Österreicher. Als ich ihm im Scherz entgegnete, ich sei Schweizer, gab er auf und konzentrierte sich auf seinen Job. Wir schwiegen. Das Taxi näherte sich dem Ziel und ich wies ihn an, langsamer zu fahren. In einer Nebenstraße hatte ich die Limousine meiner Verfolger gesehen. Das glaubte ich jedenfalls. Andererseits sah jeder zehnte Wagen so aus. Wenige Meter vor meiner Wohnung entfernt, erkannte ich plötzlich mühelos einen der Gauner. Men in Black stachen selbst in Düsseldorf sofort ins Auge. Er stand unter der Laterne vor der Haustür und zündete sich eine Zigarette an. Der Fahrer bremste, der Ganove bemerkte uns und blickte neugierig zu uns herüber. „Fahren Sie weiter, schnell!“ Im Rückspiegel sah mich ein verdattertes Gesicht fragend an. Draußen nutzte der Typ das Zögern des Fahrers und stürmte auf das Taxi zu. Der Mann am Steuer legte den ersten Gang ein. Inzwischen hatte der Schwarze den Türgriff erreicht. In Erwartung einer Attacke zwängte ich mich auf die andere Seite des Rücksitzes. Warum fuhren wir nicht los? Die Kindersicherung klickte, der Angreifer fluchte und klopfte auf das Autodach. Mir blieb das Herz stehen, die nächsten Sekunden erlebte ich wie in Zeitlupe. Seelenruhig öffnete der Fahrer das Handschuhfach, ließ das Beifahrerfenster herunter, kramte eine Pistole hervor, und richtete sie auf den Gauner. Der hob die Arme und wich einen Schritt zurück. „Verkrömel dech!“ Unschlüssig blieb der schwarze Mann stehen und machte keinen Mucks. „Hörs do schleiht? Mach dech vom Acker!“ Der Angreifer drehte sich um, das Düsseldorfer Original schmiss die Waffe auf den Beifahrersitz und fuhr endlich los. Er grinste breit und warf mir einen verschwörerischen Blick im Rückspiegel zu. Ich dankte ihm mit einem anerkennenden Lächeln. Mehr bekam ich nicht hin, mir hatte es die Sprache verschlagen, was selten vorkam. Als ich mich beruhigt hatte, befahl ich meinem Retter mit zittriger Stimme: „Bringen Sie mich zum Hauptbahnhof, Ostseite, Bertha-von-Suttner-Platz.“ Der Mann am Steuer hatte Spaß am Gaunerstück, denn er feixte unablässig in den Rückspiegel hinein. Ich spürte, wie er vor Neugier platzte, doch er blieb trotzdem stumm. Er war wohl ein Chauffeur alter Schule: loyal und diskret. Zehn Minuten später kamen wir an. Ich zahlte, sprang aus dem Taxi und eilte durch die Passage zum Konrad-Adenauer-Platz. Dass ich vierzig Minuten später wieder am Ort des Überfalls auftauchte, würden meine Jäger kaum vermuten. Die Luft war rein. Ich lief durch den Immermannhof, überquerte die Karlstraße und eilte die Immermannstraße entlang zum Hotel Nikko. Soeben hatte ich beschlossen, mich für eine Nacht im Nikko zu verstecken. Zur Polizei zu gehen, war doch sinnlos. Zuerst musste ich herausbekommen, wer hinter mir her war und was meine Häscher von mir wollten. Dazu hatte ich eine Nacht Zeit oder sogar zusätzlich eine Woche auf der Aida. Am nächsten Morgen würde ich mich von zwei oder drei Bekannten aus dem Fitnessstudio in meine Wohnung begleiten lassen, meinen Koffer packen und dann direkt zum Flughafen fahren. Wobei ich nicht sicher war, ob die Spitzbuben nicht bereits wussten, dass ich verreisen wollte. Aber an ein baldiges Wiedersehen mit den Jungs wollte ich jetzt nicht denken. Ich stutzte und schüttelte den Kopf. Inzwischen hatte ich mich zwar an meine ungewohnte Kaltschnäuzigkeit gewöhnt, doch wunderte ich mich immer noch darüber, wie mutig und entschlossen ich vorging. An der Rezeption buchte ich ein Zimmer zum preiswerten Wochenendtarif. Ich hatte immer schon mal im Nikko übernachten wollen, dort, wo sich meine japanischen Geschäftsfreunde einquartierten und angeblich so wohlfühlten.
2
Ich verriegelte die Zimmertür und warf mich aufs Bett. Wer zum Teufel steckte dahinter? Ich hatte weder Spielschulden, noch war ich in kriminelle Machenschaften verwickelt. Eine meiner diversen weiblichen Bekanntschaften oder meine geschiedene Frau? Nein, meine Frau und ich hatten uns friedlich getrennt. Das konnte ich von meinen Liebschaften zwar nicht immer behaupten, doch eine Racheaktion dieses Kalibers war äußerst unwahrscheinlich. Hatte ich eins der Muskelpakete im Fitnessstudio beleidigt? Nein, auch nicht. Mir fiel nichts ein. Aber ich sollte besser mein Handy ausstellen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass ich über mein Handy geortet werden könnte. Wobei ich nicht sicher war, ob es auch funktionierte, wenn es ausgeschaltet war. Ich stand auf und stellte es ab. Dann legte ich mich wieder aufs Bett. Im Yogakurs hatte ich gelernt, mich auf mein Innerstes zu konzentrieren. Zumindest theoretisch. Doch jetzt zeigte sich, dass ich viel zu nervös dazu war. Unruhig wälzte ich mich im Bett herum.
Nach einer Weile erinnerte ich mich an die Begegnung mit einem Filmproduzenten. Vor drei Monaten hatten wir ein seltsames Gespräch während einer Podiumsdiskussion im Verlagshaus der Rheinischen Post gehabt. Das Thema war Deutschland in der Globalisierung. Den Veranstalter kannte ich vom Fitnessstudio und das war auch der Grund für meine Einladung gewesen. Ich mochte derlei Zeitverschwendungen, bei denen Sekt geschlürft wurde und die Gäste sich profilieren mussten, nicht, allerdings wollte ich es mir wenigstens einmal anschauen. Die Vorzeichen standen gut, denn es war ein sonniger und warmer Frühlingstag. Von der Dachterrasse des Redaktionsgebäudes hatte man einen tollen Ausblick auf die Stadt. Als das offizielle Programm beendet war, die Selbstdarsteller vom Fragenstellen erschöpft waren, stand das unvermeidliche Händeschütteln und Sekttrinken auf dem Programm. Ich wollte mich gerade aus dem Staub machen, als mich der Produzent ansprach. Ein leger gekleideter schlanker Mann meines Alters, jedoch mit mehr Haaren auf dem Kopf, die immerhin bereits ergraut waren. Er kam ohne Umschweife sofort zur Sache und machte mir ein absurdes Angebot. Wenn ich mich zwei Wochen lang psychologischen Tests unterziehe, bekomme ich dafür zehntausend Euro. Er habe von einem Psychiater, der meiner Ex-Frau und mir eine nutzlose Eheberatung angedient hatte, erfahren, dass ich ein geeigneter Kandidat sei. Der verrückte Produzent hatte tatsächlich beabsichtigt, sich in meine Träume einzublenden und deren Inhalte zu visualisieren. Daraus wollte er einen Film machen. Natürlich lehnte ich sein Angebot ab, da ich es für einen Witz hielt. Ich glaubte, er wäre verrückt. Vor ein paar Wochen erfuhr ich dann, dass er tatsächlich eine ganz große Nummer war und ich fand heraus, dass ich mindestens zehn seiner Filme gesehen hatte. Bernhard Lerchinger hieß der Knabe. Könnte es sein, dass er sich von meiner Absage wenig beeindrucken lassen hatte? Er war ein Machtmensch, für den das Wort Grenze ein Fremdwort war. Ein Macho, der Männern genau das sagte, was er meinte und der von Frauen stets bekam, was er wollte. Keiner packte so unterschiedliche Genres an wie Lerchinger. Ein Filmbesessener, der sein Publikum nicht nur erreichen, sondern auch beglücken konnte. Gäbe es einen Oscar für fantastische Kinoträume, er hätte ihn verdient. Je länger ich über ihn nachdachte, umso mehr verfestigte sich mein Verdacht. Wenn ich ihn anriefe, gäbe er bestimmt unverblümt zu, dass er mich suchte. Seine Telefonnummer hatte ich natürlich nicht und ich hätte sie auch nicht so einfach bekommen. Aber ich könnte meinen ehemaligen Psychiater anrufen, überlegte ich. Doktor Heinrich Engelhart war ähnlich skurril - so etwas wie Lerchingers Taschenbuchausgabe. Ich griff nach dem Hoteltelefon, wählte die Auskunft und bekam sofort Engelharts Nummer. Ich versuchte es und hatte Glück. „Hier Engelhart, guten Abend, was kann ich für Sie tun?“
Ich bekam kein Wort raus. „Hallo, wer spricht dort?“, fragte er mit ungeduldiger Stimme.
„Guten Abend, Herr Doktor, hier spricht Richter …“
„Richter, verdammt noch mal, wir suchen Sie, wo sind Sie?“
Aha, jetzt wusste ich, wer dahinter steckte. Ich lag also richtig. Erst wollte ich mich für das Geburtstagsgeschenk bedanken, überlegte es mir aber anders und legte auf. Und jetzt? Ich zitterte, spürte mein Herz klopfen. Nur nicht nervös werden, denk nach, rügte ich mich. Wurde die Telefonnummer des Hotels unterdrückt oder war sie auf dem Display des Telefons von Engelhart erschienen? Egal, vermutlich hatten sie mich über mein Mobiltelefon längst geortet. Und nun? Ich öffnete die Minibar und trank einen Whiskey auf ex aus. Das nächste Fläschchen schlug ich mir aus dem Kopf, denn mir wurde klar, dass ich besser sofort die Polizei anrufen sollte.
Ich wollte gerade den Hörer abheben, da klopfte es an der Tür. Ich zuckte zusammen. Dann suchte ich das Zimmer nach einem Gegenstand ab, den ich als Waffe gebrauchen könnte. „Wer ist da?“, fragte ich mit belegter Stimme. Ich war mir fast sicher, mein Herzschlag pochte durch die Tür bis in die Ohren der Person hinein, die vor der Tür stand. „Begrüßungssekt, Special Service für Neukunden!“, rief jemand mit japanischem Akzent. Ich atmete auf. Ein Schluck Schampus vor dem Gespräch mit der Polizei schadet nie, dachte ich und öffnete die Tür. Vor mir stand ein Hotel Boy, der ein Tablett mit einem Piccolo und einem Sektkelch in der Hand hatte und mich verängstigt anstarrte. Aus dem Nichts schlängelte sich eine Hand an ihm vorbei und drückte mir ein Tuch ins Gesicht. Jemand packte mich. Ich versuchte mich zu wehren, doch meine Arme reagierten nicht mehr. Alle Muskeln verkrampften, ich roch noch etwas Süßes, dann spürte ich nichts mehr.
3
Irgendwo im Himmel streiten zwei Personen: Ein Seelenverwalter, namentlich Erzengel Michael, sowie eine untröstliche Seele, die sich entschlossen hat, nicht wiedergeboren zu werden. Die Seele gleicht einem Schwamm mit Augen und Mund. Michael ist stattlich gebaut, sein Rücken leicht gebeugt. Wallendes weißes Haar fällt ihm auf die Schultern. Er ist bärtig und blickt mit Nachsicht und Güte auf die Seele, die vor sich hin jammert. „Das letzte Mal wurde ich in der Hölle von Verdun von einer Granate zerrissen. In der Regel lebe ich zwanzig Jahre, dann werde ich erschossen, zerfetzt, gehenkt oder gevierteilt. Ich habe keine Lust mehr. Meine Kameraden sterben ab und zu auch mal eines natürlichen Todes. Warum darf ich das nicht?“
Michael hebt beschwichtigend seine Arme. „Jeder ist die Summe seiner Erfahrungen. Ich habe mir deine Akte angeschaut und festgestellt, dass du tatsächlich in einer Schleife hängst und es dein Schicksal nicht wirklich gut mit dir meint. Aber du hast bisher nichts geleistet, was einen Sprung auf die nächste Ebene rechtfertigen könnte. Du musst dich mehr anstrengen!“
Die Seele heult auf. „Soll das heißen, ich habe ein mieses Karma und muss nun für immer und ewig darunter leiden? Weißt du was, Michael? Ich habe keine Lust mehr. Während andere die Freuden des Lebens genießen, verabschiede ich mich immer mit dem ersten Schuss eines Krieges, bevor ich in den Genuss eines Stelldichein mit einem Weibe komme. Gestern Verdun, vorgestern die Schlacht von Sedan, davor die Völkerschlacht bei Leipzig und so weiter und so fort. Das ist nicht fair!“
Michael überfliegt die Akte. „Bisher hast du außer einigen Opfern auf dem Schlachtfeld nicht viel in unserer Chronik hinterlassen. Ich sehe viel Schatten und kaum Licht. Ich kann nichts für dich tun; ich kann dir nur raten, dass du dich zukünftig auf gute Taten konzentrieren solltest, um ein besserer Mensch zu werden.“