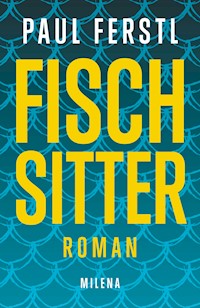
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Milena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander Keller ist Fischkenner und betreut Aquarien. Seine neue Freundin Mary nimmt ihn mit zu ihrer Familie – der 90. Geburtstag ihres berühmten Großvaters steht an. Die Feierlichkeiten werden vorbereitet, und Keller befreundet sich mit dem harten, alten Mann. Aber die Katastrophe ist unausweichlich. Ein hochintelligenter, wichtiger Roman über Familie, Kunst und uns. Alexander Keller hat ein Händchen für Fische und setzt dieses äußerst lukrativ um – in Fischzucht, Aquariumsbetreuung und Gastronomie. Keller liebt Fische – lebendig, roh, gebraten. Diese Ambivalenz zwischen Fürsorge und Verschlingen zieht sich durch sein ganzes Leben. Kellers Freundin Mary, Enkelin des berühmten Künstlers und Gartenarchitekten Akira Benshi, stellt Keller kurz vor dem 90. Geburtstag ihres Großvaters ihrer Familie vor. Und es wird familiär kompliziert: Die Eltern definieren sich ausschließlich über Benshis Kunst, Benshi selbst schweigt, seit er seine Familie beim Atombombenabwurf über Nagasaki verloren hat. Doch als er Keller Fisch essen sieht, bricht er sein Schweigen, macht Keller zu seinem Helfershelfer bei der Neugestaltung seines berühmten Gartens – und verursacht lediglich dessen Verwüstung. Mary selbst wird wieder in längst vergangen geglaubte Familienstrukturen hineingezogen – und mittendrin Keller, der als Benshis "neuer bester Freund" weit über den Rand seiner vermeintlichen Toleranz und seines Gleichmuts gebracht wird. Ein Roman mit geschliffenem Stil, klug, fließend – aber dann!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAUL FERSTL
FISCH SITTER
ROMAN
Für Lisa
Inhalt
Itadakimasu!
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Literarische Verweise
Der Autor
Itadakimasu!
1
DIE DREI METER HOHE MAUER STACH INS AUGE, kein Mensch in dieser Gegend hatte so etwas, Klostergärten einmal ausgenommen.
Keller wünschte, er hätte diesen Gedanken nicht gehabt. Mary reichte ihm wortlos den Schlüsselbund mit dem Chip, der das Tor entsperren würde. Natürlich stand er mit dem Auto zu weit von dem Sensor weg, also musste Keller sich abschnallen, um einigermaßen durch das Fenster gelangen zu können. Die Torflügel gingen auf, und er fuhr den Audi über einen breiten Kiesweg in Richtung Haus.
Es war ein mächtiger Vierkanthof, frisch verputzt und aufwändig renoviert. Doch es war vor allem der Garten rundum, der die Blicke auf sich zog. Jeder Grashalm trug den Anspruch vor sich her, Richtung und Sinn zu haben. Keller wunderte sich, dass sein erster Eindruck von dem Ganzen recht scheußlich war.
»Um Gottes willen«, sagte Mary. Sie hatte während der Fahrt geschwiegen. Mary war nervös, gleichzeitig aber still und hilflos ergeben. Das wiederum machte Keller nervös.
»Ich hoffe, dass du mir nichts davon übel nimmst«, sagte sie, »egal, was passiert.«
Keller lachte: »Ich dachte, ich würde heute geprüft werden.«
»Es kommt mir genau umgekehrt vor«, sagte sie. Er parkte neben zwei anderen Autos, sie stiegen aus, Mary nahm ihn an der Hand und zog ihn von der Eingangstür fort Richtung Garten. »Wir sind ohnehin zu früh, schauen wir uns das Ganze an. Es ist das Schönste hier.«
Sie folgten den gebogenen Kieswegen um das Haus herum. Die vielen Fenster des Hofs waren recht klein und taugten nur für einen schmalen Blick nach draußen. Keller sah sich um: Es gab einige künstlich angelegte Hügel, ein breites Kiesbecken, in das mit einem Rechen Muster gezogen worden waren, mehrere Teiche und Kanäle. Weiter hinten stand ein kleines asiatisches Tempelchen, weiß verputzt, mit einem roten Dach – Keller hörte einen imaginären Besucher »sehr hübsch!« oder etwas in der Art rufen, mit Ironie oder ohne. Da und dort standen ein paar Kunstwerke aus der Schrottphase des alten Benshi herum, aus den Fünfzigerjahren. Keller hatte Marys Großvater pflichtschuldig recherchiert, als sie einander kennengelernt hatten, aber der Kunstkram hatte ihn nicht sehr interessiert. Die architektonischen Arbeiten sprachen ihn mehr an, denn der alte Benshi setzte in seinen Gärten immer recht gefinkelte Kanalsysteme ein. Zwischen geschnittenen Obst- und anderen Bäumen, Felsgärten und Moosplantagen standen ein paar grüne Bambuswäldchen, wie er sie aus dem botanischen Garten kannte. Die gefielen ihm. Hinter einem Hügel tauchten ein paar Zeilen Wein auf, und die gefielen ihm noch mehr.
»Blauburgunder und Grauburgunder«, sagte Mary, »er presst seit dreißig Jahren selber.«
Ein »Er« war immer der Großvater, so viel hatte Keller schon begriffen.
»Schöne Angewohnheit«, sagte er und blieb vor einem Kanal stehen: Seerosen, Wasserlinsen (kaum Strömung, notierte er bei sich), und dort drüben – der erste Koi.
»Wir hätten das alles ganz anders machen sollen«, sagte Mary, »ganz anders. Ich sollte dich nicht mitbringen. Ich sollte dich bei ihnen kennenlernen. Das wäre viel besser. Alles wäre besser so. Es wäre ihre Schuld, wenn ich dich kennen würde.«
»Ihre Schuld, sehr schön«, sagte Keller.
»Die Koi sind ja eh krank. Als ich letzte Woche draußen war, habe ich gehört, dass mein Vater deinen Namen erwähnt hat.«
»Ausgezeichnet«, sagte Keller.
»Was soll daran ausgezeichnet sein?«
»Beruflich gesehen, meine ich. Werbung kann ich mir bald sparen. Die Leute reden – umso besser.«
»Ich weiß nicht, ob ich das will«, sagte Mary.
»Dann nicht. Wenn sie’s ansprechen, kann ich sagen, ich wäre ausgebucht.«
»Ich weiß auch nicht, ob ich das will.«
»Ah ja«, sagte Keller und sah sie amüsiert an – sie hob die Schultern und gab damit wortlos zu verstehen, dass sie selber wusste, dass das nicht sehr hilfreich war –, dann fragte er: »Können das die Leute nicht selber machen? Dein Vater oder dein Großvater?«
»Pflanzen und Steine, ja. Obwohl es dafür auch Hilfe gibt. Vieles will er selber machen. Mit Tieren haben sie es aber nicht so.« Sie machte eine Pause. »Deswegen habe ich es überhaupt erst gesagt, es ist mir rausgerutscht, wenn man das glauben mag. Ist ja auch komisch gewesen, der Papa sagt, da gibt es diesen Keller, vielleicht sollten wir den anrufen, und ich hab nichts Besseres zu tun als zu sagen: ›Den kenn ich, das ist mein Freund‹.«
Keller lachte.
»Ja, lach du nur. Das ganze Getue sofort … der erste Freund, den ich nach Jahren heimbringen werde … Ich hab fast zwanzig Jahre gebraucht, um aus diesem Haus herauszukommen. Meine Mutter hat es nie geschafft.«
»Drama, Drama«, sagte Keller.
»Ja, ich weiß eh. Es ist gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm.«
»Wir stehen vor der Haustür, das ist dir schon klar. Und ich soll da jetzt hineingehen?«
»Natürlich. Aber es wird dir gefallen. Roher Fisch, Reis, als Vorspeise gekochte Nordseebrühe.«
»Isst das dein Großvater am liebsten?«
»Es muss nicht immer nach ihm gehen. Außerdem isst er am liebsten Schweinsbraten.«
»Aussetzer eines japanischen Genies?«
»Der Spruch könnte von meiner Mutter sein.«
»Weißt du, wie der Wasseraustausch in den Kanälen funktioniert?«
Mary küsste ihn auf den Mund und sah ihm in die Augen. Sie schüttelte langsam und traurig den Kopf, als bedauerte sie ihr Unwissen. Dann lachte sie.
Die Mutter war sympathischer als gedacht, und Keller ärgerte sich ein wenig über sich selbst – Mütter waren meistens sympathischer, als sie von ihren Töchtern dargestellt wurden. Der Anblick der Frau Merlicek-Benshi musste ohnehin ein besonderer sein – der absurde Name hing sehr passend an ihr, wie auch der Name Mariko Merlicek sehr passend an Mary hing, die diese Bezeichnung prompt verweigerte. Auf die Mutter war immer ein waches Auge zu werfen, wenn man langfristige Beziehungspläne verfolgte, und zwar aus den üblichen vielfältigen Gründen.
In Mama Merlicek-Benshi schlug der asiatische Zug viel stärker durch als bei Mary, aber die Mama verstärkte diesen Zug auch offenkundig, während Mary ihn zu verschleiern versuchte. Andererseits wurde man bei Mary ohnehin nur beim ersten Anblick von einem vagen exotischen Eindruck gestreift, danach dachte man kaum mehr daran. Keller hatte nicht einmal beim ersten Mal daran gedacht, aber gut, es war ja auch dunkel gewesen, und Marys asiatische Aufmachung hatte wie ein Bluff gewirkt. Die niederösterreichischen Laute, die Mary bei körperlicher Arbeit und generell bei Erregung auskamen, taten ihr Übriges.
Herzlich war sie, die Mama, vielleicht ein wenig offensichtlich bemüht, herzlich zu sein, aber das konnte er ihr kaum vorwerfen. Er bemühte sich ja auch, und mit diesem Gedanken ging das Lächeln prompt leichter: »Alexander Keller. Schön, Sie endlich kennenzulernen.«
Sie bedauerte, dass die Gäste erst so spät hätten kommen können. Der Herr Keller habe noch zu tun gehabt, ja? Aber nun seien sie hier. Sehr schön. Sie habe sich schon lang gefreut. »Und da ist ja auch mein Mann.«
Bleich, dünn und groß war Merlicek-Vater, in Jeans und Sakko. Die sandbraunen Haare waren strohig und ölig zugleich, Keller fiel es schwer, den Blick von ihnen abzuwenden. Merlicek-Vater schüttelte Keller die Hand und lächelte mit weitem Mund, dann nahm er Mary in die Arme, küsste sie auf die Stirn, begrüßte das »Kind«. Dann driftete er schon wieder ab, als würde er von einer Strömung in Richtung Esszimmer gezogen, die Zeit sei schon etwas knapp, aber ein Aperitif gehe sich allemal aus.
Sein Abgang und die Einladung kamen etwas zu plötzlich für die anderen drei, die noch immer recht ziellos im Eingangsbereich herumstanden, man hatte das Gefühl, es gäbe dort noch etwas zu tun – im Sommer hatte man nie etwas abzulegen, wenn man die Schuhe anbehielt.
»Sie waren schon im Garten, ja?«, fragte die Mutter.
»Ja«, antwortete Keller, »Mary hat mich einmal ums Haus geführt.«
»Sie sagen auch Mary zu ihr?«, fasste die Mutter das Offensichtliche in eine Frage, und sie tat das erstaunlich heftig. »Sie heißt Mariko!«
»Öh«, sagte Keller halb dümmlich, halb diplomatisch, zwischen den beiden Frauen stehend, die ihn ansahen – und als sich die beiden einander zuwandten, was er für eine viel bessere Idee hielt, nutzte er die Gelegenheit zu ein paar schnellen Schritten zur Seite und sprang in die Strömung, die schon Merlicek-Vater davongetragen hatte.
Im Wohnzimmer stand der Vater am bereits gedeckten Tisch und rückte Geschirr zurecht. Keller lagen ein paar Sätze auf der Zunge, die nach wenig raffinierter, aber effektiver Tradition die sofortige generationenübergreifende Verbrüderung einleiten würden; irgendetwas zu einer »Flucht aus dem Kreuzfeuer zwischen den Damen«, Tür und Angel, Regen und Traufe, darauf würde Grinsen, Stöhnen oder Gelächter folgen (je nach Vater-Charakter), dann als nächster Schritt das Angebot, Alkohol zu teilen – bei zumindest siebzig Prozent der Väter hätte das in irgendeiner Weise funktioniert und erste Weichen für die gemeinsame Reise gestellt. Hier war sich Keller aber unsicher, welches Resultat damit zu erzielen wäre. Die Mutter hatte ihn ein wenig aus der Bahn geworfen, und er wollte nicht gleich nach dem Kanalsystem im Garten fragen, obwohl es ihn sehr danach juckte. Andererseits war das auch ein ganz ausgezeichnetes Gesprächsthema, das man nicht zu früh verheizen sollte. Also witzelte er doch – gerade deswegen – in die Unsicherheit hinein, sprach von Kreuzfeuer, Hölle und Fegefeuer, etwas in der Art, er schämte sich ein wenig, die Reaktion war ernüchternd: »Ha-ha, ja-ja«, sagte der blasse Merlicek-Vater ohne einen Funken Freundlichkeit und ohne einen Hauch von Ironie und bot Keller einen »Campari-Soda als Aperitif« an, das habe er sich in seiner »Zeit in Italien angewöhnt«.
Als Mary fünf Minuten später mit ihrer Mutter ins Zimmer kam, hatte Keller ein bereits leeres Glas in der Hand und zu schwitzen begonnen. Merlicek-Vater sprach noch immer über Italien, ohne sich je unterbrochen zu haben, das volle Glas in der Hand, aus dem er keinen einzigen Schluck genommen hatte. Zu einer Frage an den frisch vorgestellten Freund der Tochter war er noch nicht gekommen. Keller war erstaunt, dass er beinah so etwas wie Bestürzung empfand, und er beschloss, auf die grobe Behandlung grob zu antworten. Er unterbrach Merlicek-Vater mitten im Satz – unverständlicherweise hatte dieser es für nötig gehalten, sich in umständlicher Manier über den Kreuzgang des Klosters Sassovivo irgendwo in Italien zu verbreiten –, indem er Mama Merlicek anlächelte und auf ein großes, gerahmtes Foto wies, das über der Couch hing: »Das gefällt mir sehr.«
Auch Mama Merlicek lächelte – »das freut mich, ich habe das Bild gemacht« –, Mary lächelte schief, weil sie wusste, dass Keller darüber Bescheid gewusst und das recht bekannte Bild mit Absicht gelobt hatte, und Merlicek-Vater lachte und sprach sofort vom Inhalt des Bildes, statt sich mit der Perspektive seiner Frau aufzuhalten. Das Bild zeigte eine der vielen Gedenkstätten, die der alte Benshi gestaltet hatte – der lange Schatten eines Kreuzes lag auf weiten Gräberreihen, die Figur des Christus war ganz durch das Holz geschnitten und damit eine Gestalt aus Licht, die morgens mit sterbenden Armen die Ruhestätten der Ermordeten umarmte.
Merlicek-Vater sprach von Leid, Holocaust und Bomben, der Erinnerung der Überlebenden und von Todeslisten, vom Fassbaren des Unfassbaren und vom Trost und Schrecken der Gärten, die Benshi anlegte. Mama Merlicek schenkte Keller nach und holte sich und ihrer Tochter zwei Gläser, rief in die Küche und zupfte am Tischtuch, und sie sagte zwischen Bergen-Belsen und Wyoming: »Sie mögen ja Fisch?« Mary hatte einen Arm um Kellers Mitte gelegt und trank, hörte ihrem Vater zu und biss Keller in einem kurzen unbeobachteten Moment in die Schulter – der Vater hatte sich umgewandt, um auf eine Feinheit des Bildes hinzuweisen. Keller spürte den Alkohol und hatte für einen Moment ein seltsames Gefühl der Distanz zu all den Leuten hier – dann kamen sie wieder näher, die Situation fühlte sich beschwingt an, er drückte Mary an sich und sagte mit fester Stimme: »Ja, ich mag Fisch.«
Der Esstisch war groß, größer noch als bei den Pollacks, den Kunden, zu denen sie nachher mussten. Das war ein Tag des Geldes heute. An den Wänden hingen Chagall, Arnulf Rainer und Damien Hirst. In einer Vitrine lag eine Kawabata-Erstausgabe mit Widmung des Autors. Keller erkannte weder den Chagall noch den Rainer noch den Hirst (von Letzterem kannte er aber immerhin den echten toten Hai, den dieser in eine durchsichtige Box getan hatte), aber Merlicek-Vater beeilte sich, seiner Unwissenheit abzuhelfen. Der Hinweis, der Literaturnobelpreisträger Kawabata habe den Roman mit eigener Hand signiert, erweiterte Kellers Wissen nicht unwesentlich: Der Herr Kawabata hatte also Literatur verfasst und zudem auch noch den Nobelpreis gewonnen.
Keller wartete darauf, dass sich die Damen setzten, Merlicek-Vater nahm als Erster Platz. Mary lief hinaus und half einer Frau Mitte fünfzig, die Misosuppe hereinzutragen, indem sie sie mit Zärtlichkeiten behinderte. Keller war angesichts dieser Begrüßung überrascht, von der Dame noch nie etwas gehört zu haben. Als er aufstand, um ihr die Hand zu geben – eine Ungeschicklichkeit mit schlechtem Timing, denn der Topf hatte seinen Platz auf dem Tisch noch nicht gefunden –, sahen ihn die Eltern Merlicek etwas befremdet an, und Merlicek-Vater stellte die Frau als »die gute Seele des Hauses« vor.
Die Misosuppe war ausgezeichnet. Sie fingen an, ohne auf den alten Benshi zu warten, den Keller recht gespannt erwartet hatte; auf seine Frage hin wurde ihm mitgeteilt, dass dieser nicht immer zu den Mahlzeiten erscheine. Mama Merlicek stellte ihm über der Suppe die erste persönliche Frage und erkundigte sich angelegentlich danach, ob seine Familie im Krieg sehr gelitten habe. Keller gab an, dass er das kaum beurteilen könne, über familieneigene Tote und Leid wisse er nichts zu berichten – sein Großonkel sei allerdings zur Waffen-SS eingezogen worden und habe dort höchstwahrscheinlich einige Grausamkeiten begangen. Mama Merlicek hinterfragte sofort das Wort »eingezogen«, zur SS habe man sich schließlich freiwillig gemeldet, es gab so viele Bewerbungen, dass strenge Auslese erfolgen konnte, »sogar die Zähne haben sie angeschaut«, warf Merlicek-Vater ein. Keller erklärte den Unterschied zwischen sogenannten Reichs- und Volksdeutschen und wies darauf hin, dass die slawischen Sprachkenntnisse des Großonkels sicherlich sehr begehrt gewesen wären, um Menschen im Osten schneller töten zu können. Den Kriegsdienst seines Großvaters ließ er fürs Erste einmal aus. Er empfand das Gespräch als etwas missglückt, und damit schien er nicht allein zu sein: Der Suppentopf wurde unter Schweigen weggetragen.
»Sie wissen das ja wahrscheinlich«, sagte Mama Merlicek, und Keller hatte die dumpfe Ahnung, dass er diesen Einleitungssatz hier noch öfter hören würde, »Sie wissen das ja wahrscheinlich, das ist ein Chagall!« – »Also, Sie wissen das ja wahrscheinlich, aber mein Vater hat seine erste Familie beim Atombombenabwurf auf Nagasaki verloren.«
»Ja, das weiß ich«, sagte Keller, fragte sich, was er nun damit anfangen sollte, und schmeckte dem Satz nach. Seltsam, was man so sagte, wie man versuchte, ein derartiges Geschehen auszudrücken – und hatte irgendjemand beim Abwurf an sich etwas verloren? Er spürte eine seltsame Lust, die Geschichte von dem Mann zu erzählen, der aus dem siebten Stockwerk gesprungen war und bei jedem Stockwerk dasselbe sagte. – »Bis hierhin ging’s gut«, sagte Mary da plötzlich, Keller lächelte, Mama Merlicek machte eine verständnislose Handbewegung, und Keller drückte Marys Hand unter dem Tisch.
Nächster Gang: koreanischer Fischeintopf mit Kohl, sehr heiß, sehr sauer, sehr gut. Keller lobte. Die Suppe war schon erinnerungswürdig gewesen, aber das hier war noch eine ganz andere Größenordnung.
»Wir haben uns immer sehr für die japanisch-koreanische Verständigung eingesetzt«, sagte Merlicek-Vater als Antwort auf das Lob für den Kohl.
»Wir?«, fragte Keller.
Merlicek-Vater holte aus. Neben »unserer eigenen künstlerischen Tätigkeit« seien Mama Merlicek und er stark damit beschäftigt, das Œuvre des alten Benshi zu verwalten, Ausstellungen und Projekte umzusetzen und generell den Kontakt zur Außenwelt und die Darstellung des alten Mannes abzuwickeln. In Bälde – »Sie wissen das ja wahrscheinlich« –, nämlich in zehn Tagen schon, stünden die Feierlichkeiten zu Benshis neunzigsten Geburtstag an, Jahrgang 1924, es würde hier einen großen Festakt geben, mitten im wunderschönen Garten, sehr persönlich, mit ausgewählten Gästen, eine große Sache selbstverständlich. Zwischendrin geschah Merlicek-Vater auch die Aussage, es sei »ein wenig unglücklich, dass der Vater« – so nannte er seinen Schwiegervater – »nicht 1925 geboren ist, man könnte alles in einem Aufwischen machen, Geburtstag feiern und gedenken, wo es doch am selben Tag ist, 9. August, aber das macht nichts, gar nichts, macht man eben zweimal alle zehn Jahre große Veranstaltungen.« Außerdem sei der Atombombenabwurf paradoxerweise so etwas wie ein zweiter Geburtstag am selben Tag, Benshi sei ja nur zufällig nicht bei seiner Familie in Nagasaki gewesen, Tod und Rettung, vom Leid getrübtes, gewollt-ungewolltes Glück, das Sich-Zurechtfinden in einer sinnlos zerstörten Welt, das Ende der Jugend, die Neuausrichtung, künstlerisches Schaffen, die weite Welt, Kreislauf des sich aufbäumenden, bejahend-ablehnenden Lebens. Das Wachsen des Todes, im Tod. Benshis Kunstwerke, Jahrzehnte seiner Zeit voraus, Bio-Art, die faulenden Baumstämme in seinen Gärten, auf denen Schwämme aufblühten über die Jahre hinweg, Pilze, die sich von der toten organischen Materie ernährten, Kunstwerke, die zehn Jahre zur Reife benötigten.
Keller pfefferte seinen Eintopf.
Die Seele des Hauses räumte ab und reichte Sushi nach. Ein Mann betrat den Raum und ging auf den Tisch zu. Er war klein und dürr. Der Mann hielt sich sehr aufrecht, trug braune Cordhosen, ein weißes Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und Hosenträger.
Merlicek-Vater hörte mitten im Satz zu reden auf. Der alte Benshi hatte nur wenige Haare auf dem Kopf und sah höchstens aus wie siebzig. Er warf einen kurzen Blick auf die Tischgesellschaft. Keller machte Anstalten aufzustehen, aber Mary packte seinen Oberschenkel unter dem Tisch und hielt ihn auf seinem Platz fest.
Benshi setzte sich und häufte seinen Teller voll. Die Seele des Hauses erschien noch einmal und brachte ihm eine geöffnete Flasche Bier aus einer Privatbrauerei, ohne Glas.
Niemand sagte ein Wort.
Keller sah den alten Mann von oben bis zur Leibesmitte genau an. Im geöffneten Hemd waren graue Haare auf der Brust zu sehen. Benshi erwiderte Kellers Blick kurz und begann dann zu essen. Er hatte ein paar Altersflecken auf der Stirn, muskulöse Unterarme und sehr schöne, schlanke Hände.
Keller wandte sich dem Sushi zu. Der Thunfisch war passabel. Der Butterfisch hingegen war der beste, den er seit Jahren gegessen hatte. Er würde mit der guten Seele des Hauses noch sprechen müssen, neben der offensichtlich großen Kochkunst hatte diese bislang auch den sinnvollsten Satz dieses Abends geäußert, nämlich: »Freut mich, Gruber mein Name.«
Der Tisch wurde größer, und jedes Reiskorn schien einzeln in den Mund zu fallen. Keller wunderte sich über die plötzliche Gedrücktheit – zuvor war es nicht unbedingt angenehm gewesen, aber keineswegs angespannt. Die Stäbchen, die er mit der rechten Hand zum Mund führte, wurden ihm plötzlich deutlich bewusst, und er ließ ein Maki fallen. Der alte Benshi saß da und nahm den Fisch mit einem groben dreizinkigen Monstrum von einer Gabel auf. Keller lächelte und nahm sich mehr vom Butterfisch.
»Und Sie arbeiten mit Fischen?«, fragte Mama Merlicek. »Mein Mann hat etwas in die Richtung gesagt. Mary hat nicht viel erzählt.«
Mary stopfte sich den Mund voll.
»Ja«, sagte Keller, »ja.«
Die Eltern Merlicek sahen ihn an. Auch Benshi hatte den Kopf gehoben.
Keller fragte sich, wie gut Benshi Deutsch verstand. »Ja, mit Fischen«, sagte er, da offensichtlich ein Mehr an Information von ihm verlangt wurde, »alles Mögliche mit Fischen. Ich habe ein Geschäft in Wien, Aquarien, Süß- und Meerwasser, auch mit etwas Anglerei. Aber eigentlich mache ich Beratung und Pflege, Fischzucht, Luxusaquarien, Zierfische in stehenden Gewässern und Kanalsystemen, etwas Fischhandel für die Gastronomie.«
»Sie sollen ein rechtes Wunderkind sein«, sagte Merlicek-Vater gönnerhaft, »ein Fischflüsterer. Preise auf Anfrage, wie ich gesehen habe.«
»Natürlich Preise auf Anfrage«, sagte Keller, »den Fischen habe ich aber nicht wirklich etwas zu flüstern. Mein Job ist es eher, den Menschen etwas zu flüstern. Um die geht es ja immer. Auch was die Preise auf Anfrage betrifft.«
»Wie meinen Sie das?«
»Den Preis macht nicht die Krankheit des Kois, sondern der Chagall des Besitzers.«
Mary lachte. Mama Merlicek wedelte wieder ungeduldig mit der Hand. »Nein, nein, das habe ich schon verstanden, wir machen ja auch Preise auf Anfrage, nein, ich meine, das Flüstern. Das Menschenflüstern.«
Keller überlegte.
»Der Fisch kommt nicht von selbst auf die Idee, dort zu sein, wo er ist. Die Menschen machen das. Ist ja auch ihr gutes Recht. Und natürlich muss ich sehen, was mit den Fischen ist. Aber den Fischen brauche ich nichts zu flüstern – die Besitzer müssen etwas tun, und an denen hängt es meistens. Viele haben fixe Vorstellungen, sonst würden sie sich das ja gar nicht antun. Speisefisch ist immer leichter als Zierfisch. Die Leute wollen, dass es schmeckt oder kostet. Das geht dann leichter. Bei der Schönheit geschieht der Pfusch.« Keller hatte das Gefühl, sich nicht gut auszudrücken.
»Und wie sind Sie dazu gekommen?«
»Ich habe schon als Kind Aquarien gehabt. Es hat mir immer gefallen. Kleine Welt, aber komplex zu basteln. Viele Faktoren. Abgetrennt vom Rest. Glaswände. Im Studium habe ich es dann zum Dazuverdienen gemacht. Wunderkind, hat Ihr Mann gesagt … Es hat funktioniert. Ich habe aufgehört zu studieren und nur noch das gemacht. Irgendwie … ich konnte es den Leuten erklären.«
»Was erklären?«
»Die große Stille.«
Keller hatte begonnen zu verkaufen, und er ärgerte sich wohlwollend über sich selbst – »kannst nicht aus deiner Haut, du Depp« – in diese Richtung ging das Gefühl.
»Die große Stille. In einer Blase aus leisem Lärm. Im Wasser schwebt es. Die Pumpen arbeiten, die Lampen surren. Der Fisch schwebt, weit weg von uns, obwohl er direkt vor unseren Augen ist. Aber er ist weit weg, in einem anderen Element – die Glasscheibe kommt auch noch dazu. Der Weltraum könnte kaum fremdartiger sein, man kann ihn sich aber nicht ins Wohnzimmer stellen. Korallen sind besonders gut. Sie stehen im Wasser, wachsen und tanzen. In Stille. Es ist schon viel Physik und Chemie dabei – messen, messen, messen. Aber ich kann sehen, was passiert. Und ich kann es in Worte fassen. Es ist, als würde man einen seltsamen Stummfilm erklären.«
Mama Merlicek lachte nervös auf, und Keller hatte das Gefühl, er habe zu dick aufgetragen.
»Erklären, was geschieht – denen, die es eben nur sehen. Klingt alles sehr esoterisch, ich weiß. Aber es funktioniert. Ich kann die Probleme lösen.«
»Na gut, na gut«, sagte Merlicek-Vater, der Kellers Ausführungen mit wachsender Ungeduld zugehört hatte, »vielleicht können Sie einmal einen Blick auf die Koi werfen, wenn es die Zeit erlaubt. Irgendwas hat es da. Na ja.«
Na ja, das hieß – scheiß auf die Koi, letztlich. Man hatte wahrscheinlich Koi, wie man eben auch signierte Kawabata-Erstausgaben hatte. Keller grinste Merlicek-Vater an und schenkte sich Wein nach.
»Wie habt ihr zwei euch eigentlich kennengelernt?«
Keller sah zu Mary hinüber und überließ es ihr, die Geschichte zu erzählen. Mary hatte eine Ausstellung der Akademie der bildenden Künste im Regionallinien bedienenden Franz-Josefs-Bahnhof besucht, weil sie ihr ehemaliger Professor dazu eingeladen hatte. Keller hatte die Ausstellung der erstsemestrigen Studierenden besucht, weil er der kleinen Schwester eines Freundes geholfen hatte, Holzkohle in eine Schauvitrine zu schaufeln. Auf dem Weg zu der Vitrine war ihm ein bloßfüßiger Junkie aufgefallen, der in Richtung Bahnhofstoilette getaumelt war. Keller hatte die junge Frau bedauert und erwogen, sinnlos Hilfe anzubieten, dann sah er, dass Security auf die Toilette nachfolgte, was auch nicht schön war, dem Ganzen aber einen offiziellen Anstrich verlieh. Bei der Präsentation später entpuppte sich der vermeintliche Junkie als Performerin der Universität, die nur auf die Toilette gegangen war, um sich für ihre Schleimspur einzunässen – sie zeigte nämlich während der Eröffnung eine Schneckenperformance und legte in quälend langen zehn Minuten eine Strecke von fünf Metern zurück. Mary wurde auf Keller aufmerksam, weil dieser während der Performance laut lachte.
»Warum haben Sie denn gelacht?«, wollte Mama Merlicek wissen.
»Na ja, das war von der Bahnhofssituation inspiriert … eine Performance gegen die Hochgeschwindigkeitsgesellschaft und den Fahrplan-Wahnsinn.«
»Und was ist daran so lustig?«
»Ja … hat Ihnen der Franz-Josefs-Bahnhof jemals das Gefühl einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft vermittelt?«
Merlicek-Vater lachte.
Tatsächlich war das aber nicht das erste Mal gewesen, dass Keller Mary gesehen hatte. Er hatte damals bereits einen langen Abend hinter sich gehabt, in wechselnder Besetzung, rund um einen festen Kern an Leuten, von Lokal zu Lokal, und nun saßen sie am Ende des Abends an dem Ort, an dem sie nur landeten, wenn sie ohnehin schon längst jenseits von Gut und Böse waren – in dem Lokal, das seine Einzigartigkeit nur dem Umstand verdankte, dass es als einziges in einem Radius von fünfhundert Metern noch offen hatte. Plötzlich kam eine Frau in einem asiatisch angehauchten Seidenkleid herein, setzte sich an einen Tisch, streifte neben Keller die High Heels von den bloßen Füßen, stieg auf aus einer Handtasche gezogene flache Schuhe um – und verschwand prompt wieder. Da kein Mensch am Tisch diese Szene kommentierte, schwieg auch Keller und erinnerte sich erst wieder daran, als er Monate später von ebendieser Frau darauf angesprochen wurde, welches Ausstellungsstück ihm am besten gefalle. Keller zeigte Mary daraufhin auf die Vitrine des Modelleisenbahnvereins der Österreichischen Bundesbahnen.
Mama Merlicek verbreitete sich ein wenig über die Akademie der bildenden Künste und Marys Zeit dort. Keller begann sich leicht zu langweilen und wertete das als positives Zeichen, in dieser Familie fürs Erste angekommen zu sein.
»Und werden Sie jetzt Japanisch lernen?«, wurde er plötzlich gefragt.
»Äh … wieso?« Er hatte wenig Lust, sich eine gescheitere Antwort auf diese seltsame Frage einfallen zu lassen.
»Sie sind doch jetzt mit einer Japanerin zusammen … Mariko und ich reden untereinander nur japanisch.«
Keller warf einen hilfesuchenden Blick auf Mary. Die räusperte sich. »Wenn Alexander Japanisch lernen möchte«, sagte jemand, »kann ich es ihm beibringen.«
Keller lächelte den alten Benshi dankbar an, er freute sich, dass sich dieser so freundlich einmischte und Notiz von ihm nahm. Gleichzeitig bereitete er eine Antwort vor, die Dank ausdrücken wie auch die Absicht durchscheinen lassen sollte, dass er dieses Angebot im Sande verrinnen lassen würde. Höflichkeit war immer eine Sache, die –
Mit einem Blick auf das verstörte Gesicht der Mama Merlicek fiel ihm wieder ein, dass der alte Benshi seit 1945 nicht mehr den Mund aufgemacht und seither kein einziges Wort gesprochen hatte.
Nie.
Die gute Seele trug den Nachtisch auf. Merlicek-Vater holte eine bauchige Flasche von der Bar. Mama Merlicek löffelte den Sesampudding.
»Äh«, sagte Keller wieder, fühlte sich nicht allzu klug dabei, und dachte: Warum sagt denn kein Mensch was?
Der alte Benshi schob den Pudding von sich weg, stand auf und verließ den Raum.
»Ja nun«, sagte Merlicek-Vater, »also darauf … also ich glaube, wir können … wer will?«
Nur Keller meldete sich, Merlicek-Vater schenkte aber allen vieren Zwetschkenschnaps ein. Der Schnaps war klar und heiß.
»Bleibt ihr heute hier?«, fragte Mama Merlicek mit Blick auf die Schnapsgläser, und in einem Ton, der alles andere als einladend war. »Ihr könnt gleich hier schlafen, wenn ihr wollt.«
Mary schwieg. Keller sah sie an. »Alex muss weiter«, sagte sie.
»Vielen Dank für das Angebot«, sagte Keller, »aber ich muss gleich zu Kunden, die in der Nähe wohnen. Ich bin zu einem Termin bestellt. Trotzdem vielen Dank.«
»Das trifft sich ja gut«, sagte Mama Merlicek, und nach einer Pause fügte sie hinzu: »Dass die Kunden in der Nähe wohnen, meine ich.« Sie kratzte in der leeren Puddingschale herum.
»Alle müssen arbeiten!«, Merlicek-Vater stand auf. Nachdem er Mary geküsst und Keller die Hand gegeben hatte, verließ er den Raum. Keller war für die Verabschiedung ebenfalls aufgestanden – Mama Merlicek nutzte die Gelegenheit sofort, Mary und ihn zur Tür zu bringen, die sie hinter ihnen schloss. Während Keller noch kopfschüttelnd und etwas überfordert die Tür betrachtete, knirschten Marys Schritte bereits in Richtung Auto. Auf der kurzen Fahrt zur Familie Pollack sprach sie kein einziges Wort. Keller versuchte ihr Schweigen vorerst zu akzeptieren und tat sich schwer damit. Es war kalt im Auto – er sah nach der Klimaanlage, doch die war aus. Mary hatte eine Hand am Haltegriff über dem Fenster und die andere in der Handtasche. Keller dachte mit wenig Freundlichkeit an Marys Familie und an die Pollacks, obwohl er für den Termin beinah dankbar war.
»Zwei sind schon tot!«, rief der Pollack zur Begrüßung, schüttelte Keller die Hand, ließ nicht mehr los und versuchte ihn ins Haus zu schleifen. Keller bewegte sich nicht, der andere blieb an ihm hängen. Keller stellte Mary vor.
»Ja, ja, Hallo, wir kennen uns, letztes Jahr im Sommer, ich erinnere mich«, ratterte der Pollack herunter und brachte sie ungeduldig ins Haus, indem er nach hinten griff und Mary durch die Tür schob. Sie ließ es ohne ein Anzeichen von Widerstand oder auch nur Unbehagen zu. Keller mochte Mary gern, er dachte genau in diesem Moment, ganz bewusst und sehr bemüht: Ich mag sie gern.
Das Haus war zu groß für die Gegend. Der Pollack schwitzte zu viel für das Haus. Im Vorraum führte eine breite Treppe mit tiefen Stufen langsam in den ersten Stock hinauf. Darunter schwitzten und stöhnten die Pumpen für das Aquarium. Der Pollack ließ Mary los und packte Keller, sie hatte er längst vergessen. Keller dachte sich zum wiederholten Mal, dass der Pollack zu wenig Scheu vor Berührungen hatte. Der Mann zog ihn mit sich (»Keine Umstände machen, wen scheren die Schuh«) durch eine Doppeltür in das Wohnzimmer. Marys Absätze klackten auf dem afrikanischen Hartholz. Zwei Fensterfronten boten einen Blick auf den Garten mit Swimmingpool. In einer Ecke stand eine Couch samt Sesseln in schwarzem Leder, in einer anderen sehnte sich ein weißer Bösendorfer-Flügel nach einem Blick. Seitlich in Richtung der offenen Küche war ein schwerer Esstisch mit zehn Sesseln, im dunklen Holz des Bodens gehalten und etwas kleiner als bei den Merlicek-Benshis.
In der Mitte thronte das Aquarium.
Es war enorm. Die schiere Masse gefiel ihm jedes Mal, und Keller lächelte. Er erinnerte sich vom Aufbau her noch an die Maße, aber er hätte sie auch auf den ersten Blick erraten.
»Hallo, Alex«, sagte eine Frau hinter ihm. Er drehte sich um und grüßte. Christine Pollack begrüßte Mary und trat dann an ihn heran, Kuss links, Kuss rechts. Er sah sie an, wie er es seit vier, fünf Jahren immer tat – mit Unverständnis für die seltsamen Dinge, mit denen man früher seine Zeit verbracht hatte. Aber wenn man allein darauf stieß, zufällig einen Karton mit altem Zeug öffnete und herumzusuchen begann, dann konnte man schon hängen bleiben.
»Zwei habe ich gerade herausgeholt«, sagte der Pollack, den das alles ungeduldig machte, »ich hab mir gedacht, es wäre besser so. Sie sind tot. Dort drüben sind sie«, er deutete auf eine Plastikkiste, »in Salzwasser, ich habe mir gedacht, du schaust dir das gern genauer an.«
»Das hast du gut gemacht«, sagte Keller und trat näher an das Aquarium heran. Ein Blick hinein, und es war immer das Gleiche. Er ärgerte sich nicht, aber er schüttelte doch den Kopf. Der Pollack würde es nie lernen. Es war eine Verschwendung.
Zwölftausend Liter Meerwasser. Vier Meter lang, zwei Meter breit, eineinhalb Meter hoch, auf einem ein Meter hohen Sockel in Holzverschalung. Beim Bau des Hauses schon war ihm der Pollack ständig in den Ohren gelegen, Keller hatte dabei sein müssen, als das Fundament gelegt und an dieser Stelle gesondert verstärkt worden war, als hätte er eine besondere Ahnung von Stahlbeton. Er hatte trotzdem eine Rechnung gelegt, der Pollack hatte es nicht anders verdient. Knapp über dem Aquarium hing die Beleuchtungsanlage, allein die Leuchtkörper dort hatten an die zweitausend Euro gekostet. Und erst der Inhalt des Aquariums …
Von selber dachte er solche Dinge nie in Zahlen, fürs Geschäft war es aber nötig. Er sah die Korallen und Fischbestände an, kalkulierte kurz, dann pendelte sich seine Einschätzung auf über fünfzigtausend Euro ein, alles in allem, frisch gekauft. Der Pollack hatte die Ressourcen, und er hatte auch den Biss. Aber er hatte keine Ahnung. Keller dachte an zwei, drei andere Kunden, die sich mit Mühe ihre Leidenschaft vom Mund absparten und auf viel kleinerem Platz weitaus Schöneres zustande brachten. Der Pollack aber wollte immer alles erzwingen, steckte ständig Raubfische zusammen, die einander nie ein Überleben gönnen würden. Man konnte genauso gut Geldscheine verbrennen, mit mehr Effekt und Glücksgefühl, denn der Pollack litt ja darunter, wenn die Fische einander umbrachten. Komisch, dachte Keller und sah vom Aquarium weg auf den Mann, Freude hat er keine am Leid, aber er fordert es ständig heraus. Christine fragte Mary nach deren Geschäften, viel zu laut und so gönnerhaft, dass man es merken musste. Zugleich gab sie damit ihrem Mann das Gefühl, sie kümmere sich wenig um seine Sorgen. Keller war von ihrer Effizienz beeindruckt. Der Pollack verdrehte die Augen, da er anscheinend der Einzige war, der die sich anbahnende Katastrophe ernst nahm, hob die Plastikkiste mit den sich zersetzenden Korallen auf und hielt sie Keller unter die Nase – »Da!«
Pollacks Tochter kam ins Zimmer gelaufen. Sie musste jetzt vier Jahre alt sein. Wie aus Prinzip musste sich Keller etwas anstrengen, bis ihm ihr Name einfiel. Judith. Ein guter Name, ein böser Name, das konnte man entscheiden, wie man wollte. Judith machte einen weiten Bogen um ihn (und um Mary, die sich nach der Kleinen gebückt hatte) und lief auf das Aquarium zu. Er bemerkte wie jedes Mal, dass sie gut erzogen war – sie machte keinen Versuch, das Glas mit den Händen zu berühren.
»Arme Korallen«, sagte das Mädchen, und legte dann die Arme um Pollacks Bein, während sie zu Keller hinaufschaute. Der Pollack legte die Hand auf den Kopf seiner Tochter, sah aber selbst so aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Mit der anderen Hand hielt er noch immer die Kiste mit den toten Korallen an seine Brust gepresst. Keller fühlte sich plötzlich gemein, also nahm er dem anderen die Kiste ab, warf einen prüfenden Blick hinein und stellte sie ab. Es war eigentlich typisch Pollack – den Toten ansehen wollen, was das Problem der Lebenden war.
»Habt ihr schon gegessen?«, fragte Christine.
»Ja«, sagten sie gleichzeitig. Sie hatten schon gegessen. Ein schönes Essen. Keller wurde mit einem Mal wütend auf sich, weil er mitspielte und Mary beim Schweigen half. Satt wurde niemand von so etwas.
»Später vielleicht«, sagte er freundlicher als nötig zu Christine und trat endlich ganz an das Aquarium heran, bevor der Pollack zu schreien beginnen konnte, der kurz vor einem Anfall stand. Eine weitere Nebensächlichkeit noch, die er miterleben müsste, ohne dass sein Problem gelöst würde, und er würde zu brüllen beginnen. Keller sah in das Aquarium hinein. Mit leichter Anstrengung vergaß er alles, was er wusste, vergaß Namen und Zahlen und sah das Wasser und seine Bewohner einfach an.





























