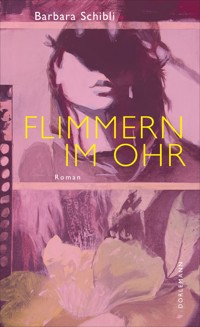Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich? Diese Frage ist für Anna nicht einfach zu beantworten, denn sie ist ein eineiiger Zwilling. Und eineiige Zwillinge sind eine einzige Zumutung. Sie ist aus dem bündnerischen Bever nach Zürich gezogen, um Biologie zu studieren. Nun arbeitet sie in der Flechtenforschung, ihre Schwester Leta widmet sich der Fotografie. Beide betrachten die Welt durch eine Linse: Anna durch das Mikroskop, während Leta seit der Kindheit obsessiv Anna fotografiert. Als Anna nach Treviso zur Eröffnung von Letas Fotoinstallation »Observing the Self« fährt, fühlt sie sich von ihr verraten, missbraucht und ausgelöscht. Denn Leta hat das einzige Zeichen, das sie beide unterscheidet, wegretuschiert. Barbara Schibli gelingt in ihrem Debütroman ein packend-poetisches Frauenporträt, in dem sie gekonnt Kunst und Wissenschaft mit der Frage nach Identität in der modernen Gesellschaft verwebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Schibli
Flechten
Roman
DÖRLEMANN
Die Verlag dankt der Studer/Ganz-Stiftung, der Stadt Zürich und dem Kanton Zürich für die Unterstützung bei der Publikation des vorliegenden Buches.
eBook-Ausgabe 2017 Alle Rechte vorbehalten © 2017 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Ölbildes von Esther Schena. Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-951-5www.doerlemann.com
Inhalt
Car si j’aime les jeux
qui font briller les yeux
finis les jeux
s’ils sont dangereux.
Delphine, La fermeture éclaire
1
Die Neue dreht sich auf dem Bürostuhl um sich selbst. Ein Mädchen wie eine Turbine. Sonst ist nicht viel los. Ich surfe im Netz, gebe meinen Namen bei der Suchmaschine ein. Ich bin Mitglied eines Schwimmvereins in Herisau und lege in einer Diskothek in Novosibirsk auf, man hat mich gesehen in einer Bar, in der ich nicht war, und in einem Videoclip rennt mir ein sechsjähriges Mädchen entgegen, blutleer.
Die Neue und ich sind für die Flechten hier, die anderen unserer Gruppe für Moose, Farne, Algen und Pilze, alles Kryptogamen – Gewächse, die im Verborgenen heiraten, so hat sie Carl von Linné in seiner Pflanzensystematik bezeichnet. Was wir am Institut tun, erscheint konspirativer, als es ist. Ich mikroskopiere, bahne mir einen Weg durch den schleppenden Vormittag, ein weiterer von der Sorte, an denen die Bestandsaufnahme nicht vorwärtsgeht. Wir sind umtriebig, aber worauf das alles letztlich hinausläuft, verlieren wir dabei leicht aus den Augen.
Mit einer Rasierklinge mache ich einen Schnitt durch eines der Ästchen der Cladonia, lege es auf den Objektträger, zoome hinein. Jetzt wächst alles, schlägt aus, treibt. Im Mikroskop wird jedes Ästchen zum Baum, ein Wald öffnet sich. Gleichzeitig verengt sich mein Blick immer mehr. Punkte, Linien, Netze, vermeintliche Bewegungen. Mit beiden Augen sehen, keines zusammenkneifen. Und das Präparat so anschauen, als würde der Blick in eine weite Landschaft schweifen, mit völlig entspannter Augenmuskulatur. Man lernt, die fliegenden Flecken zu ignorieren, die unregelmäßigen, schwarzen Fäden, die mit jeder Augenbewegung übers Gesichtsfeld tanzen, ein Flirren, das mich anfangs fast irremachte. Es sind die Schatten von Schlieren in der Augenflüssigkeit, die das helle Mikroskopierlicht auf die Netzhaut zurückwirft. Man meint, ein Stück unbekannte Natur zu beobachten, dabei ist es ein Teil von einem selbst.
Seit vergangenem Wochenende, seit der Ausstellung, habe ich Mühe, mich auf die Arbeit zu konzentrieren.
Durch die Drehtür verlasse ich das Institut, zünde mir eine Zigarette an, ziehe tief ein. Ich gehe hinüber auf die andere Straßenseite zum Telefonapparat ohne Kabine, einem der letzten Exemplare dieser aussterbenden Gattung. Auf dem Hörer hat sich Feinstaub festgesetzt. Für den Nachmittag lasse ich mir einen Termin bei der Dentalhygiene geben. Jedes Ausweichen ist mir recht. Mutter beharrt darauf: »Den Zähnen musst du schauen, sonst hast du so ein Theater wie ich.« Ich will kein Theater im Mund. Und schon gar keine Tragödie. Früher ging Großmutter in die Kirche, zündete eine Kerze an und betete zur heiligen Apollonia. Betete, der böse Wurm möge endlich von dannen gehen. Er aber wollte nicht gehen, flehte, man solle ihn lassen, er wolle sich nur ein wenig einrichten, dazu hätte er doch ein Recht, auch er. So weit will ich es nicht kommen lassen. Den Zähnen muss man Sorge tragen, sie sind ein verlässlicher Nachweis unserer Identität. An den Zähnen werdet ihr sie erkennen.
Die Dentalhygienikerin trägt einen weißen Kittel. Sie fragt wieder, ob ich Medikamente nehme und ob ich gegen etwas allergisch sei. Ich muss den Mund öffnen.
Als ich vor einem halben Jahr in der Praxis war, wurde eine abgestorbene Wurzel entdeckt. Mit einem Kältestab testete man den Nerv, doch dieser reagierte nicht. Bei der Flechte der Gattung Cladonia stygia sterben die unteren Teile ab und verrotten, ihre Spitzen verzweigen sich und wachsen weiter. Die Strauchflechte erneuert sich stetig. Meine Zahnwurzel hingegen ist unwiederbringlich dahin.
Jetzt stellt die Dentalhygienikerin starke Verfärbungen fest und will wissen, wie viel ich rauche. Dann macht sie eine Bisslinie auf der Innenseite der Wange aus, fragt: »Schlimme Träume?« In die Patientenakte wird notiert, was sich im Mundraum offenbart, welche Verhaltensweisen Spuren hinterlassen, sich in die Molaren eingegraben und auf der Zunge abgelagert haben. Ein Panoramaröntgenbild durchleuchtet das Gebiss und hält die gegenwärtige Gesamtsituation fest. Nichts bleibt unbemerkt. Kein Entkommen. Alles bleibt an einem kleben. Die Dentalhygienikerin fasst meinen Kiefer, dreht meinen Kopf von einer Seite zur anderen. Sie spricht von Mesial und Distal, obwohl sie als Einzige im Raum etwas davon versteht. Die ganze Zeit die Angst im Nacken, die Frau werde einiges entdecken, das in mir sitzt, von dem ich selbst nichts weiß. Am Schluss abermalig die Instruktion, wie mit der Zahnseide umzugehen sei. Um das oberste Gelenk des rechten Zeigefingers gewickelt, dann um jenes des linken, und wenn sich der gewachste Faden zwischen den beiden Fingern spannt und dabei fein surrt, wird die Sitzung für einen Moment zu einem Hochseilakt. Darunter die von den Zahnzwischenräumen ausgehende, zu bekämpfende Bedrohung. Werde ich dieser Aufgabe nicht nachkommen, schade ich nur mir selbst und in einem halben Jahr wird mich der Aufruf zur Erfolgskontrolle einmal mehr kalt erwischen. Wer nicht halbjährlich eine der überall wuchernden, sich unkontrolliert vermehrenden Dentalhygienepraxen aufsucht, ist dem Untergang geweiht. Die Dentalhygiene ist eine Zäsur. Danach ist nichts wie davor. Fährt man mit der Zunge die Zähne entlang, sind einem diese vollkommen fremd. Glatt, wie sie sind, rutscht man von sich selbst ab.
Nach der Zahnbehandlung gehe ich zurück ins Institut. Ich schlüpfe in meine einsamen Sandalen. Morgens stehen sie zusammen mit allen anderen da, bis jedes Paar seinen Mitarbeiter gefasst hat. Die Sohlen quietschen leise auf dem hellgrauen Linoleumboden. Fliehen in Birkenstocks ist nur schwer vorstellbar.
Um mich abzulenken, surfe ich. Die obersten Einträge, welche die Suchmaschine mit Anna Baselgia verknüpft, beziehen sich auf publizierte Artikel in Fachzeitschriften zur Flechtenforschung, der Lichenologie. Ich wechsle zur Bildersuche, zwischen den Fotos von mir sind auch solche von Leta eingereiht. Nicht nur die Gene, auch die Algorithmen verbinden uns. Daran wird auch der Umstand nichts ändern, dass in ein, zwei Jahren das Gesichtserkennungsprogramm, das derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, ausgereift sein wird – an uns wird es scheitern. Es wird uns nicht unterscheiden können: Wir sind eineiig.
Wenn ich bei der Suchmaschine ein L eintippe, ergänzt der Computer automatisch Leta, auch wenn ich eigentlich nach Lichen suche. Ich bin mir sicher, dass ich bisher häufiger das englische Wort für Flechten als Letas Namen eingegeben habe. Die personalisierte Suchfunktion ist jedoch letztlich unberechenbar und wirft mich wiederholt auf uns zurück. Leta, ein typischer Vorname aus dem Graubünden, bedeutet im Schwedischen »suchen«, leta efter, search for. Ein Schwede, wer sonst hätte während einer solchen Feldexkursion wie letzten Sommer, an einen flechtenbewachsenen Baumstamm gelehnt, im Hintergrund irgendein Fjord, meine Brüste in den Händen, nach dem Namen meiner Zwillingsschwester gefragt? Und dann wollte er ganz genau wissen, worin wir uns unterscheiden, denn das müsse dann ja letztlich eine sehr kleine Differenz sein, wenn wir eineiig seien. Mir schien, er suche beim Kuss neben meiner eigenen Zunge auch noch die meiner Schwester, und so drang er weiter in meinen Mundraum vor. Und träumte wohl davon, vier gleiche Brüste in den Händen zu halten.
Die Neue ruft mir etwas zu. Ich werde aus meiner ungerichteten Suche gerissen, bei der ich mich im Kreis drehe. Das passiert leicht, ist die Drehung doch nichts anderes als die natürlichste aller Bewegungsrichtungen. Alles gerät ständig in sie hinein.
Die Neue packt jede Gelegenheit, dazuzulernen, will möglichst schnell nicht mehr die Neue sein. Aber wir müssen ja froh um sie sein – Nachwuchs ist rar. Und alles macht sie mit Leichtigkeit, als wäre das eine der Arbeit eingeschriebene Gesetzmäßigkeit. Ich flüchte vor ihr.
Das Licht, das durch den Tubus dringt, nimmt mein Auge voll ein, schaltet alles andere aus. Ich lasse mich einsaugen und atme nun frei, die Lungen öffnen sich. Mikroskopieren ist ein Rausch – der allerdings auch eine Gefahr birgt: Die Flechte zum Spektakel machen und damit ihr Wesen, das sich durch Unscheinbarkeit auszeichnet, verletzen. Ihr das beruhigend Banale nehmen. Die Spitzen der feinen Ästchen der Cladonia rangiferina sind wie bei einem reich verzweigten Geweih alle nach einer Seite ausgerichtet. Rentiere ernähren sich den Winter über davon, das hat Großmutter erzählt. Als Kind habe ich gehofft, auf den verschneiten Wiesen um Bever herum diesen Tieren zu begegnen. Doch nie zogen die Herden vom hohen Norden Finnlands bis zu unseren Flechten ins Engadin, denn Hunger mussten sie nicht leiden: Heute weiß ich, dass die Rentierflechte in Finnland ganze Teppiche bildet, sich wie ein Meer aus hellem Schaum über die Böden der Tundra legt, in die Fichtenwälder hineinschwappt, leicht gräulich, fast weiß, matt gefärbt, die Oberfläche filzig.
Würde Leta mich mit ihrer Kamera verfolgen, ihre ganze Aufmerksamkeit wäre auf das Gesicht gerichtet – oder auf das, was man davon hinter dem Mikroskop sehen würde. Abtasten, den richtigen Ausschnitt wählen. Süchtiges Suchen, Gieren, näher ran, in mich hineinkriechen und sich gleichzeitig selbst aus den Zusammenhängen herausnehmen oder sich dies zumindest glauben machen, denn man ist immer mit dem Objekt der Beobachtung verstrickt. Unweigerlich. Aufs Engste. Zumindest suchen wir beide, Leta und ich, dasselbe, simpel und quälend schwierig zugleich: ein Verhältnis zur Welt. Und die Welt macht es einem, weiß Gott, nicht leicht.
Dennoch: Mikroskopieren hilft, die Erinnerung an die Ausstellung verschwimmt.
Ich trage ein weißes, überlanges T-Shirt, renne über die Wiese, fang mich doch, du kriegst mich nicht, ich bin nicht du und du nicht ich, und wenn du was Dummes bist, eine alte Äsche, dann bist du immer eins mehr, eine Zahl folgt auf die nächste, zwei Mädchen bilden einen Kreis, beim Gummitwist, nur dass niemand da ist, der hüpft. Dann stehen wir breitbeinig, das Gummiband zwickt in den Kniekehlen, eine Lücke in unserer Reihe, und raus bist du, und die andere geht mit, dann sagt keine mehr ein Wort, wir sind ganz still, das ist der unausgesprochene Zauberspruch, durch ihn werden wir eins, gehen ineinander über. Gab es hier einmal zwei Mädchen? Wer hat sie gesehen? Zwei Mädchen, die gleich aussehen, die gingen zusammen in den Wald, wer hat sie gesehen? Wo sind sie geblieben? Keine Spur von den beiden. Nicht bewegen, verharren in Totenstarre. Eins sein und nicht atmen. Wo beginnt der einzelne Mensch und wo hört er auf? Wenn du gefragt wirst, antwortest du mit Wir, auch wenn du alleine bist.
Manchmal ist es zum Verzweifeln: Sie zu differenzieren – das Bestimmen der einzelnen Arten bei der Gattung der Cladonien ist äußerst schwierig. Die geringen Unterschiede in Größe und Form der Sporen und Conidien geben nichts Stichhaltiges her, die Verhältnisse in der Dicke und Abgrenzung der verschiedenen Schichten des Lagers und der Lagerstiele sind nicht so zuverlässig, als dass man darauf bauen könnte. Dazu kommt, dass Arten, die nahe beieinander wachsen, dazu tendieren, sich einander anzupassen und derart ähnlich zu werden, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Und was zunächst als individueller Organismus wahrgenommen wird, ist häufig genetisch identisch mit den Nachbarsgewächsen.
Anna. Leta. Annaleta. Wir werden nach Unterscheidungsmerkmalen abgesucht. Aus Angst zu scheitern wird vermieden, uns mit Namen anzusprechen.
Eineiige Zwillinge sind eine einzige Zumutung.
Es wird ausgewichen auf Paarformeln, zusammengeschweißt, verharmlost, denn zwei so eng zusammen, die tarieren sich aus, da kontrolliert die eine die andere, da kann nichts Extremes daraus entstehen.
Das dachten sie alle. Außer Onkel Georg.
»Was für eine eigentümliche Brut ihr seid«, er traute uns nicht, Blutsauger, die wir waren. Und zwei von der gleichen Sorte, das war definitiv eine zu viel. Nimm nie zwei, donnerte er vom Küchentisch aus. Aber man konnte nichts mehr machen, wir waren da. Das musste auch Onkel Georg einsehen, nachdem uns Vater bei ihm in Zürich einquartiert hatte, gleich nach der Matura. Vorerst sollten wir lediglich für die Zeit, in der wir einen Ferienjob im Muttersitz von Vaters Konzern hatten, dort wohnen. Doch danach hieß uns Vater bleiben. Eine alte Geschichte zwischen Brüdern. Vater hatte nach der Ausreise in die USA einen Amischlitten in einer Garage in Bever eingestellt, Onkel Georg hatte den Schlüssel und die heiße Karre auf einer Spritztour im Inn versenkt. Die Feuerwehr hatte den Wagen zwar wieder rausgehievt, aber er war größtenteils hin. Und wir lösten nun also Onkel Georgs Schuld ein, wohnten so noch während zweier Jahre bei Onkel Georg Drachentöter.
Zum Konzern fuhren wir in jenem Sommer mit dem Bus. Jeden Morgen saß da ein hustender Mann. Es war dieses Husten, das alte Männer um die sechzig haben. Sie sitzen da und husten, husten, als hätte ihr Husten Berechtigung, halten nicht die Hand vor den Mund.
Auch Onkel Georg hustete oft. Sobald er hustete, ging ich ins Bad. Wenn er lange hustete, rauchte ich eine Zigarette, öffnete das Fenster und blies den Rauch über die Badewanne hinweg in den Innenhof hinaus. War ich fertig, schnippte ich die Zigarette ins Klo und spülte. Jedes Mal vergaß ich, dass sie dabei nicht unterging. Ich fischte sie raus, ließ sie abtropfen und warf sie dann in den Abfalleimer. Ich ging an der Küche vorbei, blieb kurz im Türrahmen stehen, sagte: »Gute Nacht, Onkel Georg.« Er nickte. Vielleicht würde er in ein paar Jahren auch diesen wippenden Kopf bekommen, den viele alte Männer haben. Ein unkontrolliertes Wippen, als ob der Kopf ein Eigenleben führt. Die Welt schaukelt ganz allein für die alten Herren auf und nieder.
Vor der Eingangstür des Mehrfamilienhauses, in dem wir mit Onkel Georg wohnten, gab es einen Bewegungsmelder. Das macht wachsam.
Wie bei Letas Kamera: dauernd auf der Hut. Eine Bewegung und es blitzt. Auch kleinste Verschiebungen des Körpers, Veränderungen der Mimik, des Blicks bleiben nicht unbemerkt. Das Licht kommt aus einem Blitzwürfel, der auf die Kamera gesteckt wird. Vier Blitze haben darin Platz, nach jedem trübt sich das Glas des Würfels und er muss für die nächste Aufnahme gedreht werden. Die Blitze übersprühen alles mit ihrem Licht. All die Jahre gelernt: Sich bewegen bedeutet, einiges auszulösen und zugleich schwieriger zu fassen zu sein.
Ab siebzehn Uhr gingen, wenn man eine unsichtbare Schranke passierte, vor Onkel Georgs Haus zwei Lichter an, ausgelöst von empfindlichen Sensoren, die links und rechts neben den Wegplatten eingelassen waren. Im Sommer war diese Programmierung sinnlos. Wenn ich nach Büroschluss bei Onkel Georg eintraf, war es noch hell und die Lichter gingen trotzdem an. Ich kam meist alleine zurück. Leta hatte in jenem Sommer eine Affäre und traf sich fast jeden Tag mit dem Mann.
Ich leerte den Briefkasten. In Bever hatten die Tage mit der frischen Post begonnen. Mutter hatte die meine auf den Frühstücksteller gelegt. Hier in Zürich war alles anders, ich musste sie abends selbst aus dem Kasten holen, schon ganz abgestanden. Ich merkte erst jetzt, dass Mutter jeweils die Werbung aussortiert haben musste, dass sie uns diese Verlockungen vorenthielt, die mich in jenem Sommer vielstimmig erreichten und betörten. Ich lebte in einer Traumwelt voller Produkte mit verführerischen Namen und Farben. Neben Werbeprospekten manchmal auch Post von Mutter. Dabei war das Einzige, was uns in jenem Sommer verband: Vaters Geld. Er überwies es für Leta und mich an Onkel Georg. Dann klopfte Onkel Georg zuerst an Letas Zimmertür, dann an meine: Das Geld ist da. Wenn Briefe von Mutter kamen, unterschrieb sie auch für Vater, als wäre er nicht in den USA und die beiden nicht geschieden. Onkel Georg wurde in diesen Briefen nie gegrüßt. Auch auf der einzigen Postkarte, die Leta und ich während jenes Sommers von Vater erhielten, war kein Gruß an Onkel Georg vermerkt. Mit einem Magnet haben wir sie an den Kühlschrank gehängt, anderntags war sie jedoch verschwunden.
Ob Dejan schon einkaufen war? Der Kühlschrank war heute Morgen ziemlich leer. Aber das ist sein Zuständigkeitsbereich. Ich schicke ihm eine Nachricht mit einem Herz-Icon.
Dann konzentriere ich mich wieder auf meine Arbeit am Mikroskop und versuche, die einzelnen Cladonien genauer zu bestimmen. Die Proben müssen hierfür eingebettet werden, Paraffin eignet sich meist nicht, es macht die Flechten spröde, sie splittern beim Schneiden. Am besten werden sie in Wasser eingeweicht, so lassen sich feine Schnitte von Hand machen. Anschließend gibt man sie in verdünntes Glycerin, das Präparat kurz über dem Bunsenbrenner erhitzen, damit die Luftblasen an den Rand wandern. Die Flechten bilden beim Trockenlagern kaum Artefakte. Tun sie dies trotzdem, gilt es, die Strukturveränderungen zu erkennen und sie von den natürlichen Formen zu unterscheiden. Wir haben ein Auge dafür. Die Neue schaut mich von der Seite an. Sie meint, ich würde es nicht bemerken. Durchdringende Blicke sind mir zuwider. Blicke, die alles von einem wissen wollen, zur Bestätigung dessen, was sie schon vor dem Schauen zu wissen meinen.
Ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden, nehme das Päckchen Zigaretten, das neben meinem Computer liegt, und gehe nach draußen. Während ich den Rauch ausstoße, klopfe ich mit dem Daumen nervös an den sandfarbenen Papierfilter, so dass ich mir die Hände werde waschen müssen. An den Fingern setzt sich der Tabakgeruch besonders hartnäckig fest, nur mit viel Seife lässt er sich neutralisieren.
Ich stelle mir vor, wie das aussehen würde: Beim Einziehen werden die Wangen hohl, die Bauchdecke zieht sich weiter nach innen, durch den Bauchnabel wird langsam die ganze Haut eingesogen, ich falle in mich zusammen, schrumpfe, werde klein und kleiner, ein ganz kleines Menschlein, und schaue in den Himmel, der jetzt noch weiter oben ist, schaue in die Ästchen des Baumes neben mir, dessen Krone aus Alpen-Rentierflechte, Cladonia stellaris, besteht. Die Landschaft ist mit liebevoller Sorgfalt angeordnet, durchqueren jedoch kann ich sie nicht, bin mit Sekundenkleber am Asphalt befestigt. Alles auf den kleinsten Radius, auf den Augenblick fixiert. Detailgetreu wurde ein Morgen nachgebildet, ein Briefträger, festgeklebt wie ich, wird seine Post nicht los, ein Paar küsst sich ewig, kriegt die Lippen nicht auseinander, und eine Frau raucht vor dem Haupteingang eines Instituts und die Zigarette verglimmt nicht. Die Besucher des Modells bewegen sich in Zeitlupe, lesen die Erklärungen auf der Tafel vor der Glasscheibe. In vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. Rätoromanisch fehlt. Ein sechsjähriges Mädchen in weißem T-Shirt, Pagenschnitt und roten Gummistiefeln bleibt stehen, schaut all die winzigen Menschlein an, entdeckt immer wieder Neues, fixiert dann mich und fragt:
»Kleine Frau, was nun?«
Wenn ich das wüsste.
Was Dejan jetzt macht? Halb vier, seine Schicht ist zu Ende, vermutlich pafft er und hört Musik. Hoffentlich mit Kopfhörern, sonst gibt’s wieder Reklamationen.
Zigarettenpapier unter dem Mikroskop: Man sieht die Kristalle, die dazu dienen, die angezündete Zigarette weiterglimmen zu lassen. Später schaue ich mir die Internetseite des Naturhistorischen Museums von Helsinki an. In drei Tagen werde ich dort sein, bei den Dioramen mit den ausgestopften Rentieren, den Flechten. Zurzeit Sonderausstellung zu Fledermäusen. Fotografieren ausdrücklich erlaubt.
Leta schoss Bild um Bild, legte die Bilder in Schachteln ab und die Sammlung wuchs. »Das geht aber ins Geld«, seufzte Großmutter manchmal besorgt. Aber das Geld war ein kontinuierlicher unterirdischer Fluss, der unter dem Atlantik durch zu uns fand.
Sammlungen kosten. Sie brauchen Platz, man muss sie pflegen, sortieren, dokumentieren. Es gilt aufzupassen, dass sie nicht abgestoßen werden, ihre Relevanz will kontinuierlich als existentiell dargestellt werden. Es ist ein unablässiges Werben, und obwohl sich in mir alles dagegen sträubt, bin ich mittlerweile sehr geschickt im Verkaufen von Utopien.
Dass unser Institut nicht der ideale Ort für die Sammlung ist, verschweige ich natürlich tunlichst, und erstaunlicherweise wurde das bislang nie hinterfragt. Doch das sitzt mir natürlich im Nacken und ich bin auf der Hut. Aber ich tue, als wenn nichts wäre, Umtriebigkeit ist die beste Tarnung.
Diesen Sommer gehen die Neue und ich die ganze Flechtensammlung des Instituts durch, Gesamtinventur mit abschließendem Bericht, an dessen Anfang eine Bestandsaufnahme stehen soll, eine Handlungsempfehlung als Abschluss, die entwirft, wie wir Wissenschaftlern den Zugriff erleichtern können. Lückenlose digitale Erschließung der Sammlung ist das ernannte Ziel. Die Daten sollen öffentlich zugänglich, alles mit allem verknüpft sein. Damit wollen wir ein Zeichen setzen, denn es ist erst ein kleiner Teil der erhobenen Daten öffentlich zugänglich. Das Teilen von Ergebnissen in der Forschung ist ein schwieriges Kapitel, alle finden es wichtig, aber kaum jemand macht es. Das hat vielerlei Gründe, der wohl zentralste – die Arbeit dafür wird so gut wie nicht honoriert. Unser Bestand muss ausführlich und systematisch beschrieben, Belege überprüft, die Datenbank erweitert werden. Und das kostet. Frühere Eingänge, Schenkungen und Transaktionen mit anderen Institutionen und privaten Sammlern wurden bislang nur ungenügend aufgezeichnet, das Nachverfolgen gelingt nur in vereinzelten Fällen. Einmal Verpatztes lässt sich kaum mehr gutmachen, die Entwicklungsgeschichte des Herbars sich nur schwer rekonstruieren.
Rückblickend ist vieles nicht ganz einfach zu erklären. Von Leta und mir gibt es nur ganz wenige Fotos, auf denen wir gemeinsam zu sehen sind. Auch als Kind. Als wäre Leta nahezu die Einzige gewesen, die Fotos machte. Die wenigen Fotos, die uns gemeinsam zeigen, sind aufs höchste inszeniert: Dieselbe Kleidung (hatten wir eigentlich nie) – Lächeln auf den Lippen (wir meist ernst) – Puppen im Arm (mit so etwas spielten wir nicht). Eines der gemeinsamen Bilder zeigt uns sitzend auf einer Treppenstufe, wie wir zusammen ein Bilderbuch anschauen. Wer die rechts ist, wer die links, ist heute nicht mehr zu eruieren. Auch von uns selbst nicht. Die Narbe ist noch nicht da.
Die Einladung zu Letas Ausstellung in Treviso zeigt das Foto eines sechsjährigen Mädchens vor einem eiförmigen Betonbau. Steif wie eine Puppe steht es da. Der Gesichtsausdruck ist verkrampft, ein Lächeln wird versucht. Den rechten Arm streckt es weit über den Kopf, zeigt auf etwas: Der Fokus der Aufmerksamkeit bleibt unsichtbar. Was sich auch außerhalb der Aufnahme befindet: die Zwillingsschwester, die das sechsjährige Mädchen fotografiert, und der Vater, der hinter der Kleinen steht, mit den Armen um sie greift, ihr zeigt, wie sie die Kamera halten, wie einstellen, wo abdrücken muss. Der Vater, der sagt, er werde sich nun von uns verabschieden, aber es sei nicht für ewig, wir würden uns bald wiedersehen, alles komme gut. Keine Sorge. Und dann gebe es ja noch Onkel Georg Drachentöter.
Leta bekam die Kamera von Vater geschenkt.
Und nichts kam gut.
Wir standen unter diesem riesigen Ungetüm, das die Form von einem Ei auf Stelzen hatte. Wenn man darunter stand, sah man nur einen gewölbten Betonbauch. So muss der Bauch unserer Mutter ausgesehen haben, als sie mit uns schwanger war, der Bauch, den wir uns teilten und den die dünnen Beine unserer Mutter kaum in die Welt hinauszutragen vermochten. Wir schauten ängstlich das riesige Beton-Ei an und Vater las in unseren Blicken Zweifel an der Tragkraft der schlanken Stützen. Er lachte, die Verankerungen würden sechs Stockwerke unter den Boden reichen. Jetzt geriet Vater über die Konstruktion ins Schwärmen. Jedes Mal, wenn wieder ein Foto von den Bauarbeiten in der Zeitung war, erklärte er uns deren Stand. Eine Luftaufnahme, die das offene Ei zeigte: Stahlstreben liefen auf die Mitte zu, wo sich ein großes Loch auftat. Als wir uns an jenem Nachmittag dem Ei näherten, sahen wir, dass in diesem Loch nun ein Kran stand, ein anderer außerhalb. Beide Kräne waren gelb. Sie drehten sich langsam durch die Luft aufeinander zu, ein behutsamer Kranentanz. Und ich meinte, hoch oben sogar den Kranführer zu erkennen, und zeigte hinauf. Da wurde das Foto gemacht, das jetzt auf der Einladungskarte zur Ausstellung abgedruckt ist. Zwei Theater würden später ihren Platz finden in diesem Ei, dem Egg, das ein Jahr später fertiggestellt und zum Wahrzeichen von Albany, New York State, werden sollte. Vater wollte sich an einem bedeutenden Ort von uns verabschieden. Er wusste, wie man Momente inszenierte. Er liebte Baustellen, Landschaften des Unfertigen. Faszinierend fand er den Bauprozess, das Entstehen, Materialströme und die ihnen zugrunde liegende Logistik. Bauen, das war Ehrgeiz, war Erfolg. Er liebte es, Mauern hochzuziehen, wie ein Spiel betrieb er Ab- und Eingrenzungen. Auch das Niederreißen liebte er, Bulldozer, Abrissbirnen, Sprengungen, Aufräumaktionen, Platz für Neues schaffen.
Vater liebte auch schon damals Schichtungen und Überlagerungen. So hatte er, als wir noch alle zusammen in Albany waren, bereits eine Parallelbeziehung. Das erfuhren wir von Mutter an unserem fünfzehnten Geburtstag. Mit wem, das wusste sie nicht.
Alles begann beim Ei. Denn von da an trug Leta die Kamera immer bei sich, bereit, mich jederzeit zu fotografieren. Sie brauchte nur den Auslöser zu drücken und schon hatte sie mich gebannt. Das schien ihr eine seltsame Zufriedenheit und Ruhe zu geben. Doch die Bändigung war von gegenseitiger Natur – sie schärfte unseren Umgang miteinander. Alle gingen davon aus, dies sei nur eine Phase, eine vorübergehende, harmlose Marotte, denn wie gesagt: Zwei zusammen, die tarieren sich aus, da kontrolliert die eine die andere, daraus kann nichts Extremes entstehen.