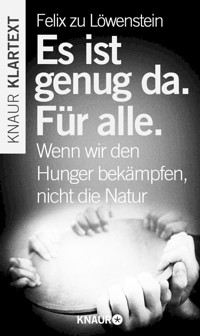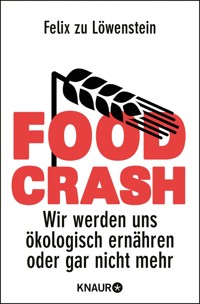
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Bio? Als Luxus für Reiche ist das ja ganz nett. Aber jetzt wird's ernst. Fast sieben Milliarden Menschen müssen ernährt werden, und es werden ständig mehr. Jetzt muss industriell produziert werden: mit Pestiziden, Kunstdünger, Gentechnik!" Diese These klingt doch nach gesundem Menschenverstand! Aber ist sie wirklich zutreffend? Oder gehen wir damit der Agrarindustrie auf den Leim, für die der Hunger in der Welt die Grundlage für ein florierendes Geschäft mit Pestiziden, Düngemitteln und Gentechnik-Saatgut ist? In seinem Buch FOOD Crash macht der international angesehene Fachmann für Ökolandbau Felix zu Löwenstein verständlich, dass eine industrielle Landwirtschaft, die auf der Übernutzung von Ressourcen aufbaut, kein Weg zur Lösung, sondern eine Sackgasse ist. Und dass nicht die mangelnde Produktionssteigerung, sondern der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln, die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sowie mangelnde Gerechtigkeit zum Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems führen. Mit seiner zugespitzten These »Wir werden uns entweder ökologisch ernähren oder gar nicht mehr« betreibt Löwenstein keine apokalyptische Schwarzmalerei. Vielmehr zeigt er an spannend und lebendig erzählten Beispielen, wie es im Einklang mit der Natur – und damit nachhaltig – gelingen kann, die Ernährungsgrundlage der Menschheit zu sichern. Und er beschreibt, welche Hebel politischen und privaten Handelns dafür in Bewegung gesetzt werden müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Felix zu Löwenstein
Food Crash
Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Bio ist Luxus für Reiche, um aber 9 Milliarden Menschen zu ernähren, brauchen wir eine massive Produktionssteigerung durch industrielle Landwirtschaft!« Seit Jahren bekommen wir Bürger das eingehämmert von einer machtvollen Lobby aus Lebensmittelproduzenten, Agrar- und Chemiekonzernen. Schlechten Gewissens schlucken wir alles: die boomende Pestizidproduktion, die Auswüchse der Mastviehhaltung, die genetische Veränderung von Saatgut. Damit gehen wir einer Lüge auf den Leim. In seinem Buch »FOOD CRASH« weist der international angesehene Öko-Fachmann Felix zu Löwenstein nach, dass genau das Gegenteil der Fall ist: Die Agrarindustrie verhindert nicht Hunger, sie produziert ihn. Konzerne sind mitverantwortlich für die Zerstörung der Natur und der Lebensgrundlagen von Millionen von Bauern weltweit. Und sie sorgen dafür, dass das, was wir auf den Teller bekommen, immer schlechter wird. Seine These lautet: »Wir werden uns entweder ökologisch ernähren oder gar nicht mehr.« Damit macht er auf spektakuläre Weise Frontgegen politisch gedeckten und industriell organisierten Ausverkauf unserer globalen Ernährungsgrundlagen.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Gewalt macht hungrig: Kriege und Konflikte
Wer nichts hat, dem wird genommen
Wenn meine Ernte längst ein anderer hat
Maniok für Untertürkheim
Vom Winde verweht und vom Wasser abgeschwemmt
Die betonierte Zukunft
Wo Pessimisten zu optimistisch sind
Tank oder Teller?
Alkohol im Straßenverkehr: Ethanol als Treibstoff
Die Ölscheichs auf dem Acker
Ist Energie vom Acker unmoralisch?
Aber die Wurst bleibt hier
Was uns krank macht, macht andere hungrig
Das Butterbrot im Mülleimer
Steuergeld für Marktzerstörung
Wie zu Lande, so zu Wasser
4. Kapitel
Ressourcen-Effizienz
Öl essen und Klima heizen
Ohne Artenreichtum sind wir arm
Die Düngung des Wassers
Essen aus der Giftküche
Schnitzel aus der Tierfabrik
Planetary Boundaries – Wie viel unser Planet noch aushält
Heilsversprechen aus dem Labor
Ein Wort an die Berufskollegen
5. Kapitel
Soziale Dimension
Ökonomische Dimension
Ökologische Dimension
Haiti – Das Konzept von Agroécologie
Die richtigen Prioritäten setzen
MASIPAG – Eine philippinische Erfolgsgeschichte
Die Kompostrevolution im Tigray
Listig die Natur belauschen
Push and pull – Es gibt noch viel zu verstehen …
Innovation im Fischbecken
Aber im Ernst: Kann denn jetzt Bio die Welt ernähren?
Ökologische Intensivierung – Alles andere als eine verschrobene Einzelmeinung
Ein Wälzer namens Weltagrarbericht
Ins Kapital der Natur investieren – Ein Bericht der UNEP
Es gibt nicht nur Fans des Ökolandbaus …
6. Kapitel
Die Preise und die ökologische Wahrheit
Allgemeingüter und Marktversagen
Was liegt im Werkzeugkasten?
Was in der Macht des Staates liegt
Zuckerbrot statt Peitsche
Den Verbraucher ins Boot nehmen
Staat und Verbraucher reichen sich die Hand
Was geht?
Der erste Hebel: Stickstoff
1. Durch eine Besteuerung von Stickstoff …
2. Durch eine Förderung des Leguminosenanbaus …
Der zweite Hebel: Tierschutz und Baurecht
Public Money for Public Goods: die europäische Agrarpolitik
In allen Politikfeldern den Umbau der Landwirtschaft mitdenken!
Am deutschen Wesen …
Eine globalisierte Welt erfordert globales Handeln
Königin und König Kunde das Regieren ermöglichen
Was ist ein sozial gerechter Preis fürs Essen?
Wer sich ändern muss? Sie. Und ich.
Kaufen Sie Biolebensmittel
Kaufen Sie regional und saisonal
Werden Sie selbst zum Erzeuger
Eat food!
»Bitte esst weniger Fleisch!«
Kaufen Sie nachhaltigen Fisch!
7. Kapitel
Anhang
1. Einleitung
2. Forschungsansätze in der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft
2.1 Intensivierung durch ökologische Prozesse (eco-functional intensification)
2.2 Forschung im Kontext der »guten fachlichen Praxis« (GFP)
2.3 Geschlossene Kreisläufe als Forschungsthema
2.4 Pflanzen und Tierzucht im Kontext ihrer Umwelt und angepasst an eine ökologische Wirtschaftsweise (verbesserte Genotyp-, Umwelt- und Management-Interaktionen)
2.5 Entwicklung von natürlichen Pflanzenschutzmitteln und Phytotherapie
2.6 Partizipation als Antrieb für die Innovation
3. Schlussfolgerungen: Ökolandbau als Keimzelle für alternative Ernährungskonzepte
Für Emelie – und alle anderen,
denen wir eine Welt hinterlassen müssen,
in der sie leben können.
1.
Vom Kleinen ins Große – Wie uns das Hungerproblem eingeholt hat
Nichts ist so gefährlich wie ein weiches Sofa vor dem Fernseher, ein prasselndes Kaminfeuer, das heute-journal ist zu Ende, und jetzt mal schnell mit der Fernbedienung rumgezappt. Da stößt man auf höchst merkwürdige Sendungen. Weil die Schwerkraft stärker ist als die Vernunft, gelingt das Aufstehen nicht, und außerdem ist es gemütlich. In solchen Situationen habe ich schon die dümmsten Filme gesehen, und nur meine Frau hat etwas davon, weil sie dabei einschläft.
Eine Sendung über den Weltrekord im Wettessen hat uns aber hellwach gemacht.
Es ging irgendwie darum, dass Leute, die ohnehin schon aussehen, als wäre eine Diät gerade das Beste für sie, zeigen, was alles in sie reingeht. Ein Mensch mit unaussprechlichem russischem Namen schaffte über 3,5 Liter Mayonnaise. In acht Minuten! Das muss man sich einmal vorstellen. Ein anderer konnte Ähnliches mit Butter. Und eine Frau, die vergleichsweise normal (eigentlich sogar ganz nett) aussah, vertilgte 167 Hähnchenflügel. Ich musste immer an die 83 und ein halbes Hähnchen denken, die jetzt keine Flügel mehr hatten – und alles nur, damit Sonya aus Bottrop ins Buch der Rekorde kommt.
An dem Abend waren auch unsere Kinder da. Nicht alle sechs, aber doch genug für eine heftige Diskussion. Sie begann mit etwas, was bei uns die Regel ist: einer Art Spontantheater, in dem alle Protagonisten des Wettkampfes vorkamen, ins Groteske übersteigert und zum Brüllen komisch. Irgendjemand sagte dann: »Das ist ja unglaublich pervers!« – und erinnerte an das, was eine Woche zuvor passiert war.
Das war Anfang April 2008.
Das Getreide, das wir im Sommer 2007 geerntet hatten, war gut verkauft, und auch die Welt der konventionellen Ackerbauern um uns herum sah rosig aus. Endlich wieder anständige Getreidepreise, und auch die Kartoffeln liefen prima!
In diese Hochstimmung waren Nachrichten über Versorgungsprobleme gesickert. Na ja, Versorgungsprobleme – eher Hunger, um die Sache beim Namen zu nennen. Aber, was da die Filter der Nachrichtenmacher passierte, das schien doch weit weg und eine von den vielen Katastrophenmeldungen zu sein, wie sie ständig in den Nachrichten zu sehen sind. Man darf sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil man sonst depressiv wird. Doch an diesem Abend kamen die Bilder aus einem Land, das wir gut kennen – aus Haiti. Dort haben wir gelebt, meine Frau, ich und zwei Kinder, aus denen in Port au Prince dann drei wurden.
Mit den Bildern schwappten O-Töne, Worte, Wortfetzen zu uns ins Wohnzimmer. Im Gegensatz zu vielen Millionen Menschen, die sie auch gehört haben, haben wir sie verstanden. Nichts Aufregendes! Es waren Worte wie »Nou grangou« oder »Ba’m kichoy pou’n manjé«, Dinge, die verzweifelte Menschen in eine Kamera sagen, hinter der sie jemanden vermuten, der ihnen helfen kann: »Wir haben Hunger« und »Gib uns was zu essen«. Aber für uns waren es Worte, die uns unter die Haut gingen. Plötzlich war die Distanz weg. Wir waren wieder mittendrin. Bilder kamen hoch von Familien in den armseligen Hütten in den Bergen, rund um die Ebene von Les Cayes, im Süden der Insel. Bilder von Familien, die es normal finden, dass sie nur einmal am Tag essen können, und auch das nicht immer. Bilder von Kindern mit geblähten Hungerbäuchen, über deren rote Haarfarbe wir uns immer gewundert haben, bis uns jemand erklärte, dass auch das eine Folge der Mangelernährung ist. Bilder von Vätern, die ihre Verzweiflung in Tafia, dem billigen Zuckerrohrschnaps ertränken, weil sie keine Arbeit haben und ihren Frauen erklären müssen, dass sie auch heute nichts mit heimgebracht haben, das man auf dem Markt in Essbares tauschen könnte.
Und dann dieses Kontrastprogramm, die Fressorgien bei der Weltmeisterschaft! Aus der Alberei vor dem Kamin war ein ernsthaftes Gespräch geworden. Wie hängt das zusammen: unser Leben und das der Hungernden in Haiti? Was ist zu tun, damit dieser Skandal aufhört? Was heißt das für uns als Bauern, als Konsumenten, als Staatsbürger?
Aus unserer Erfahrung in einem landwirtschaftlichen Entwicklungsprojekt der Caritas von Les Cayes, finanziert durch das deutsche Hilfswerk Misereor, hatte ich manches zur Diskussion beizusteuern. Unsere mittlerweile erwachsenen Kinder haben an diesem Abend verstanden, dass hinter den pittoresken Fotos in den immer und immer wieder von ihnen durchgeblätterten Alben mehr Geschichten stecken als die eines dreijährigen Abenteuers.
Und ich habe realisiert, dass ich selbst viel mehr Fragen als Antworten hatte. Dass ich noch viel zu wenig wusste von den Ursachenketten, die unsere Lebenssituation mit der von Menschen verbindet, von denen uns Welten trennen, in deren Städten wir aber nach einer Handvoll Flugstunden ankommen können. Wenn ich aber schon konfuse Vorstellungen von den Ursachen habe – das wurde schnell deutlich –, wie kann ich dann klare Vorstellungen von Lösungen entwickeln? Da halfen mir meine konkreten, aber doch räumlich und zeitlich eng begrenzten Erfahrungen in Haiti und später in Afrika nicht weiter.
Mir hat einmal jemand von einem Pastor erzählt, der seiner Frau zu sagen pflegte: »Davon verstehen wir nichts, mein Schatz. Wir sollten einen Vortrag darüber halten.« Die Geschichte kannte ich damals noch nicht. Aber genauso habe ich’s gemacht: Material gesammelt, Zahlen erhoben und nachgerechnet, gescheite Leute gefragt, Vorträge gehalten. Und irgendwann hat dann jemand gesagt: »Darüber musst du ein Buch schreiben!«
Davor habe ich mich lange gedrückt. Aber dass Sie, lieber Leser, diese Zeilen lesen, beweist, dass ich’s dann doch gemacht habe. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich es wichtig finde, zu verstehen, wie es in der Welt da draußen, außerhalb unserer Wohlstandsinsel, aussieht. Ich finde es wichtig, zu verstehen, welche Ursachen dafür verantwortlich sind, dass jeder sechste Einwohner unseres Planeten Hunger leidet, dass er heute Abend mit den Schmerzen eines leeren Magens schlafen geht. Und ich will, dass Sie wissen: Wir müssen das nicht hinnehmen! Es gibt Lösungen. Wir können und müssen zuvor aber ein paar Bedingungen schaffen, damit Lösungen möglich werden. Wie das geht – und wie es nicht geht –, davon handelt dieses Buch: davon, wie wir einen Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems verhindern können. Einen FOOD CRASH, wie er in einigen Weltgegenden schon geschehen ist. Und dass es dafür nur einen Weg gibt: Wir werden uns ökologisch ernähren – oder gar nicht mehr.
2.
Welthunger, Welternährung
Ein Gipfel ist ein ebenso herausgehobener wie spitzer Ort – einer, an dem sich allenfalls eine Handvoll Leute gleichzeitig aufhalten können, um von dort in die weite Ferne zu blicken. Bei politischen Gipfeln ist das anders. Da drängen sich Scharen von Menschen, und mit dem klaren Blick in die Ferne ist es nicht so gut bestellt. Die Metapher stimmt allenfalls in dem Punkt, dass die Teilnehmer eines »Gipfels« den Ebenen und ihrer Mühsal entrückt erscheinen.
Im November 1996 war Rom für mehr als zehntausend Menschen aus 185 Nationen zum Gipfel geworden; man wollte sich dort auf Einladung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO1 über die Ernährungssituation der Menschheit Gedanken machen. Zweiundzwanzig Jahre zuvor hatten die Gipfeldiplomaten eines ähnlichen Ereignisses jedem Mensch das unveräußerliche Recht auf ausreichende und ausgeglichene Nahrung zugeschrieben.2 Sie waren damals von großem Vertrauen in das Potenzial des technischen Fortschritts beflügelt und hatten der Welt das Ziel gesetzt, Hunger, Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung innerhalb einer Dekade zu überwinden. Doch daraus war nichts geworden. Das Heer der Unterernährten war seit Rom sogar auf 850 Millionen angewachsen. Vor diesem Hintergrund stellten sich die Experten die Frage, wie das nächste Ziel aussehen könnte und was zu seiner Erreichung ins Werk zu setzen sei.
Einer, der den ersten Ernährungsgipfel eng begleitet hat, ist Rudi Buntzel-Cano vom Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) – ein Veteran in der entwicklungspolitischen Arena und auch heute noch ein streitbarer Kämpfer für die Rechte der Bauern in den Ländern des Südens. Damals war er noch Doktorand an der Uni Heidelberg. Später hatte er eine Kommission für »Brot für die Welt« zu leiten, in der die Konsequenzen besprochen wurden, die sich aus den Ergebnissen des Gipfels für die Arbeit der Evangelischen Entwicklungszusammenarbeit ergeben sollten. Er erinnert sich an eine Stimmung, die auf den gemeinsamen Willen der Nationen setzte und von der gemeinsamen Hoffnung auf einen Aufbruch geprägt war: »Zu der Zeit hielten alle die Beseitigung des Hungers auf der Welt für machbar. Gerade hatte CIMMYT seinen Durchbruch mit dem Hybridmais erreicht und IRRI3 mit dem Hybridreis, Norman Borlaug war der Star, die Grüne Revolution war eingeleitet. Die Erwartungen waren hoch, und von Umweltproblemen hatte man noch nichts gehört. Es war die Zeit des Kalten Krieges, und die Vorherrschaft des Westens wollte man mit Hilfe der Grünen Revolution und Hungerbekämpfung – vor allem in Indien – sichern. Denn Indien war Sprecher der Blockfreien Staaten, selbst Wackelkandidat auf der Grenze zum kommunistischen Block. Die Grüne Revolution wurde als die demokratische Antwort auf die kommunistische Herausforderung gesehen, als das Gegenstück zu der kollektivistischen industriellen Landwirtschaft. Es war die Zeit des großen Aufbruchs in Afrika: die Unabhängigkeitserklärungen der antikolonialen Bewegungen in den ehemaligen portugiesischen Kolonien, Afrikas Suche nach einem Dritten Weg (afrikanischer Sozialismus, Ujamaa). Entwicklung schien machbar, nur eine Frage der guten Planung …«
Quelle: FAO, The 2010 World Hunger figures
Als sich die 10 000 Fachleute an den Abstieg vom Gipfel und an die Heimreise zu den Menschen machten, über deren Zukunft sie debattiert hatten, stand das neue Ziel fest: Bis 2015 müsse die Anzahl der chronisch Unterernährten wenigstens halbiert werden. Dass zu diesem Zeitpunkt allen bewusst gewesen sein muss, dass man in die Rechnung eine starke Bevölkerungszunahme einzubeziehen hatte, zeigt, wie mutig und selbstbewusst diese Zielsetzung war. »Wir haben die Möglichkeit, das zu erreichen, wir haben das nötige Wissen. Wir haben die Ressourcen. Und wir haben mit der Erklärung von Rom und unserem Aktionsplan gezeigt, dass wir auch den Willen haben«, gab der FAO-Chef Jacques Diouf den Delegierten mit auf den Weg.
Heute, 15 Jahre danach, ist Ernüchterung eingetreten. Trotz des Willens, trotz aller eingesetzten Ressourcen und Kenntnisse hat die Zahl der Hungernden fast eine Milliarde erreicht. Das sind ungefähr doppelt so viele Menschen, wie in der Europäischen Union wohnen.
So unterschiedlich, wie Menschen und Kulturen sind, so unterschiedlich ist die Situation der Hungernden, die in dieser monströsen Zahl zu einem Block zusammengefasst werden. 40 ((prozentplatzhalter)) der Weltbevölkerung leben von weniger als zwei US-Dollar am Tag. Schon aufgrund ihrer geringen Kaufkraft sind sie ständig vom Hunger bedroht. Aber auch in eigentlich reichen Gesellschaften, bis hin zu den USA oder Ländern der Europäischen Gemeinschaft, finden sich Menschen, die unter- oder mangelernährt sind.
Dennoch gibt es zwei hervorstechende statistische Merkmale, die zu kennen wichtig ist, wenn man bei den »food summits«, den Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zur Welternährung, mitreden und globale Lösungswege für ein globales Problem finden will.
Die absolute Zahl der Hungernden ist in Asien am höchsten, weil dieser Kontinent den größten globalen Ballungsraum mit der höchsten Bevölkerungsdichte darstellt. Die Weltgegend jedoch, in der nahezu alle Länder in der Rekordklasse auftreten, was den Anteil Unterernährter an der Gesamtbevölkerung angeht, ist Afrika südlich der Sahara. Der mit unendlich scheinenden fruchtbaren Flächen ausgestattete Kongo teilt sich dort die Spitzenposition mit dem kargen Eritrea.
Zwei Drittel der Hungernden leben nicht etwa in den Slums der Städte, sondern auf dem Land – also dort, wo das Essen erzeugt wird.
Wo Menschen hungern, da gibt es zu wenig zu essen. Und wenn Menschen auf diesem Globus hungern, dann gibt es auf diesem Globus zu wenig zu essen.
Diese naheliegende Schlussfolgerung lässt sich mit Zahlen untermauern, die jedermann leicht zugänglich sind. Im »Grain Market Report« – als Zusammenfassung für jeden im Internet abrufbar – kann man monatlich verfolgen, wie die Prognosen für die Produktion der wichtigsten Getreidearten lauten. Dort ist auch zu lesen, wie sich ihr Verbrauch entwickelt und wie es folglich um die Reserven bestellt ist, mit denen wir Menschen unser Brot backen und unsere Reisschüssel füllen können.
2007, im Jahr vor den Hungerrevolten, wiesen diese Zahlen ein deutliches Defizit aus: an Hauptgetreidearten (Weizen und Futtergetreide) waren ca. 40 Millionen Tonnen weniger geerntet als verbraucht worden, im Jahr davor hatte die Lücke 13 Millionen Tonnen betragen.
Eigene Zusammenstellung nach den Zahlen des Grain Market Report No. 411 des International Grains Council
Entsprechend waren damals die Weltgetreidevorräte geschrumpft. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass sie in den Jahren danach wieder zugenommen haben. Gemessen am durchschnittlichen täglichen Verbrauch liegen sie in der Größenordnung von gut zwei Monaten. Nur wenig größer sind die Vorräte des wichtigsten Grundnahrungsmittels, dem Reis. Oder, anders ausgedrückt: Würde ab sofort auf der Welt nur noch Getreide verbraucht und nirgends geerntet, dann wäre in zwei Monaten Ladenschluss.
Diese Rechnung zeichnet ein grobes, aber dennoch unübersehbar düsteres Bild. Vor allem im Zusammenhang mit drei weiteren Entwicklungen:
Das Wachstum der Weltbevölkerung, von der geschätzt wird, sie werde von jetzt 6,9 Milliarden auf über 9 Milliarden Erdenbürger bis Mitte dieses Jahrhunderts ansteigen.
Die Hinwendung von immer mehr zu Wohlstand kommenden Volkswirtschaften zu unserem »westlichen« Lebensstil, der sehr viel mehr landwirtschaftliche Produktionsfläche, Wasser- und Energieeinsatz pro Kopf erfordert.
Und die zunehmende Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse für industrielle und energetische Zwecke.
Der Weltmarktführer für Chemieprodukte, BASF in Ludwigshafen, betreibt einen gut gemachten Internetauftritt für seine Landwirtschaftssparte: www.agrar.basf.de. Hier kann man einen kleinen Film sehen, in dem ohne viel Schnörkel gesagt wird, um was es angesichts dieser Herausforderungen geht: »Nun wird es Zeit, über Produktivität zu sprechen«,4 heißt es dort in frischem Ton. Diese Schlussfolgerung ist so einsichtig und so zwingend, dass sie den Punkt bildet, auf den irgendwann jedes Gespräch zu diesem Thema kommt.
Eckart Guth ist ein wichtiger Mann. Er ist ständiger Vertreter der EU-Kommission bei den Internationalen Organisationen in Genf. Doch als ich ihn zum ersten Mal sah, saß er auf der Kante eines Podiums, in dessen Mitte die wirklich Wichtigen saßen. Das war am 17. Januar 2009, im Berliner Kongresszentrum, wo ein Kongressprogramm absolviert wurde, das die Internationale Grüne Woche in Berlin begleitet. Aus gegebenem Anlass war es in diesem Jahr dem Thema »Welternährung« gewidmet.
Da mir auf einer Messe jede Gelegenheit, zu sitzen, recht ist und ich obendrein auf die im Veranstaltungstitel angekündigten »Innovativen Lösungen bei begrenzten Ressourcen« neugierig war, hatte ich mich in dem riesigen Saal niedergelassen. Weit unten auf dem Podium, durch eine Leinwand porenscharf vergrößert, saß die Phalanx der großen Macher und mächtigen Experten: Vorstände der weltgrößten Agrarkonzerne: Kali und Salz (Düngemittel), AGCO (Landmaschinen), Archer Daniels Midland (Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe), BASF (Pflanzenschutzmittel und Gentechnik), die Chefs der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Deutschen Bauernverbandes. Kein einziger Vertreter einer Entwicklungshilfeorganisation war vorgesehen! Das war aber auch nicht nötig, denn die geballte Wirtschaftsmacht des Podiums hatte alles gut im Griff. Die Mahnung des EU-Vertreters: »Wir dürfen das Thema hier nicht nur als Geschäftsmodell verstehen«, kam irgendwie deplaziert rüber. Genau darum und um nichts anderes ging es – ums Geschäft.BASF-Vorstand Stefan Marcinowski fasste es in seinem Impulsreferat handlich zusammen: Wir müssen, so erklärte er uns, eine zweite »Grüne Revolution« anzetteln: Mit Hilfe von Gentechniksaatgut, Düngemitteln, Pestiziden5 – den Betriebsmitteln, die eine moderne Landwirtschaft braucht, um produktiv zu sein. Und dazu einen funktionierenden Welthandel, damit die Lebensmittel von dort, wo man produktiv ist (also z.B. bei uns), reibungslos zu denen kommen können, die sie für ihre wachsenden Ernährungsansprüche brauchen.
Damit ist eigentlich alles gesagt: Wenn es zu wenig zu essen gibt, dann muss mehr erzeugt werden. Dafür müssen mehr Dünger, mehr Pestizide und leistungsfähigeres Saatgut eingesetzt werden. Kurz: Wo zu wenig Output ist, da muss mehr Input geleistet werden.
Die Logik der Konzerne ist scheinbar zwingend. Ich bringe sie noch einmal auf den Punkt: Schon heute erleben wir eine Unterversorgung der Märkte, weshalb Menschen hungern. Die Zahl der Menschen steigt unerbittlich an. Sie essen mehr tierische Proteine, wofür mehr Futter erzeugt werden muss. Die Agro-Treibstoffe brauchen rasant mehr Fläche, sonstige nachwachsende Rohstoffe auch. Die Agrarfläche ist aber kaum noch auszuweiten. Also müssen wir mehr auf derselben Fläche erzeugen. Das geht nur mit Sorten, die gentechnisch an die veränderten Ansprüche angepasst sind. Und mit Düngemitteln, damit die Erträge steigen, und mit immer mehr chemischem Pflanzenschutz, damit die Ernten vor Schädlingen und Verderb geschützt werden.
Ist das nicht glasklar gedacht? Schlagend logisch? Unwiderlegbar richtig? Wer wollte sich dem verweigern? Ja, ist es nicht geradezu unverantwortlich, vor diesen Tatsachen und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen die Augen zu verschließen?
Wem diese ebenso glatte wie schlichte Argumentationskette genügt, kann an dieser Stelle mein Buch zuklappen und seinen Anschaffungspreis abschreiben. Zur inhaltlichen Feinabstimmung reicht dann die Lektüre der Homepages der obengenannten Unternehmen, die sich gerne und kompetent um des Problems Lösung kümmern werden.
Dass ich dennoch weiterschreibe, zeigt Ihnen, dass ich die Dinge anders sehe. Es zeigt Ihnen, dass ich die Lösung des Problems für sehr viel komplexer halte, weil auch das Problem selbst sehr viel komplexer ist. Und es zeigt Ihnen, dass ich die Vorstände von BASF, Bayer oder Monsanto nicht für geeignet halte, einen Ausweg aus den Sackgassen von Landwirtschaft und Ernährung zu finden. Sie selbst haben diese Sackgassen angelegt, und ihr Motiv ist es, darin dennoch Gewinnchancen für ihre Aktionäre zu finden.
Ich will Sie einladen, in vier Schritten zu einer Perspektive zu kommen, die eine völlig andere ist als die, die auf dem Podium in der Berliner Kongresshalle eingenommen wurde.
Im dritten Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, ob das Welternährungsproblem tatsächlich ein Produktivitätsproblem ist. Ob es also auf einer zu geringen Produktion je Hektar6 Ackerfläche beruht. Möglicherweise werden wir dabei entdecken, dass schon das Wort »Welternährung« das Problem so falsch beschreibt, dass daraus die falschen Schlussfolgerungen gezogen werden.
Im vierten Kapitel will ich die Landwirtschaft unter die Lupe nehmen, die BASF-Mann Marcinowski beschreibt, um darzulegen, weshalb die Hungernden dieser Welt ihre Hoffnung nicht auf die großen Unternehmen setzen können.
Das fünfte Kapitel beschreibt einen Gegenentwurf: eine Landwirtschaft der »Ökologischen Intensivierung«, die ein gangbarer Weg für die Zukunft unserer Lebensmittelerzeugung ist – ein Weg, den nicht zu beschreiten wir uns nicht leisten können.
Und ganz am Ende, im sechsten Kapitel, soll es um die Instrumente gehen, um die Hebel, mit denen eine falsche Agrar- und Lebensmittelwirtschaft aus den Angeln gehoben und in einen zukunftsfähigen Zustand gebracht werden kann. Und schließlich darum, welchen Beitrag Sie dazu leisten müssen.
Vielleicht legen Sie das Buch jetzt erst mal weg und holen sich – je nach Tageszeit – eine gute Tasse Tee oder ein Glas Rotwein. Dann kommen Sie wieder, blättern um, und dann legen wir zusammen los.
3.
Hunger auf der Welt: Geht’s wirklich nur um die Produktionsmenge?
Gewalt macht hungrig: Kriege und Konflikte
Es gibt eine Geschichte, die gerne erzählt wird, um zu illustrieren, wie wichtig die Errungenschaften der modernen Landwirtschaft sind.
Es ist die Geschichte der Iren, die in den 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts ihr Vaterland verließen und sich daranmachten, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu einer der stärksten Einwanderergruppen zu werden.7 Sie waren im Wesentlichen Hungerflüchtlinge. In Irland zu bleiben war für sie keine Alternative, obwohl sie wie alle Iren die Grüne Insel heiß und innig liebten. Denn dort gab es nicht genug zu essen für alle. Der Feind, der sie aus dem Land vertrieb, war unsichtbar klein. Er befiel das wichtigste Nahrungsmittel, die Kartoffel. Er ließ das Kraut so früh verdorren, die Pflanze so früh absterben, dass in der Erde kaum mehr als walnussgroße Knollen entstehen konnten. Und die begannen im Lager dann auch noch zu faulen, so dass auch bei strengster Rationierung der Winter kaum vorbei war, als aus den Erdmieten und Kartoffelkellern schon nichts mehr zu holen war. Der Feind hieß Phytophtora infestans, »potato blight« auf Englisch. Wir beschreiben seine Wirkung im Namen mit »Kraut- und Knollenfäule«.
Die Schlussfolgerung und Lehre daraus: Hätten die Iren damals schon Wirkstoffe wie Mancozeb, Maneb oder Fluazinam gehabt – oder wie sonst noch die Fungizide (Pilzbekämpfungsmittel) heißen, dann hätten sie nicht gehungert und, wer weiß, John F. Kennedy wäre nie nach Berlin gekommen.
Das ist die Version, die ich schon in manchem Vortrag von Pflanzenschutzmittel-Vertretern gehört habe. Es gibt aber noch eine andere:
In diesen schrecklichen Jahren hatten die englischen Grundherren, die den Iren zu Recht als Besatzer aus einem fremden Land galten, und wohl ebenso die eigenen, irischen Großgrundbesitzer den größten Teil der fruchtbaren Böden unter sich aufgeteilt. Und wo diese nicht Schafe züchteten, um vom Boom der angelsächsischen Textilindustrie zu profitieren, da produzierten sie Weizen und anderes Getreide, das in irischen Häfen auf englische Schiffe verladen und von dort in englische Mühlen gebracht wurde. Auch ihre Pächter mussten Weizen für den Export produzieren, denn nur so ließ sich das Bargeld erwirtschaften, mit dem die Pacht zu bezahlen war.
Für ihre eigene Nahrungsversorgung blieben den irischen Bauern und Landarbeitern nur kleine Flächen, die schlechtesten zudem. Da man mit kaum einer Kulturpflanze so viel Nahrungsenergie je Flächeneinheit erzeugen kann wie mit der Kartoffel, bebauten sie ihre kleinen Parzellen dicht an dicht damit. Und da sie obendrein nicht wussten, dass eine jahraus, jahrein wiederholte Monokultur von Kartoffeln sehr schnell zum Ausbruch von Krankheiten führt, wie eben der »potato blight«, kam, was kommen musste. Ihre Nahrungsgrundlage brach zusammen. Tausende verhungerten und Abertausende verließen das Land.8
Dass für die große, irische Hungersnot die Krautfäule verantwortlich ist, erweist sich in Kenntnis dieser Zusammenhänge als eine nützliche Legende. Denn die mörderische Kartoffelkrankheit war nicht Grund, sondern Folge – Folge menschlicher Gewalt, die dann die Bewohner der Grünen Insel in Hungertod und Auswanderung trieb. Und so war es mit vielen Hungersnöten. Auch in unserer mitteleuropäischen Geschichte wurden sie viel seltener durch Missernten oder gar das Nichtwissen der Bauern ausgelöst als vielmehr durch Kriege, Revolutionen und Unterdrückung. Und so ist es auch in unseren Tagen. Die schrecklichen Hungerbilder aus dem Südsudan oder aus Eritrea sind Beispiele dafür. Oft wird das Aushungern der Bevölkerung sogar gezielt als Kriegswaffe eingesetzt.
Die schlimmsten Hungersnöte des letzten Jahrhunderts wurden durch Gewaltherrscher mit ihren menschenverachtenden Systemen verursacht. So war es in den von Hitlerdeutschland besetzten Gebieten. Und so war es im Russland Stalins, im China Mao Zedongs oder im Kambodscha von Pol Pot, wo erst der Bauernstand ausgetilgt und dann Staats- und Gesellschaftstheorien auf bizarre Art auf die Landwirtschaft angewandt wurden. In der Folge verhungerten Millionen Menschen.
Das extremste Beispiel dafür, dass auch heute skrupellose Machtausübung mehr Menschen ihre Nahrungsgrundlage raubt als Heuschrecken und sonstige Plagen der Natur, ist die Republik Kongo. Ich bin Anfang der 90er Jahre in diesem riesigen Land gewesen, um im Auftrag von Misereor ein Entwicklungshilfeprojekt zu begutachten. Von allen Ländern der Dritten Welt, die ich bis dahin gesehen hatte, war Zaire – so hieß der Kongo damals noch – das heruntergekommenste und korrupteste. Obwohl enorme Landflächen ungenutzt waren und reichlich Wasser zur Verfügung stand, lebte die Bevölkerung in großem Elend. Zu meinem großen Erstaunen konnte man stundenlang fahren, ohne jemanden zu sehen, der einem etwas zu essen hätte verkaufen wollen. Den Grund habe ich erst begriffen, als ein Bauer mir erzählte, sein Nachbar sei kürzlich beim Beernten einer Kokospalme abgestürzt und habe sich ein Bein gebrochen. Darauf habe er dem Dorfgewaltigen ein Strafgeld entrichten müssen. Der hatte das damit begründet, dass es verboten sei, vom Baum zu fallen. Da die Geschichte durch zwei Übersetzer musste – von der Dorfsprache in die Bantusprache Kikongo, von dort ins Französische –, glaubte ich, falsch verstanden zu haben. Nach intensivem Nachfragen war aber klar: Ich hatte gerade ein besonders absurdes Beispiel von Machtmissbrauch und Korruption erzählt bekommen. Der örtliche Polizeikommandant hatte sich einfach etwas Kreatives einfallen lassen, um noch ein wenig mehr Geld aus den Bewohnern des Dorfes herauszupressen. Das ließ erahnen, weshalb es in diesem Land nur für die Stärksten möglich ist, sich wirtschaftlich zu entwickeln.
Inzwischen ist im Osten des Landes jener fürchterliche Krieg entstanden, in den auch Ruanda verwickelt ist. Rebellenmilizen und die Interessen derer, die den für den Betrieb unserer Mobiltelefone erforderlichen Rohstoff Coltan unbehelligt von einer funktionierenden Staatsmacht ausbeuten wollen, verhindern, dass Bauern existieren können. Denn das können sie nicht, wenn sie bereits zum Zeitpunkt der Aussaat wissen, dass sie noch vor der Ernte von einer der Parteien aus ihrem Dorf vertrieben werden.
Das Ergebnis dieser Mischung aus schlechter Regierungsführung (»bad governance«), auswärtiger Einmischung und inneren Konflikten ist: Hunger. Nach der Statistik der FAO hält der zentralafrikanische Kongo den Rekord, knapp hinter Eritrea: 70 ((prozentplatzhalter)) der Bevölkerung fallen unter die Kategorie »Unterernährt«!9 Obwohl das im Nordosten des Kontinentes gelegene Eritrea ungleich schlechtere landwirtschaftliche Produktionsbedingungen aufweist, ist auch die Unterernährung der eritreischen Bevölkerung eher die Folge einer schlechten Verwaltung und die Nachwirkung des Sezessionskrieges mit Äthiopien. Über der 50 ((prozentplatzhalter))-Marke liegt ansonsten nur Burundi – das eine sehr hohe Bevölkerungsdichte aufweist und in denselben Konflikt involviert ist wie der Kongo – und Haiti, auf das ich noch an mehreren Stellen zu sprechen kommen werde.
Gewalt macht hungrig: Kriege und Konflikte. Quelle: UN World Food Programme (WFP)
Wer nichts hat, dem wird genommen
Dass zwei Drittel der Hungernden auf dem Land wohnen, also ausgerechnet dort, wo die Nahrung produziert wird, hat einen einfachen Grund: Meist handelt es sich um Menschen, denen weder eigenes Land noch ausreichendes Einkommen zur Verfügung steht. In Brasilien fehlt es einem Fünftel der Bevölkerung an Essen, obwohl auf Millionen von Hektaren Exportgüter oder Zucker für die Ethanolgewinnung angebaut werden. Auf sehr viel weniger krasse Weise gilt das auch für Indien, wo ein Drittel der von der FAO als unterernährt eingestuften Menschen zu Hause ist. Indien exportiert jährlich ca. fünf Millionen Tonnen Reis. Wer keine Kaufkraft hat, weil es an Erwerbsmöglichkeiten fehlt, der ist auch nicht in der Lage, sich Essen zu kaufen.
Das gilt im Übrigen auch für Länder in Nordamerika oder Europa, wo am unteren Rand einer Gesellschaft mit hohen Durchschnittseinkommen bittere Armut existiert. Auch hier ist nicht die mangelnde Produktivität der Landwirtschaft, sondern die ungleiche Verteilung von Einkommen Ursache für Hunger.
Dass aufstrebende und reiche Länder in den letzten Jahren massiv auf globale Einkaufstour gehen, um sich Ackerflächen für die steigenden Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu sichern, verschärft dieses Problem. Denn ab dann dient die Fläche nicht mehr der Ernährung der Bevölkerung vor Ort, sondern dem Export in die Staaten der Investoren. Und in aller Regel folgt auf die Landnahme die Vertreibung der Kleinbauern, die bis dahin dort gewirtschaftet haben. Auf diese Weise kehrt der Kolonialismus zurück, mit einem neuen Gesicht.
China und die Golfstaaten stehen an der Spitze derer, die Millionen von Hektaren dort unter ihre Kontrolle zu bringen versuchen, wo Bodenfruchtbarkeit und Verfügbarkeit von Wasser gute Erträge versprechen.10 Aber auch unter Kapitalinvestoren hat sich längst herumgesprochen, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen eine inflationssichere Anlage mit großen Zukunftschancen bieten. Nur in den wenigsten Fällen dürfte sich die Hoffnung erfüllen, dass auf diese Weise unterkapitalisierte Bauern in Afrika und Asien die nötigen Ressourcen für ihre Entwicklung zugesteckt bekommen. In den meisten Regionen, auf die sich die Begehrlichkeit der Investoren richtet, besitzen die Bauern keine oder doch nur sehr schlecht abgesicherte Rechtstitel auf ihren Landbesitz. Sie müssen deshalb der Willkür der Mächtigen weichen, die an dem Deal verdienen. Wenn dann die industrialisierte Großlandwirtschaft in Gang gesetzt wird, die sich für ein unkompliziertes Ausbeuten der neu erworbenen Flächen am besten eignet, bleibt den vertriebenen Bauern noch nicht einmal der Abstieg zum Tagelöhner. Wo Wasser knapp ist, sind auch die betroffen, denen man ihr Land gelassen hat. Denn dem gut technisierten Neubesitzer gelingt es im Zweifel als Erstem, den alteingesessenen Nachbarn das kostbare Nass abzugraben.
Der globale Feudalismus, der so entsteht, schafft nicht nur Ungerechtigkeit und Armut – und in der Folge Hunger –, er destabilisiert auch ganze Staaten und trägt so zu einem sich selbst verstärkenden Teufelskreis bei, dessen Leidtragende immer dieselben sind: die Ärmsten der Armen.
Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, dass Naturkatastrophen – Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Tsunamis – ebenfalls diejenigen am härtesten treffen, die ohnehin kaum über Reserven verfügen. So werden solche Ereignisse zeitlich und räumlich punktuell zur Hauptursache von Hunger.
Schließlich ist auch die Verwundbarkeit durch volkswirtschaftliche Faktoren dort am größten, wo Menschen wegen zu geringer Kaufkraft zu wenig zu essen haben. In Deutschland wenden wir gerade einmal 11,2 ((prozentplatzhalter)) unseres Einkommens für die Ernährung auf, die Einwohner in Burundi oder Bangladesch wohl eher drei Viertel. Es ist unschwer vorzustellen, dass Letztere von dem dramatischen Anstieg der Lebensmittelpreise, wie in 2007 und 2008 und auch wieder in 2011, erheblich stärker betroffen sind als wir.
»Wir ernten, was andere säen« war der Titel einer Werbebroschüre, die mir die Allianz auf dem Höhepunkt der Hungerkrise zugeschickt hat. Dort wurde für Fonds geworben, die in landwirtschaftliche Rohstoffe investiert sind. Ich erinnere mich nicht, was mich damals mehr schockiert hat: die Kaltblütigkeit, mit der hier der Vorschlag unterbreitet wird, aus etwas Profit zu schlagen, an dessen Entstehen man gar nicht beteiligt ist. Oder die Taktlosigkeit des Werbetexters, dafür so entlarvend deutliche Worte zu finden. Mir ist wohl bewusst, dass Börsenspekulanten nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, hohe oder niedrige Rohstoffpreise zu erzeugen. Da ist die Wirkung schon entscheidender, die beispielsweise von der Exportsperre ausgeht, die große Getreideerzeuger wie die Ukraine verfügen, um ihre Vorräte für alle Fälle zurückzuhalten. Sicher ist jedoch, dass Preisausschläge wesentlich durch Rohstoffbörsen verstärkt werden, die ein Vielfaches des Volumens in Kontrakten handeln, das tatsächlich als Ware auf dem Markt vorhanden ist. Auf diese Weise mag man Geld vermehren. Essen vermehrt man nicht. Dafür trägt man aber zum Verhungern derjenigen bei, deren Geld nicht reicht, um die Zeit zu überbrücken, bis die Blase platzt.
Wenn meine Ernte längst ein anderer hat
Bangladesch ist eines jener Länder, die in unseren Nachrichten nur dann auftauchen, wenn es eine Katastrophe zu vermelden gibt. Und immer, ganz gleich, ob es sich um eine Flutwelle, eine Monsun-Überschwemmung, ein Erdbeben oder eine Dürre handelt, produziert eine solche Katastrophe die gleichen Bilder. Hungernde Menschen, verzweifelt oder apathisch, die übers Land wandern, in der Hoffnung, irgendwo Hilfe und Essbares aufzutreiben. Ein solches Jahr war das Hungerjahr 1974. Auch in Chittagong füllten sich die Straßen mit frisch zugewanderten, ausgemergelten Bettlern aus dem Umland.
Professor Mohammed Yunus, Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Universität dieser zweitgrößten Stadt des Landes, war einer von jenen Angehörigen der wirtschaftlichen und politischen Elite, die es in allen Ländern der Dritten Welt gibt: Sie leben unter ihresgleichen, gebildet und finanziell abgesichert, so weit weg von der Realität der armen Menschen im Land, als sei es ein anderer Kontinent. Doch an dem Elend, das in diesem Jahr bis vor die Tore der Universität drängte, war kein Vorbeisehen mehr. Yunus beschloss, mit seinen Studenten eines der nahe gelegenen Dörfer zu besuchen, aus dem diese Menschen stammten, um die Ursachen des Elendsmarsches wissenschaftlich zu fassen.
Dort trafen sie auf Sufia Begum, die vor ihrer Hütte saß und Körbe flocht. Die Realität, die hinter dem idyllischen Bild steckte, war folgende: Um das Material für die Körbe zu kaufen, hatte die Frau einen Kredit bei einem Wucherer aufgenommen. Dieser verlangte astronomische Zinsen und nahm ihr zur Tilgung die Körbe in Zahlung. Was ihr verblieb, waren zwei Cent pro Tag – zu wenig, um davon die Familie zu ernähren. Vor allem aber zu wenig, um Kapital zu bilden. In diesem Kreislauf des Elends, so fanden Yunus und seine Studenten heraus, drehte sich nicht nur das ganze Dorf, sondern das ganze Land. Ohne über das fürs Überleben Notwendige hinaus etwas akkumulieren zu können, was die Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung gewesen wäre, und ohne die Möglichkeit, Reserven zu bilden, warf jede Missernte die ökonomische Existenz der Menschen über den Haufen.
Yunus beschloss – weiterhin ganz Pädagoge und Wissenschaftler –, mit Sufia ein Projekt zu starten. Er lieh ihr 25 Dollar. Eine Summe, von der er herausgefunden hatte, dass sie ausreichendes Startkapital für die Gründung eines eigenständigen Gewerbes war. Als auch weitere Kreditnehmer genug Erfolg hatten, um den Kredit tilgen und ihre Aktivitäten entwickeln zu können, sprach er die großen Banken seines Landes an, um mit ihnen ein Kreditprogramm für die Armen Bangladeschs auf die Beine zu stellen. Die Antwort waren Spott und Ablehnung. Welch absurde Idee, Menschen Geld leihen zu wollen, die keinerlei Sicherheiten zu bieten hatten! Mit einer staatlichen Bank fand sich dann doch noch ein Partner: die Grameen-Bank wurde gegründet. Dreißig Jahre später sind acht Millionen Bangladeschis Mitglieder der Grameen-Bank, halten Guthaben und nehmen Kredite. Sie haben sich damit eine Möglichkeit für wirtschaftliche Entwicklung erschlossen. Fast alle von ihnen sind Frauen – schon früh stellte sich heraus, dass sie besser und nachhaltiger mit den Finanzen umgehen als die Männer –, und alle gehören zu den dörflichen Unterschichten des 150-Millionen-Volkes am Golf von Bengalen. Mittlerweile hat sich die Grameen-Bank auf allen Kontinenten etabliert und auch viele Nachahmer gefunden.
Yunus hat für das Konzept der Mikrokreditbanken und für seine Umsetzung sehr zu Recht den Friedensnobelpreis bekommen. Und doch hat er im tropischen Bangladesch nur neu aufgelegt, was 130 Jahre vor ihm schon einmal im kühlen Westerwald unternommen worden war. Friedrich Wilhelm Raiffeisen hatte dort die ersten Kreditkassen auf Gegenseitigkeit aus genau dem gleichen Grund errichtet. Auch er wollte nicht mehr mit ansehen, wie die Wucherer die Not der Bauern ausnutzten, indem sie ihnen die Ernte zu Konditionen vorfinanzierten, die einer Übernahme des gesamten Ertrages gleichkam.
Nicht nur in Bangladesch oder im Hunsrück des 19. Jahrhunderts ist die Abhängigkeit der Bauern von den Lieferanten ihrer Betriebsmittel ein wesentlicher Auslöser für Hunger und Elend. Derselbe Mechanismus findet sich überall, wo Bauernfamilien zu wenig zum Leben haben. Besonders drastisch ist das in Indien, wo ganze Gegenden von Selbstmordwellen heimgesucht werden: Bauern bringen sich um, weil ihre Lage aussichtslos geworden ist und weil sie die Schande nicht mehr ertragen, ihre Familie nicht mehr ernähren zu können. Nicht die mangelnde Produktivität ihrer Felder ist dafür die Ursache, sondern mangelnde Unabhängigkeit:
Je abhängiger Bauern von Betriebsmitteln werden, die sie von außen zukaufen müssen – Saatgut, Düngemittel, Pestizide und Futtermittel –, desto größer wird die Angriffsfläche für die Kredithaie, die schon am Feldrand in ihren Lastwagen laden, was der Bauer eben erst geerntet hat.
Maniok für Untertürkheim
Mit der Wucherfalle für Bauern sind wir auf der Suche nach Bestimmungsgründen für den Hunger der eigentlichen landwirtschaftlichen Produktion schon näher gerückt. Ehe wir ganz auf dem Acker ankommen, gilt es noch Parameter zu betrachten, die ich unter »Infrastruktur« zusammenfassen will.
Was mich bei meinem Aufenthalt im damaligen Zaire besonders beeindruckt hat, war der Zustand der Straßen. Vielleicht reicht es zu deren Beschreibung, zu erzählen, dass wir an einem Tag auf einer der Hauptverkehrsadern für die Strecke von 100 km zehn Stunden lang unterwegs waren. Und nicht etwa wegen Staus auf der Autobahn – wenngleich wir auch zwei Stunden an einem Flussbett warten mussten, bis ein Lastwagen, der sich am Vortag in der Furt eingewühlt hatte, aus dem Weg geräumt war. Es war einfach nicht möglich, schneller zu fahren, so tief waren die Löcher und die von den Rädern in die Straßen gepflügten Furchen. Dabei herrschte vollkommen trockenes Wetter. Die Lastwagen auf dieser Strecke sind gewaltigen Belastungen ausgesetzt, und vor der Geschicklichkeit der Mechaniker, die sie mit primitivsten Mitteln in Gang halten, befällt einen Ehrfurcht. Aber nicht nur sind die Straßen schlecht, die Strecken sind auch noch lang. Über kaum einen der vielen Flüsse, die auf dem Weg nach Kinshasa zu überwinden waren, führt eine Brücke, und das zwingt zu großen Umwegen. All das führt dazu, dass den Bauern kaum etwas von der Wertschöpfung für ihre Produkte verbleibt.
Ich will das – ohne jeden Anspruch an empirische Genauigkeit – an einer Rechnung verdeutlichen. Yamswurzeln sind ein wichtiges Grundnahrungsmittel für die Menschen auf dem Land, aber auch für die Bewohner der Hauptstadt. Dort konkurrieren sie im Preis mit anderen Stärkelieferanten, vor allem dem Weizen, was ihren Preis auf, sagen wir, 20 Zaire11 begrenzt. Davon gehen acht Zaire nach Untertürkheim, um dort einen namhaften deutschen Nutzfahrzeughersteller für seinen Lastwagen zu bezahlen. Vier Zaire kostet das Diesel. Zwei bekommt der Fahrer und vier weitere der Zwischenhändler. Damit bleiben dem Bauern seinerseits nur zwei Zaire, also gerade einmal 10 ((prozentplatzhalter)) von dem, was der ja immer noch unverarbeitete Rohstoff Yams nach dem Transport kostet. Ich verbürge mich nicht für die Aufteilung der Spanne; die beiden Preise am Anfang und am Ende jedoch waren das, was damals gezahlt wurde. Dass weniger strapazierfähige Lebensmittel für einen solchen Transport gar nicht in Frage kommen und im Zweifelsfall am Erzeugerort verrotten, schmälert die Möglichkeit der Bauern, Wertschöpfung zu realisieren, zusätzlich.
Noch mehr geschieht dies durch schlechte Lagerung. Nahezu alle Grundnahrungsmittel werden zu bestimmten Zeitpunkten geerntet und über lange Zeiträume weg, bis zur nächsten Ernte, verzehrt. Man schätzt, dass 10 bis 30 ((prozentplatzhalter)) des weltweit geernteten Getreides nach der Ernte durch Schädlingsfraß, Pilzbefall oder Feuchtigkeit verloren gehen. Die Tabelle illustriert das am Beispiel für das östliche und südliche Afrika.12
Das wäre die unglaubliche Menge von 170 bis 340 Millionen Tonnen der Getreidearten, bei denen im Kapitel 2 von einem Defizit zwischen 10 und 50 Millionen Tonnen zwischen Welterzeugung und -verbrauch die Rede war. Bedenkt man zudem, dass die Nachernteverluste gerade in den Regionen überdurchschnittlich hoch sind, wo es auch die Zahl der Hungernden ist, wird deutlich, welch wichtige Hebel Investitionen in Lagereinrichtungen und das entsprechende Know-how der Bauern darstellen. Noch mehr gilt das für verderbliche Produkte wie Obst und Gemüse. Hier liegen die Nachernteverluste bei bis zu 40 ((prozentplatzhalter)) – so zum Beispiel bei Okraschoten in Indien.
Durchschnittliche Gewichtsverluste in Prozent für Getreide im östlichen und südlichen Afrika. Die Verluste beziehen sich auf Ernte, Lagerhaltung nach der Ernte, Transport sowie Lagerhaltung auf den Märkten. Nicht enthalten sind Verluste während der Verarbeitung (Quelle: www.phlosses.net).
Vom Winde verweht und vom Wasser abgeschwemmt
Die Haitianer nennen einen kleinen Stein »Jèn roch«. Einen jungen Stein. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Nicht dass mich der Beweis eines in unseren Augen etwas sonderbaren Naturverständnisses überrascht hätte. Spätestens seit unsere Köchin Jeanette mich herzlich und mitleidig ausgelacht hat, als ich behauptete, der Regenbogen sei kein Tier – natürlich ist er ein Tier, was denn sonst, um alles in der Welt! –, weiß ich, dass naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht die einzig mögliche Quelle eines Weltbildes ist. Aber woher kommt die Erfahrung, die einen annehmen lässt, Steine würden wachsen, also klein sein, wenn sie jung sind, und dann größer werden?
Der Grund ist die Mutter aller Katastrophen auf diesem gebeutelten Teil der Insel Hispaniola: die Erosion. Es gibt einige Ebenen dort, die sind fruchtbar und wasserreich. Vor allem aber gibt es Berge. Irgendein berühmter Mann hat behauptet, Haiti sei ein zerknülltes Blatt Papier, das der liebe Gott auf die Erde geworfen hat. Auch der Name, den die Aufständischen 1803 nach der Befreiung aus der französischen Sklaverei ihrem neuen Land gegeben hatten, sagt das Gleiche. Er stammt aus der Sprache der damals längst ausgerotteten indianischen Ureinwohner und bedeutet schlicht »bergiges Land«. Haiti ist aber nicht nur bergiger als die Schweiz, es ist auch dichter bevölkert als Belgien. Die meisten Einwohner sind Bauern, und viele wirtschaften auf Hängen, die viel zu steil für den Ackerbau sind. Ich habe erzählt bekommen, dass es Flächen gibt, auf denen die Bauern sich anseilen, wenn sie mit der Hacke den Boden bearbeiten. Die vielen heftigen tropischen Regengüsse reißen den Boden mit sich, und dann beginnen sie zu wachsen, erst klein, dann groß: die Steine des unfruchtbaren Untergrundes. Wer die Insel überfliegt, sieht das ganze Ausmaß des Elends mit wenigen Blicken: verkarstete, kahle Berge, an den Mündungen der Flüsse weit ins Meer hinauswuchernde, Atompilzen nicht unähnliche braune Fahnen. Es hat gerade einmal vier bis sechs Generationen gebraucht, um aus einem fruchtbaren, waldbedeckten Eiland ein buchstäblich verwüstetes karges Land zu machen, das zum Armenhaus der Welt geworden ist. Nicht die starke Bevölkerungsdichte ist die wesentliche Ursache – auch Bali ist ähnlich dicht besiedelt. Viel hängt an der fehlenden Staatlichkeit einer Gesellschaft, die längst hätte eingreifen müssen. Auch die miserable Eigentumsverfassung trägt Schuld an der Misere: Wer keinen sicheren Rechtstitel auf ein Stück Land hat, der wird auf keinen Fall in Terrassen, Erosionsschutzwälle oder -hecken investieren. Denn dadurch macht er das Land wertvoller. Das wiederum ruft die Begehrlichkeit derer auf den Plan, die über mehr Macht und wenig Skrupel verfügen. Und dann ist nicht nur die Investition umsonst gewesen, sondern auch das Land weg. Das wissen die Menschen aus bitterer Erfahrung.
Und dann ist da das Weltbild, das Regenbögen für Tiere und Steine für wachstumsfähig hält. Es ist zwar schwer vorstellbar, aber es ist so: Den Bauern ist die Bedeutung der Erosion für den Verlust der Bodenfruchtbarkeit nicht bewusst. Oder jedenfalls nicht bewusst (und wichtig) genug, um trotz der obengenannten Schwierigkeiten etwas dagegen zu unternehmen.
Sollten Ihnen auf meine Schilderung hin diese Bauern jetzt dumm, träge und ungebildet vorkommen, dann bitte ich Sie, einen kurzen Denkstopp einzulegen. Wir müssen uns nicht zu viel auf unsere aufgeklärte Intellektualität einbilden. Denn schließlich haben wir verstanden, was uns die Klimaforscher über den Zusammenhang zwischen der Erderwärmung mit ihren Folgen und unserem Energieverbrauch vorrechnen. Aber wir intelligenten, agilen und gebildeten Europäer bringen es auch nicht ansatzweise zustande, diese Erkenntnis in Handeln umzusetzen.
Viele Menschen glauben inbrünstig daran, der Mensch werde schon etwas erfinden, wenn die Not groß genug sei. Das sei ihm schon immer gelungen, und das werde auch künftig für die Lösung unserer Probleme sorgen, ehe es zu spät ist. In Haiti kann man besichtigen, dass das eine Illusion ist. Dort ist der »point of no return« längst erreicht: Das Problem hat ein Ausmaß erreicht, das keiner Lösung mehr zugänglich ist. Der Boden, der im Meer ist, liegt dort und kehrt nicht zurück. Er vernichtet so ganz nebenbei im Bereich der Mündungen mehr und mehr die Fauna des Meeresbodens und damit die Reproduktionskraft ganzer Fischbestände. Und damit die Möglichkeit der Fischer, sich und ihre Mitmenschen durch Fischfang zu ernähren …
»Man braucht sich nicht wundern, wenn die Haitianer das Meer nehmen, wenn der Boden das Meer nimmt«, ist eine Formulierung, die nur die Bewohner der Insel verstehen können. »Prann lamè« kann nämlich zweierlei heißen: »als Boat-People versuchen, die USA zu erreichen« und auch: »ins Meer geschwemmt werden«. Ich hatte diesen Satz auf dem Weg zu einer Veranstaltung im Institut Français mitgenommen, ein alter Missionar hatte ihn mir gesagt. Ich sollte dort einen Vortrag halten, in dem ich die Abholzung im Oberlauf des Bewässerungssystems der Ebene von Les Cayes öffentlich machen wollte, im letzten Bergregenwald der Insel rund um den 3000 m hohen Pic Macaya. Das war sehr viel heikler als der Inhalt meines Vortrags, in dem es um einfache Zusammenhänge wie den Wasserkreislauf, die Erosion, die Gründe für das Versiegen von Quellen und die sich häufenden Überschwemmungen ging. Der Auftraggeber der Abholzung war nämlich der Schwiegervater des Präsidenten.
Als deshalb nach dem Satz mit der doppelten Bedeutung erst ein sekundenlanges atemloses Schweigen und dann ohrenbetäubender Applaus folgten, war das ein nahezu revolutionärer Vorgang. Für mich als Redner war es ein magischer Moment, den ich nie vergessen werde. Doch leider ging es um sehr viel mehr als die Wirkung meiner Redekunst. Es ging um die Zukunft des haitianischen Volkes. Das zu behaupten ist nicht pathetisch, sondern realistisch.
Denn die Abfolge von falscher landwirtschaftlicher Nutzung, Erosion und Exodus hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte oft und oft wiederholt. Der amerikanische Geologe David R. Montgomery hat das in einem Buch beschrieben, das überaus hilfreich ist, wenn man die Entwicklung verstehen will, die unser von Menschenhand gestalteter Planet nimmt. Es trägt den schlichten Titel »Dreck« und beschreibt, wie schon vor Jahrtausenden im Zweistromland der Sumerer und im Quellgebiet des Gelben Flusses wenige Jahrhunderte einer erosionsfördernden Nutzung reichten, um den Menschen ein für alle Mal die Lebensgrundlage zu entziehen. Und es zeigt, wie nach der langen Geschichte des Werdens und Vergehens von Zivilisationen der Mensch heute zu einer industriellen Meisterschaft der Effektivität gelangt ist. Wir zerstören mit unserer großflächigen, modernen und leistungsfähigen Landwirtschaft heute mehr an Boden als alle Generationen vor uns.