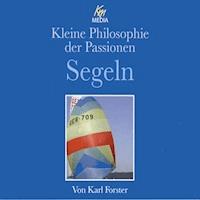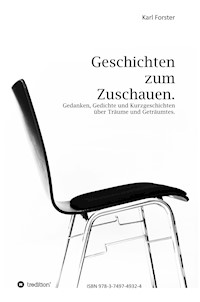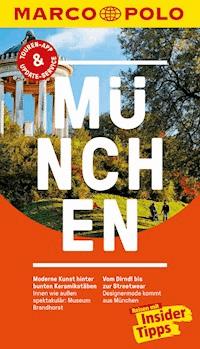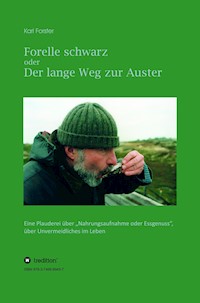
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Kochen ist Kommunikation", sagt Karl Forster. Und schon steht man neben ihm, ein Glas mit dem traditionellerweise in der Küche kredenzten Aperitif in der Hand, mitten in den Düften, Farben, Aromen und Geschichten, die er gleich auftischen wird, und schaut ihm über die Schulter... So konzentriert sich der renommierte Bildermacher und Bühnenfotograf, der in seiner Jugend eine Zeit lang als Küchenputzer beim Leibkoch des schwedischen Königshauses lernte, der Zubereitung seiner Lieblingsgenüsse widmet, so begeistert plaudert er dabei über jenes Gesamterlebnis, das sich "der schlichten Tatsache verdankt, dass wir einfach essen müssen". Ein Buch übers Kochen? Eher ein Erlebnisbuch - "über den Weg zur Lust und Freude am Beschaffen, Auswählen, Zubereiten, Riechen, Schmecken - am Genießen, Erleben, Erfahren, Erfühlen, Probieren, Kombinieren und wieder: Genießen." Eine Einladung dazu, selbst loszulegen, hemmungslos zu experimentieren mit den Kostbarkeiten, die man nicht zu unrecht Lebensmittel nennt, und über den eigenen Tellerrand zu schauen - unweigerlich begegnet man so dem ermutigend zwinkernden Blick eines Freundes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Forelle schwarz
oder
Der lange Weg zur Auster
Eine Plauderei über Nahrungsaufnahme oder Essgenuss, über Unvermeidliches im Leben.
von Karl Forster
IMPRESSUM
Copyright © 2018 by Karl Forster, Bad Grönenbach-Zell
Umschlaggestaltung: Karl Forster.
Umschlagfoto: Hans-Herbert Liebich
Alle Fotos im Innenteil: Karl Forster
Druck und Verarbeitung: Tredition Verlag
ISBN 978-3-7469-8943-3 (Paperback)
ISBN 978-3-7469-8944-0 (Hardcover)
ISBN - 978-3-7469-8945-7 (e-Book)
Für Monika, die ich ein wenig aus der Küche verdrängt habe und für Marion Vera, die schon als Zweijährige rohe Seeigel mit mir gegessen hat.
Apéro
Schon wieder ein Kochbuch?! – Überall dampfen Töpfe, bruzzelt es in bunten Pfannen. TV-Köchinnen und Köche gestalten einen großen Teil der Unterhaltungs-Programme der Sender und sorgen für eine Nachkochhysterie bei privaten Einladungen. Kochen hat seit Jahren Hochkonjunktur. Kochen ist in. Plötzlich kochen alle, die nicht mehr Tennis, Fußball oder Golf spielen können oder wollen. Und jeder hat seine Rezepte von den Kochikonen aus deren zahlreichen Büchern abgeschaut und wiederholt nun als Plagiat was er gerne glaubt, selbst geschaffen zu haben.
Wem helfen diese Hochglanz-Foodfotos? So werden Sie es nie hinkriegen.
Die schönen Teller-Dekos sind meist ungenießbar, lackiert, mit Gelatine überzogen, mit Haarspray verklebt, kalt, gefärbt oder anderweitig unappetitlich behandelt, damit sie so aussehen, wie sie auf dem Foto aussehen sollen.
Warum ich auch noch übers Kochen plaudere? Weil ich glaube, dass Kochen einfach mehr ist als nur Nahrungszubereitung. Kochen besitzt viel mehr Bedeutung in unserem Leben, als wir gemeinhin annehmen (wollen). Kochen ist Kommunikation, wie Essen natürlich auch. Und wie dieses zugleich ein lebenserhaltendes Muss. Beides ist mehr als Lifestyle, Trendsetterei und angesagtes Hobby und sollte auch unter Zeitnot immer mehr sein als ein Nebenher, ein notwendiges Zwischendurch, mehr als ein Aufgießen von Fertigsuppen und Aufwärmen von Pizza. Abgesehen von den rein geschmacklichen Fragwürdigkeiten geben die Inhaltsstoffangaben auf den Verpackungen genügend Anlass zur Sorge um unsere Gesundheit.
Das Abo in der Muckibude oder der Wochenend-Walk mit Stöcken können die Schäden nicht beheben, die wir uns durch Aufnahme der Erzeugnisse von Fertigprodukt- und industrieller Fleischindustrie zufügen. Wir essen uns krank! Wir haben nicht mehr richtig Lust auf Essen, auf Auswählen, Einkaufen, Riechen, Schmecken, Zubereiten. Wir vertrauen den Werbespots der Fertiggerichte-Industrie und glauben, dass jeder Käse natürlich ist. Wie sonst kann es sein, dass die Supermarkt-Regale mit Pizza und Co immer ausladender werden?
Lust an der Suche nach Zutaten, nach Ideen und dass es jeder kann, der es will, das möchte ich vermitteln, das ist mein Credo für jedermanns Küche, nicht für die wenigen eh schon infizierten leidenschaftlichen Herdarbeiter. Letztlich soll vom Einkauf bis zum Essen die Arbeit zwanglos Freude machen und nicht neuen Druck entstehen lassen. Schon gar nicht solchen, der durch Nachahmungsversuche entsteht, die gleich als missglückt gelten, wenn das Ergebnis nicht genau den (Vor-)Bildern entspricht, die als Rezeptbegleitung den Umfang des Kochbuchs haben wachsen lassen. Deshalb keine Vorschriften in Form von Gramm-, Löffel- und Tassen-Angaben, keine homöopathischen Dosen exotischer Samen, kein wildes Ausstattungsgetöse. Wer das braucht oder auch gerne hat, findet Tausende von Rezepten in ebenso vielen Kochbüchern jeglicher Art und Ausstattung. Finden Sie für sich den Weg, der Ihnen am Herd am meisten Freude bereitet, durch die Lust an der Auswahl von Zutaten und an deren "guter Behandlung". Und: Kochen lernt man nur durch Kochen! Sicher auch durch neugieriges Suchen und Beobachten, durchaus auch durch lesen, lesen und immer wieder lesen, was die Crème de la Crème der Köche so niederschreibt. Aber nicht, um es zu kopieren, sondern um mehr über Qualität, Auswahl und Behandlung von Lebensmitteln zu verstehen.
Was Sie in Händen halten, ist kein Buch über Austern und Forellen, wenn auch der Titel das glauben machen mag. Es ist kein wirkliches Kochbuch, in dem Sie einfach nachschlagen, um ein Rezept auszusuchen. Ein Buch übers Kochen ist es ein wenig, mehr aber noch ein Buch über den Weg zur Lust und Freude am Beschaffen, Auswählen, Zubereiten, Riechen, Schmecken – am Genießen, Erleben, Erfahren, Erfühlen, Probieren, Kombinieren und wieder: Genießen.
Kochen ist nicht Selbstzweck, sondern findet den höchsten Grad der Erfüllung im gemeinsamen Essen in angenehmer Gesellschaft, mit guten Freunden.
So betrachtet halten Sie ein Erlebnisbuch in Händen. Eines, das über ein Gesamterlebnis berichtet, das sich der schlichten Tatsache verdankt, dass wir einfach essen müssen.
Weder bin ich Profinoch sehe ich mich als Hobbykoch. Vor dem Profi habe ich viel zu viel Respekt, und für das Hobby fehlt mir der Fanatismus. Der große Respekt vor den Profis am Herd rührt nicht nur daher, dass ich das unglaubliche Glück hatte, drei Monate im Dunstkreis einer Topbrigade als Küchen-putzer zu arbeiten, sondern ist mehr durch die Schlampigkeit, die ich mir am Herd leisten kann, definiert. Ist der Sterneträger vom Terror exakter Erlebnisreproduktion getrieben und muss gleichzeitig immer Neues schaffen, um sein Klientel zufrieden zu stellen, so darf ich in meiner privaten Küche die Lässigkeit gedeihen lassen, darf ein Gericht immer wieder ein wenig anders daherkommen, und kein mäkelnder Möchtegern-Gourmet richtet über Wohl und Wehe des Etablissements. Mich erfüllt es einfach nur mit Freude, und es gibt mir Gelassenheit, wenn ich beim Einkauf gute Lebensmittel finde und aus dem dann Vorhandenen ein mehr oder meist weniger üppiges Essen bereite.
Die Gesamtheit aus Einkaufen, Beschaffen, Zubereiten und Verzehr in angenehmer Begleitung ist das täglich zu schaffende und schaffbare Kunstwerk, bei dem die notwendige Nahrungsaufnahme immer wieder zum Genuss wird. Rezepte? Fehlanzeige, oder zumindest fast.
Ich möchte mehr Ihre eigene Kreativität am Herd aktivieren und Ihre Lust auf Qualität sowie den Mut zum „Experiment“ steigern. Nur manches führe ich weiter aus, weil ich beste Erfahrung mit der einen oder anderen Form der Zubereitung machen durfte, in der Hoffnung, dass es nicht nur nachgekocht, sondern weiterentwickelt oder abgewandelt wird.
Eine irritierende, wenn nicht gar erschreckende Erfahrung:
Ich habe 15 Achtjährige einer Schule nach Ihrem Lieblingsessen befragt und folgendes Ergebnis erhalten: PDP bezeichnet die mit Abstand führenden Favoriten. Gemeint sind Pizza – Döner – Pommes.
Pfannkuchen und Nudeln schaffen es ins Mittelfeld, Spaghetti sind ins letzte Drittel gerutscht und ganz am Ende stehen Hähnchen und Schnitzel (mit Pommes). Wer fertigt wohl die feine Pizza? Wer hat die Zeit dazu, wer nimmt sich die Zeit, denn schnell und einfach ist eine gute Pizza nicht zu fertigen. Gleiches gilt für Döner und Pommes. Da kommt doch der Verdacht auf, dass die an sich guten Speisen aus dem Tiefkühlregal von einem der Fastfood-Giganten stammen und mit der beängstigenden Bezeichnung „industrielle Lebensmittelproduktion“ benannt werden. Die Steigerung ist nur noch „industrielle Fleischproduktion“. Ist da noch von Leben und lebendigen Tieren die Rede? Für mich ein hoher Grad an Perversion.
Ein Schritt zurück: Pizza, Döner und Pommes, alles kann höchster Genuss sein, aber nur, wenn bekannt ist, was drin ist – am besten selbst gemacht.
Die Qualität des Essens unserer Kinder bestimmen wir dadurch mit, dass wir sie frühzeitig an die Freude am Essen und das Erkunden neuer Geschmackserlebnisse heranführen. Kinder sind bereit, das Abenteuer Geschmackserlebnis einzugehen. Meine Tochter hat mit zwei Jahren rohe Seeigel genossen und alles probiert, was ihr angeboten wurde. Die seltene Maximalablehnung hieß: „Das ist schon fein, aber kein Kindergeschmack!“.
Ein weiterer Grundgedanke, der durch das Buch begleitet: Wenn wir den Tieren, die wir verzehren mehr Respekt schenken, werden wir auch gesünder leben können.
Wenn jeder einmal selbst ein Huhn töten und einer Schlachtung in einem europäischen Schlachthaus beiwohnen müsste – der Fleischkonsum würde rapide zurückgehen!
Wir würden mehr Achtung vor anderen Lebewesen bekommen und gleichzeitig physisch wie psychisch gesünder werden. Das sollte Ihnen jetzt nicht den Appetit verderben, sondern ein Nachdenken darüber anregen, wie Tiere behandelt werden, deren Fleisch wir essen.
Und: es gibt in der Nähe (noch) immer einen Züchter, der seine Tiere artgerecht hält und einen Metzger, der diese Tiere stressfrei schlachtet, nachdem sie zuvor ein gutes Leben hatten. Diese „Handwerker“ schaffen gute Lebensmittel, aber wenn wir nur noch an den Kühltheken der Supermärkte unseren Bedarf decken, schaffen wir die Quellen für „echte Lebensmittel“ selbst ab. Weshalb häufen sich denn Allergien und Krankheiten aller Art?
Weil wir immer mehr „Dreck“ essen, künstliche Zutaten, Chemie und „krankes“ Fleisch.
Wir essen die Panik und die Angst der Tiere aus Massentierhaltungen und brutalen Schlachtungen mit.
Nein, ich bin kein Vegetarier, auch kein Veganer! Ich bin ein Allesfresser, aber ich weiß von jedem Fleisch, das ich verzehre, wo und wie das Tier vor seinem Ende gelebt hat.
Genug der Vorrede, auf ins Genussreich zu wieder erfreulichen Dingen!
Teller-Multitasking
Knabbern beim Fernsehen. Zeitung lesen beim Frühstück. SMS schreiben beim Brunch. E-Mail checken beim Mittagessen, dazu Hintergrundmusik, vielleicht noch ein Telefonat… Wir praktizieren Multitasking in einer besonders ausgeprägten Form.
Unsere Sinnesorgane besitzen eine faszinierende Leistungsfähigkeit. Die Gesamtheit der verfügbaren Energie verteilt sich je nach Anforderung mehr auf das eine oder andere; modernes Energie-Shifting könnte man das nennen. Der Vorteil dieser Flexibilität ist unbestritten, können wir doch in Grenzen entscheiden, welches Organ die Hauptleistung erbringen soll. Oder warum schließen wir die Augen, wenn wir intensiv Musik hören oder uns auf einen bestimmten Duft konzentrieren wollen? Auch beim besonderen Genuss einer Speise schließen wir, manchmal unbewusst, die Augen und steigern so die Genussempfindung durch Konzentration auf den Geschmackssinn.
Wenn wir also eine andere Tätigkeit mit der Nahrungsaufnahme verbinden, teilt sich die Energie, die Aufmerksamkeit, und es wird nebensächlich, was wir aufnehmen, Hauptsache Nahrung. Die Frage nach der Qualität gleitet ins ferne Nirgendwo und die Sinne Riechen und Schmecken mutieren zu willfährigen Komplizen von Geschmacksverstärkern und Kauaktivatoren, die uns dann vorgaukeln, noch lange nicht satt zu sein. Nur so ist es für mich erklärbar, wie McNuggets, Fertigpizza und Aufguss-Suppen ihren Siegeszug in unsere Mägen antreten konnten. Die perfideste Kombination findet sich bei Chips und TV: Augen und Ohren sind gut beschäftigt und die Geschmacksverstärker gaukeln den Geschmacksknospen ein andauerndes Hungergefühl vor.
Ist essen für uns wirklich nur Nahrungszufuhr und dient der Sättigung durch beliebige Kalorienaufnahme, oder streben wir konzentrierten Genuss, Wohlbefinden und gesundes Essverhalten an?
Alle Sinne auf den Teller gerichtet! Die Augen essen mit! Die Nase natürlich auch – wer möchte sich schon Übelriechendes zuführen. Als Türsteher verhindern beide, dass Unverträgliches den Weg in unseren Körper findet; sofern wir ihrer Beurteilung Beachtung schenken…
Damit ein Gericht auf dem Teller seine angemessene Wertschätzung bekommt, sollte die Zuneigung schon beim Auswählen der Zutaten zu wachsen beginnen, bei der Zubereitung stabil werden und beim Essen dann in einem freudigen Genuss kulminieren.
Manchmal beginnt es früh – und keiner merkt es
Erste datierte Kontakte mit Kochen und Backen im Vorweihnachtsbackfieber 1951: Plätzchen ausstechen, Spitzbuben schokolieren, Spritzgebäck – und Teignaschen, nicht zu viel, das gibt Würmer. Wenigstens war das die Überzeugung meiner Mutter, natürlich auch meiner Großmutter, die das Risiko einer Verwurmung aber wesentlich geringer einschätzte. Bei ihr begann die Gefahr erst bei größeren Mengen zu drohen. Die Arbeit mit Oma bekam dadurch höheren Reiz. Omas Toleranz war in allen Situationen größer als Mutters, besonders aber bei der Adventsbackerei und meiner Vorliebe für den rohen Teig. Damit ich dem Ziel meiner Wünsche nahe kommen konnte, musste ich eine Eckbank erklimmen und mich so lang wie möglich machen um die Mitte des Nudelbrettes und die darauf ruhende Teigmasse zu erreichen. Auf dem Boden stehend trafen meine Blicke gerade auf die Mitte der Schürzen von Mutter und Großmutter, sahen in kurzen Momenten ihre teigbehafteten Hände. Es roch irgendwie süßlich und nach Kerzen, das Licht war nicht besonders hell und unter dem Tisch war es ziemlich dunkel. Der kompakte Teig schmeckte süß, klebte leicht und zerfloss langsam im Mund – Suchtgefahr! War vielleicht der gleiche Effekt, auf den die Fastfood-Clique heute baut, der Gaumen verlangt immer mehr, mehr, mehr…
In den Folgejahren Fortsetzung der winterlichen Sandkastenspiele bis zu ernsthaften Dekorationsbemühungen und Formgebung. Blechausstecher, Sterne mit vier, sechs und acht Zacken – Fische, Mondsicheln und Kreise.
Ringe und Stäbchen wurden gespritzt und nach dem Backen zur Hälfte oder an beiden Enden mit Schokolade bestrichen. Dann der Zuckerguss und die bunten Zuckerstreusel, Gefahr Nummer zwei: die Zähne kriegen Löcher.
Das Leben ist schon früh gefährlich, bei Mutter mehr, bei Oma etwas weniger. Wirklich Bauchschmerzen bekam ich aber höchstens, wenn ich zu viel von den fertigen Plätzchen gegessen hatte, beim rohen Teig passierte nie etwas, außer dass meine Kleidung am Schluss eines Backtages ziemlich beteigt war.
In den Jahren danach – und das bis heute – große Distanz zum Backen, nicht aber zu Gebackenem und nicht zu den zauberhaften Kuchen meiner Frau. Mein Favorit: Mohntorte, ganz ohne Mehl, mehr weiß ich nicht, nur dass sie begleitet von feinem Kaffee oder erlesenem Tee unglaublich gut schmeckt. Das Rezept stammt aus einem Kochbuch für Mehlspeisen der K & K Monarchie. Mehlspeisen, welche Untertreibung für die Zaubereien, die in Österreich unter diesem Begriff zusammengefasst werden.
Alptraum Spinat
Der Alptraum jeden Kindes meiner Generation: Spinat. Erst heute weiß ich, weshalb. Es hat mit Spinat nicht viel zu tun, was da in die Kleinsten manchmal (auch heute noch) reingesteckt wird. Grüngraue, breiige Masse, eklig im Geschmack. Ich bin geneigt anzunehmen, dass mit den frühen spinatischen Vergewaltigungen die Geschmacksnerven bis weit ins spätere Leben irritiert werden!
Ich spreche von den pürierten Gefrierblöcken, die aufgetaut als Rahmspinat auf die Teller wandern. Meine Abneigung gegen das grüne Gematsche, auch aus Gläschen fix und fertig serviert – für Baby und Greis – hält sich hartnäckig. Nie wieder habe ich Spinat in Matschform gegessen. Nicht einmal der mit dem Blubb war für mich akzeptabel, weil Spinat in allen cremigen Formen für mich zu große Ähnlichkeit mit den wärmenden Kuhfladen hatte, in denen im Spätherbst so wunderbar die nackten Füße gewärmt werden konnten und mit den Verdauungsergebnissen der Gänse. Spinat war immer kuhfladenartig und immer in Begleitung von Bratkartoffeln und Spiegelei. Daran habe ich mich wohl überessen. Wiewohl ich heute jedes für sich sehr genießen kann, Spiegelei wie Bratkartoffeln, auch Spinat.
Erst als mein Bruder mit etwa vier Jahren es schaffte, einen ganzen Teller des grünen Breis ohne Schlucken irgendwo zwischenzulagern und dann das verschmähte Grün in wilder Explosion im Raum zu verteilen, reduzierte sich die Häufigkeit der Spinatmahlzeiten etwas.
Wenn schon Spinat, dann frisch, sehr frisch:
Großer Topf. Frischer Spinat, säubern und von harten Stielen befreien. Olivenöl (mit etwas Butter) erhitzen. Fein gehackten frischen Knoblauch dazu. Spinat in den Topf. Mehrmals wenden, damit er nicht anbrennt. In drei bis fünf Minuten ist er genussfertig.
Mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz würzen und auf den Tisch.
Das geht richtig schnell. Wer es cremig mag, rührt noch einen Löffel Schmand oder Crème fraîche darunter oder Sahne, würzt vielleicht auch mit etwas scharfem Senf. Dann wird es doch noch ein Rahmspinat, aber was für einer! Lieber als ein Spiegelei lege ich ein gegrilltes Fischfilet darauf oder gegrillte Steinpilze oder nur Bratkartoffeln oder doch ein Spiegelei oder zwei, aber diese dann unbedingt in Olivenöl gebraten. Der Spinat eignet sich für fast alles als „Untersetzer“. Gleiches gilt für Mangold. Grün von den Stielen trennen und von diesen die Haut abziehen.
Mangold blanchiere ich kurz in Salzwasser bevor er in Öl oder in einer Öl/Butter-Mischung mit Knoblauch kurz gedünstet wird. Es geht auch direkt in die Pfanne, ohne Umweg über das Salzwasser.
Auch frische Löwenzahnblätter und junge Brennnesselblätter werden so zu einem frühlingsfrischen (Spinat)gericht.
Ebenso klappt das mit einer Mischung junger Wiesenkräuter (Löwenzahn, Spitzwegerich, Brennnessel, Sauerampfer - ein Genuss, wenn sie nicht schon vorher als Salat enden. Entdeckenswert sind ähnliche Gemüse beim italienischen Biohandel: Cima di rapa oder ähnliches – als Gemüse, im Risotto, gebraten oder gedünstet.
In einem Bächlein helle: natürlich die Forelle
Ohne zu ahnen, dass ich wesentliche Erkenntnisse über die Frische von Zutaten in der Praxis erfuhr, wurde mir das schon früh vor Augen geführt, wurde ich selbst Zeuge und Mittäter bei der Beschaffung frischester Nahrungsmittel.
Nachdem mein Vater vor längerer Zeit verstorben ist, kann ich über diese Situationen so arglos berichten, wie ich sie – im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren – erlebt habe…
Sonntag war der Tag der Forellen. Und Forellen waren Abendessen. Der Spaziergang der Familie führte gegen 14.00 Uhr - nach dem Mittagessen und vor der Kaffeestunde - immer eine Standardstrecke durchs Dorf, am Sportplatz vorbei Richtung Wald und immer lag dasselbe Bächlein am Weg.
Vaters einziger Anzug auf dem Rückweg meist voll Grasflecken, das Hemd auch grün und nass und die Taschen ausgebeult wegen der Forellenfüllung, Mutter in schierer Verzweiflung ob der zu erwartenden Reinigungsaufwendungen. Irgendwie musste der Fang ja unbemerkt wieder am Sportplatz vorbei durchs Dorf in die Waschküche geschafft werden, zur Vorbereitung auf das Ende in der Pfanne. Die Geschmackserinnerung ist nur schwach aber durchaus zwiespältig.
Rückblickend „Forelle schwarz“, daher der eine Teil des Buchtitels – das ist kein Gourmettempel-Rezept, obwohl, die Vermählung alpenwasserfrischer Forellengenüsse mit Tinte salzwassergeborener Minicalamares durchaus einen Versuch wert wäre. (Dazu Safranrisotto oder gebackenen Kürbis…)
Meine „schwarze Forelle“ ist allerdings eine zu Tode gebrannte „Müllerin“, rebellischer Küchen-Fauxpas meiner Mutter, die sich nur mit blankem Entsetzen der gewilderten Forellen meines Vaters annahm.
Mit den Gräten hatten wir alle unsere liebe Mühe, ist der Allgäuer doch nicht der passionierte Fischesser. Aber frisch waren die Tiere, frisch aus dem Bach in die Pfanne. Immerhin schaffte ich mit neun Jahren auch schon die eine oder andere Forelle selbst zu fangen. Meist aber waren an steilen Bachufern Halteaufgaben angesagt. Zum Beispiel als mein Bruder, gerade fünf, mich (zwölf) am Hals und ich, Vater an den Beinen haltend, unweigerlich ins Wasser gezogen wurden. Forellen gab es trotzdem wieder. Mein Vater warf sie einfach in die Wiese neben dem Bach und wir sammelten sie ein.
Forellen mag ich heut am liebsten geräuchert oder, nur wenn sie wirklich frisch aus einem Gebirgswasser sind, blau. Mit frischer Petersilie, zerlassener Butter und Pellkartoffeln.
Das ganze Braten und Panieren behagt mir nicht nur wegen des unnötigen Fettgehaltes nicht. Für mich zerstört oder behindert es zumeist das zarte Aroma der frischen Gebirgsforelle. Forellen aus Massenzuchtanlagen sind für mich genauso ein „no go“ wie Massenmasthähnchen aus der Tiefkühltruhe oder Massenzuchtlachs.
Natürlich gibt es auch ordentliche Fischzüchter, bei denen die Tiere ausreichend Platz für Bewegung haben und mit bestem Futter versorgt werden. Frischwasser selbstverständlich, am besten ein kühler Bachdurchfluss.
Die besten kommen aus kalten Gebirgsbächen oder Zuchtanlagen, die von kaltem Wasser durchflossen werden.
Grundsätzlich gilt: Lieber ganz selten aber dafür von bester Qualität – Forelle wie Hähnchen.
Frische Forelle töten. Das muss sein und erhöht nur den Respekt vor den Tieren und der Natur. Vielleicht übernimmt das ja der Angler oder Fischer, auch der Züchter – zusehen wäre eine Erfahrung.
In sanft siedendes Wasser (nicht kochend) mit etwas Essig, Wein, Salz, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren die Forellen gleiten lassen.
In wenigen Minuten fertig!
Forelle abtropfen lassen, zerlassene Butter und gehackte Petersilie darüber.
Dazu frische Pellkartoffeln. Die sind intensiver im Kartoffelaroma als Salzkartoffeln, weil in der Schale (und möglichst im Dampf) gegart.
…und Flusskrebse.
Fangempfehlung meines Vaters: Nur die Finger in deren Unterwasserunterschlupf stecken und wenn das Tier mit der Schere zupackt, den Krebs schnell ans Ufer werfen. Für meinen Bruder und mich waren die gekochten Krebse eher problematisch, war doch das Rankommen an das Essbare für uns nicht einfach. Leider sind sie aus vielen Gewässern verschwunden, weil es ihnen zu schmutzig wurde und nur ganz langsam kehren sie wieder zurück. Inzwischen haben Krebszuchten die Lücke ein wenig gefüllt.
Was an den krustigen Dingern wirklich so toll ist habe ich erst Jahrzehnte später im Restaurant „Wurlflut“ in Lychen und auf einem Segeltörn durch die finnischen Schären erfahren.
Besonders die finnische Variante hat es in sich:
Ein Krebs, ein Schnaps, ein Krebs, ein Schnaps - solange man durchhält.
Vielleicht lag die frühere Einschränkung der Begeisterung auch daran, dass wir nicht das ideale Werkzeug anwenden konnten. Zange, eine ganz gewöhnliche, Schraubenzieher und Küchenmesser mussten ausreichen. Inzwischen liegen die richtigen Werkzeuge in der Schublade und ich rate jedem, der ab und an oder öfter selbst Krustentiere zubereiten möchte, das richtige Werkzeug zu beschaffen, das bewahrt ganz sicher vor großer Verzweiflung und erhöht die Freude am Genuss erheblich.
Immer noch frisch: Rebhuhn und Wachtel – und Hase
Der Startrichtung entgegen kann man sie, so man behände genug ist, abklatschen. Zu zweit sollte man schon sein bei dieser Jagdmethode nach Art meines Vaters, wenn auf einen italienischen Netzbau verzichtet werden soll. Den habe ich erst Jahre später kennengelernt, aber da wusste ich schon, dass diese Art der Jagd nicht erlaubt und überhaupt zur Jagd allgemein eine entsprechende Ausbildung und Genehmigung nötig ist. Den Vogelfang mit den Riesennetzen verabscheue ich extrem, wie auch den hemmungslosen Fischfang mit den alles vernichtenden Riesen-Schleppnetzen.
Heute kaufe ich die Tiere natürlich. Am liebsten Wachteln, die sind bei uns leichter zu bekommen als Rebhühner. Überhaupt ist es mit unserm Federwild nicht so einfach.
In Frankreich ist das Angebot viel größer, aber wer fährt schon wegen Wildgeflügel und speziellen Zuchtfederviehs immer ins Elsass oder eine andere französische Grenzregion ?
Wachteln halbieren. Salzen und pfeffern. Kurz anbraten in Butter bis beide Seiten gebräunt sind. Dauert nicht lang, 2 bis 3 Minuten je Seite. 10 Minuten im warmen Backrohr bei 60°C ruhen lassen.
Servieren auf Ackersalat.
Auch auf Sellerie- oder Kartoffelpüree. Auf gegrilltem Chicorée oder einer Polenta. Auf einem Pilzrisotto oder, oder, oder…..klar, auch auf Spinat!
Den Hasen, den wilden natürlich, will ich ebenfalls nicht verschweigen. Besonders nicht die erklärenden Ausführungen meines Vaters betreffend den Fang vor seiner Life-Demo vor Ort.
Der Hase duckt sich in die Ackerfurche und glaubt, nicht gesehen zu werden und so der Gefahr zu entgehen. Also: man merkt sich, wo der Hase sich geduckt hat, geht zwei Furchen daneben etwa einen Meter vorbei ohne hinzusehen und wirft sich rücklings schräg ins Kraut auf das Tier, hält alles was zappelt fest, und mit viel Kratzen und Beißen von Hasenseite wird der Kampf durch einen gezielten Handkantenschlag beendet. Gut, das klingt brutal, aber was mutet Mensch den Zuchttieren heute zu? Die anonymen Fleischportionen werden lebend in engen Gehegen fettgefüttert, mit Medikamenten vollgestopft, in dunklen Verschlägen über endlose Strecken gekarrt, mitleidlos auf den und vom Transporter getrieben, in Massen zur Schlachtbank geprügelt.
Wer glaubt denn wirklich, dass das noch etwas mit dem Begriff Lebensmittel zu tun hat? Es heißt eben pervertiert auch: industrielle Fleischproduktion.
Ich bin sicher, wenn jeder, der Fleisch mit Genuss verspeist, einmal das Tier auch selbst töten oder wenigstens, bei größeren Gattungen, der Tötung beiwohnen müsste, die Qualität der tierischen Nahrungsmittel würde schnell wieder vor der Quantität rangieren und die Lebewesen verachtenden Produktionsanlagen würden bald als grandioser Irrtum in historischen Betrachtungen verschwinden.