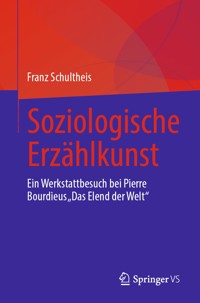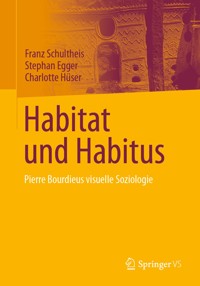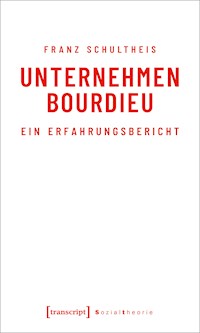29,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Forschen mit Bourdieu
- Sprache: Deutsch
Pierre Bourdieu prägte als einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts die Praxis des kollektiven Forschens. Franz Schultheis bietet ethnografische und soziobiografische Einblicke in dessen Forschungswerkstatt und rekonstruiert Bourdieus erste Schritte auf dem Gebiet der Feldforschung bis hin zu seinem Spätwerk. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht publizierte bzw. nicht auf Deutsch erschienene Forschungsarbeiten. Unveröffentlichte Manuskripte, Arbeitspapiere und -protokolle sowie Korrespondenzen mit Vertretern der internationalen scientific community aus dem Pariser Bourdieu-Archiv ermöglichen grundlegend neue Einblicke in Bourdieus Lebenswerk, aber auch in dessen Einbettung in die kollektive Praxis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Editorial
Die Reihe Forschen mit Bourdieu schließt an die interdisziplinäre und teamorientierte Arbeitsweise Pierre Bourdieus an. Sie bietet Forschungsperspektiven aus der Soziologie, Ethnologie und Anthropologie sowie aus dem Spektrum der Kultur- und Geschichtswissenschaften einen Publikationsort. Im Mittelpunkt stehen Untersuchungen, die innovative Methoden anwenden und Gegenstände auch abseits des akademischen Mainstreams bearbeiten. Dabei steht die Praxis des kollektiven Forschens ebenso im Fokus wie der Zugang soziologischer Reflexivität und praxeologischer Kritik. Neben Beiträgen der jährlichen »Bourdieu Lectures« gibt die Reihe Untersuchungen aus Bourdieus »Actes de la Recherche en Sciences Sociales«, ausgewählten Dissertationen sowie Lehr- und Handbüchern Raum.
Die Reihe wird herausgegeben von Ullrich Bauer, Uwe H. Bittlingmayer und Franz Schultheis.
Franz Schultheis (Prof. Dr.), geb. 1953, ist Seniorprofessor an der Zeppelin Universität Friedrichshafen und arbeitete lange mit Pierre Bourdieu zusammen. Er ist Präsident der »Fondation Pierre Bourdieu« sowie Redaktionsmitglied von »Actes de la recherche en sciences sociales«.
Franz Schultheis
Forschen mit Bourdieu
Werkstattbesuche 1958-2002
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
2025 © transcript Verlag, Bielefeld Hermannstraße 26 | D-33602 Bielefeld | [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen Lektorat: Lilli Kim Schreiber Korrektorat: Amelie Sina Werner & Martha Deter https://doi.org/10.14361/9783839474587 Print-ISBN: 978-3-8376-7458-3 | PDF-ISBN: 978-3-8394-7458-7 | ePUB-ISBN: 978-3-7328-7458-3 Buchreihen-ISSN: 3052-6353 | Buchreihen-eISSN: 3052-6361
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Ein ganz besonderer Dank gilt Lilli Kim Schreiber, die das Manuskript dieser Studie aufmerksam und inhaltlich kompetent betreut und lektoriert hat.
Inhalt
1.Die kollektive Forschungspraxis eines singulären Autors: Einblicke in die Werkstätten Pierre Bourdieus (1958–2002)
Bourdieus Forschungswerkstätten in soziologischen Erzählungen
Forschung als kollektive Praxis: Perspektivenwechsel auf Werk und Wirken Bourdieus
Vorgehen unserer Rekonstruktion
2.Bourdieu und die Statistiker des INSEE: Ursprung und Dynamik eines außergewöhnlichen Forscherkollektivs
Begegnungen in einem soziologischen Laboratorium
Auf dem Wege zu einer soziologienahen öffentlichen Statistik
Forschen unter Bedingungen kolonialer Herrschaft
Mit Statistik über die Statistik hinaus: Soziologische Reflexivität am Werk
Soziologie und Statistik: Dynamik einer prekären Machtbalance
In Verteidigung eines pluralistischen Wissenschaftsverständnisses
DARRAS: Pseudonym eines neuen Typus kollektiven Forschens
Software und Hardware: Symbiosen qualitativer und quantitativer Forschung
Kollektives Forschen in einem wissenschaftlichen »Startup«
Vorbemerkung zu »Die Liebe zur Kunst«
L’amour de l’art revisited: Bourdieu erforscht die Magie des Centre Pompidou in Paris
3.Gemischtes Doppel bei einer transmediterranen Ethnographie
Transmediterrane Wahlverwandtschaften
Soziologie in Zeiten eines antikolonialen Befreiungskrieges
Projektleitung: Paris – Durchführung: Aghbala
Von der Ethnografie der Ferne zu jener des Eigenen
Der ethnografische Blick im Dienste soziologischer (Selbst-)Reflexivität
4.Familiensoziologie bei den Bourdieus
Von Algerien in die bäuerliche Kultur der Heimat
Citizen Science avant la lettre
Der Bauer und die Fotografie: »Das Banale gut malen«
»Reproduktion verboten«: Soziologie eines gesellschaftlichen Dramas
Von der qualitativen Feldforschung zur historischen Archivarbeit
5.Das Centre de Sociologie Européenne: Inkubator eines Typus kollektiven Forschens sui generis
Das Habitat des Forscherkollektivs
Bildung und soziale Reproduktion: Leitmotive eines Forschungskollektivs
Annäherungen an die Praxis kollektiven Forschens beim CSE
Struktur und Dynamik einer Forschergruppe
Vom Chorleiter zum Solisten: Spuren eines Statuswechsels
Auszeit für den kollektiven Forscher – Blütezeit des singulären Autors
Forschen im Kollektiv – Schreiben im Singular
6.Ein Soziologen-Trio lüftet Bankgeheimnisse
Design einer ungewöhnlichen Studie
Heikle Balance: Forschung zwischen Auftrag und Autonomie
Von einer Moral des Sparens zu einer Moral des Kredits
Detektivisches Forschen auf subversiven Pfaden
Das »Ich« und das »Wir«: Grauzonen kollektiven Forschens
7.Actes de la recherche en sciences sociales: Forum kollektiven Forschens
Programm und Gestalt einer inkommensurablen Revue
Text-Bild-Collagen als Mittel dichter Repräsentation sozialer Wirklichkeit
Actes de la recherche: Brand und Corporate Identity eines kollektiven Forschers
Soziologische Reflexivität in kollektiver Praxis
Actes und die Metamorphosen des kollektiven Forschers
8.Forschen als kollektiver Lernprozess: Die Arbeit an »Das Elend der Welt«
Ein Forscherkollektiv konstituiert sich
Soziale Symptomatologie: die Erfindung eines kollektiven Forschungsansatzes
Habituelle Voraussetzungen der Teilnahme am Forscherkollektiv
Vom Programm zur Praxis einer kollektiven Forschung
Soziologisches Handwerkszeug: Einblicke in eine Forschungswerkstatt
Möglichkeitsbedingungen eines kollektiven wissenschaftlichen Habitus
9.»Wissenschaft im Werden«: Besuch bei Bourdieus Forschungs-Lehrwerkstatt
10.Forschen am Collège de France: Mit, bei und ohne Bourdieu
Ein Kollektiv (er)findet seinen Gegenstand
Enttäuschte Erwartungen
Back to the Roots: Das Projekt »Die Europäer und ihre Bildungseinrichtungen«
Für einen kritisch-reflexiven Gebrauch interkulturellen Vergleichs
11.Was machen mit Bourdieus Erbe? Die Fondation Bourdieu und das Projekt »Für einen europäischen Raum der Sozialwissenschaften«
ESSE: Ein Projekt
Fondation Pierre Bourdieu – Versuch einer Institutionalisierung kollektiven Forschens im Geiste Bourdieus
Literaturverzeichnis
1.Die kollektive Forschungspraxis eines singulären Autors: Einblicke in die Werkstätten Pierre Bourdieus (1958–2002)
»[…] man müsste eine Art kollektiven Intellektuellen erfinden nach dem Vorbild der Enzyklopädisten«
(Pierre Bourdieu in Le Monde am 7. Dezember 1993).
Pierre Bourdieus Werk, seine bahnbrechenden empirischen Forschungen und die zum Grundwortschatz der zeitgenössischen Soziologie geronnenen theoretischen Konzepte wie »Kapital« oder »Habitus«, bedürfen angesichts der breiten und intensiven internationalen Rezeption und Diskussion und einer kaum noch zu überschauenden Sekundärliteratur eigentlich keiner weiteren Abhandlung. Er selbst stellte in Gesprächen manchmal hierzu mit trockenem Humor fest: »Hört auf mich zu zitieren – fangt selbst an zu forschen!«
Im vorliegenden Falle wollen wir uns daran halten und Bourdieus Werk und Wirken selbst auf der Grundlage von ethnografischen Beobachtungen, Gesprächen und schriftlichen Quellen aus dem Pariser Bourdieu-Archiv zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Objektivierung machen. Gefragt wird nach der konkreten Praxis hinter seiner praxeologischen Soziologie, den jeweiligen soziobiografischen Hintergründen und den kontextuellen Möglichkeitsbedingungen seines Arbeitens sowie nach der für seinen außergewöhnlichen Werdegang kennzeichnenden Geradlinigkeit und Beharrlichkeit der kritischen Hinterfragung und Durchleuchtung der gesellschaftlichen Welt. Hierbei soll wie bereits in der kleinen ethnografischen Studie »Unternehmen Bourdieu« (2019) nicht wie üblich Bourdieu als singulärer, ja inkommensurabler Forscher, Intellektueller und Autor im Vordergrund stehen, sondern die von ihm entwickelten vielfältigen Formen kollektiven Forschens. Es wird hierbei versucht, eine Art Soziobiografie des Bourdieu’schen »Forscherkollektivs« bzw. »kollektiven Forschers« zu präsentieren, die im Unterschied zu »Unternehmen Bourdieu« mittels einer Langfristanalyse die Variationen und Metamorphosen kollektiven Forschens mit und um Bourdieu über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten umfasst.
Damit ist bereits eine Teilantwort auf die Frage »Warum nochmals ein Buch über Bourdieus Praxis kollektiven Arbeitens?« gegeben. Während es sich bei »Unternehmen Bourdieu« (2019) um eine kleine, im Essaystil gehaltene ethnografische Studie handelt, welche auf Grundlage der eigenen langjährigen Mitarbeit am Centre de Sociologie Européenne (CSE, im Folgenden Centre genannt) und enger Zusammenarbeit sowie persönlicher Beziehung mit Bourdieu zustande kam und sich deshalb auf den Zeitraum von 1986, beim Eintritt ins Centre als Chercheur associé, bis zu Bourdieus Tod im Jahre 2002 beschränkte, wird die hier vorgestellte, historisch und biografisch deutlich weiter ausholende und entsprechend umfangreichere Rekonstruktion wissenschaftlicher Praxis à la Bourdieu zwar nochmals punktuell auf die empirischen Beobachtungen und Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Quellen der Vorgängerstudie zurückgreifen, diese aber vor allem durch intensive Forschungen beim Bourdieu-Archiv in Paris ergänzen und somit die zeitliche Perspektive auf die gemeinsamen Fragestellungen beider Studien bis in die späten 50er Jahre zurück erweitern.
Diese Langfristbetrachtung eignet sich in besonderer Weise dafür, Bourdieus These zu untermauern, nach der er in seinen frühesten Feldforschungen in Algerien ein »Kapital an Fragen« ansammeln konnte, von dem er lebenslang profitierte.
Die dabei entstandenen vielfältigen, meist noch brach liegenden Quellen des Archivs – Manuskripte, ethnografische Notizen, Korrespondenzen, Skizzen künftiger Publikationen etc. – konnten in den letzten Jahren bereits mehrfach für Publikationen verwendet werden (vgl. Schultheis et al. 2022, 2023a & 2023b; Schultheis 2024), wobei sich unweigerlich thematische Überschneidungen ergeben, die mitunter auch in Passagen gleichen Wortlauts Ausdruck finden. Um dem Vorwurf des Selbstplagiats an dieser Stelle nicht noch selbst Vorschub zu leisten, wird an betroffenen Passagen darauf hingewiesen – wenn wohl auch nicht flächendeckend –, wofür ich mich hier schon einmal präventiv entschuldigen möchte.
Schlimmer noch steht es bei den für unser Vorhaben der Langzeitrekonstruktion der Formen und Praxen kollektiven Forschens bei manchen Kapiteln unumgänglich erscheinenden Anleihen bei »Unternehmen Bourdieu« (2019). Um auch hier dem Vorwurf hemmungslosen Selbstplagierens zuvorzukommen, sei darauf hingewiesen, dass ich diese Frage gegenüber dem Verlag, bei dem ja auch die kleine Vorläuferstudie erschien, offen angesprochen habe. Entschieden, wenn auch nicht zur vollen Zufriedenheit gelöst, wurde dieses Problem, indem im vorliegenden Band erst gar nicht versucht wird, die Ausführungen in »Unternehmen Bourdieu« stilistisch so umzumodeln oder gar zu paraphrasieren, dass sich Reprisen als akzeptable Anleihen ausgeben. Da es bei diesen beiden Studien um Bourdieus Praxis des Forschens geht, erlaube ich mir in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass dieser ja selbst ausgiebigen Gebrauch von »Reprisen« früherer Veröffentlichungen machte und manche seiner Monografien in unterschiedlichsten Vorgängerstudien fußten – eine Eigenheit seines Arbeitsstils, zu der er sich, wie im späteren Verlauf unserer Betrachtungen noch thematisiert werden wird, offen bekannte.
Während sich also die frühere Auseinandersetzung mit der kollektiven Forschungspraxis Bourdieus auf eigene Anschauung und aktive Teilhabe stützen konnte, müssen wir uns bei der Beschäftigung mit den vorausgehenden rund drei Jahrzehnten (1958–1986) auf mündliche und schriftliche Quellen unterschiedlichen Typs stützen.
An erster Stelle steht hier Bourdieu selbst, der mir in vielen persönlichen Gesprächen über seinen Werdegang berichtete. Sei dies in Form von später veröffentlichten Interviews, in privaten Unterhaltungen oder auch in Vorbereitung seines »Soziologischen Selbstversuchs« (2002a), den er mir kurz vor seinem Tod anvertraute, um ihn in deutschsprachiger Übersetzung vor der späteren französischsprachigen Ausgabe herauszugeben.
Daneben standen mir viele Zeitzeugen als ethnografische Informanten zur Verfügung, die teilweise schon in den frühen 1960er Jahren zusammen mit Bourdieu Forschung betrieben hatten. Weiterhin kann sich die vorliegende Erforschung einer ganz außergewöhnlichen Forschungspraxis auf eine fast 30-jährige, intensive Beschäftigung mit Werk, Wirken und Wirkung der Soziologie Bourdieus und seiner Mitarbeitenden stützen – sei es in Form der Herausgabe der Schriften Bourdieus bei Suhrkamp gemeinsam mit dem leider verstorbenen Kollegen und Freund Stephan Egger, sei es durch die Herausgabe deutschsprachiger Übertragungen von Werken Bourdieus oder anderer Mitglieder des Centre de Sociologie Européenne sowie im Rahmen eigener Studien zu spezifischen werkbiografischen Phasen, insbesondere hinsichtlich der algerischen Forschungen Bourdieus (vgl. Schultheis 2007).
Bourdieus Forschungswerkstätten in soziologischen Erzählungen
Ausgehend von den eigenen persönlichen Erfahrungen mit der Forschungspraxis Bourdieus und den hierzu schon gelieferten ethnografischen Beschreibungen wird versucht, mittels diverser schriftlicher und mündlicher Quellen ein möglichst dichtes und lebendiges Bild der Alltagspraxis von Forschung wachzurufen und die sich dabei manifestierenden Konstellationen kollektiven Arbeitens in ihren unterschiedlichen Spielarten zu identifizieren und sichtbar zu machen. Mittels der im Fonds Pierre Bourdieu, in der Humathèque am Campus Condorcet (Aubervilliers); Grand équipement documentaire – so die offizielle Adresse des Bourdieu-Archivs – bei eigenen diversen Recherchen identifizierten thematisch relevanten Quellen, wurden verschiedene besonders signifikant und relevant erscheinende Manifestationen kollektiven Forschens ausgewählt, um diesen für Bourdieus Werdegang kennzeichnenden Typus wissenschaftlichen Arbeitens beispielhaft so detailliert und anschaulich wie möglich vor Augen zu führen. Hierbei wurden die aus der Dokumentenanalyse von Archivquellen stammenden Informationen und Einblicke mit den Berichten aus mündlichen Quellen und eigenen persönlichen Erfahrungen so kombiniert und verdichtet, dass sich dabei in einem gewissen Sinne soziologische »Milieustudien« zu den jeweiligen Figurationen kollektiver Praxis herauskristallisieren lassen. Diese Milieustudien werden dann mit Erläuterungen zum jeweiligen soziohistorischen Kontext, institutionellen Anbindungen und Arbeitsbedingungen, alltagsweltlichen Rahmenbedingungen oder Erläuterungen von Gruppendynamiken und persönlichen Beziehungen, wie auch Konflikten innerhalb der verschiedenen Forschungswerkstätten ergänzt.
Hierbei werden wir die Plausibilität von Metaphern an den analysierten konkreten Fallbeispielen prüfen, die Bourdieu zur Selbstbeschreibung seiner Rolle im Verhältnis zu seinen Mitarbeitenden verwendete – nämlich »Coach«, »Dirigent« und »Regisseur«.
In die dichte Beschreibung der spezifischen »Kultur« kollektiven Forschens fließen eine Vielzahl unterschiedlichster Aspekte ein, die für eine soziologische Untersuchung der Forschungspraxis von Relevanz sind. Es geht um Fragen der Emanzipation von sogenannten »Gatekeepern« im wissenschaftlichen Feld und um die Aneignung von Produktionsmitteln für autonomes Schaffen wie im Falle der 1975 gegründeten Revue Actes de la recherche en sciences sociales (ARSS, im Folgenden Actes genannt) und deren spezieller Status als Privatbesitz Bourdieus. Weiterhin geht es um die Erfindung und Durchsetzung von Alleinstellungsmerkmalen im Feld der französischen Soziologie, die riskante Abwendung von einer akademisch-disziplinierten Präsentation von Forschungsergebnissen, die sukzessive Schaffung eines internationalen Netzwerks qua Kooptierung von Autoren (s. hierzu: Bourdieu-Archiv1), oder die Hervorbringung eines kollektiv geteilten Stils und einer gemeinsamen konzeptuellen Toolbox.
Forschung als kollektive Praxis: Perspektivenwechsel auf Werk und Wirken Bourdieus2
Die Idee, dass Forschen grundsätzlich als eine kollektive Praxis zu verstehen ist und Forschungsarbeit faktisch weit mehrheitlich als sozial organisierter Prozess geschieht, dürfte für Naturwissenschaftler so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche sein. In den Geistes- und Sozialwissenschaften hingegen ist diese Einsicht aufgrund der weit verbreiteten Verwechslung von Geistesarbeit mit Forschen bzw. von Theoriearbeit mit Forschungsarbeit keineswegs selbstevident.
So kommt es wohl auch, dass eine so herausragende Figur des wissenschaftlichen und intellektuellen Lebens wie Pierre Bourdieu primär auf das mit seiner Signatur versehene Werk reduziert wird, und die Vorstellung von einem irreduzibel singulären Autor und Produzenten wissenschaftlicher Erkenntnisse vorherrscht.
Wie wir mit unserer hier vorgelegten soziobiografischen Rekonstruktion kollektiver Forschungspraxis bei Bourdieu zeigen wollen, widerspricht diese dem sich hartnäckig haltenden Mythos vom singulären Autor und dem damit verbundenen Geniekult und der realen alltäglichen Arbeitswelt sowie der -praxis der Forschenden aller Disziplinen. Doch erschöpft sich dieses Phänomen eines herausragenden Sozialforschers und Intellektuellen denn wirklich auf das gedruckte Werk des Autors? Was geht diesem jeweils an vielfältigen Aktivitäten voraus? Ist es tatsächlich immer der Autor im Singular, nur weil das veröffentlichte Werk überwiegend seine Signatur trägt? Müsste man nicht eher auch den Blick auf die spezifische Praxis Bourdieu’schen Forschens, Vermittelns und Wirkens richten, und dies umso mehr, als er ja mit seinem praxeologischen Ansatz immer wieder die gesellschaftliche Genese, Dynamik und Einbettung von »Werken«, z.B. in Literatur oder bildender Kunst, betonte? Wie Bourdieu oft – dabei Marx paraphrasierend – feststellte, verkehren Texte ohne ihre Kontexte und werden bei der grenzüberschreitenden Rezeption aus ihrem spezifischen soziohistorischen und kulturellen Zusammenhängen, in denen sie entstanden und eingebettet sind, herausgelöst. Durch diese Dekontextualisierung gehen konkrete Bezüge und Intentionen verloren, verändern sich Konnotationen und verschieben sich Akzente von Stellungnahmen, die jeweils aus einer spezifischen Konfiguration des Feldes und einer bestimmten politischen Konjunktur heraus zustande kamen.
Mehr noch: Mit seinem posthum erschienenen »Soziologischen Selbstversuch« hat Bourdieu ja persönlich seine eigene »soziobiografische« – was gerade nicht mit autobiografisch verwechselt werden darf! – Objektivierung unternommen und einen Beitrag zum Verständnis seiner eigenen sozialen Möglichkeitsbedingungen vorgelegt. In diesem Selbstversuch wird an verschiedenen Stellen, allerdings jeweils nur in aller Kürze und für Vertraute des französischen Feldes der Soziologie wirklich identifizierbar und nachvollziehbar angesprochen, für welche Form kollektiver Vernetzung und Kooperation der Name Bourdieu steht.
Aus der Ferne, bei geringer Vertrautheit mit diesem sozialen Feld und fehlenden Informationen und Einblicken in dessen Strukturen und Funktionsweisen, ist jedoch eine adäquate soziologische Objektivierung und Verortung der wissenschaftlichen Praxis Bourdieus kaum möglich. So ist z.B. die für die Entwicklung seines kollektiven Ansatzes seit den 1960er Jahren prägende enge Zusammenarbeit einer kleinen Gruppe gleichgesinnter junger Forschender, Dissidenten gegenüber dem etablierten Mainstream der französischen Soziologie sowie auch gegenüber der sich schon anbahnenden globalen Hegemonie US-amerikanischer Theorie, trotz Hinweisen in Bourdieus Werk und Aussagen in thematisch einschlägigen Interviews in ausländischen Studien und Medien weitgehend noch Terra incognita geblieben. Auch die Namen der so wichtigen Wegbegleiter Bourdieus wie Jean-Claude Passeron, Abdelmalek Sayad oder Claude Chamboredon haben – sieht man einmal von Luc Boltanski ab – als eigenständige Persönlichkeiten jenseits des »Anhängsels« Eingang in die ausländische Rezeption der Bourdieu’schen Soziologie gefunden, obwohl sie bei gemeinsamen Publikationen eigentlich gut sichtbar werden. Auch dieser blinde Fleck dürfte zum guten Teil einer Rezeptionslogik geschuldet sein, die dazu tendiert, singulären Genies zu huldigen.
Schließlich ist auch das Flaggschiff dieses sozialwissenschaftlichen Kollektivs rund um Bourdieu, die Zeitschrift Actes de la recherche en sciences sociales, deren Gründung im Jahre 1975 in jeder Beziehung eine bahnbrechende Innovation kollektiver sozialwissenschaftlicher Produktionsformen repräsentierte, aufgrund fehlender deutschsprachiger Quellen und schwierigem Zugang zum Feld der französischen Soziologie weitgehend ignoriert geblieben. Wenn in diesem Band ein Tour d’ Horizon ausgewählter soziobiografischer Konstellationen kollektiven Forschens rund um Bourdieu geboten wird, dann eben nicht primär, um die Neugier an einer herausragenden Figur der Sozialwissenschaften zu befriedigen. Vielmehr ist die Frage nach der sozialen Einbettung dieser Soziologie, deren alltägliche Praxis, Bourdieus Rolle als wissenschaftlicher Entrepreneur und die Existenz eines beachtlichen Netzwerkes an engen Kooperationen gerade deshalb von Bedeutung, weil diese Rahmenbedingungen seines Schaffens und Wirkens diesseits des Rheins auch bei den Rezipierenden seiner Theorien und Forschungen weitgehend unbekannt geblieben sind und man in der Regel mit dem Namen Bourdieu eben nur das Werk eines singulären Forschers und Autors identifiziert. Dies war er zwar auch, aber es gibt daneben noch eine andere Seite des »Phänomens« Bourdieu, die es zu erhellen und zu thematisieren gilt, wenn man dieses adäquat verorten und einschätzen, vielleicht sogar soziologisch »objektivieren« will.
Ähnlich wie die visuelle Soziologie Bourdieus aus den Zeiten seiner ethnografischen Feldforschungen in Algerien, die trotz ihrer Präsenz in seinen Publikationen – man schaue sich hierzu die Titelseiten seiner verschiedenen Algerienstudien an – bis nach seinem Tod unbeachtet und bei der Wahrnehmung seines Werks unberücksichtigt blieben, wurde der Umstand, dass der Name Bourdieu von Anfang an für ein kollektives Unternehmen stand, bei dem eine Vielzahl von Akteuren in wechselnder Zusammensetzung über mehrere Jahrzehnte aktiv waren, bei der Rezeption seiner Soziologie weitgehend ignoriert (vgl. hierzu Schultheis et al. 2022, 2023a & 2023b).
Wenn Bourdieu in immer neuen Variationen des gleichen Themas auf den unweigerlich und unverzichtbar kollektiven Charakter der Hervorbringung von »Werken« verweist, gilt dies eben nicht nur für die Sphäre der Kunst, in der die sozialen Möglichkeitsbedingungen ihres Entstehungsprozesses systematisch durch die Überhöhung der Signatur eines vermeintlich irreduzibel singulären Schöpfers verschwiegen bzw. verschleiert werden. Auch in der Wissenschaft als gesellschaftliche »Praxis« zeigen sich ähnliche tote Winkel beim Rückblick auf Entstehungsprozesse von Werken und die bei ihnen zur Geltung kommenden genealogischen und interdependenten Beziehungen zwischen einer Vielzahl an Akteuren. Dies umso mehr, wenn es sich wie im Falle Bourdieus, um einen Forscher handelt, der über mehr als vier Jahrzehnte hinweg seine Theorie der sozialen Welt in empirische Feldforschung gründete und aus ihr heraus entfaltete, und dies in kontinuierlicher und intensiver Teamarbeit und enger Kooperation mit Mitarbeitenden.
Bei einem solchen Blick auf wissenschaftliche Praxis soll die mit dem Namen Bourdieu verbundene Anerkennung seiner herausragenden Rolle in nichts geschmälert, sondern ganz im Gegenteil, eine Gewichtsverlagerung bei der Einschätzung dieser Bedeutung vollzogen werden. Bourdieus soziologische »Kunst« bestand vielleicht gerade in seiner bemerkenswerten Fähigkeit als Trainer eines Teams ein kontinuierliches kollektives Brainstorming zu initiieren und zu animieren. Da er selbst betonte, dass er hauptsächlich beim Sprechen dachte und wohl deshalb auch immer eine Gruppe als Resonanzboden benötigte, wurde kollektives Forschen für ihn zu einer habituell angelegten und selbstverständlich erscheinenden Praxis. Diese Praxis verstand er so überzeugend mehreren Generationen von Nachwuchsforschenden zu vermitteln bzw. zu übertragen, dass sie ihnen selbst nach und nach zum Habitus wurde.
Vorgehen unserer Rekonstruktion
In den vier Jahrzehnten seines Forschens hat Bourdieu eine unglaubliche Zahl an Projekten zu einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Feldern und Themen produziert. Man hat also im Hinblick auf unser Vorhaben nun die Qual der Wahl und muss zwangsläufig aus dieser Fülle eine Selektion vornehmen, die wohl unweigerlich auch subjektiven Interessen und Vorlieben gehorcht. Dennoch wird hier der Versuch gemacht, diese Auswahl an bestimmten systematisch nachvollziehbaren Kriterien auszurichten und zu begründen.
Da hier eine auch nur annähernd flächendeckende und komplette Präsentation der kollektiven Forschungen Bourdieus schlicht nicht möglich ist – sie wäre bei jeglichem Versuch dazu verdammt, nur steckbriefartig und stenografisch einen lediglich oberflächlichen Eindruck zu vermitteln –, gehen wir hier nach folgenden Prinzipien vor: Entgegen der für das Genre der »Biografie« üblichen Praxis, entlang den einzelnen Etappen des Lebenslaufs und seinen wichtigen Wegmarken chronologisch und personenfixiert zu verfahren, beginnen wir nicht – wie vielleicht erwartbar – mit dem Kapitel »Familiensoziologie bei den Bourdieus«, deren Spuren bis in die Jugendzeit Bourdieus zurückreichen, sondern wenden uns zuerst einer langfristigen Forschungspartnerschaft Bourdieus mit den Vertretern des Statistischen Amtes Frankreichs zu, die schon Ende der 1950er Jahre beginnt und über Jahrzehnte in immer neuen Forschungen zur Geltung kommt.
Parallel zu ihr und in ihrem Fahrwasser beginnt die langjährige Zusammenarbeit mit seinem Schüler an der Universität von Algier, dann Assistenten und engen Freund sowie Kollegen Abdelmalek Sayad, die unter dem Titel »Gemischtes Doppel bei einer transmediterranen Ethnographie« rekonstruiert wird. Danach folgt eine wohl etwas überraschende Beschäftigung mit der bei den Bourdieus zuhause in Béarn betriebenen Forschungen im Familienverband, bei der sich neben Vater und Mutter dann auch Bourdieus frisch angetraute Frau Marie-Claire beteiligte. Punktuell wird auch Sayad mit von der Partie sein. Es folgt eine ausführliche Beschäftigung mit dem in den frühen 1960er Jahren von Raymond Aron gegründeten Centre de Sociologie Européenne, dessen unglaublich vielfältige Forschungsaktivitäten an einer kleineren Auswahl von Projekten illustriert und rekonstruiert werden. Diese Auswahl orientiert sich nicht in erster Linie an der Bedeutung, die den Forschungen in der Rezeption beigemessen wurde, sondern vielmehr an ihrer jeweiligen Relevanz für unser Thema »kollektives Forschen«. Im Zentrum stehen hier bildungssoziologische und kultursoziologische Forschungen, die ja auch zum Markenzeichen des Centre wie auch Bourdieus selbst werden sollten.
In besonderer Weise wird einem Projekt Aufmerksamkeit zuteil, das unter Leitung Bourdieus von seinen Mitarbeitern Boltanski und Chamboredon unter größten praktischen Schwierigkeiten durchgeführt werden musste und deshalb auch nie wirklich abgeschlossen wurde. Dennoch findet sich im Archiv ein ausgesprochen spannender, jedoch bisher unveröffentlichter Bericht mit dem Titel La banque et sa clientèle, mit dem wir uns in einem eigenen Kapitel ebenfalls ausführlich beschäftigen wollen. Es folgt daraufhin, ähnlich wie in der vorausgehenden Studie, eine historisch bis in die Zeit der Gründung 1975 zurückreichende und ausführliche Beschäftigung mit Bourdieus Zeitschrift Actes, die dem Forscherkollektiv eine autonome Tribüne bietet und kollektives Forschen von da an in ganz neuen Dimensionen ermöglicht.
Darauf folgt eine kritische Auseinandersetzung mit einer fast zehnjährigen Phase der Abkehr Bourdieus vom kollektiven Arbeiten und einer Hinwendung zum eigenen Schreibtisch in der Rolle des singulären Autors, der jedoch systematisch auf die Früchte kollektiver Arbeit rekurriert. Mit dem aufwändigen Projekt La misère du monde (1993) wird dann ein Musterbeispiel kollektiven Forschens rekonstruiert und im Hinblick auf die Arbeitsteilung und Bourdieus Rolle als »Coach« des Forscherteams durchleuchtet. Hierbei kommt noch ein weiteres Interesse an der soziobiografischen Rekonstruktion zur Geltung, denn es lassen sich anhand dieses Projekts Kontinuitäten des beharrlichen Abarbeitens an Fragestellungen nachvollziehen, die von den frühen Algerienstudien zum Thema »Ethos und Kredit« über die Studien »Die Bank und ihre Kundschaft« und zur »Der Einzige und sein Eigenheim« bis hin zu »Das Elend der Welt« führen. Es folgt unter dem Titel »Wissenschaft im Werden« eine Auseinandersetzung wiederum mit Bourdieus Rolle als »Coach«, diesmal allerdings einer soziologischen Lehr-Werkstatt, bei der es darum geht, die von Bourdieu meisterlich beherrschte Transmission von praktischer wissenschaftlicher Kompetenz an die Adresse von Nachwuchswissenschaftlern vor Augen zu führen. Auch dies stellt eine wichtige, oft vernachlässigte Variante kollektiven Forschens dar.
Schließlich folgen Präsentationen einiger Forschungsprojekte aus den späten 1990er Jahren, die nach einem allmählichen Rückzug Bourdieus aus teammäßigen Forschungen und einer Konzentration auf die Arbeit am kollektiven Produktionsmittel Actes hin zu einem Fokuswechsel auf eigene monografische Publikationen als – leider mehr oder minder misslungener – Versuch eines Revivals kollektiven Forschens angesehen werden müssen. Drauf folgt schließlich eine Skizze eines Vorhabens Bourdieus für eine großangelegte kollektive europäische Forschung zu seinem zentralen Forschungsthema der Bildungssoziologie, das leider durch seinen Tod kurz nach Beginn dieser Arbeiten verhindert wurde.
Über seinen Tod hinaus verweist das letzte Kapitel unter dem Thema »Was machen mit Bourdieus Erbe?« auf das ambitionierte Forschungsnetzwerk ESSE, das im Projekt »Für einen europäischen Raum der Sozialwissenschaften« Formen der Fortführung des mit Bourdieu begonnenen Experimentierens mit einem spezifischen realutopischen Ideal kollektiven Forschens präsentierte.
1Für eine Recherche im Bourdieu-Archiv an der Humathèque auf dem Campus Condorcet in Paris sei auf die Online-Rechercheplattform https://archives.humatheque-condorcet.fr verwiesen, wo unter dem Register Recherche générale dans les fonds de Pierre Bourdieu gesucht werden kann. Sämtliche Verweise auf das Bourdieu-Archiv in dieser Publikation basieren auf vorhergehenden Archivsichtungen und beziehen sich auf dort physisch vorliegende Materialien.
2Die folgenden Passagen stammen primär aus Schultheis (2019) – deren Lektüre nicht vorausgesetzt werden kann. Sie sind jedoch für ein Verständnis der Intentionen der vorgelegten Analyse wichtig.
2.Bourdieu und die Statistiker des INSEE:Ursprung und Dynamik eines außergewöhnlichen Forscherkollektivs
Mittlerweile dürfte hinreichend bekannt sein, auf welchen Wegen der junge Bourdieu, frisch an einer Pariser Elitehochschule in Philosophie gekürt, als einfacher Soldat im kriegsgeschüttelten Algerien der antikolonialen Befreiungskämpfe landete. In meinen eigenen Beiträgen zu diesen biografischen Rekonstruktionen legte ich bisher den Akzent auf die stark autodidaktisch geprägte Selbstinitiation Bourdieus in die Techniken und Methoden der ethnografisch-soziologischen Feldforschung, wie auch sein autonomes und interdisziplinär orientiertes Selbststudium hinsichtlich der von ihm schon 1958 vorgelegten Studie zur »Soziologie Algeriens«. Diese Version der Erzählung unterstreicht eine zentrale Achse bei der Genese des für Bourdieu kennzeichnenden wissenschaftlichen Habitus und seiner sich lebenslang fortsetzenden soziologischen Praxis verstehender Soziologie auf der Basis qualitativer Forschungsmethoden.1
Verschwiegen wurde dabei nicht das für diese algerischen Lehrjahre auch sehr wichtige Zusammentreffen mit Vertretern des INSEE2, des Statistischen Amtes Frankreichs, jedoch wurde dieses nicht angemessen gewürdigt. Dieses markierte nämlich den Ausgangspunkt einer langfristig prägenden und bis zu Bourdieus Tod in vielfältigen Konstellationen niederschlagenden engen Zusammenarbeit mit Statistikern dieser Institution. Was das Vorgehen unserer soziobiografischen Rekonstruktion betrifft, so hätte es einerseits nahegelegen mit dem familialen Kontext der Annäherung Bourdieus an soziologische Fragen zu beginnen, bietet doch die Herkunftsfamilie in chronologisch-biografischer Hinsicht die früheste praktische Erfahrung. Wie später dargelegt werden soll, gab es zwar schon beim jugendlichen Pierre Familiengespräche mit soziologisch anmutenden Inhalten, diese wurden jedoch erst zu einem tatsächlich an echten Forschungen beteiligten Austausch mit den Eltern nach seiner Rückkehr aus Algerien, wo ja das kollektive Forschen mit den Vertretern des INSEE vorausgegangen war. In chronologischer Hinsicht wäre es auch denkbar, mit der sich auch schon Ende der 1950er Jahre entwickelten engen Zusammenarbeit mit Abdelmalek Sayad zu beginnen, da wir dieser aber schon in einer früheren Studie den erwähnten Vorrang gegenüber der sich parallel anbahnenden Kooperation mit dem INSEE eingeräumt hatten, soll hier diese vernachlässigte Thematik den Anfang bilden. Nun, wo wir in dieser Studie unter dem Thema »Forschen mit Bourdieu« gezielt der Frage nach den für dessen Werk und Wirken prägenden sozialen Netzwerken fragen, sollen die algerischen Lehrjahre Bourdieus also aus einer anderen, die bisherigen Erzählungen ergänzenden Perspektive berichtet werden.
Hierbei verfolgen wir die These, dass sich die für Bourdieus Blick auf die Sozialwelt so kennzeichnende reflexive Distanz von ihrer Genese her genau am Schnittpunkt dieser beiden Stränge – autodidaktisch erlernte ethnografischer Feldforschung mit vielfältigen qualitativen Forschungsmethoden hier und streng nach kodifizierten statistischen Methoden verfahrenden Erhebungen dort – festmachen lässt. Und zwar gehen wir davon aus, dass Bourdieu von Beginn an im Verhältnis eines critical friend zur beruflichen Praxis seiner Kollegen vom INSEE stand. Die von ihnen verwendeten Kategorien der empirischen Registrierung, Klassifikation und Repräsentation von Tatbeständen, die sie aus ihrer beruflichen Praxis im französischen Mutterland mit ins kolonialisierte, immer noch in vormodernen Strukturen verhaftete Algerien importierten und bei dortigen Erhebungen standardisiert einsetzten, wurden von Bourdieu auf ihre vermeintliche Evidenz hin radikal hinterfragt.
Aber kommen wir zuerst einmal auf die Umstände des Zusammentreffens zweier unterschiedlicher wissenschaftlicher Praxen und Habitus zu sprechen.
Begegnungen in einem soziologischen Laboratorium
Nachdem Bourdieu die Zeit seines Wehrdienstes in einer Amtsstube der französischen Armee maßgeblich damit zubrachte, die erwähnte »Soziologie Algeriens« zu verfassen, bot sich ihm die Möglichkeit an der Faculté d’Alger zu unterrichten. Hier traf er auf einen algerischen Studenten namens Abdelmalek Sayad, mit dem er bis zu dessen Tod im Jahre 1998 eine enge Freundschaft und Zusammenarbeit pflegte. Die mit Sayad unternommenen Formen kollektiven Forschens sollen später im Detail und in ihrem eigenen Stellenwert gewürdigt werden.3
Eine kleine Gruppe junger Statistiker aus Frankreich, die bei der Statistique générale de l’ Algérie in der Rue Bab-Azoun in Algier angestellt waren, bemühte sich um die Wiederaufnahme systematischer wissenschaftlicher Arbeiten über die algerische Gesellschaft. Zu dieser Zeit führten sie im Auftrag der Association pour la Recherche Démographique, Économique et Sociale (ARDES), finanziert von der Caisse de Développement de l’ Algérie, diverseErhebungen durch. Sie eröffneten Bourdieu auf sehr unbürokratische Weise die Möglichkeit, sich an diesen Studien zu beteiligen und sich dabei mit einer immer weiter elaborierten und verfeinerten eigenen sozialwissenschaftlichen Perspektive einzubringen. Insbesondere mit Alain Darbel knüpfte Bourdieu schon früh freundschaftliche Beziehungen. Dieser hatte die Pariser École d’ application de l’ Insee (heute ENSAE) absolviert und hier, wie mir Claude Seibel, der ebenfalls Mitglied dieser Gruppe war, im Jahre 2007 anlässlich einer Tagung in Algier in einem Gespräch erläuterte, starke Affinitäten mit soziologischem Denken und Forschen entwickelt. Wie ich selbst bei einer Studie zur Rolle des INSEE bei der Entwicklung der französischen Sozialstrukturforschung, unter anderem in Zusammenarbeit mit Luc Boltanski und Laurent Thévenot, in den 1990er Jahren immer wieder feststellen konnte, teilten sie diese Affinität zur Soziologie mit vielen anderen ihrer Kollegen. Dies lässt sich nicht zuletzt durch die für sie typische Ausbildung an der durchaus elitären Grande École für Statistik – der ENSAE – erklären, wo, wie später noch erläutert wird, Soziologen wie Bourdieu Kurse in Methodologie und Sozialtheorie gaben.
Der von vielen Gesprächspartnern beim INSEE an den Tag gelegte Anspruch selbst aktive sozialwissenschaftliche Forschung – von der Demografie, über Sozialstrukturanalyse bis hin zu makroökonomischen Fragen – zu betreiben und zu publizieren, gepaart mit einem deutlich demonstrierten intellektuellen Gestus, stach deutlich von dem Habitus ab, der beim Statistischen Amt Deutschlands in Wiesbaden anzutreffen war. Hier traf man primär auf Juristen, Mathematiker und Ökonomen, welche die öffentliche Statistik »verwalteten«, anstatt sie, wie ihre französischen Kollegen, zu »gestalten«.
Die Freundschaft zwischen Bourdieu, Darbel und Seibel jedenfalls sollte sich auch in langjährigen Kooperationen und gemeinsamen Publikationen wie etwa »Die Liebe zur Kunst« (1966) niederschlagen.
Um die sich in Algerien anbahnende nachhaltige und intensive Beziehung zwischen offizieller Statistik à la francaise und der Soziologie Bourdieus zu kontextualisieren und (sozio-)biografisch nachvollziehbar zu machen, empfiehlt es sich an dieser Stelle, einen kleinen Exkurs zu unternehmen und die sich schon in den 1950er Jahren abzeichnenden Wahlverwandtschaften transparent zu machen. Hier wird dann nachvollziehbar, inwieweit Bourdieus Wege in die Soziologie und die von ihm eingeschlagene Verknüpfung qualitativer Sozialforschung mit quantitativer Methodik und statistischen Datensätzen schon durch die Besonderheiten einer soziologisch geprägten öffentlichen Statistik Frankreichs vorgespurt war.
Auf dem Wege zu einer soziologienahen öffentlichen Statistik4
Fragt man nach den Bedingungen, die die hier rekonstruierte enge Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Statistik und der dezidiert gesellschaftskritischen Soziologie Bourdieu’scher Prägung ermöglichten, stößt man unweigerlich auf die charakteristische Art und Weise, wie das INSEE soziale Strukturen und gesellschaftliche Tatbestände jeglicher Art abbildete – von familiärer Reproduktion über Konsumstile bis hin zu kulturellen Aktivitäten. Zentral hierfür war ein 1954 entwickeltes System sogenannter »sozioprofessioneller Kategorien«, das in gewissem Sinne bereits die später für Bourdieu so prägende Praxis der Analyse gesellschaftlicher Phänomene anhand ihrer Stellung in einem bi-dimensionalen und hierarchisch konzipierten Sozialraum vorwegnahm. Die für die deutsche Statistik seit Bismarcks Institutionalisierung der Sozialversicherung charakteristischen Kategorien der »Stellung im Beruf« – insbesondere entlang der Achse »selbständig-unselbständig« –, wurde bei einer Reform der französischen Statistik mit jenen der »Stellung im Betrieb« kombiniert, und diese wiederum mit der empirisch belegten relativ starken Korrelation von Qualifikations- und Einkommensniveaus verknüpft. Man erinnere sich hier an die von Bourdieu entwickelten unterschiedenen Achsen des Sozialraums, nämlich ökonomisches Kapital auf der einen und kulturelles Kapital (gemäß dem höchsten erreichten Bildungsabschluss) auf der anderen.5
Die im Jahre 1954 vom Nationalen Statistischen Amt Frankreichs (INSEE) erstmals bei einer Volkszählung eingesetzte Klassifikation nach sozio-professionellen Kategorien wurde drei Jahre zuvor von einem Mitarbeiter des INSEE (Jean Porte) entwickelt und war von ihm zunächst nur für einen hausinternen und limitierten Gebrauch geplant. Porte stellt in einem Artikel aus dem Jahre 1961 retrospektiv hierzu fest, er habe schlicht eine leicht handhabbare, pragmatische Klassifikation der französischen Bevölkerung für Zwecke der Marktforschung und Wirtschaftsplanung gesucht, und –wie er meinte – mit den Catégories socio-professionnelles auch tatsächlich gefunden. Deren Güte bemaß sich für ihn allein am Umstand, ein hohes Maß an relevanten Korrelationen einer Vielzahl sozialer Merkmale und Verhaltensweisen der gebildeten Gruppen zu erreichen. Seine Klassifikation sei schlicht »empirisch« orientiert, ohne sich an einer expliziten theoretischen Position auszurichten. Außerdem, so schreibt Porte, sei dieses Klassifikationssystem »grob« und notwendigerweise unperfekt, denn er habe natürlich nicht alle denkbaren alternativen Feingliederungen ausprobiert, sondern die gewählt, die ihm am »geeignetsten« erschien.11
Was Porte mit dem Hinweis auf die »empirische« Orientierung seines Modells – man spricht heute von einem système empirique raisonné, also einem »theoriegesättigten empirischen Modell« – betonen wollte, ist, dass es unabhängig von den zu seiner Zeit vorherrschenden marxistischen Klassenmodellen entwickelt wurde, zu denen Porte als deklarierter Anarcho-Syndikalist auf Distanz ging. Wie dem auch sei, das Klassifikationssystem Portes’ erlebte ab dem Jahre 1954 einen erstaunlichen Siegeszug. Zunächst wurden die Ergebnisse der Volkszählung nach diesen Kategorien aufgeschlüsselt und präsentiert, dann folgten eine Vielzahl großangelegter repräsentativer Studien anderer Forschungseinrichtungen wie jene zur differentiellen Mortalität und Natalität seitens des Institut National d’ Études Démographiques (INED).
Besonders wichtig für diesen Diffusionsprozess waren des Weiteren die französischen Massenmedien, die die vom INSEE produzierten Analysen klassenspezifischer Konsum- und Freizeitgewohnheiten, Einkommens- und Vermögenslagen, Bildungschancen und kulturellen sowie religiösen Praktiken millionenfach reproduzierten. So entstand in den nachfolgenden Jahrzehnten in Frankreich durch sukzessive Forschungen auf der Basis eines kohärenten Sozialstrukturmodells eine ausgefeilte Sozialtopografie, die empiriegesättigt den gesellschaftlichen Raum entlang den in den »CSP« vorgegebenen sozialen Grenzziehungen bis in die feinsten Schattierungen kolorierte. Diese Art der Sozialtopografie hat mit den seit den 1960er Jahren regelmäßig publizierten Données Sociales, das in etwa dem Pendant (wenn auch sehr verschieden) der deutschen »Gesellschaftliche Daten« bzw. des »Datenreport« entspricht, sogar eine Art eigenen offiziellen soziologischen »Atlas« gefunden, der sich einer erstaunlichen Breitenwirkung erfreut. Von gruppenspezifischen Formen der Partnerwahl bis hin zur Verteilung von Familientypen und Disparitäten beim Schulerfolg, von der Verteilung des Wohnraums oder der Präferenz für Katze oder Hund als Haustier, bis hin zur sozialen Zusammensetzung der Wohnbevölkerung bestimmter Stadtgebiete, bieten die Données Sociales ein ganzes Arsenal spannender sozialstatistischer Befunde an.
Aufgrund dieser enormen Zusammenschau soziologisch relevanter Sachverhalte hat sich das Klassifikationsmodell des INSEE zu einer Art »Apriori« der Repräsentation sozialer Wirklichkeit in Frankreich entwickelt, welches dann ab den 1960er Jahren dank der sozialtheoretischen Untermauerungen und den breit gefächerten empirischen Demonstrationen Bourdieus noch stark an Stringenz und Kohärenz gewinnen sollte. Letzterer war ab 1964, als er begann an der Hochschule für Statistik des INSEE zu unterrichten und viele Mitarbeitende der Öffentlichen Statistik in seinen Bann zog, an der Weiterentwicklung der CSP selbst aktiv beteiligt. Wie Seibel (2004) berichtet, wurden mehrere Generationen von Statistikern und Ökonomen während ihrer Ausbildung an der ENSAE mit der von Bourdieu speziell für diesen Zweck entwickelten Textsammlung Morceaux choisis pour une introduction à la sociologie (Ausgewählte Texte zur Einführung in die Soziologie) konfrontiert, die dann 1968 als Grundlage für die gemeinsam mit Jean-Claude Chamborédon und Jean-Claude Passeron unter dem Titel Le métier de sociologue herausgegebene Einführung in die epistemologischen und methodologischen Grundlagen der Soziologie dienen sollte.
Beide Seiten dieser engen Kooperation zwischen öffentlicher Statistik und Soziologie dürften wohl gleichermaßen hiervon profitiert haben. Man könnte sagen, dass aufgrund der ausgeprägt soziologieaffinen Statistik Frankreichs schon ein gutes Stück des Weges vorbereitet war, den Bourdieu dann mit seinen Kollegen vom INSEE, allen voran Darbel und Seibel, weiter beschreiten sollte.
Um hier auch der Vollständigkeit halber kontrastiv noch kurz auf die vermutlichen »Unmöglichkeitsbedingungen« einer solchen Allianz öffentlicher Statistik und sozialwissenschaftlicher Forschung in Deutschland sprechen zu kommen, sei erwähnt, dass ganz ähnliche Reformpläne auch hierzulande fast gleichzeitig diskutiert, jedoch nie realisiert wurden.
Die im Jahre 1954 in Frankreich vollzogene Totalrenovation der offiziellen Sozialstatistik und ihrer sozio-professionellen Taxonomie kann durchaus als eine kleine Revolution im Bereich der gesellschaftlichen Repräsentation soziostruktureller Tatbestände angesehen werden, die im Übrigen auch in Deutschland zur gleichen Zeit »in der Luft« lag.
Ich zitiere im Folgenden, als eine von vielen Quellen, eine Rede des Oberregierungsrates Zopfy vom Bayrischen Statistischen Landesamt aus dem Jahre 1955, gehalten vor der 26. Jahresversammlung der Deutschen Statistischen Gesellschaft in Augsburg. Zopfy setzt sich in seinem Referat kritisch mit der statistischen Erfassung des Berufs und der Stellung im Beruf im Hinblick auf ökonomische, vor allem aber auf soziologische Untersuchungen auseinander. Er beklagt, dass die Kategorien der Stellung im Beruf fälschlicherweise und mangels stringenterer Kategorien als soziale Stellungen missverstanden würden und unterstreicht weiter wörtlich: »Sein Wert (das Merkmal ›Stellung im Beruf‹) ist infolge seiner Primitivität für subtilere Untersuchungen sehr fragwürdig.« (Schultheis et al. 1996, 47)
Daraufhin entwirft Zopfy ein Programm einer angemessenen sozialstatistischen Erfassung der sozialen Schichtung der bundesdeutschen Bevölkerung, welches einerseits in bester deutscher Tradition steht – man denke etwa an Geigers Analysen der sozialen Schichtung des deutschen Volkes oder Webers Konzeptualisierung von Klassenlagen – und andererseits noch sehr aktuell ist, da sich ja nun seit Zopfys Rede in der deutschen Berufs- und Erwerbsstatistik nichts bewegt hat.
Wie man weiß, ist dieses Programm tatsächlich auch »Programm« geblieben, und bis zum heutigen Tage verstummt das Klagelied deutscher Soziologen über die Wirklichkeitsferne der deutschen Sozial- und Berufsstatistik nicht mehr, wohingegen die französische Soziologie seit mehr als einem halben Jahrhundert, wenn auch mit entsprechenden Anpassungen, ungebrochen in den CSP ein kollektiv geteiltes Koordinatensystem für die Verortung ihrer Gesellschaft im Sozialraum findet. Der Versuch, diese für die kapitalistische Marktgesellschaft entwickelten Kategorien auf die kolonialisierte traditionelle algerische Gesellschaft zu übertragen, musste allerdings scheitern und genau hier schlug dann die Stunde für Bourdieus und Sayads Kompetenzen in Sachen kritisch-reflexiver Dekonstruktion ethnozentrischer Verkennungen.
Forschen unter Bedingungen kolonialer Herrschaft6
Die Caisse de développement de l’ Algérie stellte den Großteil der für Bourdieus Studien benötigten Mittel zur Verfügung. Ihr Leiter für Studien, Jean-Jacques Boissard, wollte die Infrastrukturprogramme, insbesondere im Bereich des Wohnungsbaus, durch sozioökonomische Erhebungen begleiten, die den Erwartungen der algerischen Bevölkerung, sowohl der einheimischen als auch der europäischen, besser Rechnung tragen würden (vgl. hierzu Seibel 2004).
Aus dieser Zeit stammen eine Volkszählung in Algerien, die Ende 1959 trotz des Krieges durchgeführt wurde sowie zwei Versuche, statistische Verfahren aus dem Mutterland eins-zu-eins zu übernehmen. Nämlich die Beschäftigungserhebung und die Wohnungserhebung. Die Übertragung von statistischen Untersuchungsinstrumenten, die in westlichen Volkswirtschaften entwickelt worden waren, stellte jedoch schnell ein beachtliches Problem dar, da die zugrunde liegenden Konzepte für die Erhebungen (z.B. »Arbeit« oder »Arbeitslosigkeit«), in der traditionellen algerischen Wirtschaft nicht in gleicher Weise relevant waren bzw. an den gelebten ökonomischen und gesellschaftlichen Realitäten vorbei gingen. Genau hier konnte sich Bourdieu schnell nützlich und dann durch die Überzeugungskraft seiner soziologischen Reflexivität und Kritik an ethnozentrischen Verkennungen und damit einhergehenden Missverständnissen mehr und mehr unverzichtbar machen.
Diese sich über vier Jahre hinziehende und nach der Rückkehr nach Paris dann über rund vier Jahrzehnte weiter gepflegte enge Zusammenarbeit mit Kollegen vom statistischen Amt Frankreichs war für Bourdieu in mehrfacher Hinsicht ein enormer Gewinn. Zunächst einmal muss man hier daran erinnern, dass diese Zusammenarbeit unter schwierigsten, ja gefährlichsten Bedingungen der Jahre des algerischen anti-kolonialen Befreiungskrieges stattfand. Während die Beamten des INSEE in offiziellem Mandat ihre Forschungen unter dem Schutz der französischen Armee durchführten, war Bourdieu als Einzelgänger bzw. nur in Begleitung seines algerischen Schülers und später Freunds, Abdelmalek Sayad, für deren Feldstudien unterwegs, und damit beachtlichen Risiken ausgesetzt. Während die INSEE-Statistiker mit einem großzügigen Budget für ihre Studien ausgestattet waren und über die notwendige Logistik für die Reisen in unterschiedliche Gebiete verfügten, hatte Bourdieu nur sein bescheidenes Gehalt als lehrender Assistenzprofessor an der Universität von Algier zur Verfügung. Und im Unterschied zu den verbeamteten Statistikern konnte Bourdieu keinen Ausweis vorzeigen, um seine Rolle als Forscher bei Erhebungen in privaten Haushalten zu legitimieren. Kurzum, indem er sich mit seinen Forschungsinteressen an den rollenden Zug der offiziellen statistischen Erhebungen ankoppelte, kam Bourdieu in den Genuss all dieser Vorzüge.
Aber das war bei Weitem noch nicht alles, was diese Zusammenarbeit ihm an Chancen eröffnete. Parallel zu seinen autodidaktischen Lernprozessen im Bereich ethnografischer Feldforschung und soziologischer Analysen fand Bourdieu in seiner Rolle als ausgebildeter Philosoph Zugang zu Instrumenten, Methoden und Forschungsstrategien quantitativer Provenienz, für die er weder bei seinen Pariser Studien noch durch autodidaktisches Learning on the Job im Feld Zugang gefunden hätte.
Zu den diversen Auftragsstudien von ARDES zählten jene über »Arbeit und Arbeitende in Algerien«, an der Bourdieu maßgeblichen Anteil haben sollte und seine soziologische Herangehensweise als wertvolle Ergänzung für die konventionellen statistischen Arbeiten unter Beweis stellen konnte. Weiter gehörten auch jene über die kolonialen Umgruppierungslager zur Reihe der Auftragsstudien, die sich später in einer, zusammen mit Sayad unter dem Titel Le Déracinement7: La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie (1964), publizierten Monografie niederschlagen sollten. Auch die Forschungen über das Konsumverhalten und die Wohnbedingungen der Algerier, bei denen Bourdieu sich besonders arbeitsintensiv einbrachte, zählten dazu. Wichtig ist es hier, daran zu erinnern, dass Bourdieu und Sayad parallel zu diesen offiziellen Forschungsaufträgen jeweils weitere ergänzende Studien wie z.B. zu Fragen des Konsums der algerischen Familien, ihrer Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit, städtischem Wohnen und vielem anderen mehr durchführten und zwischen den Befunden aus diesen verschiedenen Feldforschungen kontinuierlich Querbezüge herstellten, die sie dann in ihre übergreifenden theoretischen Perspektiven einfließen ließen (Schultheis et al. 2023, 26).
Mit Statistik über die Statistik hinaus: Soziologische Reflexivität am Werk
Gemeinsam mit den Kollegen vom INSEE unternimmt Bourdieu eine repräsentative Erhebung zur Erwerbs- und Wohnsituation in Algerien und lässt sich zusätzlich eine Unterstichprobe von 200 Haushalten ziehen, die er selbst als Grundlage seiner eigenen Untersuchungen benutzt. Er verfügt also über die repräsentativen Daten der Gesamtstichprobe und konnte die eigenen Ergebnisse in diesem Rahmen systematisch verorten. Schon die nach standardisierten Fragen vorgehende erwerbsstatistische Erhebung brachte sehr interessante Einblicke in die unterschiedlichen kulturellen Repräsentationen von Arbeit. Man fragte: »Wie viele Stunden haben Sie gestern gearbeitet? Wie viele Tage während der letzten Woche? Wie viele Wochen im vergangenen Monat?« Und schließlich: »Was ist Ihr Beruf?«8