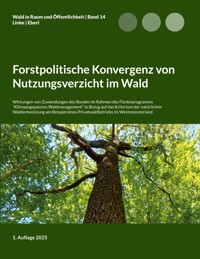
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" ist die erste unmittelbar vom Bund aufgelegte und administrierte forstliche Beihilfe und hat damit forstpolitisch Neuland betreten. Das wirft daher auch zahlreiche forstpolitische, forstrechtliche und forstökonomische Fragen für Wissenschaft und Praxis auf. In der vorliegenden Untersuchung wird das Förderkriterium "Natürliche Waldentwicklung" des Programms "Klimaangepasstes Waldmanagement" anhand des Policy Coherence Frameworks untersucht. Dabei werden die mit dem Programm verfolgten Ziele in Beziehung zu ihrer Umsetzung und den möglichen Outputs gesetzt. Dazu werden zunächst mögliche Auslegungsmöglichkeiten der Förderrichtlinie diskutiert. Dadurch soll ermittelt werden, welche Umsetzungsmöglichkeiten sich für Forstbetriebe ergeben. Auf dieser Grundlage Anwendungsszenarien ausgewiesen und computergestützt simuliert. Die so erzielten Ergebnisse werden analysiert und in Bezug auf betriebswirtschaftliche und ökonomische Wirkung diskutiert. Die Untersuchung liefert damit Erkenntnisse über mögliche Umsetzungspfade des Programms "Klimaangepasstes Waldmanagement" für die weitere Diskussion in Wissenschaft und Praxis. In der Untersuchung wird erstmals die Implementationsebene in die Kohärenzanalyse empirisch mit einbezogen. Für die Annäherung der Umsetzung an das politische Ziel wird der Begriff der Konvergenz eingeführt und erstmals in diesem Zusammenhang verwendet. Die unmittelbaren Wirkungen eines Nutzungsverzichts auf forstwirtschaftlichen Flächen werden in den Kontext nationaler und europäischer Politikinstrumente gesetzt. Daraus werden positive und negative Wechselwirkungen abgeleitet und die Wirksamkeit von Flächenstilllegungen zur Zielerreichung diskutiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Natürliche Waldentwicklung auf 5 Prozent der Waldfläche.
Obligatorische Maßnahme, wenn die Waldfläche des Antragstellers 100 Hektar überschreitet. Freiwillige Maßnahme für Antragsteller, deren Waldfläche 100 Hektar oder weniger beträgt.
Die auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar und ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen.
Naturschutzfachlich notwendige Pflege oder Erhaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen der Verkehrssicherung gelten nicht als Nutzung. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen anfallendes Holz verbleibt im Wald.“
(BMEL, 2022)
Inhaltsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Formelverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Baumartenzuordnung
1 Vorwort
2 Grundlagen der Untersuchung
2.1 Untersuchungsgegenstand
2.2 Verortung im Forschungsprozess
2.3 Hypothesen
2.4 Policy Coherence Framework
3 Rechts- und Politikrahmen der EU
3.1 EU-Vorschriften und Instrumente der Umweltpolitik
3.2 Staatliche Beihilfen auf dem europäischen Binnenmarkt
4 Richtlinie „Klimaangepasstes Waldmanagement“
4.1 Rechtliche Grundlage
4.2 Inhalt der Förderrichtlinie
4.2.1 Zweck der Zuwendung
4.2.2 Kriterienkatalog
4.2.3 Kriterium „Natürliche Waldentwicklung“
4.3 Spezifikationen des PEFC zur natürlichen Waldentwicklung
4.4 Juristische Auslegungsmethodik
4.4.1 Auslegungstheorie
4.4.2 Auslegung der Förderrichtlinie
5 Anwendung der Förderrichtlinie
5.1 Softwaregestützte Waldwachstumssimulation
5.1.1 Simulationssoftware
5.1.2 Aufnahmemethoden
5.2 Beispielbetrieb (anonym)
5.2.1 Betriebsportrait
5.2.2 Betriebliche Zielsetzung und Kriterien zur Flächenauswahl
5.2.3 Methode der prognostischen Kosten-Leistungs-Rechnung
6 Ergebnisse
6.1 Betriebliche Umsetzung
6.1.1 Flächentyp Erlenbruchwald
6.1.2 Flächentyp Eichen-Mischkultur
6.1.3 Flächentyp Fichten-Mischkultur
6.2 Simulationsergebnisse
6.2.1 Bestandesdaten
6.2.2 Strukturdatentabellen
7 Diskussion
7.1 Vereinbarkeit der Flächenausweisung mit den Spezifikationen
7.2 Belastbarkeit der Simulationsdaten
7.3 Bewertung der flächentypenspezifischen Strukturentwicklung
7.4 Konvergenz der betrieblichen Umsetzung mit den Zielen der Förderrichtlinie
7.5 Konvergenz der natürlichen Waldentwicklung mit dem EU-politischen Rahmen
7.5.1 Binnen-Konvergenz der Umweltpolitiken
7.5.2 Externe Konvergenz mit dem EU-Beihilferecht
8 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Rechtsquellenverzeichnis
Anhang
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Forsteinrichtungsdaten der Teilfläche 51 c (AVH Forst, 2020)
Anhang 2: Forsteinrichtungsdaten der Teilfläche 63 d (AVH Forst, 2020)
Anhang 3: Forsteinrichtungsdaten der Teilfläche 79 a (AVH Forst, 2020)
Anhang 4: Bestandesdaten aus der Flächenaufnahme des Bestandes 51 c4
Anhang 5: Bestandesdaten aus der Flächenaufnahme des Bestandes 63 d1
Anhang 6: Bestandesdaten aus der Flächenaufnahme des Bestandes 79 a2
Anhang 7: Zuwachsreduktionsfaktoren
Anhang 8: Prognostische Kosten-Leistungs-Rechnung der Flächentypen innerhalb der Bindefrist der Förderrichtlinie
Anhang 9: Bestandesdaten aus der Simulation des Bestandes 51 c4
Anhang 10: Bestandesdaten aus der Simulation des Bestandes 63 d1
Anhang 11: Bestandesdaten aus der Simulation des Bestandes 79 a2
Anhang 12: Strukturdatentabelle je Flächentyp und Simulationssample
Anhang 13: Stammzahlbasierte Berechnung des Shannon-Wiener-Index und der Evenness des Bestandes 51 c4
Anhang 14: Stammzahlbasierte Berechnung des Shannon-Wiener-Index und der Evenness des Bestandes 79 a2
Anhang 15: Berechnungstabelle zur Ermittlung der maximalen Zuwendungshöhe anhand der Kosten für Kohlenstoff-Emissionszertifikate und der Kohlenstoffbindung auf Waldflächen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zusammenstellung der übergeordneten Ziele des Europäischen Green Deals (Europäische Kommission, 2019, S. 3)
Abbildung 2: Darstellung der schrittweisen Kaskadennutzung des Rohstoffes Holz im Verwendungszyklus (Europäische Kommission, 2021b, S. 23)
Abbildung 3: Die Entwicklung der Biodiversität von Flora und Fauna in Waldökosystemen im typisierten Waldentwicklungszyklus (Adler et al., 2013, S. 2)
Abbildung 4: Baumartenverteilung des Beispielbetriebs nach Baumartengruppen im Untersuchungsrevier zum Stichtag 01.01.2020 (eigene Darstellung nach AVH-Forst, 2020)
Abbildung 5: Altersklassenverteilung des Beispielbetriebs nach Baumartengruppen im Untersuchungsrevier zum Stichtag 01.01.2020 (eigene Darstellung nach AVH-Forst, 2020)
Abbildung 6: Potenzielle Deckungsbeiträge der Flächentypen im Vergleich zur Zuwendungssumme je Hektar (eigene Darstellung)
Abbildung 7: Veränderung des äußeren Bestandesbilds im Bestand 63 d1 durch natürliche Waldentwicklung von 2024 (oben) bis 2044 (unten) (© 2002-2020 NW-FVA)
Abbildung 8: Entwicklung der Baumartenmischung nach Baumartengruppen im Oberstand des Bestandes 63 d1 vom 01.01.2024 (innen) zu 2044 (außen) bei natürlicher Waldentwicklung (eigene Darstellung)
Abbildung 9: Veränderung des äußeren Bestandesbilds im Bestand 51 c4 durch natürliche Waldentwicklung von 2024 (oben) bis 2044 (unten) (© 2002-2020 NW-FVA)
Abbildung 10: Entwicklung der Baumartenmischung nach Baumartengruppen im Oberstand des Bestandes 51 c2 vom 01.01.2024 (innen) zu 2044 (außen) bei natürlicher Waldentwicklung (eigene Darstellung)
Abbildung 11: Veränderung des äußeren Bestandesbilds im Bestand 79 a2 durch natürliche Waldentwicklung von 2024 (oben) bis 2044 (unten) (© 2002-2020 NW-FVA)
Abbildung 12: Entwicklung der Baumartenmischung nach Baumartengruppen im Oberstand des Bestandes 79 a4 vom 01.01.2024 (innen) zu 2044 (außen) bei natürlicher Waldentwicklung (eigene Darstellung)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vergleich der waldwachstumskundlichen Bestandesdaten des Bestandes 63 d1 zum Stichtag 01.01.2024 und nach 20-jähriger natürlicher Waldentwicklung anhand des Simulationssamples 5.5
Tabelle 2: Vergleich der waldwachstumskundlichen Bestandesdaten des Bestandes 51 c4 zum Stichtag 01.01.2024 und nach 20-jähriger natürlicher Waldentwicklung anhand des Simulationssamples 20.3
Tabelle 3: Vergleich der waldwachstumskundlichen Bestandesdaten des Bestandes 79 a4 zum Stichtag 01.01.2024 und nach 20-jähriger natürlicher Waldentwicklung anhand des Simulationssamples 5.4
Tabelle 4: Erhobene Strukturdaten der Flächentypen zum Stichtag 01.01.2024
Tabelle 5: Mittlere Strukturparameter der Flächentypen nach simulierter natürlicher Waldentwicklung über einen Zeitraum von 20 Jahren
Tabelle 6: Bestandes- und Maximalwerte des Baumartenprofilindex (Pretzsch) der Flächentypen zum Stichtag 01.01.2024 und nach simulierter natürlicher Waldentwicklung über einen Zeitraum von 20 Jahren
Formelverzeichnis
Formel 1: Individuelle Zuwendungshöhe pro Hektar mit natürlicher Waldentwicklung des Beispielbetriebs
Abkürzungsverzeichnis
a .......... Jahr
A .......... Baumartenprofilindex
Abs. .......... Absatz
Art. .......... Artikel
BA .......... Baumart
BHD .......... Brusthöhendurchmesser
BHO ..........Bundeshaushaltsordnung
bspw. ..........beispielsweise
BST .......... Bestandessortentafeln
bzw. .......... beziehungsweise
DB .......... Deckungsbeitrag
Df .......... (Alt-)Durchforstung
dg .......... Kreisflächenmittelstamm
dmax .......... Maximaldurchmesser
E .......... Evenness
Efm .......... Erntefestmeter
EU .......... Europäische Union
G ..........Grundfläche
GAP .......... Gemeinsame Agrarpolitik
h100 .......... Oberhöhe
HEK .......... Holzerntekosten
hg .......... Höhe des Kreisflächenmittelstamms
Hs .......... Shannon-Wiener-Index
i.S.d. .......... im Sinne des
i.V.m. ..........in Verbindung mit
JDf .......... Jungdurchforstung
JPf .......... Jungwuchspflege
lit. ..........Buchstabe
LRT .......... Lebensraumtyp
N .......... Stückzahl
NW-FVA .......... Nordwestdeutsche Forstversuchsanstalt
PCF .......... Policy Coherence Framework
S. .......... Satz
SAG .......... State Aid Guidelines
SF .......... Standardfehler
SLH .......... sonstiges Laubholz hoher Lebensdauer
SLN .......... sonstiges Laubholz niedriger Lebensdauer
StAbw .......... Standardabweichung
VarK .......... Variationskoeffizient
Vfm .......... Vorratsfestmeter
VS° .......... Volumenschlussgrad
VwK .......... Verwaltungskosten
WZP .......... Winkelzählprobe
ZRF .......... Zuwachsreduktionsfaktor
Baumartenzuordnung
Bezeichnung im Fließtext
Umfassende Baumart(-en)
Buche
Rot-Buche,
Fagus sylvatica
L.
Eiche
Stiel-Eiche,
Quercus robur
L. Trauben-Eiche,
Quercus petraea
(MATTUSCHKA) LIEBL.
Roteiche
Rot-Eiche,
Quercus rubra
L.
Slawonische Eiche
Quercus robur
L. subsp.
slavonica
(GÁYER) MÁTYÁS
Birke
Hänge-Birke,
Betula pendula
ROTH
Erle
Schwarz-Erle,
Alnus glutinosa
(L.) GAERTN.
Pappel
Zitter-Pappel,
Populus tremula
L. Hybrid-Pappel,
Populus tremula
L.
x tremuloides
MICHX.
Linde
Winter-Linde,
Tilia cordata
MILL.
Hainbuche
Hainbuche,
Carpinus betulus
L.
Kirsche
Vogel-Kirsche,
Prunus avium
L.
Ahorn
Berg-Ahorn,
Acer pseudoplatanus
L.
Ulme
Flatter-Ulme,
Ulmus laevis
PALL.
Fichte
Gem. Fichte,
Picea abies
(L.) H.KARST.
Douglasie
Gew. Douglasie,
Pseudotsuga menziesii
(MIRBEL) FRANCO
Lärche
Europäische Lärche,
Larix decidua
MILL. Japanische Lärche,
Larix kaempferi
(LAMB.) CARRIÈRE
Kiefer
Wald-Kiefer,
Pinus sylvestris
L.
Schwarzkiefer
Schwarz-Kiefer,
Pinus nigra
J.F.ARNOLD
1 Vorwort
Angesichts zunehmender klimatischer Herausforderungen stehen Wälder und Forstwirtschaft unter hohem Anpassungsdruck. Zwischen vielfältigen Nutzungsansprüchen mit teils kollidierenden Zielstellungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik kommt dem Wald als Klimaregulator und Lebensraum weitreichende Bedeutung zu. Als kohlenstoffbindendes Ökosystem soll der Wald im sektorübergreifend Emissionen auffangen und als langfristige CO2-Senke fungieren. Die Erreichbarkeit der Speichermenge wird kontrovers diskutiert. Infolge des Kalamitätsgeschehens konnte der deutsche Wald im Inventurzeitraum 2017 bis 2022 erstmals nicht den Kohlenstoffvorrat erhöhen. Insbesondere der Nutzungsverzicht von Waldflächen wird bezüglich der Speicherwirkung von Kohlenstoff kritisch gesehen.
Die Unterstützung von Waldbesitzenden durch Förderprogramme gewinnt vor dem Hintergrund des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Einerseits sollen durch Klimaänderungen entstehende Schäden an Waldökosystemen finanziell ausgeglichen werden. Andererseits sollen Anreize gesetzt werden, um Wälder klimaresilient zu gestalten und Waldbesitzende für die Ökosystemleistungen ihrer Wälder zu entlohnen, von denen großräumig alle Menschen profitieren. Ein Instrument dazu ist die Forstförderung im Rahmen der „Richtlinie für Zuwendungen zu einem klimaangepassten Waldmanagement“. Ziel der Zuwendung sei neben langfristiger Kohlenstoffspeicherung in Waldökosystemen „der Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Wäldern, die an den Klimawandel angepasst (klimaresilient) sind“ (BMEL, 2022, S. 1).
Mit der Veröffentlichung der Förderrichtlinie wird erstmals eine zielorientierte Vergütung an Waldbesitzende nach dem Stil des Vertragsnaturschutzes ausgezahlt. Die Höhe der Förderung und die Länge der Bindefrist überschreiten dabei vergleichbare Fördermodelle deutlich. Durch das Design der Förderrichtlinie können die Maßnahmen in weitaus größeren Maßstäben auf die deutschen Waldflächen gebracht werden als je zuvor, da die Förderbedingungen einen hohen Zuspruch in Bezug auf Anforderungen und Ausgleichszahlungen erhalten.
Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist die Darstellung einer möglichen Umsetzung der Förderbedingungen durch einen Forstbetrieb. Der Untersuchungsumfang ist auf das Kriterium Nr. 12 der Förderrichtlinie beschränkt, das natürliche Waldentwicklung auf 5 % der Betriebsfläche umfasst. Anhand der betrieblichen Flächenausweisung sollen Effekte der natürlichen Waldentwicklung bis zum Ende der Bindefrist dargestellt werden. Dazu wird eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Flächenausweisung vorgenommen, ertragskundliche Bestandesdaten erhoben und die Bestandesentwicklung mithilfe einer Waldwachstumssoftware simuliert. Notwendige Naturaldaten werden im Dezember 2023 in einem Privatwaldbetrieb im Westmünsterland erhoben.
Die Erkenntnisse der Simulation dienen dem Abgleich mit den Förderzielen der Richtlinie „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Dazu werden Parameter der Entwicklung der Biodiversität sowie des CO2-Speichervermögens herangezogen. Abschließend wird die Ausgestaltung der Förderrichtlinie in den Kontext der Unionspolitik mit den dazugehörigen Rechtsvorschriften gesetzt. Die Konvergenz der politischen Ziele der nationalen Förderrichtlinie mit Rahmenregelungen der EU, insbesondere dem EU-Beihilferecht, wird auf Grundlage des Policy Coherence Framework diskutiert.
Die Förderrichtlinie hat das Potenzial, großflächig Anreize für Waldbesitzende zu setzen, eine ökosystemverträgliche und klimaresiliente Art der Waldbewirtschaftung auszuüben. Hierzu ist insbesondere eine geeignete Wahl und Formulierung der Förderkriterien notwendig, um Klima- und Biodiversitätsziele auch tatsächlich zu erreichen. Die Frage lautet: Ist das Klimaangepasste Waldmanagement eine Erfolgsgeschichte oder ein historischer Misserfolg?
Ich danke Professor Dr. Justus Eberl für die umfangreiche fachliche Beratung sowie dem Untersuchungsbetrieb für die Bereitstellung der erforderlichen Daten.
2 Grundlagen der Untersuchung
2.1 Untersuchungsgegenstand
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Wechselwirkung zwischen dem forstpolitischen Förderinstrument „Klimaangepasstes Waldmanagement“ (folgend: Förderrichtlinie) mit einem beispielhaften Forstbetrieb untersucht. Dabei ist einerseits die betriebliche Umsetzung auf Grundlage der erlassenen Richtlinie Untersuchungsgegenstand, andererseits die prognostizierte Wirkung der betrieblichen Umsetzung in Bezug auf die politische Zielsetzung der Förderrichtlinie.
Mithilfe der Untersuchungen soll eine Aussage ermöglicht werden, inwiefern die Erwartungen des Fördermittelgebers erfüllt werden, wenn ein Forstbetrieb die Richtlinie zulässig und betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzt. Die Erwartungen des Fördermittelgebers sind in der Förderrichtlinie in Form des Zweckes der Förderung ausformuliert. Die Wirkung der betrieblichen Umsetzung wird durch computergestützte Simulation für der Zuwendungszeitraum prognostiziert. Es wird sich aufgrund des limitierten Arbeitsumfangs auf ein Teilkriterium der Förderrichtlinie, die natürliche Waldentwicklung, beschränkt. Daraus kann eine Aussage über die Schnittmenge der Wirkung und Absicht der Zuwendung gewonnen werden. Weiterführend werden die Intention und Wirkungsweise der Förderung in den Kontext des Europäischen Beihilferechts gesetzt. Hierbei soll herausgestellt werden, ob mögliche Differenzen zwischen Formulierung und Umsetzung der Förderrichtlinie zu Konflikten mit dem unionspolitischen Rahmen der Europäischen Union (EU) führen, oder ob die Politiken der EU und des Bundes in dieser Hinsicht konvergent sind.
Forstlicher Praxisbezug wird durch Betrachtung eines realen, anonymisierten Privatwaldbetriebs hergestellt. Es erfolgt eine Neuauswahl der Förderflächen, unbeachtet eventuell bestehender Flächenausweisungen in Bezug auf die Förderrichtlinie. Bei der Flächenauswahl wird sich auf ein Revier des Forstbetriebs beschränkt. Das Untersuchungsgebiet liegt im Westmünsterland, NRW.
Forstwirtschaftliche Betrachtungen bilden den Mittelpunkt der Untersuchungen. Es soll ein konkreter Praxisbezug hergestellt werden, anhand dessen die Wirkungsweise des politischen Instruments deutlich wird. In Anbetracht des Themas sind Überschneidungen mit politischen sowie juristischen Sachgebieten zu erwarten. Methoden dieser Themenbereiche werden zweckdienlich erläutert und angewandt, sind jedoch auf die Grundzüge beschränkt, da sie nicht den Schwerpunkt der Arbeit ausmachen. Auf fachfremde Exkurse wird verzichtet, sofern sie nicht wesentlich für die Beantwortung der Fragestellung sind.
2.2 Verortung im Forschungsprozess
Neben der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Förderrichtlinie dient diese Untersuchung als Abschlussarbeit. Der Verfasser absolviert hiermit das Bachelorstudium „Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement“ der Fachhochschule Erfurt. Erstgutachter und Betreuer der Fachhochschule ist Professor Dr. Justus Eberl.
Das Forschungsthema knüpft an eine Reihe von Abschlussarbeiten zur Förderrichtlinie „Klimaangepasstes Waldmanagement“ an, ausgeschrieben im Lehrgebiet Forstpolitik und Umweltrecht (Professor Dr. Eberl). Insbesondere in Bezug auf eine Abschlussarbeit zu dem Kriterium „Habitatbäume“ (Schäfer & Eberl, 2023) wird die Forschung weitergeführt, indem ein weiteres Kriterium untersucht wird. Die Zielsetzung der Arbeiten unterscheidet sich, die Ergebnisse sind daher nur bedingt vergleichbar. Literatur wird insbesondere in Form von Gesetzestexten und Bekanntmachungen der Bundesministerien und der EU verwendet. Den Mittelpunkt der Untersuchung bildet die „Richtlinie für Zuwendungen zu einem klimaangepassten Waldmanagement“ (BMEL, 2022). Die methodische Grundlage ist der Dissertation von Eberl (2020) entnommen. Einen weiteren zentralen Aspekt der Forschung stellt die computergestützte Waldsimulation mit der Software „ForestSimulator“ der Nordwestdeutschen Forstversuchsanstalt (NW-FVA) dar. Die äußere Form der Abschlussarbeit richtet sich nach der Richtlinie für wissenschaftliche Arbeiten der Fachhochschule Erfurt, Fachrichtung Forstwirtschaft (FH Erfurt, 2021).





























