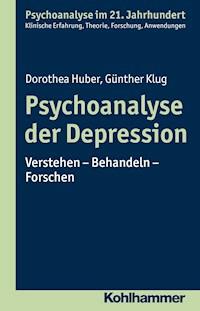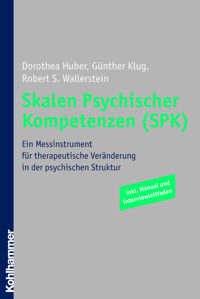Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein letztes Mal schließt Dora die Tür, dreht den Schlüssel im Schloss, nicht ohne sich noch einmal umzublicken. Die beiden Flügel, Tastatur an Tastatur, nebeneinander vor dem Fenster zum Park, der Schrank, Tisch, Stühle, Notenständer, an der Wand die Tafel mit den Notenlinien. Alles scheint wie immer, doch Dora lässt ihr altes Leben hinter sich. Und während sie ihrer Zukunft entgegengeht, blickt sie zurück auf eine Geschichte von Kriegen und Not, vom Fortgehen und Ankommen, von Liebe, Verbundenheit und von Musik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ziehende Landschaft
Man muss weggehen können
und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir ständen fest.
Man muss den Atem anhalten,
bis der Wind nachlässt
und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,
bis das Spiel von Licht und Schatten,
von Grün und Blau,
die alten Muster zeigt
und wir zu Hause sind,
wo es auch sei,
und niedersitzen können und uns anlehnen,
als sei es ein Grab
unserer Mutter.
Hilde Domin, Gesammelte Gedichte
Verlag: S.Fischer/Frankfurt am Main 1987
Inhalt
Ziehende Landschaft
I.
Die Fahrt
Geschichten
Die Stadt
Elsass
Krieg
Besiegt
Besatzung
II.
Fahrrad
Hier und dort
Shopping City
Tiere
Das Dorf
Dirndl
Nicht nur Wald und Felder
Berge und Seen
III.
Der Fluss
Hilda, Guggi und Puppi
Das Grauen im Hof
Royal Enfield 500
Phantom der Oper
Musik
Ankunft
Zu Hause
Vom Singen
IV.
Im Dazwischen
Rülli-Zülli
Und alle tragen sie hübsche
Baströckchen
Besuch
Iglu
Märchenschloss
Engel
Unbekannt
Friede
Teenagerliebe
Wütende Welt
Träume
Abschied
V.
Danach
Tanzen
Klavier
VI.
Zurück
Anhang
Stammbaum
I.
Ein letztes Mal schließt Dora die Tür, dreht den Schlüssel im Schloss, nicht ohne sich noch einmal umzublicken. Die beiden Flügel, Tastatur an Tastatur, nebeneinander vor dem Fenster zum Park, der Schrank, Tisch, Stühle, Notenständer, an der Wand die Tafel mit den Notenlinien. Alles ist wie immer und doch erscheint ihr der Raum leer und seltsam fremd.
Sie überquert den Hof, ein heftiger Gewitterregen prasselt auf das Kopfsteinpflaster und triefend nass öffnet sie die Tür zum Schulsekretariat. Den Schlüssel legt sie auf den Schreibtisch und wechselt ein paar Worte mit der Sekretärin. Die Schulleiterin eilt aus ihrem Büro herbei, es wird geplaudert und gelacht, dann folgen Umarmungen, ein letztes Adieu, und Dora macht sich auf den Heimweg. Der Rucksack ist schwer beladen mit Notenheften und Unterrichtsmaterialien. Das Meiste hat sie während der letzten Wochen Tag für Tag nach Hause getragen oder mit dem Auto abgeholt. Ein ganzer Kofferraum mit Vergangenem wurde heimgefahren, von dem sie nicht weiß, was sie damit noch soll.
Vierunddreißig Jahre lang saß Dora am Flügel und versuchte, an vier Tagen in der Woche, ihren Schülerinnen und Schülern das Klavierspielen beizubringen. Mit unterschiedlichem Erfolg. Der Satz: „Er muss ja kein Pianist werden!“, bereits in der ersten Klavierstunde von wohlmeinenden Eltern geäußert, ließ Dora erschauern. Schon von Beginn an wurde damit den Kindern die Erlaubnis erteilt, bequem und faul zu sein. Natürlich hatte Dora auch gute und interessierte Schülerinnen und Schüler, aber das über Jahre sinkende Niveau, sowie schleichende Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen, ließ auch Doras eigenen Ansporn am Instrument erlahmen. Ihre künstlerische Tätigkeit und ihr tägliches Üben verloren zunehmend an Bedeutung. Sparzwänge der Musikschule auf der einen und wachsende Wartezeiten für die zum Instrumentalunterricht Angemeldeten auf der anderen Seite führten dazu, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler in die zur Verfügung stehenden Lektionen eingeteilt wurden, was für die Lernenden kürzere Klavierstunden bedeutete und für die Lehrkräfte eine größere Anzahl zu Unterrichtender bei gleichbleibender Lektionenzahl und gleichbleibenden Lohn.
Unsicher, ob sie nicht doch noch von ihren Gefühlen übermannt würde, hatte sie sich vor den letzten Unterrichtswochen, der letzten Vorspielstunde und der Abschiedsfeier gefürchtet. Auch jetzt auf dem Nachhauseweg wartet Dora auf Wehmut, die sich nicht einstellt. Dafür empfindet sie Dankbarkeit, leise Erleichterung und die Gewissheit, den richtigen Schritt getan zu haben. Vor ihr liegen die Sommerferien, die keine Rolle mehr spielen und während sie den ansteigenden Weg zu ihrem Haus in Angriff nimmt, breitet sich dasselbe Gefühl grenzenloser Freiheit in ihr aus, welches sie am Vorabend der großen Ferien als Kind verspürt hatte, und Dora lässt ihre Gedanken zurück in ihre Kindheit schweifen.
Die Fahrt
Um vier Uhr in der Früh geht die Reise los und schon an der ersten Straßenecke fragt Dora, wann man denn endlich da sei. Knapp tausend Kilometer liegen vor den Reisenden. Das Auto ist bis unters Dach vollgestopft mit allem, was eine Familie während sechs Wochen Sommerferien zu brauchen glaubt. Kleider, Schlauchboot, Spielsachen, Schulbücher des acht Jahre älteren Bruders Edi, die während des ganzen Sommers dann doch nie geöffnet werden. Luftmatratzen, der Lieblingskakao, weil es den dort nicht gibt. Hygieneartikel, Pässe, Geld, Geschenke für die Verwandtschaft. Auf dem Dach ist ein Seesack festgezurrt. Paddel, Segel, Decken und auf dem Rücksitz macht sich zwischen den Geschwistern Bummel, Doras beinahe lebensgroßer Lieblingsteddybär, breit.
Die Reise erscheint endlos, für welche Strecke man sich auch entscheidet. Der direkte Weg führt über eine Unzahl an Land-, Berg- und Passstraßen. Stunden verbringt man hinter im Schritttempo dahinschleichenden Lastwagen und Traktoren. Und in den vielen Ortschaften, die durchquert werden müssen, ist an ein Vorwärtskommen erst recht nicht zu denken. Kinder spielen auf den Straßen, Fußgänger stehen plaudernd im Weg, Lieferwagen blockieren beim Ein- und Ausladen die Fahrbahn. Wählt man die Autobahn, führt die Strecke zuerst zweihundert Kilometer nach Norden, ehe man endlich den Weg nach Osten einschlägt. Dora starrt aus dem Fenster auf vorbeiziehende Leitplanken, Büsche, Felder, Wälder, Hügel. Manchmal entschließt man sich, auf der Strecke doch eine Übernachtung einzulegen. Dann fährt die Familie durch eine große Stadt, etwa auf der Hälfte des Weges, welche sie ohnehin durchqueren müssen, da die Autobahn vor den Toren der Stadt endet und erst auf der gegenüberliegenden Seite ihre Fortsetzung findet. Sie stehen in Kolonnen vor roten Ampeln, kämpfen sich in stockendem Verkehr durch fremde Straßen, suchen mit steigender Ungeduld nach einer günstigen Unterkunft für die Nacht. Müde und verschwitzt wird das Nötigste aus dem Auto gezerrt und über enge, nach abgestandener Luft riechende Treppen und Flure in ein einfaches Hotelzimmer geschleppt. Dort erfrischt man sich ein wenig und zieht dann los in die Stadt, für ein Abendessen in einem Biergarten, welches nun doch ein wenig nach der alten Heimat schmeckt.
Frühmorgens wird die Reise fortgesetzt. Die Sommersonne brennt auf das Autodach und die Hitze im Innern wird unerträglich. Man gelangt an den großen Autobahnzoll, doch endlose Fahrzeugschlangen stauen sich in der brütenden Hitze. Die Luft über den Autodächern flirrt im Sommerlicht, die Leute steigen aus ihren Wagen, gehen müde und genervt ein paar Meter auf der Autobahn hin und her und um das eigene Auto herum. In Kofferräumen wird nach Proviant gesucht. Käsebrote, Eier, in der Hitze angeschmolzene Schokolade, lauwarme Getränke. Ganze Familien sitzen auf Leitplanken, andere bei geöffneten Autotüren, um sich zu stärken oder die Zeit totzuschlagen. Während Stunden geht die Fahrt nur schrittweise voran. Immer wieder werden die Motoren gestartet, um eine halbe Autolänge weiter zu gelangen. Die Luft stinkt nach Abgasen und Benzin. Manche lassen die viele Starterei auch bleiben und schieben ihre Wagen auf dem glühenden Asphalt die paar Meter vorwärts. Geht die Reise endlich wieder los, liegen immer noch mehr als vierhundert Kilometer vor der Familie.
Wie jedes Jahr wird am großen Autobahnrastplatz, nahe des prächtigen Stifts, welches malerisch am Flussufer liegt, noch einmal eine Rast eingelegt und das Auto aufgetankt. Anna ruft aus einer Telefonzelle bei ihrer Mutter Jule an, um mitzuteilen: „Wir sind bald da!“, und jedesmal steht Dora neben ihrer Mutter und schickt ein Stoßgebet zum Himmel, es möge, dieses eine Mal, doch bitte so sein.
Die Autobahn lassen sie hinter sich, um den Fluss zu überqueren. Sie fahren hinab zum Ufer und warten auf die Rollfähre, welche die Fahrzeuge und ihre Insassen zur anderen Seite bringt. Auf der Fähre finden lediglich drei oder vier Autos Platz, je nachdem um welche Modelle es sich handelt und es gilt, Geduld zu haben. Auch als eine Brücke 1973 fertiggestellt ist, dauert die Fahrt kaum weniger lange, aber immerhin entfällt die lästige Warterei, unten am Fluss.
Drüben angekommen, fahren sie auf der engen Landstraße den Fluss entlang, vorbei an Weinbergen und Obstwiesen. Auf den Hügeln thronen Burgen und Ruinen. Sie durchqueren langsam die vielen kleinen, pittoresken Ortschaften, mit noch engeren Dorfstraßen, und obwohl sie der Gegend jedes Jahr einen Besuch abstatten, haben sie in diesem Moment keinen Blick für deren Schönheit.
Dann erscheint endlich auf den Hügeln am gegenüberliegenden Flussufer ein weiteres Stift und sie erreichen die breitere Landstraße, auf welcher sie der kleinen Stadt entgegenfahren. Nach zwölf bis vierzehn Stunden Fahrt am Ziel angekommen, ist Dora jedes Mal erstaunt über die immer noch gleichen Löcher in den Straßen, die gelbe, abblätternde Farbe an den Fassaden, der nur aus einem Erdgeschoss bestehenden und der Länge nach direkt an die Gehsteige gebauten Häuser mit den großen Toreinfahrten in ihrer Mitte, die in Höfe führen, welche allerlei alte, nicht mehr gebrauchte Gerätschaften beherbergen. Dort wo Dora zu Hause ist, ist alles sauber und aufgeräumt, doch das Kind empfindet die Einfahrt in die kleine Stadt jedes Jahr aufs Neue wie eine Heimkehr.
Vor den Häusern sitzen alte Männer auf hölzernen Stühlen, die Hände und das Kinn auf ihre Gehstöcke gestützt und blicken den vorbeifahrenden Autos hinterher. Alte Frauen in Kleiderschürzen und unter dem Kinn geknoteten Kopftüchern stehen auf den Gehsteigen, vertieft in den neusten Tratsch aus der Nachbarschaft.
Die Straße zu dem kleinen Eckreihenhaus der Großmutter ist immer noch nicht asphaltiert und so rumpelt man die letzten Meter über eine Schotterstrecke den kleinen Hügel hinauf zum Ziel. Die Großmutter steht schon seit Stunden wartend am Zaun des Vorgartens. Ihr weißer Gehstock, ihre Brille mit den dicken, getönten Gläsern und ihre Kleiderschürze – genau so, wie Dora sie seit dem letzten Abschied in Erinnerung behalten hat. Als die Familie aus dem Auto steigt, kann Jule ihre Tränen der Wiedersehensfreude und Erleichterung über die unversehrte Anreise ihrer Familie nicht mehr zurückhalten.
Edi öffnet das alte Holztor, welches neben dem kleinen Häuschen in den Hof führt, und der Vater manövriert den Wagen durch die enge Einfahrt. Immer noch nimmt der mächtige Nussbaum, mit seinen schweren, auf hölzernen Stützen ruhenden Ästen, beinahe den ganzen Hof für sich in Anspruch und während die Erwachsenen Koffer um Koffer aus dem Auto heben und ins Haus schleppen, läuft Dora vom Hof aus weiter in den Garten, den schmalen Weg zwischen Blumenbeeten und Sträuchern entlang, nascht von den Johannisbeeren, dann von den Stachelbeeren, läuft zu den alten Apfelbäumen mit den kleinen, sauren Klaräpfeln und sinkt glücklich ins Gras. Ein endlos scheinender Sommer wartet auf sie.
Geschichten
Dora liebt Geschichten. Ungezählte freie Schulnachmittage liegt sie, eng an die Mutter geschmiegt, auf der Couch und lässt sich von Annas ruhiger Stimme forttragen. Fremde, spannende Welten breiten sich im Wohnzimmer aus. Und immer wieder verlangt das Kind nach seiner Lieblingsgeschichte. «Mama, erzähl von früher!»
Und während Anna von ihrem Vater und von ihrer unstillbaren Sehnsucht nach dem geliebten Papa erzählt, reist Dora in Gedanken weit weg nach Osten. Dora hat ihren Großvater Hans nie gekannt, aber das Bild des kleinen Eckreihenhauses, das fast am Ende der langen, ansteigenden Straße liegt, die sich dem Wald am Stadtrand entgegenstreckt, erscheint vor Doras innerem Auge. Da sind der Zaun um den Vorgarten herum und die drei Stufen, die zur Haustüre führen. Rechts neben dem Haus das alte Holztor zum Hof, der in ewigem Schatten unter dem mächtigen Nussbaum versinkt. Versteckt ans Haus gebaut liegt der Schuppen, mit der Treppe hinab in einen feuchten, dunklen Keller. Am Ende des Hofes eine quietschende Tür, die in den Garten führt. Im Haus nur zwei Zimmer und eine kleine Kammer, von den Bewohnern Kabinett genannt, sowie Küche, Waschküche, WC und Speisekammer. Von der Kammer im ersten Stock führt eine Tür auf einen kleinen, über der Küche liegenden Balkon, der wegen Einsturzgefahr jedoch von Dora nicht betreten werden darf. Und so bleibt der Raum über dem Schuppen, welcher nur auf diesem Weg erreicht werden kann, für das Mädchen ein ewiges Geheimnis. Eine zweite Tür im Kabinett öffnet sich zur steilen Treppe, über welche man auf den Dachboden gelangt. Ist die kleine Dora sehr mutig, steigt sie ein paar Stufen hinauf und sieht im Dämmerlicht Spinnweben und Staubpartikel schweben, sonst scheint sich nichts dort oben zu befinden.
Im Kabinett von Großtante Mimi steht auf dem Nachttisch eine Marienstatue aus rosafarbenem Glas. Die Schleppe ihres Kleides bildet hinten eine kleine Mulde, in welcher ein kleiner Schlüssel liegt. Dora setzt sich auf Mimis Bett, nimmt den Schlüssel, steckt ihn vorsichtig in die an Marias Rücken dafür vorgesehene Öffnung und dreht ihn sanft, bis es nicht mehr weitergeht. Dann legt sie den Schlüssel wieder zurück und sieht durch das rosa Glas, wie sich die kleine, gezackte Walze im Innern der Statue zu drehen beginnt und dabei die kleinen Stäbchen in Bewegung versetzt, welche zart das „Ave Maria“ erklingen lassen. Besondere Freude hat Dora, wenn sich am Ende die Walze immer langsamer dreht, die Melodie erlahmt, um schließlich stockend und stolpernd ganz zu verstummen.
Annas Stimme nahe am Ohr, sieht Dora Annas Mutter Jule in der Küche mit dem schweren Wassertopf auf dem Gasherd hantieren, sie sieht Annas zehn Jahre ältere Halbschwester Thea im Hof stehen, die kleine Anna auf ihrem Arm. Sie sieht Annas vier Jahre älteren Bruder Berti auf die Bäume im Hof und Garten klettern, sowie Hans’ Schwester Mimi das gehäkelte Decklein auf ihrem Tisch glattstreichen. Anna berichtet, wie Mimi als Kind übermütig auf den Wirtshaustischen ihrer Eltern tanzte und schwer stürzte. Mimi wuchs daraufhin nicht mehr weiter, ihre Wirbelsäule war verletzt und ein großer Buckel blieb zurück. Vergeblich wartete sie darauf, einen Mann zu finden und zu heiraten. Und so verbrachte Mimi ihr Leben, neben ihrer Arbeit im Büro, mit Beten und den täglichen Besuchen der katholischen Messen am frühen Morgen und abends, und hatte sie ein paar freie Tage, zog sie sich ins Kloster zurück.
Bis Großmutter Jule starb und Großtante Mimi in ein Seniorenheim umsiedeln musste, verbrachten die Schwägerinnen ihr Leben gemeinsam im kleinen Haus. Sie konnten unterschiedlicher nicht sein. Jule zog, während die Welt in den Abgrund stürzte, drei Kinder groß und erledigte trotz ihrer Sehbehinderung bis ins hohe Alter die Arbeit in Haus, Hof und Garten. Das Putzen und Einkaufen wurde nach und nach von Nachbarinnen und Bekannten übernommen, Berti und seine Frau Astrid schauten während ihrer regelmäßigen Besuche nach dem Rechten, und Berti führte die nötigsten Renovationsarbeiten aus. Die Mahlzeiten lieferte der Seniorendienst „Essen auf Rädern“, aber täglich kümmerte sich Jule, bis zu ihrem Tod, um all die im Haushalt anfallenden Kleinigkeiten. Jeden Tag stellte sie ein Frühstück auf den Tisch, nahm das Mittagessen entgegen, und jeden Abend wärmte sie die vom Mittagessen übrig gebliebenen Reste auf, wusch das Geschirr und räumte alles wieder auf, putzte, wo es gerade nötig war, den ärgsten Dreck weg, sortierte die Wäsche, die zum Waschsalon gebracht werden musste, während Mimi derweil betend in ihrer dunklen Ecke, in der mit Wandschrank, Teppich, Tisch und Fauteuil zu einem Durchgangszimmer umgestalteten Waschküche saß, sich kaum von der Stelle rührte und sich von ihrer Schwägerin bedienen ließ. Die Großmutter politisch links, die Großtante zutiefst katholisch, führten sie ein Leben wie Hund und Katz.
Auf der anderen Seite des Waldes, außerhalb der Stadt, führt der Weg – entlang sich endlos dem Horizont entgegenstreckender Felder – zum Garnisons-Übungsplatz, welcher im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht als Exerzierplatz und zur Unterbringung von Artillerieeinheiten benutzt wurde. Auf den Feldern stehen für Offiziere während des Krieges eilig errichtete, einfache Mehrfamilienhäuser.
„Hierhin zogen deine Großeltern mit deinem Vater und seiner Halbschwester Resi, nachdem der Krieg zu Ende war.“ erzählt Anna weiter, und Dora sieht sich selbst auf Zehenspitzen, am weit geöffneten Wohnzimmerfenster ihrer Großeltern, in der kleinen Zweizimmerwohnung mit Küche und Bad stehen und über die im Wind wogenden Ähren blicken, während die Sonne langsam hinter den Feldern am Horizont versinkt. Sie liebt das sanfte Rascheln und Knistern der Ähren im Wind, den Geruch nach Erde und Korn, und wo immer sie später im Leben dieser Abendstimmung begegnet, wird Dora von brennender Sehnsucht nach dem Ort ihrer Kindheitssommer erfüllt.
Resi wurde von ihrem Stiefvater Gregor nie angenommen und stets schlecht behandelt. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend hin und her geschoben zwischen der kleinen Stadt und dem Bauernhof, nahe der Grenze im Osten, auf welchem Resis Mutter Helga aufwuchs.
Doras Vater Heinz musste schon früh für sich selbst sorgen. Sein Vater Gregor arbeitete in der Fabrik und seine Mutter Helga zog in der näheren Umgebung von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof, um als Landarbeiterin dringend benötigtes Geld für den Lebensunterhalt dazu zu verdienen. Die nach dem Krieg geborene, neun Jahre jüngere Schwester Regula wurde Heinz aufgebürdet. Im Kinderwagen schleppte er sie zu seinen ausgelassenen Spielen mit Freunden auf den Feldern und im Wald. Weinte das Kind, warfen die Buben Steine an den Wagen, damit dieser zu schaukeln begann und sich das Baby darin beruhigte.
Dora rückt noch näher zu ihrer Mutter. „Mutti, bitte, bitte nochmal die Geschichte von Opa und den Tassen!“ und Anna erzählt von Gregor, der im Suff nach Hause kam und in rasender Wut sämtliche Tassen in der Mitte auseinanderbrach und zu Boden schmiss, weil er sich daran störte, dass keine einzige unbeschadet war. „So, und morgen säufst du den Kaffee aus dem Hut!“ war alles, was Helga dazu zu sagen hatte.
Die Sitten waren rau in Heinz’ Elternhaus. Weil keiner die Arbeit verrichten wollte, zwangen die Eltern ihren Sohn dazu, seine geliebte Häsin zu erschlagen, damit etwas zu Essen auf den Tisch kam. Handgreiflichkeiten waren keine Seltenheit, und erst als Heinz zum jungen Mann heranwuchs und seinem Vater in einer letzten Auseinandersetzung damit drohte, zurückzuschlagen, kam dies zu einem jähen Ende. Großvater Gregor sank hemmungslos weinend auf die Kohlenbank in der Küche.
Heinz fand Erfüllung in der Musik. Mit unerschütterlichem Willen setzte er sich über alle Widerstände hinweg und dank Annas uneingeschränkter Unterstützung folgten Doras Eltern ihrem gemeinsamen Weg, der sie in die Fremde führte.
Die Stadt
Die kleine Stadt (1), in welche Dora, mit ihren Eltern und ihrem Bruder, jedes Jahr im Sommer aufbricht, erholt sich nur langsam von den Ereignissen, die das Land, wie auch die Menschen, während der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in Atem hielten.
Schon während des ersten Krieges leidet die Bevölkerung der kleinen Stadt große Not. Wer sich nicht durch Schleichhandel zusätzlich Lebensmittel beschaffen kann, steht vor dem Verhungern. 1915 eingeführte Brot- und Mehlkarten, sowie Rationierungen für Kleider und Schuhe, können die Versorgung der Menschen in keiner Weise sichern. Epidemische Krankheiten breiten sich aus. Scharlach, Diphtherie, Tuberkulose. Hinzu kommt der Ausbruch der Spanischen Grippe, welcher täglich fünf bis sechs Personen in der kleinen Stadt zum Opfer fallen. Die örtlichen drei Fabriken werden zu Rüstungsbetrieben umfunktioniert, und durch die großen Verluste an der Front müssen zunehmend auch militärische Aufgaben von älteren Zivilisten übernommen werden.
Der erste Krieg ist zu Ende, aber die Wirtschaft erholt sich nur langsam. Um Weihnachten 1920 kommt es zu einer Versorgungskrise. Die Lebensmittelknappheit treibt die Menschen demonstrierend auf die Straßen, um auf ihren Hunger und ihr Elend aufmerksam machen. Die um sich greifende Inflation zwingt Gemeinden dazu, eigene Geldscheine, sogenanntes Notgeld, als Zahlungsmittel innerhalb des Gemeindebereichs einzusetzen. Die Weltwirtschaftskrise beschert auch der kleinen Stadt einen sprunghaften Anstieg an Arbeitslosigkeit und damit verbunden eine Zunahme von Verbrechen. Zahlreiche Arbeitslose gehen als Gastarbeiter nach Frankreich, wo sie Arbeit finden und etwas zu essen bekommen.
Elsass
Ein Krieg ist vorbei, der nächste dämmert am Horizont. Auch Gregor, bisher in der Landwirtschaft als Huf- und Wagenschmied tätig, findet keine Anstellung mehr.
Er wird an die Elsässische MaschinenbauGesellschaft Grafenstaden im fernen Frankreich vermittelt und dort für grobe Schmiedearbeiten eingesetzt. Die Arbeit ist dreckig, schwer und schlecht bezahlt. Eines Abends erscheinen fremde Männer in der Fabrik und bringen die Arbeiter in die nahe Gaststätte. Spendabel wird eine Runde nach der anderen ausgegeben. Gregor, als Waisenkind von seinen älteren Geschwistern und wechselnden Verwandten, bei denen die Kinder um ein Stück Brot und Unterkunft betteln, durchs Leben geschleift, ist des Schreibens und Lesens sowie der fremden Sprache nicht mächtig. Und vom Alkohol benommen, versteht er nicht, was die Männer den Arbeitern versprechen. Ein besseres, ein neues Leben, wer weiß das schon.
Der Abend nimmt seinen Lauf, und am Ende hat Gregor seinen Namen und seine Papiere verloren. Er wird in die Fremdenlegion (2) eingezogen. Über Orange und Marseille führt seine Reise nach Algerien. Sidi bel Abbès, Saida, El Kheiter und Colomb Béchar sind seine Stationen.
Die Legionäre erhalten in Sidi bel Abbès ihre Grundausbildung und fristen anschließend oft ein eintöniges Dasein in irgendwelchen verlassenen Außenposten. Endlose Wachdienste und Patrouillen, im Wechsel mit schwerer körperlicher Arbeit, zum Beispiel im Straßenbau, sind ihr Alltag.
Seines guten Umgangs mit Pferden und seines früheren Berufes wegen, wird Gregor bei Offizieren als Schmied untergebracht und übernimmt wohl auch allerlei Aufgaben als Laufbursche und Hilfsarbeiter.