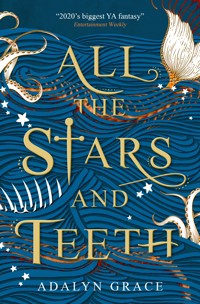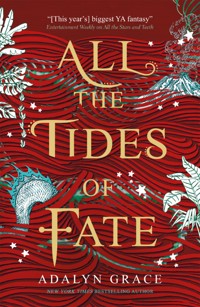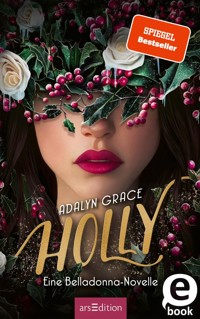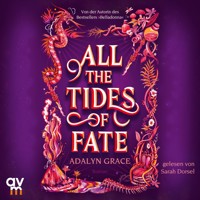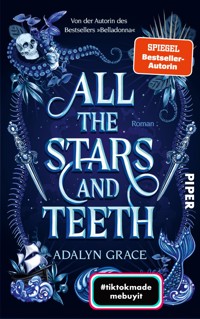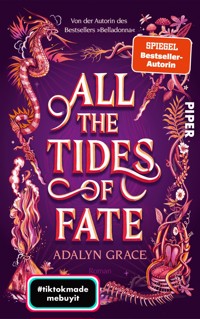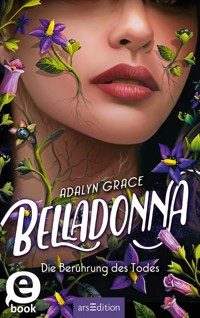9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: arsEdition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine verbotene und tödliche Liebe ... Seit der Tod Signa verlassen hat, ist sie am Boden zerstört. Doch schon betritt sein Bruder Schicksal die Bühne. Da der Tod ihm seine Geliebte genommen hat, ist er auf Rache aus und spinnt Signa in ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen ein. Als ihr Onkel Elijah für einen Mord angeklagt wird, den er nicht begangen hat, müssen sich die drei zusammentun, um die Familie zu retten. Und Signa muss sich darüber klar werden, wo ihre Gefühle und Loyalitäten liegen ... Band 2 der romantischen Trilogie - mit einem Love Triangle, das einen nachts wach hält! Alle Bände der Belladonna-Reihe: Band 1: Belladonna - Die Berührung des Todes Band 2: Foxglove - Das Begehren des Todes Band 3: Wisteria - Die Liebe des Todes Band 4: Holly - Eine Belladonna-Novelle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Adalyn Grace
Foxglove
Das Begehren des Todes
Aus dem Englischen von Petra Knese
arsEdition
Du möchtest noch mehr von uns kennenlernen?
Vollständige eBook-Ausgabe der Softcoverausgabe München 2024
Text copyright © Adalyn Grace, Inc, 2023
Cover copyright © Hachette Book Group, 2023
Cover art copyright © Elena Masci, 2023
Titel der Originalausgabe: Foxglove
Die Originalausgabe ist 2023 bei Little, Brown and Company
(Hachette Book Group), New York, erschienen.
© 2024 arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, D-80801 München
Alle Rechte vorbehalten
© Text: Adalyn Grace
Übersetzung: Petra Knese
Lektorat: Katja Korintenberg
Covergestaltung: Grafisches Atelier arsEdition,
unter Verwendung der Illustration von Elena Masci
Bildmaterial von Inna Sinano / Shutterstock und
OSTILL is Franck Camhi / Shutterstock
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN eBook 978-3-8458-5705-3
ISBN Printausgabe 978-3-8458-5692-6
www.arsedition.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Als eine Freundin von mir beimVorstellungsgespräch gefragt wurde,was sie morgens aus dem Bett triebe,sagte sie: »Mein Wecker.«
Dieses Buch ist ihr,meiner Erstleserin, gewidmet,der genialsten Reisebegleiterin undeins a Spürnase, die mich zumLachen bringt, selbst wenn sie esnicht darauf angelegt hat.
Prolog
Das Schicksal hatte ein Jahrtausend gebraucht, um die Lieder der Lebensfäden zu erlernen, und noch länger, um sie zu wirken.
Im Schein der schwindenden Kerze saß es im Schneidersitz in einem Keller auf dem Boden und beugte sich über ein noch unberührtes Gewebe auf seinem Schoß. Die Nadel glitt flink hindurch, beständig wechselte der Faden die Farbe, während das Schicksal ein weiteres Leben entwarf.
Wie immer begann es mit einer Hymne aus Weiß, denn Weiß stand für ein neues Leben. Gleich darauf ein beruhigendes Blau, dem Rhythmus folgend, den das Schicksal in sich trug. Dann Riffs aus Rot und schreiendem Gelb, als würde die Sonne hinter den Wolken hervorbrechen. Das Schicksal überließ sich dem Leben einer reichen Aristokratin, deren Schönheit eines Tages Inspiration für große Kunst sein sollte. Gemälde, Skulpturen, Musik und Gedichte – keines der Werke würde ihre Schönheit je ganz einfangen. Ihr Leben war eine Abfolge feuriger Affären, die mit feinsten Fäden vorgezeichnet wurden, so zart wie kostbar. Mit jedem neuen Liebhaber und jeder neuen Wendung wurde das Schicksal fieberhafter, als würde es in einem Crescendo, das nur es selbst hören konnte, durch das Leben der Aristokratin jagen.
Jeder, der dem Schicksal bei der Arbeit zusah, hätte es für einen Künstler gehalten haben, der mit Nadel und Faden einen Stoff zum Klingen brachte. Mit jedem Nadelstich fing das Schicksal ein ganzes Leben ein, das ihm in Sekundenschnelle in den Sinn kam, verwandelte Melodien in Farben. Vor lauter Hast blieb keine Zeit zum Überlegen, zum Atmen. So vertieft war das Schicksal in die Geschichte, dass es beim Erklingen des Mollakkords, mit dem sich der Faden zum Schluss schwarz färbte, nicht mehr wusste, wer es war oder was es da tat.
Schließlich besann sich das Schicksal und sah sich in dem kahlen Raum mit den nackten, grauen Wänden um. Da wurde ihm wieder bewusst, dass die pulsierenden Farben nicht mehr ihm gehörten, sondern denen, deren Geschichten es entwarf. Früher war der Grundton seiner Gobelins ein strahlendes Gold gewesen, doch seit ein paar Jahrhunderten verdarb eine neue Farbe das Gewebe: ein leiser Silberton, dessen Anblick das Schicksal nicht ertrug, weil es Sinnbild für alles war, was ihm genommen worden war. Was der Tod ihm genommen hatte.
Kaum hatte das Schicksal die Kerze ausgeblasen, wurden unzählige Gobelins sichtbar, die an endlosen Leinen aufgereiht hingen und an ihm vorüberglitten. Sobald sich eine Lücke auftat, hielt das Schicksal die Leine an und befestigte sein neuestes Werk. Behutsam strich es über die Wirbel in Blutrot, seiner Lieblingsfarbe, stand sie doch für Liebe und Leidenschaft, die stets die spannendsten Geschichten schrieben. Als das Schicksal die Hand zurückzog, glitt der Gobelin weiter – so lange, bis alle eingearbeiteten Fäden aufgelöst waren und er zu ihm zurückkehrte, blank und bereit für eine neue Erzählung.
Seine goldenen Augen hatten sich schon dem nächsten Gewebe zugewandt, da hörte das Schicksal hinter sich ein Geräusch, das es nicht zuordnen konnte. Sanft wie Harfenklänge und doch so fesselnd wie der Mollakkord des Todes. Das Geräusch übertönte alles andere, und obwohl das Schicksal grundsätzlich niemals ein fertiges Werk erneut hervorholte – wozu an einem Meisterwerk noch etwas ändern? –, konnte es diesem Ruf nicht widerstehen.
Das Schicksal folgte den Tönen, tauchte unter den Stoffbahnen hindurch oder wich ihnen seitlich aus. Als es näher kam, hielt es die Leine an, und da erkannte es, dass die Töne nicht von einem Gobelin, sondern von zweien stammten.
Der erste war vielleicht das hässlichste Stück, das das Schicksal je angefertigt hatte, denn es war größtenteils grau mit violetten Stellen, die an blaue Flecke erinnerten. Dabei hatte sich das Schicksal mit dem Exemplar viel Zeit gelassen und mit äußerster Präzision an dem grausamen Geschenk für seinen Bruder gearbeitet: einer Frau, die der Tod lieben, aber nie besitzen würde. Nun stand das Schicksal ungläubig davor. Sein Werk war verändert worden. Grau hatte sich in Schwarz verwandelt, war von Rot und Gold durchsetzt. Von Gelb. Von Blau. Und noch mehr Schwarz war dazugekommen, nicht bloß ein einzelner Faden, sondern Tausende, die sich von allein einflochten, selbst dann noch, als das Schicksal das entstellte Werk wütend schüttelte.
Mit dem zweiten Stoff sah es nicht besser aus. Wirbel in Altrosa und Eisblau waren verdeckt von dicken Linien in Schwarz und Weiß, viele nebeneinander wie Klaviertasten. Das Schicksal beugte sich vor und lauschte: Eine leise, düstere Melodie, bei der jeder Ton wie ein Faustschlag traf, ließ es erschrocken zurückprallen. Wunderschön, kein Zweifel, und doch war die Melodie verkehrt.
Neugierig, was wohl passieren würde, wenn es den letzten schwarzen Faden des Todes einarbeitete, griff das Schicksal nach der Nadel, die hinter seinem Ohr klemmte. Doch zu seiner Überraschung spuckte das Gewebe die Nadel zurück in seine Hand. Das Schicksal ballte die Faust darum.
Was waren das bloß für Ungeheuer? Aus seiner Nadel stammten sie jedenfalls nicht. Bei ihrem Anblick wurde ihm speiübel und es riss sie von der Leine. Selbst als das Schicksal sich bereits beide Gobelins über die Schulter geworfen hatte und damit die Treppe hinaufstampfte, wuchsen sie noch weiter, ergossen sich schwarze und weiße Linien über seinen Rücken bis auf die Stufen, und es musste sich vorsehen, nicht darüberzustolpern. Eilig betrat das Schicksal einen weiteren schmucklosen Raum, in dem ein Kaminfeuer warmes Licht verbreitete, und warf den gestreiften Gobelin in die lodernden Flammen.
Dann setzte es sich in einen Ledersessel am Kamin und wollte zusehen, wie der Gobelin verbrannte. Doch kaum war er im Feuer gelandet, erloschen die Flammen zischend und im Raum breitete sich eine nur allzu vertraute Kälte aus. Wie Eis drang sie ihm bis ins Mark, bemächtigte sich seiner und sandte ihm Schauer über den Rücken.
Taumelnd erhob sich das Schicksal, riss den Gobelin aus dem Kamin, dessen Feuer sofort wieder aufflammte. Voller Wut schleuderte es das hässliche Stück mit den blauen Flecken erneut in die Flammen. Glühende Asche stob auf. Erschrocken stolperte das Schicksal zurück, hielt sich schützend die Hand vors Gesicht. Als es ins Feuer blickte, war dieses weder rot noch orange, sondern von einer Farbe, die es nie wiederzusehen geglaubt hatte.
Das Schicksal wurde aschfahl, als es den Stoff mit zitternden Fingern aus den Flammen zog, ohne darauf zu achten, dass es sich dabei die Hände verbrannte. Es rückte den Sessel beiseite, breitete den Gobelin auf dem Boden aus und kniete sich davor. Schaute, suchte. Und da funkelten sie wie Sterne – lauter silberne Fäden, die es gar nicht geben dürfte. Bis das Schicksal blinzelte und sie auf einmal verschwunden waren.
Es rang nach Luft. Was es gesehen hatte, war doch bestimmt eine Ausgeburt seiner Einsamkeit. Ein Trugbild nach zu viel Arbeit. Konnte es sein, dass das Schicksal sie nach der langen Suche endlich gefunden hatte?
Zärtlich wie ein Liebhaber strich das Schicksal über das Gewebe, um sich anzuschauen, zu wem der Gobelin gehörte. Es war eine junge Frau, die das Schicksal aus reiner Gehässigkeit geschaffen hatte, um den Tod erst in Versuchung zu führen und dann in Verzweiflung zu stürzen. Doch dieselbe Frau führte jetzt ein Eigenleben.
Mit dem zweiten Stoff war es ähnlich. Auch dieses Stück gehörte zu einer jungen Frau. Einer, die dem Schicksal nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal getrotzt hatte. Der Tod hatte das Schicksal oft genug gewarnt, dass es zu nachlässig mit den Leben umging, die es wirkte. Dass es so etwas wie eine perfekte Schöpfung nicht gebe, dass jemand eines Tages das Schicksal bei seinem eigenen Spiel schlagen und von dem ihm vorbestimmten Lebensweg abweichen würde. Bis jetzt hatte das Schicksal so etwas nicht für möglich gehalten.
Es wollte der Sache auf den Grund gehen. Wollte diese junge Frau mit den Silberfäden, diese Signa Farrow, mit eigenen Augen sehen. Und so schnappte es sich Hut und Handschuhe, um uneingeladen auf einem Fest zu erscheinen.
Kapitel 1
Am giftigsten soll Fingerhut kurz vor der Samenreife sein.
An diese unwiderstehliche Giftpflanze, nach der ihr Familiensitz Foxglove benannt war, musste Signa Farrow beim Anblick des toten Julius Wakefield, Duke of Berness, denken.
Ihr Leben lang hatte Signa die Geschichten gehört, wie ihre Eltern auf Foxglove vergiftet worden waren. Als Kind hatte sie auf dem Dachboden ihrer Großmutter vergilbte Zeitungsausschnitte über den Vorfall gefunden. Damals hatte Signa gedacht, was für ein tragisch schöner Abend es gewesen sein musste. Hatte sich ausgemalt, wie die Paare im warmen Kerzenschein über die Tanzfläche gewirbelt waren, die Damen mit fliegenden Satinröcken. Bestimmt waren diese letzten Momente, bevor der Tod kam, ganz wunderbar gewesen. Dass ihre Mutter im Ballkleid während eines ihrer geliebten Feste gestorben war, hatte Signa stets als Trost empfunden.
Nie vorgestellt hatte sie sich die Tragik eines solchen Todes, die splitternden Gläser und ohrenbetäubenden Schreie, wie sie nun durch den Ballsaal auf Thorn Grove schallten. Und erst als ihre Cousine Blythe vorwärtsstolperte, weil sich jemand unsanft an ihr vorbeischob, wurde Signa klar, dass sie sich vorsehen musste, um nicht von panisch Flüchtenden zertrampelt zu werden.
Dieser Tod war nicht das schöne, sanfte Ende, das sie sich für ihre Eltern zurechtgeträumt hatte.
Dieser Tod war gnadenlos.
Everett Wakefield sank neben seinem Vater auf die Knie und hing wie eine welke Blume über ihm, ohne das wachsende Chaos zu beachten, nicht einmal, als seine Cousine Eliza ihn an der Schulter packte. Eliza war grün wie Galle. Nach einem Blick auf ihren toten Onkel hielt sie sich den Bauch und erbrach sich auf den Marmorboden. Everett zuckte nicht mit der Wimper, als ihr Mageninhalt auch über seine Stiefel lief.
Gerade noch hatte der Duke of Berness übers ganze Gesicht gestrahlt, gleich würde er den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem Grey’s Gentleman’s Club, dem ehrwürdigen Familienunternehmen der Hawthornes, unterzeichnen. Diese Vereinbarung war seit Wochen Stadtgespräch gewesen, und Elijah Hawthorne, Signas ehemaliger Vormund, hatte sich damit gebrüstet. Doch als dieser jetzt mit einem Glas Wasser in den zitternden Händen bei seinem Beinahegeschäftspartner stand, war von Triumph keine Spur mehr zu sehen. Elijah war so kalkweiß geworden, dass die Äderchen unter seinen Augen blau schimmerten.
»Wer hat mir das angetan?« Lord Wakefields Geist schwebte über seiner Leiche, und seine durchscheinenden Füße berührten kaum den Boden, als er sich dem Tod und Signa zuwandte, die ihn als Einzige sehen konnten.
Dieselbe Frage hatte sich Signa auch gerade gestellt, doch inmitten der aufgescheuchten Menge konnte sie ihm ja schlecht laut antworten. Angespannt wartete sie ab, ob es noch weitere Opfer geben würde. War es damals auf Foxglove beim Tod ihrer Eltern auch so gewesen? War ihrer Mutter wie ihr selbst bei dem Geruch von Erbrochenem alles viel zu glitzernd und strahlend vorgekommen? Hatte sie auch das Gefühl gehabt, das schweißnasse Kleid und die schwere Lockenpracht zögen sie zu Boden?
Signa war so in Gedanken gefangen, dass sie zusammenzuckte, als der Tod ihr zuflüsterte: »Keine Sorge, Vögelchen. Heute Abend stirbt niemand mehr.«
Falls er sie beruhigen wollte, musste er sich schon ein wenig mehr anstrengen.
Everett hielt die schlaffe Hand seines Vaters, während ihm stumm die Tränen über die Wangen rannen.
»Lässt sich das wieder rückgängig machen?« Lord Wakefields Geist kniete vor seinem Sohn und schaute Signa so durchdringend, ja so hoffnungsvoll an, dass sie in sich zusammensackte. Wie gern würde sie ihm helfen!
Doch sie musste tun, als würde sie ihn gar nicht hören, denn hinter der Leiche stand ein Mann und beobachtete sie scharf. Allein seine Anwesenheit versetzte Signa in höchste Alarmbereitschaft.
Auch wenn sie den Mann noch nie gesehen hatte, wusste sie sofort, wer er war. In seiner Gegenwart verblassten alle Lichter, verstummten alle Schreie, bis sie nur noch ein fernes Summen waren. Obwohl der Tod sie noch fester umfasste, vermochte sie ihn nicht anzusehen, denn sie konnte den Blick nicht von dem Mann lösen, der sich Schicksal nannte, und seinem schiefen Grinsen nach zu urteilen, war er sich dessen auch bewusst.
»Endlich lernen wir uns kennen, Miss Farrow.« Seine Stimme klang wie dunkler Honig, dem die Süße fehlte. »Ich suche schon so lange nach Ihnen.«
Das Schicksal war größer als der Tod in seiner menschlichen Gestalt, aber schmal und drahtig. War der Tod hellhäutig, mit markantem Kinn und hohlen Wangen, so hatte das Schicksal bronzefarbene Haut mit irritierend reizenden Grübchen. Im Gegensatz zur dunklen Verlockung des Todes leuchtete das Schicksal so hell wie alles Licht der Welt.
»Was willst du hier?«, fragte der Tod eisig, denn Signa brachte keinen Ton heraus.
Das Schicksal legte den Kopf schief und musterte die Hand des Todes, die nur durch ein Stück Stoff von Signas Schulter getrennt war. »Ich wollte die junge Frau kennenlernen, die meinem Bruder das Herz gestohlen hat.«
Signa horchte auf. Bruder. Den hatte der Tod nie erwähnt, außerdem konnte sie es angesichts der angespannten Stimmung nicht so ganz glauben. Der Tod wirkte bedrohlicher denn je, während sich die Schatten unter ihm sammelten. Signa hätte sich gerne in die schützenden Schatten zurückgezogen, doch sie war wie festgenagelt. Unter dem bohrenden Blick des Schicksals kam sie sich vor wie ein Käfer, den es jederzeit zertreten konnte. Doch stattdessen machte das Schicksal zwei Schritte auf sie zu und schmiegte seine überraschend weiche Hand an ihre Wange. Weich wie die Hand eines Adligen, dachte Signa. Es beugte sich zu ihr herunter, seine Berührung versengte ihr die Haut.
»Lass sie los!« Die Schatten des Todes schossen auf das Schicksal zu und machten erst halt, als dieses mit dem Daumen über Signas Kehle strich.
»Das lässt du schön bleiben.« Das Schicksal ließ sich durch die Drohung des Todes nicht beirren, es schaute nicht einmal auf. »Du magst über die Sterbenden und die Toten herrschen, aber vergiss nicht, dass ich das Schicksal der Lebenden in der Hand habe. Solange das Herz der jungen Dame schlägt, gehört sie mir.«
Die Kälte wich aus dem Saal, als der Tod innehielt. Signa wollte sich aus dem Griff des Schicksals befreien, doch dieses hielt sie fest und kam ihr so nah, dass sich ihre Nasen beinahe berührten. Und wenngleich kein Wort fiel, schienen diese uralten Augen sie zu durchdringen. In diesem Blick lag etwas so Dunkles, so Fieberhaftes, dass Signa es nicht wagte, sich gegen einen Mann zur Wehr zu setzen, der sogar dem Tod Einhalt gebot.
Im Flüsterton wandte sich das Schicksal an sie: »Wissen Sie denn überhaupt, wer ich bin, Miss Farrow?«
Als sie aufschaute, war ihr, als würde sie direkt in die Sonne blicken. Und je länger sie hinsah, desto mehr verschwamm alles ringsherum. Gleißende Sonnenstrahlen nahmen ihr die Sicht und seine Stimme vernebelte ihr die Sinne.
Das Blut pochte schmerzhaft in ihren Schläfen. »Nur vom Namen her«, keuchte sie. Alles an diesem Mann drohte einen zu versengen: die Berührung, die Stimme.
Das Schicksal hielt ihr Gesicht noch fester umklammert, sodass sie den Blick nicht abwenden konnte. »Denken Sie nach. Geben Sie sich ein wenig mehr Mühe.«
»Da brauche ich nicht weiter nachzudenken, Sir.« Wenn sie nicht schleunigst wegkam, würde ihr Kopf explodieren. »Ich habe Sie noch nie gesehen.«
»Tatsächlich?« Das Schicksal ließ sie los. Trotz allem kam ihr seine Wut vertraut vor. Erinnerte sie an den Nestling, den sie vor ein paar Monaten in den Händen gehalten hatte, und auch an die verwundeten Tiere, die sie im Wald gefunden hatte. Als das Schicksal sich wieder aufrichtete und sich das Halstuch zurechtzog, hüllte der Tod sie sofort in seine Schatten.
»Was hat es zu dir gesagt?« Die Schatten des Todes waren kälter als sonst, unruhig und gereizt. Signa wollte etwas Beruhigendes sagen, doch die Frage des Schicksals blieb ihr im Halse stecken. Insgesamt dreimal unternahm sie den Versuch, sie auszusprechen, bis sie begriff, dass ihre Stummheit nichts mit dem Schreck oder den hämmernden Kopfschmerzen zu tun hatte. Wütend funkelte sie das Schicksal an.
Der Tod glitt wortlos an ihr vorbei. Dunkelheit breitete sich mit jedem seiner Schritte aus, ließ die vergoldeten Wände verblassen und legte sich um die Marmorsäulen. Sogleich bekam Signa wieder besser Luft und musste auch nicht mehr die Augen gegen das grelle Licht zusammenkneifen. Der Schnitter baute sich in seiner Menschengestalt vor dem Schicksal auf und sagte mit einer Stimme wie aus einem Schauerroman: »Wenn du sie noch einmal anfasst, wird es das Letzte sein, was du getan hast.«
Das Schicksal setzte seinen Sarkasmus meisterlich wie eine messerscharfe Waffe ein. »Sieh einer an, was für ein großer Junge du geworden bist! Und was für ein glühender Beschützer!« Auf sein Fingerschnippen hin drehte sich die Welt weiter. Das gerade noch gedämpfte Geschrei gellte jetzt erneut in Signas Ohren, und sie nahm das Gedränge um sie herum wieder wahr. Von dem Toten stieg ein immer intensiver werdender Geruch von Bittermandelöl auf. »Du bist nicht der Einzige, der drohen kann, Bruderherz. Soll ich’s dir mal zeigen?«
Es war unmöglich zu sagen, wie viel Zeit vergangen war oder ob überhaupt welche vergangen war, jedenfalls führte Elijah nun eiligst einen Wachtmeister in den Saal. Das Schicksal hatte sich unter die kleine Schar gemischt, die noch im Saal verblieben war. Auch wenn Signa nicht verstand, was es einer Frau ins Ohr flüsterte, entging ihr nicht deren Entsetzen. Die Frau gab das Gehörte fieberhaft an den Mann neben sich weiter, der es wiederum seinem Nachbarn erzählte. In Windeseile breitete sich so ein Gerücht aus, und bald schon waren alle Blicke auf Elijah und seinen Bruder Byron gerichtet, der neben ihm stand und sich zitternd auf seinen Gehstock aus Rosenholz stützte. Auch vor Blythe wichen alle zurück, als hätten die Hawthornes die Pest.
Elijah begegnete der plötzlichen Feindseligkeit im Saal erhobenen Hauptes, doch Blythe wurde bei dem lauten Getuschel immer kleiner. Argwöhnisch sah sie sich im ganzen Saal um, der auf einmal viel zu groß und hell wirkte. Alle wichen ihrem Blick aus.
Dieses Gefühl der Ausgrenzung kannte Signa nur allzu gut und wusste, wie zerstörerisch es war. Erbost wandte sie sich an die Schaulustigen. »Schämen Sie sich denn nicht? Hier ist gerade jemand gestorben, und Sie benehmen sich, als wäre es eine Theatervorstellung. Gehen Sie nach Hause und lassen Sie den Wachtmeister seine Arbeit verrichten.« Einige Gäste rümpften pikiert die Nase, ohne sich in Bewegung zu setzen, zumal sich nun das Schicksal aus dem Grüppchen löste und auf den Wachtmeister zusteuerte. Als Signa es aufhalten wollte, zog der Tod sie am Arm zurück.
Noch nicht. Seine Worte hallten ihr durch den Kopf. Solange wir nicht wissen, was es vorhat, sollten wir uns zurückhalten. Signa ballte die Fäuste und musste sich zusammenreißen, um nicht dazwischenzugehen.
Das Schicksal hätte für seinen gelungenen Auftritt Eintritt verlangen sollen. Demonstrativ deutete es auf die Hawthorne-Brüder.
»Er war’s«, verkündete es und schien noch ein bisschen größer zu werden, als ein Keuchen durch den Saal ging. Anders als der Tod war das Schicksal nun für alle im Saal zu sehen, ohne dass Signa etwas dagegen tun konnte. »Elijah Hawthorne hat Lord Wakefield das Glas gereicht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen!« Zustimmendes Gemurmel. Immer mehr der Umstehenden nickten und bestärkten sich gegenseitig in dem Glauben, genau dasselbe gesehen zu haben.
Mit unbewegter Miene beugte sich der Wachtmeister neben dem Toten hinunter und sammelte eine Scherbe des Champagnerglases vom Boden auf. Als er daran roch, verzog er die Nase. »Zyankali«, sagte er tonlos. Signa gab sich Mühe, überrascht zu wirken. Der Wachtmeister hingegen wirkte im Gegensatz zu den Gästen keineswegs verwundert. Ob es wohl damit zu tun hatte, was sie in den letzten Monaten in der Zeitung gelesen hatte?
Gift, insbesondere Zyankali, wurde immer beliebter. Da es schwer nachzuweisen war, eignete es sich hervorragend für einen Mord. Und weil es leicht zu verabreichen war und keinerlei körperliche Gewalt erforderte, wurde es zu Signas Leidwesen von manchen als typisch weibliche Waffe bezeichnet.
Ihr Blick fiel auf Everett und Eliza Wakefield. Eliza hielt sich noch immer von der Leiche abgewandt den Bauch, während Everett am ganzen Leib zitterte.
Das Schicksal trat an Everett heran, kauerte sich neben ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie haben doch auch gesehen, wie Elijah Hawthorne Ihrem Vater das Glas gereicht hat, nicht wahr?«
Everett riss den Kopf hoch. Seine Augen lagen tief in den Höhlen, ihr Licht war erloschen. »Alle beide.« Er kam auf die Beine und schrie fast. »Byron hat danebengestanden. Ich verlange, dass beide Hawthornes verhaftet werden!«
In Signa stieg die Wut auf, als sie den leichten Goldschimmer an den Fingerspitzen des Schicksals entdeckte. Wie langsam es die Finger bewegte. Signa hätte schwören können, dass dazwischen hauchdünne Goldfäden glitzerten.
»Hör mal zu, mein Junge«, setzte Byron an, brach jedoch ab, als Elijah ihn am Arm fasste.
»Wir gehen gerne mit aufs Revier und geben alles zu Protokoll, was wir wissen. Denn uns liegt ebenso daran, die Wahrheit herauszufinden.«
In diesem Moment war Signa unendlich dankbar dafür, dass Elijah in letzter Zeit immer nüchtern geblieben war. Nicht auszudenken, wie er vor ein paar Monaten noch reagiert hätte, als er vor Kummer über den Tod seiner Frau und die Krankheit seiner Tochter ständig betrunken gewesen war. Wahrscheinlich hätte er diese Situation auch noch komisch gefunden. Jetzt hingegen machte er ein entschlossenes Gesicht.
Der Wachtmeister führte die beiden Brüder durch den Ballsaal ab und gestattete ihnen, sich kurz von Blythe und Signa zu verabschieden, die Hand in Hand beisammenstanden.
Elijah nahm Blythes Gesicht in die Hände und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Mach dir keine Sorgen. Spätestens morgen früh ist alles geklärt.«
Dann umarmte Elijah Signa. Ihr wurde ganz warm ums Herz, als er ihr genau wie seiner Tochter einen Kuss auf die Stirn drückte. Vielleicht lag es auch daran, dass sie und Blythe den Tränen nahe waren, während Elijah die Ruhe selbst schien. Als würde er einer Einladung zum Tee folgen und nicht öffentlich des Mordes angeklagt worden sein.
»Macht euch keine Sorgen, Mädchen.« Er legte ihnen die Hände auf die Schultern. »Ihr habt mich bald wieder.«
Und damit waren Elijah und Byron verschwunden, aus Thorn Grove eskortiert wie zwei Gentlemen. Signa schaute ihnen noch hinterher und blinzelte die Tränen weg, denn das Schicksal sollte sie nicht weinen sehen. Den Triumph gönnte sie ihm nicht.
Elijah hatte nichts zu befürchten. Er musste lediglich ein paar Fragen beantworten. Bevor der Gerichtsmediziner kam und die Leiche abholte, wäre der Verdacht gegen die beiden Brüder schon ausgeräumt.
Signa drückte Blythes Hand, um ihr Mut zu machen. Doch ihre Cousine schenkte weder ihr noch ihrem Vater einen Blick, sondern funkelte das Schicksal an. Ehe Signa oder der Tod reagieren konnte, stürzte sie auch schon quer durch den Saal auf es zu, raffte dabei ihre Röcke so energisch, dass man um den Stoff bangen musste.
»Sie haben weder meinen Vater noch meinen Onkel in der Nähe des Glases gesehen!« Obwohl sie Absätze trug, war Blythe ein ganzes Stück kleiner als das Schicksal, was sie nicht davon abhielt, auf es zuzutreten und ihm den Zeigefinger in die Brust zu bohren. »Ich habe keine Ahnung, was Sie von meiner Familie wollen, aber Sie bekommen es nur über meine Leiche.« Damit stürmte sie an ihm vorbei auf Charles Warwick zu, den Butler auf Thorn Grove. Das Schicksal lachte bloß spöttisch, bevor es sich wieder Signa und dem Tod zuwandte. »Jetzt bist du an der Reihe, Bruder. Lass dir etwas einfallen.«
Und so schnell, wie es gekommen war, verschwand das Schicksal auch wieder und ließ nichts als Chaos zurück.
Kapitel 2
Eine Stunde später herrschte unheimliche Stille auf Thorn Grove.
Signa hielt den knorrigen Handlauf umklammert, während sie langsam und bedächtig die Treppe hinunterschlich. Nachdem die eisernen Riegel hinter dem letzten Klatschmaul vorgeschoben worden waren und Warwick sich in sein Quartier zurückgezogen hatte, horchte Signa bei jedem Knarzen und Knacken auf.
Ihr kitzelte die Nase vom Rauch der hastig ausgeblasenen Kerzen. Eigentlich sollte sie nicht einmal mehr die Hand vor den Augen sehen, doch es war hell wie auf einer sommerlichen Waldlichtung, denn der Glanz eines Geistes sickerte unter dem Türspalt des Ballsaals hindurch und wies ihr den Weg. Wahrscheinlich sprach der Tod noch mit dem verstorbenen Duke. Sie versuchte, unauffällig in den Saal zu spähen, und schrak zusammen, als hinter ihr eine Stimme ertönte.
»Der Duke bat um einen Moment allein mit seinem Sohn.«
Signa wich erschrocken zurück, bis ihr klar wurde, dass die tiefe, klangvolle Stimme dem Tod gehörte. Bevor sie ihn zu sich winkte, sah sie sich noch einmal zum Treppenhaus um, nicht dass jemand sie beobachtete. Dass einer der Hausangestellten sie kurz nach dem Mord in Selbstgespräche vertieft in der Dunkelheit vorfand, hatte ihr noch gefehlt.
Der Tod hatte wieder seine Schattengestalt angenommen und glitt hinter ihr über die Wand. In seiner Nähe erschauderte sie unwillkürlich. Tausend Fragen quälten sie, doch nachdem sie die Tür zum Salon geschlossen hatte, rutschte eine einfach heraus: »Wann wolltest du mir eigentlich sagen, dass du einen Bruder hast?«
Der Tod seufzte, blies ihr mit seinem Atem ein paar Haare aus dem Gesicht und nahm ihre Hände in seine. Hätte sie keine Handschuhe getragen, hätte diese Berührung schon genügt, um ihr Herz anzuhalten und die Kräfte der Schnitterin hervorzubringen. Doch so blieb Signa Mensch, als sie die Finger mit seinen verschlang.
»Ich habe schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen«, antwortete der Tod schließlich. Sanft strich er ihr mit den Schatten eine Haarsträhne hinters Ohr, sorgfältig darauf bedacht, ihre Haut nicht zu berühren. »Wäre es uns nicht unmöglich zu sterben, hätte ich nicht einmal gewusst, ob ich noch einen Bruder habe.«
Signa führte sich noch einmal vor Augen, wie er in Gegenwart des Schicksals in sich zusammengesunken war, sie fest umklammert gehalten hatte. Und selbst jetzt, als sie allein waren, drängte er sich in der Ecke gegen ein Bücherregal und sprach ganz leise. Signa gefiel es ganz und gar nicht, dass er sich so klein machte. Das hatte der Tod gar nicht nötig. Angst brauchte er doch keine zu haben. Wer war dieses Schicksal, das einfach angerauscht kam und solchen Einfluss auf seinen Bruder hatte?
»Es spielt mit uns«, sagte Signa. Ihre Haut kribbelte. Das Auftauchen des Schicksals hatte sie mehr aus der Fassung gebracht, als sie zugeben wollte. Erst als der Tod sie zu sich heranzog, beruhigte sie sich ein wenig. Mit dem Daumen strich er ihr sanft über den Handschuh.
»Natürlich spielt er mit uns. Das Schicksal bestimmt das Leben seiner Schöpfungen – was sie sehen, sagen, wie sie sich bewegen … Ihre Lebenswege und Taten werden von ihm vorherbestimmt. Mein Bruder ist gefährlich. Und warum auch immer er aufgetaucht ist, er hat keine guten Absichten.«
Signa widerstrebte es, sich als Schöpfung des Schicksals zu begreifen. Irgendwie machte es ihre Erfolge zunichte, als hätte sie alles, was sie erreicht hatte, allein dem Schicksal zu verdanken. Als hätte es bei jeder schwierigen Entscheidung und jedem Triumph seine Hand im Spiel gehabt.
»Jedenfalls hat es dich nicht wie einen Bruder behandelt.« Signa presste ihren Daumen sanft in seine Handfläche. Am liebsten hätte sie sich die Handschuhe von den Händen gerissen, um ihn auf der Haut zu spüren.
»Eine sehr lange Zeit hatten wir außer uns niemanden, deshalb haben wir uns als Brüder verstanden. Doch heute heißt das gar nichts mehr. Das Schicksal hasst mich mehr als alle anderen.« Bevor sie weiter nachbohren konnte, ergriff er ihr Kinn und drehte ihren Kopf zu sich. Obwohl es im Salon stockdunkel war, konnte sie unter den wabernden Schatten sein Kinn ausmachen. Ihre Anspannung wich, als er ihre bloße Haut zum ersten Mal in dieser Nacht berührte. Eine erfrischende Kühle durchflutete sie und sie gab sich seiner Berührung hin.
»Sag mir die Wahrheit.« Als die Lippen des Todes ihr Ohr streiften, bekam Signa weiche Knie. »Hat es dir wehgetan, Vögelchen?«
Signa verfluchte ihr verräterisches Herz. Eigentlich hatte sie noch mehr von ihm in Erfahrung bringen wollen, denn ihr war gerade klar geworden, dass es noch viel gab, das sie nicht über den Tod wusste. Doch unter seiner Berührung schmolz sie dahin und nach ein paar Schlägen setzte ihr Herz aus.
Wie lange hatte er sie nicht mehr so im Arm gehalten? Tage? Wochen? Denn damit sie sich sehen konnten, musste jemand in ihrer Nähe tot sein oder im Sterben liegen, und seit sich Blythe von ihrer Vergiftung mit Belladonna erholt hatte, kam das eigentlich kaum noch vor. Darüber war Signa natürlich froh, denn ihr Leben konnte wahrlich weniger Tote und mehr Stabilität vertragen. Dennoch lag sie nachts häufig wach und dachte sehnsüchtig an seine brennenden Küsse und seine Schatten auf ihrer Haut. Viel zu lange hatte sie sich nur in Gedanken mit ihm austauschen können, ohne dass er anwesend war, jetzt geriet ihre Selbstbeherrschung ins Wanken. Ihr Verstand wollte Antworten, ihr Körper wollte ihn.
»Versuchst du, mich irgendwie abzulenken?« Signa zog die Handschuhe aus und warf sie zu Boden.
Als der Tod tief und kollernd lachte, spürte sie ein Kribbeln im Unterleib. Ihr Verlangen war erwacht. »Funktioniert es denn?«, fragte er.
»Nur allzu gut.« Signa strich ihm über den Arm. Unter ihrer Berührung schmolzen die Schatten und Haut kam zum Vorschein. Haar, so weiß wie Knochen, eine Statur, hochgewachsen wie eine Weide und breit wie eine Eiche. Augen, unergründlich wie Galaxien, in denen das gleiche wilde Verlangen stand, das sie empfand. »Trotzdem möchte ich wissen, wie dein Leben ausgesehen hat, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich will alles wissen. Das Gute und das Schlechte.«
Außer dem scharfen Kratzen eines Zweiges, den der Frühlingswind gegen das Fenster peitschte, war lange nichts zu hören. Dann flüsterte der Tod: »Und wenn du nun erfährst, dass es mehr Schlechtes als Gutes gibt?«
Solange es ging, genoss sie es, ihn zu streicheln, und prägte sich dieses Gefühl gut ein. »Ich werde immer wissen, dass all deine Erfahrungen dich zu dem Mann gemacht haben, der du jetzt bist. Und dieser Mann gefällt mir sehr gut.«
Er schlang den Arm um sie und vergrub die Finger in den Falten ihres Kleides. »Wie kommt es nur, dass du immer genau das Richtige sagst?«
Signa schmiegte sich lachend an ihn. »Vor ein paar Monaten hast du noch genau das Gegenteil behauptet. Hast du das schon wieder vergessen?«
»Wie könnte ich deine spitze Zunge vergessen, Vögelchen? Und ich werde dir alles über mich erzählen, was du hören willst, aber zuvor haben wir noch einiges aufzuholen.«
Und während der Tod sie anhob und auf den kleinen Tisch legte, fegten seine Schatten alle Schachfiguren zu Boden, mit denen sie im Winter noch gegen Elijah gespielt hatte. Schmunzelnd dachte sie an die Zeit zurück, in der sie den Tod noch glühend gehasst hatte. Und jetzt? Jetzt lag sie mit hochgeschobenen Röcken auf ebendiesem Tisch, schlang die Beine um ihn und küsste ihn stürmisch. Sein Kuss schmeckte wunderbar, und sie verzehrte sich nach seinen Lippen, wollte sie überall auf der Haut spüren. Und als ihnen der Tisch zu unbequem wurde, trug er sie zur Chaiselongue. Mit einem Knie zwischen ihren Beinen beugte er sich über sie.
Er liebkoste ihren Hals, ihr Schlüsselbein und das zarte Fleisch über ihrem Korsett. »Jeden Tag habe ich an dich gedacht.« Seine Stimme war ein reißender Fluss, der sie mit sich nahm und sie zu verschlingen drohte. »Daran habe ich gedacht und wie ich meine Abwesenheit bei dir wiedergutmachen könnte.«
Es gab nicht genügend Worte auf dieser Welt, um die Lust auszudrücken, die Signa dabei empfand. Wenn sie eines Tages alt wäre und ihr Menschenleben sich dem Ende zuneigte, würde die Kälte sie rufen und nicht wieder loslassen. Auch wenn sie diesen Tag nicht unbedingt herbeisehnte, so fürchtete sie sich auch nicht davor. Mit der Zeit hatte sie Gefallen an der Kälte gefunden, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ, und sie genoss die Macht, die ihr daraus zuwuchs, denn sie war Teil ihres Wesens. Und deshalb dirigierte sie seine Hände zu den Schnüren ihres Korsetts.
Doch statt sie dann loszulassen, hielt sie inne, denn auf der Chaiselongue, auf der sie jetzt lagen, hatten vor nicht allzu langer Zeit Blythe und Percy gesessen, um einer ihrer ersten Anstandsstunden beizuwohnen. Ihr Blick huschte zu dem dicken Perserteppich, über den sie gestolpert war, als Percy ihr bei der Tanzstunde geholfen hatte. Signa schob den Tod von sich und griff sich an die Brust, als sie an ihre letzte Begegnung mit ihrem Cousin dachte. Da war er in einem brennenden Garten dem Höllenhund zum Fraß vorgesetzt worden.
»Signa?« In Erinnerung versunken, nahm sie seine Stimme kaum wahr. Signa bereute ihre Entscheidung von damals nicht, denn hätte sie sich anders entschieden, wäre Blythe jetzt tot. Dennoch hatte sie immer noch Percys Lachen im Ohr. Sah sein Lächeln vor sich und seine rote Nase, als sie im Schnee getollt hatten.
»Hier habe ich tanzen gelernt.« Sie krallte die Finger in die Kissen. »Percy hat mir dabei geholfen.«
Mehr brauchte der Tod nicht zu wissen. Sofort richtete er sich auf und nahm sie in die Arme. Signa saß zwischen seinen Schenkeln, an seine angenehm kühle Brust gelehnt. »Du trägst nicht die Verantwortung für den Tod deines Cousins.«
Sosehr sie seinen Trost auch zu schätzen wusste, stimmte es trotzdem nicht.
»Ich hatte die Wahl«, sagte sie.
Weil er das Kinn auf ihren Kopf gebettet hatte, spürte sie die Vibration seiner Stimme. »Und wenn du noch einmal vor der Wahl stündest, würdest du dich dann anders entscheiden?«
Würde sie nicht, aber genau das machte ihr zu schaffen. Was ihr schlaflose Nächte bescherte, war nicht ihre Entscheidung, Percys Leben gegen Blythes eingetauscht zu haben, sondern dass sie es jederzeit wieder tun würde. Dabei hatte sie Percy wirklich ins Herz geschlossen gehabt. Ihn in den Tod zu schicken, war ihr viel zu leicht gefallen. Vielleicht steckte in ihr schon mehr von einer Schnitterin, als ihr lieb war.
»Ich werde dir nicht vormachen, dass man es als Schnitter leicht hat.« Zärtlich legte er den Arm um sie und sie lehnte sich mit dem Kopf an seine Schulter. »Vielleicht hätte ich dir diese Entscheidung abnehmen sollen, aber da gab es keine einfache Lösung. Und ich wollte nicht, dass du beide verlierst.«
»Du kannst mich ja nicht vor mir selbst beschützen.« Während sie das sagte, ging ihr die Bedeutung dieser Worte auf. Signa hatte die dunkle Macht in sich akzeptiert. Dennoch gab es immer noch diese Stimme in ihrem Hinterkopf, die sie schon seit der Kindheit begleitete und die ihr das Gefühl verlieh, nicht richtig zu sein.
Als sich jemand vernehmlich räusperte, löste sich Signa erschrocken vom Tod und sah sich um. Wer konnte das sein? Sie hatte nicht einmal gehört, wie die Tür geöffnet wurde. Zum Glück war die Tür auch nach wie vor geschlossen, denn es war der Geist von Lord Wakefield, der sie von der Schwelle aus musterte.
»Kein Wunder, dass Sie sich so wenig für meinen Sohn interessiert haben.« Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und bedachte Signa mit Missbilligung. Dann wandte er sich dem Tod zu. »Auch wenn ich nicht gerne an das denke, was jetzt auf mich zukommt, zieht es mich doch immer wieder zu Ihnen zurück.«
Der Tod streckte ihm die Hand entgegen. »Das ist ein gutes Zeichen. Es heißt, dass Sie bereit sind, diese Welt zu verlassen.«
Statt die Hand zu ergreifen, fragte der Duke: »Tut es weh?«
Der Tod schenkte ihm sein strahlendes Lächeln. »Überhaupt nicht.«
Wie sanft er sprach, berührte Signa. All die Jahrhunderte hatten sein Herz nicht verhärtet. Der Duke entspannte sich zusehends, streckte ihm die Hand hin, zog sie im letzten Moment aber wieder weg.
»Mein Sohn wird die Geschäfte übernehmen müssen.« Die Worte sprudelten nur so aus dem Duke heraus. »Ich weiß nicht, ob ich ihn anständig vorbereitet habe.«
Abermals reichte ihm der Tod die Hand. »Sie haben Ihre Pflicht erfüllt. Ihr Sohn wird zurechtkommen.«
»Die Aufgaben verlangen einem viel ab. Vielleicht sollte ich bleiben und über ihn wachen. Everett wird nicht ruhen, bis er meinen Mörder gefunden hat.«
»Ich weiß«, sagte Signa. Weil sich der letzte Geist, mit dem sie Kontakt gehabt hatte, ihrer bemächtigt hatte, musste sie gegen einen Fluchtimpuls ankämpfen, als sich Lord Wakefield ihr zuwandte. Gut kannte sie Everett nicht, doch sie hatte sein Gesicht gesehen, als er seinen toten Vater im Arm gehalten hatte. »Da haben Sie auf jeden Fall recht, Mylord. Und ich werde Ihrem Sohn bei der Suche nach dem Mörder helfen.« Ob sie wollte oder nicht, das Schicksal hatte es zu ihrer Aufgabe gemacht.
Nachdem es nun keine Ausflüchte mehr gab, verneigte sich der Lord vor ihr und ergriff die ausgestreckte Hand des Todes.
»Kümmern Sie sich um ihn.« Dem Duke brach die Stimme, als sich die Schatten des Todes um ihn legten.
Bevor der Tod verschwand, warf er Signa noch einen letzten Blick zu. Ich weiß noch nicht, wie oder wann, aber ich finde bald einen Weg zu dir zurück.
Signa rang sich ein Lächeln ab. Könnte sie ihm doch bloß glauben. Zweifel und Einsamkeit sollten eigentlich der Vergangenheit angehören, doch als die Schatten den Tod und den Duke verschlangen, wurde ihr bewusst, dass es vielleicht bloß der Anfang gewesen war.
Nachdem die Luft in ihre Lunge zurückgekehrt war, strich sie sich die Röcke glatt und zog ihre Handschuhe wieder an. Kaum war sie aber aufgestanden und wollte zur Tür gehen, geriet ihr Herz ins Stolpern. Signa schwankte und suchte Halt am Tisch.
Es war ja nicht das erste Mal, dass sie den Tod verführt hatte, doch dieses Mal … Irgendetwas war anders. Auf einmal wurde sie von einem Hustenanfall geschüttelt und musste sich die Hand vor den Mund halten. Mit der anderen hielt sie sich krampfhaft am Tisch fest. Ihr war, als hätte sie Scherben geschluckt, die sich nun durch ihre Eingeweide bohrten.
Es vergingen mehrere Minuten, bevor sie wieder Luft bekam. Als sie zitternd und keuchend die Hand vom Mund nahm, war ihr weißer Handschuh blutrot.
Kapitel 3
Blythe
Der Morgen graute schon, dennoch hatte Blythe noch immer nichts von ihrem Vater und ihrem Onkel gehört. Unruhig lief sie in ihrem Salon umher, ärgerte sich über den dicken Perserteppich, dessen Schönheit in einer Nacht wie dieser vollkommen deplatziert wirkte. Deshalb trampelte sie extra darauf herum.
Blythe trug noch ihr Ballkleid. Wie glücklich sie gewesen war, endlich Gelegenheit zu haben, etwas so Edles tragen zu können. Doch nun schleiften die schimmernden Röcke hinter ihr her und verfingen sich bei jedem Schritt.
Immer wieder horchte sie nach der Tür. Wartete darauf, dass Warwick oder Signa oder irgendjemand kam, um ihr zu vermelden, dass ihr Vater wieder da und alles ein großes Missverständnis gewesen sei. Vielleicht war es auch gar kein Zyankali, sondern ein Herzinfarkt, der einfach zeitlich sehr unpassend kam. Da konnte sie nur hoffen und beten. Es gab so viele Plätze auf dieser Erde, wo man sterben konnte, warum ausgerechnet auf Thorn Grove? Und musste es dann auch noch ein Duke sein? Blythe hatte sich gerade erst von ihrer Krankheit so weit erholt, dass sie wieder am sozialen Leben teilnehmen konnte. Und jetzt? Von all dem Gerede um ihre Familie war sie schon völlig erledigt. Vor ihrem inneren Auge sah sie die entsetzten Blicke der Gäste, als Lord Wakefield zu Boden stürzte, und wie sie sich gleich darauf ihrem Vater als Quelle allen Übels zuwandten.
Blythe ballte die Fäuste. Wie gerne hätte sie den Gaffern das Maul gestopft, um den haarsträubenden Klatsch zu unterbinden. Ja, ihre Familie hatte in letzter Zeit tragische Zeiten durchlebt. Und Thorn Grove wirkte mit seinem absonderlichen Dekor recht düster, aber musste man da gleich an Übersinnliches denken?
Hoffentlich nicht. Leise Zweifel regten sich allerdings auch bei ihr und fütterten ihr Hirn mit wilden, unmöglichen Ideen. Dunklen Ahnungen, dass hinter dem Vorfall mehr steckte, als es den Anschein machte. In letzter Zeit war sie häufig zur Geisterstunde aus einem Traum geschreckt, in dem sie beim Tod an die Tür geklopft hatte.
An die Fieberfantasien während ihrer Krankheit konnte sie sich kaum noch erinnern, die lagen hinter einem Schleier und hatten wenig mit der Wirklichkeit und ihrem Leben zu tun, doch die Träume waren ihr sehr präsent. Deutlich erinnerte sie sich, wie ihr Vater ihr das Haar zurückgehalten hatte, während sie sich übergab. Wie er ihrer Gouvernante Marjorie die Schuld für alles gegeben hatte. Und wie Signa mit einem gesichtslosen Schemen gesprochen hatte, den offenbar sonst keiner sehen konnte.
In ihren Träumen hatte sie jedes Mal, wenn sie kurz vor dem Tod stand, eine seltsame Regung verspürt, ein warmes, leichtes Pulsieren. So war es ein paar Tage vor Signas Eintreffen gewesen und dann wieder in der Nacht von Percys Verschwinden. Selbst jetzt hatte sie das Gefühl, ein heißes Band schnüre sich um ihren Brustkorb, würde fester und fester gezurrt, bis sie kaum noch Luft bekam. Mitunter empfand sie es als angenehm, war es doch ein verrücktes Andenken an all das, was sie überstanden hatte. Dann wieder, wie jetzt, brandete heiße Wut in ihr auf und ließ sie nicht zur Ruhe kommen.
Vor allem wenn sie an diesen Mann dachte, der ihren Vater des Mordes beschuldigt hatte. Diesen Mann mit der bronzefarbenen Haut und den gleißend hellen Augen hatte sie noch nie zuvor gesehen, was allerdings nichts zu bedeuten hatte, denn sie war fast ein ganzes Jahr lang krank gewesen und kannte einen Großteil der Leute oft nicht.
Der Mann hatte das Aussehen und Auftreten eines Adligen, doch ob er nun ein Prinz, ein Duke oder Gott höchstpersönlich war, der vom Himmel gestiegen war, um sie alle auszulöschen, so war er doch ein Narr, wenn er glaubte, einfach in ihr Haus eindringen und ihren Vater beschuldigen zu können. Denn ihrer Meinung nach konnte genauso gut er der Mörder sein, und das würde sie auch jedem mitteilen, der es hören wollte.
Erst als die Sonne richtig aufgegangen war, riss sie sich zusammen, flitzte ins Schlafzimmer, dann wieder zurück in den Salon, um einen geeigneten Stuhl zu finden, auf dem sie sich mit ihrem voluminösen Kleid ausruhen konnte. Da sie sich nicht hatte von ihrer Zofe helfen lassen wollen, blieb ihr nichts anderes übrig, als hilflos am Korsett zu zerren. Irgendwann fiel sie erschöpft auf die Chaiselongue und legte die Füße mit den Stiefeletten auf den Tisch. Danach starrte sie gefühlt stundenlang an die Decke, bis es an der Tür klopfte und sie aufsprang. Ihr Haar war bestimmt völlig verstrubbelt und das Rot, das sie auf Lippen und Wangen aufgetragen hatte, verschmiert. Dennoch unternahm sie keinerlei Anstalten, sich zurechtzumachen, denn für sie zählte nur eines.
»Vater?« Sie versuchte, die Enttäuschung zu verbergen, als vor ihr bloß ihre Zofe Elaine Bartley stand.
»Wir haben noch nichts von ihm gehört, Miss.« Elaine trat in den Salon und quittierte Blythes Zustand mit einem Stirnrunzeln.
Obwohl Blythe natürlich vor allem auf Nachrichten hoffte, warf sie einen sehnsüchtigen Blick auf das Tablett mit Tee und Gebäck, das Elaine auf dem Tisch abstellte.
»Ich dachte mir, dass Sie noch wach sind. Wie Miss Farrow. Und auch Mr Warwick. Frühstück gibt es in zwei Stunden, aber sicher haben Sie die ganze Nacht kein Auge zugetan und sind hungrig.«
Blythe war hungrig. Und wie. Doch bevor sie sich einen Tee einschenken konnte, sagte Elaine: »Wollen Sie vorher noch in etwas Bequemeres schlüpfen? Ein Ballkleid ist sicher nicht ideal zum Essen und Schlafen.« Obwohl das Tageslicht schon durch die Vorhänge schien, half Elaine ihr ins Nachthemd. Erst aus der Nähe bemerkte Blythe, dass Elaines Augen rot gerändert waren und sie immer wieder blinzelte. Dann fasste sie sich an die Stirn und schwankte leicht.
»Bist du krank?«, fragte Blythe und hielt vorsorglich den Atem an. Nachdem sie nun gerade wieder gesund geworden war, wollte sie sich nicht anstecken.
Elaine errötete. »Immer mal wieder, Miss. Wahrscheinlich ist es bloß der Beifuß. Die Pollen machen mir jedes Jahr zu schaffen.« Elaine trat zurück, damit Blythe sich das Nachthemd glatt streichen konnte. Es war ja so viel leichter und luftiger. Als Blythe in den großen Spiegel schaute, um ihre erbärmliche Erscheinung in Augenschein zu nehmen, blieb ihr Blick an Elaine hängen.
Kaltes Grauen erfasste sie. Dunkellila Augenringe und eine abgemagerte hinfällige Gestalt. Die Elaine im Spiegel war nur noch Haut und Knochen. Blythe blieb der Schrei im Halse stecken. Weder konnte sie aufhören zu zittern, noch konnte sie wegschauen, als Elaine sich ihr zuwandte. Durch Elaines pergamentdünne Haut zeichnete sich jeder Knochen im Schädel ab, ja sogar jeder Zahn. »Haben Sie sich erkältet, Miss?«, fragte Elaine.
Ihre Stimme war wie das Schaben der Zweige an der Fensterscheibe, so aggressiv, dass Blythe erschrak. Eine vertraute Übelkeit überkam sie. War sie eingeschlafen und träumte? Wie sonst ließen sich die Schatten erklären, die sich von Elaine wie eine Fäulnis ausbreiteten?
Als Blythe keuchend den Blick von ihr riss, nahm diese ihre Hand, um sie zu stützen. Blythe wurde eiskalt.
»Miss?«, flüsterte Elaine. »Miss Hawthorne, geht es Ihnen nicht gut?«
Mit einem Aufschrei wich Blythe vor der Berührung dieses Skeletts zurück. Bloß … dass Elaine überhaupt kein Skelett war. Alles an ihr war normal wie immer. Selbst als sie ihre Reflexion im Spiegel betrachtete, wirkte Elaine, abgesehen von den geröteten und leicht glasigen Augen, gesund und munter.
Blythe schluckte. Wenn sie nicht träumte, hatte der fehlende Schlaf wohl Halluzinationen ausgelöst. Gezielt schaute sie weg und atmete ruhig, um sich nicht zu übergeben. Sie wollte auf keinen Fall, dass Elaine noch länger als nötig bei ihr blieb.
»Ein wenig Ruhe würde dir guttun.« Blythes Stimme zitterte, denn sie rang sich jedes Wort ab, versuchte diese skurrilen Visionen aus ihren Gedanken zu verbannen. »Nimm dir mal den Tag heute frei.«
Das letzte Mal, als sie halluziniert hatte … Nein. Unmöglich, dass sie wieder jemand vergiftete. Daran wollte sie erst gar nicht denken.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber das kommt nicht infrage«, antwortete Elaine. »Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich Sie und Ihre Cousine jetzt im Stich lassen würde?« Nachdem Blythe sich gesetzt hatte, kniete sie vor ihr und half ihr, die langen, weißen Handschuhe auszuziehen. Blythe musste sich zusammenreißen, sonst hätte sie gezuckt, als Elaines Finger ihre nackte Haut streiften.
Kalt. Wie kalt Elaines Hände waren!
Zum Glück beeilte Elaine sich und stand gleich wieder auf. »Faulenzen liegt mir nicht. Und in Zeiten wie diesen schon gar nicht.« So unheilvoll, wie ihre letzten Worte klangen, wusste Blythe sofort, dass sie auf die seltsamen Vorkommnisse auf Thorn Grove anspielte. Die rätselhafte Serie von Morden und die Gerüchte, dass es auf Thorn Grove spukte.
Doch nachdem, was sie gerade im Spiegel beobachtet hatte, waren es vielleicht gar keine Gerüchte. Mit zusammengekniffenen Augen musterte sie Elaine erneut. Weder konnte sie irgendeine kränkliche Blässe an ihr erkennen noch eine Fäulnis. Auch ihre Stimme klang wieder ganz normal. Als hätte sich Blythe alles bloß eingebildet.
»Danke für deine Hilfe«, sagte Blythe in einem Ton, der deutlich machte, dass Elaine entlassen war. Damit wandte sie sich ab und trommelte mit den Fingern gegen ihre Hüfte, um sich abzulenken. Ihre Fantasie spielte ihr offenbar einen Streich. Auf dem Fest hatte sie Champagner getrunken, außerdem war es ein langer und anstrengender Tag gewesen. Daran musste es liegen. »Wir sehen uns beim Frühstück.«
Elaine knickste, bevor sie ging. Und als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, überkam Blythe eine bleierne Müdigkeit.
Vielleicht war der Ball doch zu viel für sie gewesen, so kurz nach ihrer Krankheit. Bis ins Bett schaffte sie es nicht, aber sie griff nach ihrer Teetasse und einem Johannisbeerscone, der allerdings viel zu süß schmeckte. Während sie kaute, hoffte sie, dass ihr Vater zum Frühstück zurück sein würde und sie diesen unglückseligen Tag hinter sich lassen konnten.
Kapitel 4
Signa hatte keine genaue Vorstellung davon, wie viele Menschen überhaupt noch auf Thorn Grove lebten. Elijah hatte die Dienerschaft nach Blythes Krankheit ziemlich ausgedünnt, nur noch die behalten, denen er traute oder für die die Mädchen ihre Hand ins Feuer legten. Ein paar neue Dienstboten waren eingestellt worden, denn natürlich mussten die Pferde versorgt und das weitläufige Herrenhaus in Schuss gehalten werden. Doch als Signa im Morgengrauen durch die trostlosen Flure an den Gemälden der längst verstorbenen Hawthornes vorbeilief, drängte sich ihr der unheimliche Vergleich mit einem Friedhof auf, denn das Gemäuer war mit den Erinnerungen längst verstorbener Bewohner getränkt, während man keiner Menschenseele begegnete. Wenn das Personal nach diesem neuerlichen Todesfall seine Habseligkeiten nehmen und sich woanders eine Stellung suchen würde, wäre es nicht weiter verwunderlich.
Einen Silberstreif am Horizont gab es zumindest: Ihre ominöse Krankheit von gestern Nacht war schnell verklungen. Die blutigen Handschuhe würde sie im Garten vergraben und den Vorfall aus dem Gedächtnis streichen. Schließlich konnte sie nicht sterben, außerdem hatte sie unter fürchterlichem Druck gestanden. Vielleicht war alles ganz harmlos. Oder es war Gift im Spiel. Oder aber doch etwas, mit dem sie sich eingehender auseinandersetzen musste, als ihr lieb war.
Nachdem sie die Treppe hinuntergegangen war, stellte sie erleichtert fest, dass der Frühstückstisch gedeckt war. Also musste es außer ihr noch jemanden im Haus geben. Als sie beim Hinsetzen mit den Stuhlbeinen über den Holzboden schabte, kam Warwick aus der Küche. Die Brille saß ihm tief auf der Nase, die Augen waren gerötet. Dass sie selbst nicht ganz so mitgenommen wirkte, lag allein daran, dass die jüngsten Ereignisse für sie weder neu noch überraschend waren. Auf das Schicksal war sie vielleicht nicht gefasst gewesen, aber dass ihr kein einfaches Leben bevorstand, war ihr klar. Womöglich sollte sie künftig immer vom Schlimmsten ausgehen, um dann angenehm überrascht zu sein, wenn es doch anders kam.
»Guten Morgen, Miss Farrow.« Als Warwick nur mehr ein Krächzen hervorbrachte, räusperte er sich und unternahm einen neuen Anlauf. »Soll ich Ihnen das Frühstück bringen?«
Signa blickte auf die leeren Stühle. Die Stille nagte an ihren Nerven. »Wollen Sie nicht mit mir gemeinsam essen, Warwick?«, fragte sie, obwohl sie wusste, dass es gegen mindestens hundert alberne gesellschaftliche Regeln verstieß. »Gibt es schon Neuigkeiten von meinem Onkel und seinem Bruder?«
Warwick verzog den Mund, sodass sein buschiger Schnauzer eine gerade Linie bildete. Auf ihre Einladung, mit ihr zu speisen, ging er weiter nicht ein, sondern blieb stehen. »Leider noch nicht.«
Ihr war flau im Magen. Dass die beiden so lange auf der Wache festgehalten wurden, war kein gutes Zeichen. »Was ist mit Miss Hawthorne? Wie geht es ihr?«
Als er gerade antworten wollte, ertönte eine weibliche Stimme hinter ihm. »Ihr ist es schon besser gegangen.« Blythe schleppte sich ins Speisezimmer und sah schlimmer aus als sie und Warwick zusammen. In ihrem verzottelten eisblonden Haar konnte man noch die Abdrücke der Klammern sehen, mit denen es festgesteckt gewesen war. Filzige Strähnen hingen über ihren knochigen Schultern. Puderreste hatten sich in den Linien und Fältchen ihres Gesichts abgesetzt, der Lippenstift war verwischt. Wie sonst nur Elijah trug Blythe einfache grüne Samtslipper und einen Morgenrock über einem locker fallenden elfenbeinfarbenen Nachthemd. Obwohl Warwick über ihren Aufzug offenkundig bestürzt war, nahm Signa ihre Cousine in den Arm. Ihr tat es gut, sie unversehrt zu sehen. Nachdem Blythe sie einmal fest gedrückt hatte, glitt sie neben Signa auf den Stuhl und griff sogleich nach der Zeitung.
Rasch überflog sie die Seiten, bis sie erleichtert aufatmete. »Von Lord Wakefields Tod steht da nichts.«
»Vielleicht hat Everett die Schreiberlinge bestochen«, sagte Signa. Sollte sie erleichtert sein oder sich noch mehr Sorgen machen? »Sonst hätte es bestimmt eine Schlagzeile gegeben.«
Ohne von der Zeitung aufzuschauen, fragte Blythe: »Ob sie Everett jetzt zum Duke ernennen werden?«
»Davon gehe ich aus.«
Blythe faltete die Zeitung zusammen, legte sie beiseite und wandte sich zum Butler um. »Gilt das Frühstücksangebot auch für mich?«
Warwick schob sich die Brille hoch und nahm wieder Haltung an. Eigentlich sollte ihm eigentümliches Verhalten nur allzu vertraut sein, schließlich arbeitete er schon viele Jahre für Elijah. Doch von Blythe schien er Derartiges nicht gewohnt zu sein. Vielleicht stärkte es auch nicht unbedingt das Vertrauen in ihren Gemütszustand, dennoch konnte Signa nicht umhin, Blythe dafür zu bewundern, ja geradezu zu beneiden, dass sie die gesellschaftlichen Erwartungen so geflissentlich ignorierte, denn sie selbst war in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um sich standesgemäß zu kleiden. Grotesk, wenn man sich die gestrigen Ereignisse vor Augen führte.
Nachdem Warwick kurz verschwunden war, setzte er ihnen wenige Minuten später Platten mit Porridge, Schinken, Scones, Räucherfisch, Eiern und Toast vor. Elaine half ihm. Summend und mit rosigen Wangen goss sie Tee ein und stellte die Kanne anschließend auf den Tisch.
Während Blythe sich eine Tasse Tee nahm, lagen ihre winterblauen Augen auf Elaine, die kurz knickste und dann den Raum verließ.
»Wirkt Elaine irgendwie krank auf dich?«, Blythe beugte sich verschwörerisch vor. »Fiebrig? Oder asthmatisch?«
Obwohl die Frage eigenartig war, antwortete Signa ihr. »Eigentlich nicht. Wobei ich sie noch nie habe summen hören.«
»Siehst du!« Blythe setzte die dampfende Tasse an die Lippen. »Und ausgerechnet heute.«
Da Signa selbst ein ungewöhnliches Verhältnis zum Tod hatte, konnte sie sich nicht anmaßen, andere für ihren Umgang mit Trauer zu kritisieren. Doch Elaine war sonst immer ein Ausbund an Anstand, und deshalb erschien sie auch ihr ein wenig sonderbar. »Mir kommt alles seltsam vor. Ich weiß auch nicht, warum die Befragung so lange dauert.«
»Ich verstehe überhaupt nichts mehr.« Blythe machte es sich jetzt im Schneidersitz auf dem Stuhl bequem und wandte sich ganz Signa zu. »Wie kommen die bloß auf die Idee, mein Vater könnte den Duke ermorden wollen? Er wollte doch das Grey’s endlich los sein.«
Auch wenn das stimmte, fühlte Signa sich verpflichtet, ihrer Cousine eine andere unschöne Wahrheit zu unterbreiten: »Er hat dem Duke aber das Glas gereicht.« Bevor Blythe ihr den Kopf abreißen konnte, ergriff sie beschwichtigend ihre Hand. »Natürlich macht ihn das nicht automatisch zum Mörder, aber in den Augen des Wachtmeisters mag er verdächtig sein.«
»Was ist mit diesem Mann von gestern Abend?« Blythe biss beherzt in ihren Toast. »Der, der meinen Vater beschuldigt hat? Hast du den vorher schon mal gesehen?«
Wieder diese Frage. Dieselbe, die ihr das Schicksal auch gestellt hatte.