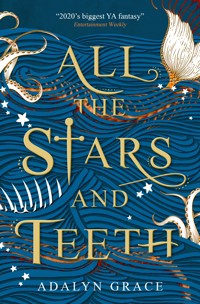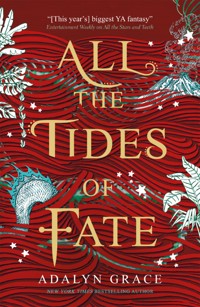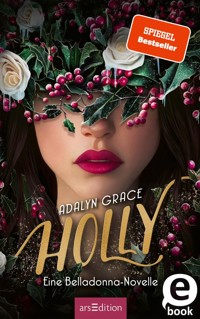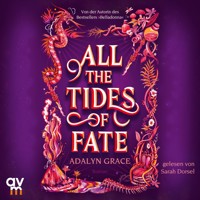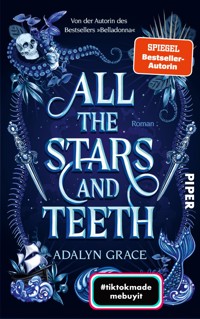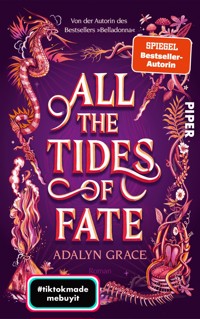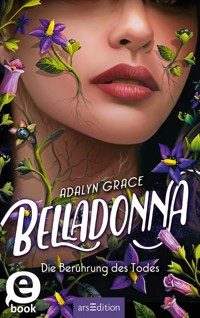9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: arsEdition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tod und Leben, Liebe und Schicksal finden ihren fulminanten Höhepunkt ... Seit das Schicksal in Signas und Blythes Leben getreten ist, hat sich die Welt der beiden unwiderruflich verändert. Während Signa um ihre Beziehung mit dem Tod kämpft, muss Blythe mit ihren neuen Fähigkeiten fertigwerden. Das Geheimnis um ihre wahre Identität lässt sie nicht ruhen. Ebenso wenig wie der Pakt, den sie mit dem Schicksal geschlossen hat. Der mysteriöse Mann lässt ihr Herz höherschlagen, doch kann sie ihm wirklich vertrauen? Das Finale der romantischen Trilogie und einer Enemies-to-Lovers-Geschichte, die fesselt! Alle Bände der Belladonna-Reihe: Band 1: Belladonna - Die Berührung des Todes Band 2: Foxglove - Das Begehren des Todes Band 3: Wisteria - Die Liebe des Todes Band 4: Holly - Eine Belladonna-Novelle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adalyn Grace
Wisteria
Die Liebe des Todes
Aus dem Englischen von Petra Knese
arsEdition
Du möchtest noch mehr von uns kennenlernen?
Vollständige eBook-Ausgabe der Softcoverausgabe München 2025
Text copyright © Adalyn Grace Inc., 2024
Cover copyright © Hachette Book Group, 2024
Cover art copyright © Elena Masci, 2024
Titel der Originalausgabe: Wisteria
Die Originalausgabe ist 2024 bei Little, Brown and Company
(Hachette Book Group), New York, erschienen.
© 2025 arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, D-80801 München
Alle Rechte vorbehalten
© Text: Adalyn Grace Inc.
© Cover und Vignetten Innenteil: Grafisches Atelier arsEdition, unter Verwendung der Illustration von Elena Masci
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN eBook 978-3-8458-5707-7
ISBN Printausgabe 978-3-8458-5706-0
www.arsedition.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Diesen Roman habe ich an einem
Regentag vorm Kamin begonnen,
an der Seite einer meiner besten
Freundinnen. Ihr ist dieses Buch
gewidmet, ihrer Freundschaft,
ihrer guten Suppe und ihrem
warmherzigen Wesen.
Prolog
Am Tag ihres Todes lag das Leben morgens wohlig unter einer Wisteria.
Mit ihrer Magie hatte sie die Blauregenranken zu einem Baldachin geformt, der sie vor der Sonne schützte, während sie die Zehen im feuchten Gras vergrub. Neben ihr saß das Schicksal über seinen neuesten Gobelin gebeugt. Aufmerksam verfolgte sie, wie er mit flinken Fingern ein neues Leben entwarf. Das Funkeln in seinen Augen, wenn er arbeitete, wollte sie sich gut einprägen.
Denn schon bald würde der Tod sie holen. Und was dann noch von ihr übrig blieb, wusste keiner. Hoffentlich würde sie nicht vergessen, wie das Schicksal bei einer gelungenen Schöpfung leicht auf und ab wippte oder dass sich auf seiner rechten Wange ein Grübchen bildete, das aussah, als habe ihm jemand einen Fingernagel ins Fleisch gebohrt und ihn so für alle Zeit mit einem neckischen Halbmond gezeichnet. Würde sie sich noch erinnern, wie er zu jeder Tages- und Nachtzeit sämtliches Licht anzog und sich darin sonnte? Ob nun am helllichten Tag oder zu einer Stunde, in der nur noch die Grillen zirpten: Ihr Mann strahlte.
Auch seine Hände wollte sie im Gedächtnis behalten. Nicht bloß ihr Geschick – sei es auf einem Instrument, mit dem Pinsel oder Nadel und Faden –, sondern auch, wie sie mit ihrem Körper verschmolzen. Wem sie ihre Existenz verdankte, war ihr ein Rätsel, und oft fragte sie sich, ob sie selbst nicht ebenfalls eine magische Schöpfung des Schicksals war, denn seine Hände allein kannten jede Kontur ihres Körpers. Jede Berührung war intuitiv, vertraut.
»Gefällt dir, was du siehst?« Auch ohne den Kopf zu heben, spürte das Schicksal ihren Blick. Seine Schönheit raubte ihr noch immer den Atem. Er war ihre Sommersonne, zu heiß für die meisten, doch sie reckte ihm ihr Blütenköpfchen entgegen und verzehrte sich nach seiner Glut.
Sie kam auf die Knie, schlang ihm die Arme um den Hals und schaute ihm über die Schulter auf den Gobelin.
Rot. Immer wieder Rot.
Die Farbe der Leidenschaft. Nichts liebte das Schicksal mehr. Lebensgeschichten, die vor Rot strotzten. Geschichten von Menschen, die einen Pakt mit dem Teufel schlossen, um das zu bekommen, was sie am meisten ersehnten. Wofür genau sie brannten, war dem Schicksal dabei im Grunde gleich. Kunst, Literatur, Erfindungen, Liebschaften, Kochen, Gärtnern … Solange Leidenschaft dahintersteckte, wirkte er die glorreichsten Geschichten, denn auch das Schicksal war ein Freund großer Gefühle.
Und ebendiesen Hunger nach der Welt mit all ihren Kostbarkeiten liebte das Leben an ihm. Gegen die Leidenschaft gab es nichts einzuwenden, und doch fand sie, dass sich die Menschen allzu oft darin verloren. Davon war auch ihr Mann nicht ausgenommen. Häufig hockte er vor seinen Gobelins wie ein Wolf vor einem eben erlegten Festschmaus, nur statt mit Blut im Maul mit Heißhunger in den Augen.
Über der Leidenschaft vergaßen die Menschen alles andere, nahmen weder den Wechsel der Jahreszeiten noch das Gras unter ihren Füßen wahr. Sie raubte ihnen die Gesundheit. Sowohl die Zeit als auch die Familie entglitten ihnen, während sie sich in ihrer Passion verloren.
Wenn es nach ihr ginge, würde ihr Mann mehr Blau in die Gobelins weben. Rot mochte für ein turbulentes Leben sorgen, aber ein beruhigendes Blau war der Garant für Glück. Deshalb strich sie ihm sanft über den Arm, genoss die sonnenwarme Haut und flüsterte: »Sei gütig, auch wenn es dir noch so schwerfällt.«
Das Schicksal hielt mitten in der Bewegung inne und legte die Arbeit seufzend ins Gras, vermochte jedoch den Blick lange nicht davon zu lösen, als kämpfe er gegen den Drang, die Arbeit fortzusetzen. Dieser Einwand war ihm wohlvertraut. Endlich wandte er sich dem Leben zu, fasste sie bei der Taille und zog sie auf seinen Schoß. »Ich bin dir gegenüber gütig. Reicht das nicht?«
Sie strich ihm durch den seidigen Goldschopf. Könnten sie beide doch nur für immer hier verweilen und unter der Wisteria Wurzeln schlagen! Sie würde ihm an den Lippen hängen, in seiner Stimme vergehen, ohne von seinen Berührungen jemals genug zu bekommen.
»Ich bin nicht die Einzige auf der Welt, die zählt, Liebster.«
Das Schicksal packte fester zu. »Für mich schon.«
Auch wenn dies eins ihrer ewigen Themen war, hätte sie diesmal dranbleiben sollen. Doch als er sie ins Gras zog, war es um sie geschehen. Lustvoll spürte sie seinen warmen, schweren Körper auf sich. Und als er mit seinen Küssen ihren Hals hinabwanderte, wölbte sie sich ihm entgegen und kostete mit geschlossenen Augen jede Empfindung aus. Sie wollte in seine Liebe eintauchen. Darin versinken. Doch im nächsten Moment war er aufgesprungen. Hinter der Wisteria hatte sich jemand vernehmlich geräuspert.
»Da kämpfst du auf verlorenem Posten«, sagte der Tod. Seine Schatten schlängelten sich über die Wurzeln der Wisteria, bis er ganz vor ihnen stand. »Güte liegt nicht in der Natur des Schicksals.« In seiner Stimme lag eine leise Traurigkeit, die ihr mitten ins Herz ging. Ob ihr Mann sie ebenfalls bemerkt hatte? Sie sah ihn verstohlen an.
»Bring doch beim nächsten Mal bitte ein Glöckchen mit, das mache ich dir dann am Hals fest«, knurrte das Schicksal und zupfte sich das Hemd zurecht.
Das Leben atmete auf. Vielleicht war es grausam, aber besser, ihr Mann wusste nicht, dass sie heute zum letzten Mal zusammen sein würden. Dann hätte er nur aufbegehrt und von seinem Bruder verlangt, sie zu verschonen. Dabei wünschte sie sich selbst nichts sehnlicher, als ihre letzten Stunden in genüsslicher Sonnenwärme in seiner Gesellschaft zu verbringen.
So wenig wie es seinem Wesen entsprach, gütig zu sein, so wenig würde er verstehen, warum sie als seine Frau sterben musste. Zwar bearbeitete sie Morgen für Morgen die tiefen Falten in ihrem Gesicht, um wieder so jugendlich auszusehen wie am ersten Tag, aber gegen die Erschöpfung kam sie nicht an. Ihr fehlte der Elan für Besuche in fernen Dörfern oder geschäftigen Städten, um seine Lieblingsgeschöpfe und ihre Kunst zu bestaunen. Sie konnte nicht mehr in der Weltgeschichte herumreisen, bloß um die feinsten Speisen und erlesensten Weine zu kosten. Auch wenn das Schicksal beteuerte, glücklich zu sein, wusste sie, dass er nur ihr zuliebe auf all das verzichtete. Das Alter hatte sie müde gemacht, jede echte oder vorgetäuschte Neugier war erloschen, nun wollte sie bloß noch unter ihrem Lieblingsbaum liegen und inmitten ihrer Lieblingsmenschen den Pulsschlag der Erde spüren.
Sie hatte den Widerstand aufgegeben. Der Tod gehörte untrennbar zum Leben, was blieb ihr also anderes übrig, als sich ins Unabänderliche zu fügen?
Der Schnitter bot seinen todgeweihten Schützlingen drei Wahlmöglichkeiten. Dabei war die erste die schlechteste: Die Seele durfte als Geist auf der Erde verweilen, musste aber am Todesort bleiben, bis sie für die zweite Möglichkeit bereit war, nämlich ins Jenseits überzusiedeln. Für sie selbst kam hingegen nur die dritte Möglichkeit infrage: die Wiedergeburt. Sie würde in anderer Gestalt zurückkehren, aber Hauptsache, sie könnte weiter neue Seelen schaffen.
Längst hatte sie akzeptiert, dass sie ihren Körper verlassen und einen neuen bekommen würde. Insgeheim war sie sogar neugierig, was vor ihr lag, auf die verschiedenen Stationen des Lebens. Nur um die Erinnerungen bangte sie, auch wenn der Tod einen Weg zu kennen meinte, sie zu behalten. Garantien gab es aber nicht.
»Wie willst du das beurteilen?«, fragte das Schicksal seinen Bruder. »Du hast dich hier im letzten Jahr kaum blicken lassen. Ich könnte mich vollkommen verändert haben.«
Sie wusste nur allzu gut, warum der Tod ihnen ferngeblieben war, schwieg aber. Der Tod konnte sie kaum ansehen, ohne seine Gefühle zu verraten, und seine Schatten wirbelten unruhig durcheinander. Sie wusste schon lange, dass sie dieses Jahr sterben würde, hatte nur bis zum Herbst um Aufschub gebeten, damit sie noch einmal den Sommer auskosten konnte. Ob sich die Sonne in einem anderen Körper anders anfühlen würde? Womöglich hätte er eine Vorliebe für den Winter, dann würde sie in Zukunft die Wärme meiden.
»Wie schön, dich zu sehen«, flüsterte das Leben. Sie war aufgestanden, um ihren Schwager zu begrüßen.
»Warum sagst du das?«, fragte der Tod schneidend wie ein Wintersturm. »Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Du musst es ihm endlich sagen, Mila. Sonst tu ich es.«
Neben ihr hielt das Schicksal die Luft an. »Was soll sie mir sagen?«
Mila wandte sich ihrem Mann zu. Ihr tat es in der Seele weh, denn sein Blick verriet, dass er es bereits ahnte. »Ich hatte gehofft, noch eine gemeinsame Nacht mit dir zu verbringen, Liebster, aber offenbar ist es uns nicht vergönnt.«
»Nein«, flüsterte das Schicksal. Er trat auf sie zu, und ehe sie sich ihm entziehen konnte, hatte er seine Finger mit ihren verflochten. Die blanke Wut in seinen Augen schlug sie in den Bann. »Nein«, sagte er abermals, diesmal an seinen Bruder gewandt. »Mila geht nirgendwohin.«
Erst da blickte der Tod ihn an. »Ich habe keine Wahl, wohin ich gerufen werde. Genauso wenig wie du kann ich über meine Schützlinge bestimmen«, sagte der Tod so sanft wie Morgentau. Nie hatte Mila ihn so sprechen hören.
Ihr blieb das Herz stehen, als sich goldene Fäden um sie wickelten und sie zurückzogen. Das Schicksal hatte sich zwischen sie und den Tod geschoben. Ihr Mann hielt die Hand erhoben, als wolle er seinem Bruder Einhalt gebieten. »Du wurdest nicht gerufen.« In dem Moment sah sie nicht, wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte. Sah weder seinen flehenden Blick noch seine Verletzlichkeit. »Mila ist meine Frau. Du hast mir alles genommen, was mir lieb war, und ich habe dich immer gewähren lassen. Ich habe dich nie um etwas gebeten. Doch jetzt bitte ich dich, eine Ausnahme zu machen. Du darfst sie mir nicht nehmen.«
Auf einmal schien der Tod zu zaudern. Da wurde ihr klar, dass sie die Partie verloren hatte. Der Schnitter trat dicht an seinen Bruder heran, schluckte dessen Licht und fragte mit einer Stimme, die nun alles andere als sanft klang: »Was ist dir ihr Leben wert?«
Kaum hatte Mila Luft geholt, um zu protestieren, hielten schon goldene Fäden ihre Zunge im Zaum. Und das Schicksal antwortete: »Alles.«
Jäh wandte sie sich dem Tod zu, doch der verweigerte ihr den Blick. Verweigerte ihr auch die Berührung. Sie kämpfte gegen die goldenen Fesseln, streckte zitternd eine Hand nach ihm aus, doch der Tod verbarg das Gesicht unter der Schattenkapuze und wich zurück.
»Für ein Leben wie ihres«, flüsterte er, »ist alles wahrscheinlich genau der Preis.«
Das Leben zog und zerrte an den Fäden. Wie gern würde sie dem Schicksal sagen, dass es kein Abschied für immer wäre. Warum ließ ihr Mann sie jetzt nicht in Frieden ziehen? Denn nur so würde sie sich in ihrem neuen Körper an ihr altes Leben erinnern. Doch sollte es ein schmerzhafter Tod werden … einer, der sie mit Haut und Haar verschlang, sodass sie an nichts anderes mehr denken konnte … Ihr Schwager hatte sie gewarnt, wie schwierig es werden könnte, die Erinnerungen zu behalten. Mila war überzeugt, dass sie bei einem gewaltsamen Tod alles verlieren würde. Dass sie ihn verlieren würde.
Dennoch wurden aus den Fäden um ihre Zunge bald auch Fesseln um ihre Handgelenke, die sie zurückhielten, während ihr Los besiegelt wurde.
Nachdem ihr Mann den Pakt mit dem Tod geschlossen hatte, schwor er ihr: »Ich werde dich nicht verlieren.«
Dabei war es bereits zu spät.
Erster Teil
Kapitel 1
Die Wisteria gilt als Sinnbild für die Unsterblichkeit.
Blythe Hawthorne hatte die Pflanze immer bewundert, die ebenso tödlich wie schön war und so widerstandsfähig, dass sie noch jahrhundertelang wuchs und gedieh, auch wenn sie sich selbst überlassen war. Doch als Blythe jetzt eine ihrer Blüten zwischen den Fingern zerdrückte, bis sich ihre Haut blau färbte, bedauerte sie die Wisteria, die ihr Schicksal teilte. Beide waren sie für immer in Aris’ Garten verwurzelt, ihre Pracht an seinesgleichen verschwendet.
In einer Hinsicht war Blythe der Wisteria gegenüber allerdings im Vorteil: Sie hatte Dornen. Und wenn es um Aris Dryden ging, war sie wild entschlossen, sie auch einzusetzen.
Blythe ließ den Blick durch den Innenhof gleiten, in dem Dutzende von Gästen unter einem Baldachin aus Blauregen warteten. Die Sonne tauchte alles in ein goldenes Licht, und einzelne Strahlen fielen sogar zwischen den Blüten hindurch, sodass die Besucher blinzeln mussten. Ihr Atem bildete beim Plaudern kleine Wölkchen.
Blythe beneidete sie um ihre feinen Mäntel, denn sie selbst fror in der kühlen Herbstluft. Ihre seidigen Ärmel boten kaum Schutz. November war auch ein eher außergewöhnlicher Monat für eine Hochzeit, doch bei Aris musste man wohl jederzeit mit Außergewöhnlichem rechnen. Wenn der vermeintliche Prinz partout an einem Herbstmorgen zu einer Stunde heiraten wollte, in der die Sonne noch nicht einmal den Tau vom Moos getrocknet hatte, wer sollte ihn dann davon abbringen?
Aris Dryden bekam immer seinen Willen. Der heutige Tag bildete wohl eine seltene Ausnahme, war er doch gezwungen, mit ihr eine Frau zu ehelichen, die er nicht leiden konnte.
Und ehrlicherweise musste man sagen, dass die Abneigung auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Du musst ihn nicht heiraten.« Das kam von ihrem Vater Elijah Hawthorne. »Ein Wort und ich bringe dich fort von hier.«
Unter anderen Umständen hätte Blythe das Angebot sofort angenommen. Doch um ihren Vater vor dem Galgen zu bewahren, hatte sie ihr Blut auf einem goldenen Gobelin vergossen und sich für den Rest des Lebens an Aris, an das Schicksal, gebunden. Als Beweis trug sie ein glitzerndes Band um den Ringfinger, ein Hauch aus Gold, für das menschliche Auge kaum sichtbar.
»Das wird schon werden.« Sollte sie ihrem Vater etwa vormachen, wie sehr sie Aris liebte und wie glücklich sie war, diesen Rohling zum Mann zu nehmen? Das Theater konnte sie sich sparen. Bibbernd stand sie in der feuchtkalten Herbstluft, ihre Haut juckte von gefühlt hundert Lagen Taft, und der Schleier kitzelte so an ihrer Nase, dass sie unentwegt das Niesen unterdrücken musste. Da hatte sie nicht den Nerv, ihrem Vater auch noch ein Märchen aufzutischen. So leicht ließ er sich auch nicht blenden, schließlich wusste er, dass sie nie vorgehabt hatte zu heiraten.
»Du wirst eine wunderbare Prinzessin abgeben«, flüsterte er. Blythe hätte ihm sicher zugestimmt, wenn Aris tatsächlich aus einer königlichen Familie abstammen würde. »Dennoch sollst du wissen, dass dir Thorn Grove jederzeit offen steht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Du kannst immer nach Hause kommen.«
»Das weiß ich doch«, entgegnete Blythe. Womöglich würde sie darauf zurückkommen.
Erst nachdem sich Elijah vergewissert hatte, dass er ihr die Hochzeit nicht mehr ausreden konnte, drückte er ihr einen Kuss aufs Haupt. Dann richtete er ihr den Schleier, sodass ihr Gesicht verborgen war.
Als sich leise Harfentöne zu einer Melodie vereinten, hielt Elijah ihr den Arm hin. »Bereit?«
Niemals. Nicht in einer Million Jahren wäre sie auch nur ansatzweise bereit. Dennoch sagte sie: »Ja«, denn um ihren Vater vor dem Tod zu bewahren, hätte sie jeden Preis bezahlt.
Obwohl sie sich zusammenriss, drehte sich alles um sie herum, als sie in den Garten trat. Der Weg war mit Trittsteinen vorgezeichnet, von denen jeder einzelne mit üppigem Klee umwachsen war. Hätte ihr Vater sie nicht festgehalten, wäre sie mit ihren glatten Schuhsohlen ausgerutscht.
Vor lauter Herzklopfen hörte sie kaum mehr die Harfe, deren Rhythmus sich ihren achtsamen Schritten angepasst hatte. Blythe blickte zu der Menge auf. Ein Meer aus viel zu weißen Zähnen und hungrigen Blicken, als wollten die Gäste ihr jeden Moment wie Aasgeier die Haut von den Knochen rupfen. Blythe reckte das Kinn und verbarg die zitternden Hände. Keiner sollte mitbekommen, dass sie Angst hatte.
Beim Anblick ihrer Brautjungfer atmete sie ein wenig auf. Ihre Cousine Signa stand in einem wunderschönen Spitzenkleid zuvorderst. Auch sie wirkte nervös, knetete die Hände. Hinter ihr ragte der Tod auf, umschlang ihre Hände mit seinen Schatten.
Blythe erschauderte. Vor dem Tod wollte sie instinktiv die Flucht ergreifen, aber … Genau diesen Mann hatte sich Signa ausgesucht. Warum, würde Blythe nie verstehen, aber solange Signa glücklich und ihr Vater Elijah frei war, war ihre Welt in Ordnung.
Nachdem Blythe an ihrer Cousine vorbeigegangen war, verklang die Harfe und ihr Vater blieb stehen. Wohl oder übel musste sie sich nun dem Goldschopf zuwenden, der in einem strahlend saphirblauen Rock vor ihnen stand. Wahrscheinlich würden die meisten Aris Dryden als gut aussehend bezeichnen, aber sie nahm bloß seine schwärende Feindseligkeit wahr. Er verbarg sie hinter einem breiten Lächeln, als wollte er sich dem Schwarm der Aasgeier anschließen, der es auf sie abgesehen hatte.
Aris trat auf sie zu und reichte ihr die Hand. Wäre ihr Vater nicht an ihrer Seite gewesen, hätte sie sie vielleicht nicht ergriffen.
»Hallo, Liebste.« Aris mochte die Worte nur geflüstert haben, doch seine Stimme war eine Waffe, die ihre Haut durchstieß und sie bis zum Heft durchbohrte. »Ich hatte schon gehofft, du würdest nicht kommen.«
Sie ergriff seine Hand und rang sich ein boshaftes Lächeln ab. »Um nichts in der Welt würde ich das missen wollen, Liebster. Aber tu dir keinen Zwang an, du kannst dich gerne morgen wieder scheiden lassen.« Das Band zwischen ihren Fingern flammte auf und brannte sich in ihre Haut, sodass Aris vor Schmerz das Gesicht verzog und laut auflachte, um es zu überspielen.
»Um dir lebenslanges Leid zu ersparen? Wohl kaum. Du hast ja keine Ahnung, was ich mir alles vor…« Aris brach ab. Sie hatten mit gesenkten Köpfen ganz leise gesprochen, doch jetzt fauchte er: »Was zum Teufel trägst du da?«
Blythe wusste sofort, dass er ihre grünen Samtslipper meinte. Ihre Lieblingsschuhe. Damit sie zu sehen waren, hatte sie den Rocksaum ein wenig gerafft. Selbstverständlich war Aris empört.
Und nicht nur er, auch die Gäste. Verstohlenes Kichern war zu hören, worauf Blythe nichts gab. Aris’ Kiefermuskeln mahlten. Er quetschte ihre Hände und zischelte durch die Zähne: »In Slippern heiratest du mich nicht. Los, geh dich umziehen!«
Blythe vergrub die Zehen im Samt. »Die Hochzeit unterbrechen? Ich denke nicht mal im Traum daran.«
Wäre Blythe nicht vorgewarnt gewesen, hätte sie spätestens jetzt erkannt, wie groß Aris’ Macht war. Auf ein goldenes Blitzen seiner Augen stand die Welt still. Elijah hatte es mitten im Schritt erwischt, als er sich wieder unter die Gäste mischen wollte. Neben Blythe flatterte ein Kolibri eingefroren in der Luft, und sie streckte die Hand aus, um ihm über den Bauch zu streichen. Einige Gäste hatten tuschelnd die Köpfe zusammengesteckt, nun standen sie tonlos mit halb offenen Mündern, die Augen starr. Nur Signa und der Tod bewegten sich in Schatten gehüllt weiter. Als Signa einen Schritt auf ihn zumachte, gebot Aris ihr mit einem Blick Einhalt, der die Sonne zum Schmelzen hätte bringen können.
»Zieh dir sofort vernünftige Schuhe an.« Aris hatte sich zu Blythe heruntergebeugt und machte nun, da die Gäste nichts mitbekamen, keinen Hehl aus seiner Verachtung für sie. »Das ist doch absurd. Ich mache deine Spielchen nicht mit.«
Blythe frohlockte. Wie gehofft, hatte sie ihn bei der Eitelkeit gepackt. Grinsend gab sie zurück: »Vielleicht ist es dir entgangen, aber du spielst mein Spiel doch bereits.«
Die Myriaden von Goldfäden rings um sie beide herum glommen auf, einige wickelten sich um ihre Handgelenke, und als Aris Anstalten machte, sie vorwärts zu zerren, wappnete sich Blythe innerlich. Doch im nächsten Moment wurde er selbst von unsichtbaren Mächten zurückgerissen und hielt sich fluchend das Handgelenk. Vorwurfsvoll sah er Signa an, die jedoch keine Miene verzog.
Hatte ihre Cousine etwa auch einen Pakt mit dem Schicksal geschlossen? Offenbar konnte er ihr nichts anhaben. Blythe lachte schadenfroh und trat auf ihn zu, sodass sie Brust an Brust standen. Oder vielmehr Brust an Bauch, denn er war einen guten Kopf größer als sie.
»Wenn es sein muss, bleibe ich so lange hier stehen, bis ich mich gegen dich durchgesetzt habe.« Blythe meinte jedes Wort. »Gib die anderen frei und lass uns mit dem Affenzirkus weitermachen.«
Eine gefühlte Ewigkeit verging, ohne dass Aris sich rührte. Da wurde sogar der Tod nervös. Blythe hielt die Luft an, als sich seine Schatten näherten, auch wenn sie wusste, dass er nur helfen wollte. Unbeirrt starrte sie Aris an, legte all ihre Wut in diesen Blick. Wie lange ihr Blickduell währte, wusste sie nicht, aber irgendwann packte er ihre Röcke und zerrte sie über die Slipper. Erst jetzt setzte Elijah vernehmlich den Fuß auf den Boden und das leise Tuscheln ertönte wieder. Der Kolibri schwirrte über Aris’ Kopf davon und nun trat der Pfarrer auf sie zu.
»Wollen Sie die hier anwesende Frau zu Ihrer rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen …«, setzte er an. Schon bei den ersten Worten wurde Blythe von solchem Schwindel erfasst, dass sie sich nur noch mühsam auf den Beinen hielt. »Wollen Sie sie lieben und ehren … allen anderen entsagen … bis dass der Tod euch scheidet?« Den Großteil der Rede bekam sie gar nicht mit, doch bei der letzten Frage wurde sie mit einem Mal hellwach. Verstohlen warf sie einen Seitenblick auf Aris, der mit gesenktem Kopf neben ihr stand und die Zähne zusammenbiss.
»Solange sie lebt«, bestätigte er so kurz angebunden, dass der Pfarrer stutzte, bevor er sich Blythe zuwandte.
»Und wollen Sie den hier anwesenden Mann zu Ihrem rechtmäßigen Ehemann nehmen und mit ihm in den heiligen Bund der Ehe treten? Wollen Sie ihm gehorchen, ihn lieben und achten, in Gesundheit und Krankheit zu ihm halten, ihm treu sein und allen anderen entsagen, bis dass der Tod euch scheidet?«
Aris schaute sie so scharf an, dass ihr das Lachen im Hals stecken blieb. Sie räusperte sich und sagte: »Das will ich, und wenn er krank ist, werde ich ihn noch mehr lieben.«
Der Pfarrer nahm nun einen goldenen Ring, der einer Schlange nachgebildet war, mit Augen aus Jade. »Sprechen Sie mir nach: Mit diesem Ring nehme ich dich zur Frau, mit meinem Leib will ich dich ehren …«
Jedes Wort schmeckte für Blythe wie Gift. Der Ring schmerzte, als Aris ihn ihr beim Nachsprechen grob auf den Finger schob. Das verdammte Ding würde sie nur mit reichlich Öl wieder abbekommen. Was sie auch umgehend tun würde, sobald sie allein war.
»Hallo, Ehefrau«, zischelte er leise, sodass nur sie es hören konnte.
Sie lächelte gequält und umfasste seine Hand, nur um ihm die Nägel in die Handteller zu bohren. »Hallo, Ehemann.«
Sie funkelten sich weiter an, bis der Pfarrer sie aufforderte, sich zum Gebet niederzuknien. Von da an bekam Blythe überhaupt nichts mehr mit. Ihr Finger pochte vor Schmerz unter dem Goldring.
Es war kein Ring, sondern eine Fessel. Und die würden wohl weder sie noch Aris auf absehbare Zeit loswerden.
Kapitel 2
An den meisten Tagen munterte es Blythe auf, in ihr Lieblingsballkleid zu schlüpfen. Nicht so an ihrem Hochzeitstag. Da zerrte sie pausenlos daran herum und hatte das Gefühl, unter den Bergen von Taft zu ersticken. Ihre Füße waren Eisklumpen, denn ihre Samtslipper hatten sich mit Tau vollgesogen. Hätte sie Aris nicht mit allen Mittel gegen sich aufbringen wollen, hätte sie längst die Schuhe gewechselt.
Während die Slipper unter ihren Zehen schmatzten und ihr die Kälte in die Knochen trieben, führte sie sich immer wieder ihren kleinen Triumph vor Augen. Mit einem falschen Lächeln auf den Lippen stand sie mit Aris unter einer Wisteria und begrüßte die Gäste. Was blieb ihr auch anderes übrig? Um sie herum ein Meer aus Gesichtern, die sie schon ihr Lebtag kannte. Viel zu viele Gesichter. Ihre Hochzeit war keine kleine Feier, sondern ein großes Fest, das eines Prinzen würdig war: Auf Goldtabletts waren erlesene Schokoladen und mit Blattgold verzierte Törtchen exquisit angerichtet und an jedem Handgelenk und Hals glitzerten Juwelen.
Charlotte und Everett Wakefield begrüßten die Frischvermählten mit aufmunternden Worten. Dabei wirkten der Herzog und die Herzogin immer noch frisch verliebt. Wie mochte sich das wohl anfühlen? Selbst würde sie es wohl nie erleben.
Unter den Gästen gab es aber auch Leute, die ihr nicht bekannt vorkamen. Vornehmtuer, die sich hochnäsig durch die Menge schoben, als würden sie alles nur in Augenschein nehmen wollen. Nachdem Blythe sie eine Weile beobachtet hatte, fiel ihr deren glasiger Blick auf, auch dass sie nie ein Wort an jemanden richteten. Offenbar waren es Aris’ Gäste. Wäre ja auch ein wenig auffällig, wenn von seiner Seite gar niemand gekommen wäre.
Die Einheimischen behielten die unbekannten Gäste gut im Blick. Aus dem Augenwinkel beobachtete Blythe, wie sich Diana Blackwater an eine von Aris’ Marionetten heranpirschte. Ein überheblich wirkender Mann um die dreißig, in feinste Tuche aus Übersee gewandet. Diana brachte sich in Positur, um seine Aufmerksamkeit zu erhaschen, doch das war vergebliche Liebesmüh. Selbst wenn der Mann gewollt hätte, hätte er ihr keine Beachtung zollen können, war er doch dazu verdammt, in einer Endlosschleife durch den Garten zu schlendern und die Dekoration zu inspizieren. Nachdem Diana ihm eine Weile vergeblich gefolgt war, gab sie auf und fächelte sich echauffiert Luft zu. Als sie Blythes Blick bemerkte, erstarrte sie. Und ganz langsam, wie unter körperlichen Schmerzen, knickste Diana vor ihr.
Dieser Knicks erfüllte Blythe mit einer unendlichen Genugtuung, zeigte ihr, dass es für ihre Seele wirklich keine Rettung gab. Allein dafür hatten sich die feuchten Slipper fast gelohnt.
Fast.
»Kannst du mit deiner Magie diesen Tag nicht einfach beenden?«, fragte Blythe, nachdem ihr die örtliche Apothekerin gratuliert hatte. Auch wenn Blythe ihr noch nie persönlich begegnet war, nahm sie die überschwänglichen Glückwünsche lächelnd entgegen. »Müssen wir das Theater wirklich bis zum Ende durchstehen?«
»Du wolltest doch eine richtige Hochzeit«, entgegnete Aris. »Soll ich da meine sittsame Braut etwa enttäuschen?«
Ihr lag eine gallige Bemerkung auf der Zunge, doch sie schluckte sie herunter. Es lohnte nicht, in dieser Situation einen Streit vom Zaun zu brechen. Vor allem nicht, weil ihr Vater in der Nähe stand und sie mit Argusaugen beobachtete.
Genau genommen hatte sich Blythe keine richtige Hochzeit gewünscht. Eher gehofft, ihr unvermeidliches Los noch ein wenig herauszögern zu können. Außerdem wollte sie ihren Vater überzeugen, dass alles in bester Ordnung sei und er sich keine Sorgen machen müsse. Von dem dauernden Grinsen hatte sie schon einen Krampf in den Wangen. Sogar untergehakt hatte sie sich bei Aris, obwohl er sie abstieß. Aris hielt sie so fest, dass es brannte wie tausend kleine Nadelstiche. Sobald sie allein war, würde sie das Kleid ins Feuer werfen und sich jeden Millimeter ihrer Haut schrubben, wo er sie berührt hatte.
Erst als Signa auf sie zutrat, löste Aris den festen Griff und seine Fassade bröckelte ein wenig. Wenn Signa irgendetwas auffiel – und Signa fiel eigentlich immer etwas auf –, behielt sie es zumindest für sich. Signa nahm Blythes Hände in ihre. »Du bist die schönste Braut, die ich je gesehen habe.« Blythe lächelte, obwohl sie stark bezweifelte, dass Signa außer ihr schon viele Bräute gesehen hatte. Vor wenigen Monaten noch war sie sich nicht einmal sicher gewesen, ob sie mit ihrer Cousine je wieder ein Wort wechseln würde. Das kam ihr ebenso unglaublich vor wie die Tatsache, dass sie sich erst seit einem Jahr kannten. Nach allem, was sie zusammen durchgestanden hatten, fühlte es sich an, als hätten sie ihr ganzes Leben zusammen verbracht.
Dann wandte sich Signa Aris zu. In ihrer Gegenwart fiel seine ganze Selbstherrlichkeit wie ein Kartenhaus in sich zusammen, was außer Blythe wohl sonst keiner bemerkte. In solchen Momenten tat er ihr fast leid, hielt er Signa doch für die Reinkarnation seiner Geliebten; für das Leben, den einzigen Menschen, den er je geliebt hatte. Und Signa würde ihm nie gehören.
»Miss Farrow«, grüßte er kühl, auch wenn im nächsten Moment, als sich die Schatten des Todes näherten, das Raubtier in ihm erwachte. »Bruder.«
»Meine Einladung muss wohl in der Post verloren gegangen sein.« Die Stimme des Todes war ein Schock, wie Eiswasser, das ihre Lungen füllte und ihr die Luft zum Atmen raubte. Blythe fasste sich an die Kehle. Wie anders war da Aris’ warmes Timbre.
»Habt ihr Pläne für die Flitterwochen?«, fragte Signa. Wohin es in den Flitterwochen ging, sollte ja eigentlich eine Überraschung für die Braut sein, trotzdem hatte sich bestimmt die Hälfte der Gäste danach erkundigt. Doch aus Signas Mund mutete die Frage befremdlich an. Hatte sie im Ernst Hoffnungen für diese Scheinehe? Wenn jemand wusste, dass diese Ehe die reinste Farce war, dann ihre Cousine – wobei auch ihr Vater Elijah Verdacht zu schöpfen schien. Und dennoch sah Signa sie so treuherzig an, dass es ihr einen Stich versetzte. Wenigstens war eine optimistisch, was ihre Ehe mit dem Schicksal anging, auch wenn es die Frau war, die den Tod liebte.
Signa erinnerte sie immer ein wenig an eine Eule. Ihre Augen waren unheimlich groß, und wenn ihre Cousine in Gedanken versunken war, vergaß sie oft zu blinzeln. Blythe machte sich gerne einen Spaß daraus und zählte dann die Sekunden. Jetzt gerade war sie schon bei dreißig angekommen, so lange hatte Signa das Schicksal mit einer tiefen Falte zwischen den Brauen angestarrt. Kein Wunder, dass viele Leute sie seltsam fanden. Und komisch, dass sie nie unter trockenen Augen litt. Signa erwachte erst aus ihrer Starre, als der Tod ihr die behandschuhte Hand auf die Schulter legte. Ob auch er die Sekunden gezählt hatte? Vielleicht vertrieben sich die zwei die Abende, indem sie sich in die Augen schauten, um zu sehen, wer zuerst blinzelte.
»Warum interessiert es Sie so, Miss Farrow?«, fragte Aris mit einer Stimme, die den Tod aufhorchen ließ. »Wollen Sie mich statt Ihrer Cousine begleiten?«
Man musste dem Tod zugutehalten, dass er sich nicht provozieren ließ. Obwohl seine Augen kaum mehr als zwei dunkle, unergründliche Höhlen waren, hatte Blythe das bestimmte Gefühl, dass er sie ansah. Eine Gänsehaut überlief sie.
»Ihr habt es selbst in der Hand. Wenn ihr schon auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden seid, hoffe ich wenigstens, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt«, entgegnete Signa.
Blythe musste sich auf die Zunge beißen. Ihre Cousine hatte gut reden, schließlich musste sie ja nicht den Rest ihres Lebens mit diesem Widerling verbringen.
»Töten kann ich sie ja nicht«, erwiderte das Schicksal trocken. »Dafür haben Sie ja gesorgt, als Sie mir das Versprechen abnahmen, ihr kein Leid anzutun. Spielt keine Rolle. So ein armseliges Menschenleben ist nur von kurzer Dauer. Dann baue ich mir ein Bett aus ihren Gebeinen und mache es mir darin für alle Ewigkeiten gemütlich.«
So albern wie dieses Bild auch war, geriet Blythe dennoch in Rage. »Freu dich nicht zu früh, liebster Gatte. Hundert werde ich bestimmt, allein schon, um dich zu ärgern.«
Signa presste die Lippen aufeinander. Blythe kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Dann nahm Signa ihre Hände. »Sag Bescheid, wenn ihr wieder zurück seid«, flüsterte sie verschwörerisch. »Ich muss dir ganz dringend etwas sagen.«
Bevor Blythe entgegnen konnte, dass sie es unbedingt sofort erfahren wollte, wurde Signa schon von dem Strom eifriger Gratulanten weitergeschoben. Bei der nächsten Soiree würde Blythe ihrem Ehemann nicht so einfach die Gästeliste überlassen.
»Mach ich«, konnte sie ihrer Cousine gerade noch hinterherrufen.
Wie lange sie mit eingefrorenem Lächeln dagestanden hatte, wusste sie nicht. Ihre Zunge wurde von all den Dankesbeteuerungen immer schwerer. Als ihnen endlich auch die Letzten gratuliert hatten, war Blythe erleichtert. Jetzt wollte sie bloß noch ein Glas Champagner.
Alle tranken schon, doch sie wartete, bis Aris den ersten Schluck genommen hatte, dann nahm sie ihm das Glas aus der Hand und trank selbst. Ignorierte seinen finsteren Blick, wartete fünf Minuten, und als nichts geschah, nahm sie einen weiteren Schluck.
Ihnen gegenüber grüßten eine auffallend schöne Frau mit sonnengebräunter Haut und ein pomphafter Mann mit sehr hellem Teint die herumscharwenzelnden Gäste. Zwar hatte das Paar ebenso leere und leblose Augen wie Aris’ übrige Marionetten, dennoch sprachen sie freundlich lächelnd mit den Anwesenden.
»Wer sind die denn?«, fragte Blythe. Das Paar war von einem goldenen Schleier umhüllt, und sie musste blinzeln, um die abertausend Goldfäden zu erkennen.
Aris leerte sein Glas. »Sie halten sich für meine Eltern.« Er sagte es so lapidar, als hätte er ihr mitgeteilt, dass November war.
Fast hätte Blythe sich vor Schreck verschluckt. »Wie meinst du das?«
Aris’ Augen leuchteten für einen Sekundenbruchteil auf, als ein Dienstmädchen mit einem Tablett vorbeikam. Er zog sie mit seinen Goldfäden zu sich, sodass er ihr zwei weitere Gläser vom Tablett nehmen konnte. Blythe streckte die Hand aus, weil sie annahm, eines sei für sie, doch Aris behielt beide Gläser. »Irgendjemand musste ja dafür herhalten. Schließlich kann ein Prinz nicht ohne Anwesenheit seiner Eltern heiraten. Und sobald die zwei ihre Aufgabe erfüllt haben, vergessen sie alles sofort wieder.«
»Es ist unfair, die Leute zu deinen Marionetten zu machen, Aris. Ihren Willen zu beugen, wie es dir in den Kram passt.«
»Warum denn?« Spielerisch fuhr er mit dem Finger über den Glasrand. »Bei dir habe ich es auch schon dreimal getan.«
Zum Glück hatte Blythe noch nichts gegessen, sonst hätte sie sich vom Fleck weg übergeben. An das eine Mal konnte sie sich dunkel erinnern. Damals hatte Aris versucht herauszufinden, warum Signa nach Foxglove verbannt worden war. Das andere Mal hatte wohl mit ihrem ersten Besuch auf Wisteria Gardens zu tun, da klafften große Lücken in ihrer Erinnerung. Aber wann sollte das dritte Mal gewesen sein? Sie hatte keinen Schimmer, was sie umso mehr beunruhigte.
Blythe riss sich zusammen und sagte möglichst entschieden: »Du wirst diese Kräfte nie wieder gegen mich einsetzen.« Aber was hatte sie schon in der Hand? Womit konnte sie ihm einen Handel schmackhaft machen? Wenigstens hatte sie ihre Wut, um ihm Einhalt zu gebieten.
»Mein Gott, musst du immer gleich kreischen?« Stöhnend rieb er sich die Schläfen. »Deine Cousine hat bereits dafür gesorgt, dass ich dir nichts anhaben kann.«
Aus der Unterhaltung vorhin hatte sie schon etwas Derartiges geschlossen, dennoch überraschte es sie, wie freimütig Aris es zugab. Für einen so gefährlichen Mann war er erstaunlich offenherzig.
Doch sein Versprechen war ihr nicht gut genug. »Auch wenn es mir nicht schadet, will ich nicht, dass du mich zu deiner Marionette machst. Ich will nicht mit jemandem zusammenleben, der mich manipuliert.«
Trotzig reckte sie das Kinn vor. Doch statt sie zu verspotten, nahm Aris nur einen großen Schluck aus seinem Champagnerglas und sagte: »Das hatte ich auch nie vor.«
Da fiel ihr ein Stein vom Herzen. »Gut, dass du so vernünftig bist.«
»Vernünftig?« Sein freudloses Gelächter brachte sie sofort wieder auf. »Wozu sollte ich dich manipulieren? Lohnt sich nicht, wenn ich ohnehin kein Interesse an dir habe. Aber mit meinen Kräften solltest du dich schon anfreunden. Um die Posse aufrechtzuerhalten, bedarf es nämlich einiger Anstrengungen.«
Blythe stellte das Glas so vehement ab, dass sie noch einmal hinschaute, ob es auch nicht zu Bruch gegangen war. »Wenn du nicht vorgegeben hättest, ein Prinz zu sein, hätten wir uns das Theater ersparen können.«
Aris zuckte mit den Achseln. »Schon möglich, aber was hätte ich mit diesem Gesicht denn anderes sein sollen?«
Kleiner Scherz, oder? Blythe lachte hysterisch. Gerade wollte sie ihm eine Beleidigung an den Kopf werfen, da fiel ihr Blick auf ihren Vater. Auch wenn er gerade mit Signa ins Gespräche vertieft war, hatte ihr Lachen seine Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. Als er auf sie zukam, richtete sie sich sofort kerzengerade auf. Schnell flüsterte sie Aris ins Ohr: »Los, tu, als wäre ich die Frau deiner Träume, sonst mache ich dir jede Sekunde deines Lebens zur Hölle.«
»Tust du das nicht ohnehin schon?« Aris rückte ein wenig von ihr ab. Für Fragen war jetzt keine Zeit mehr, denn schon stand Elijah vor ihnen. Auch Aris machte sich gerade. So mächtig er auch war, in Gegenwart des Schwiegervaters wurde selbst ein Halbgott nervös.
»Mr. Hawthorne.« Aris verbeugte sich.
»Eure Hoheit.« Elijahs Stimme war eiskalt. Doch sobald er sich seiner Tochter zuwandte, kehrte die Wärme zurück. »Darf ich bitten?« Er hielt ihr die Hand hin.
Ihrem Vater konnte sie keinen Tanz ausschlagen. Deshalb löste sie sich von Aris, ergriff Elijahs Hand und ließ sich wortlos auf die Tanzfläche führen. Da er die Gesellschaft gemeinhin verschmähte, hatte sie schon fast vergessen, über welch geschliffene Umgangsformen ihr Vater verfügte. Selbstbewusst wirbelte er sie im Walzer über die Tanzfläche. Bei ihm saß jeder Schritt. Nicht weniger überrascht war sie über seine Worte.
»Ich habe dir ein Messer in deine Reisetruhe gepackt«, sagte er fast beiläufig.
Zum Glück legte sich die Musik in einem Crescendo über seine Stimme, sodass es außer ihr wohl niemand hörte. Sie sah fassungslos zu ihm hoch, aber er erwiderte ihren Blick ungerührt.
»Ein eher ungewöhnliches Brautgeschenk«, gab sie zu bedenken. »Vergiss nicht, dass es meine freie Entscheidung war. Aris zwingt mich zu nichts …«
»Für wie naiv hältst du mich eigentlich?«, brach es aus ihm heraus, doch sein Ton blieb freundlich. »Ich war zum Tode verurteilt. Soll ich da an einen Zufall glauben? Und wenn du dem Mann noch so schöne Augen machst, mich kannst du nicht täuschen.«
Blythe überlegte fieberhaft. Jetzt musste ihr schnell eine kluge Entgegnung einfallen. »Vernunftehen gibt es doch immer wieder.«
»Das stimmt.« Elijah warf Aris schneidende Blicke zu. »Aber doch nicht für meine eigene Tochter. Lieber wäre ich tausend Tode gestorben, als dir so etwas aufzubürden.«
»Du hast mir gar nichts aufgebürdet«, flüsterte sie. Insgeheim war sie erleichtert, dass ihre Übereinkunft mit Aris ans Licht gekommen war. »Vielleicht warst du bereit zu sterben, aber ich war nicht bereit, dich gehen zu lassen. Auch nicht, wenn wir noch eine Million weitere Leben vor uns hätten.« Blythe hatte in den vergangenen Jahren einfach schon zu viele geliebte Menschen verloren. Offenbar ahnte ihr Vater, was in ihr vorging, denn er lockerte seinen Griff.
»Na schön«, flüsterte er. »Aber du bist mein Ein und Alles, Blythe. Auf nichts bin ich so stolz wie auf dich. Sollte dir etwas zustoßen …«
»Mir stößt schon nichts zu. Es geht hier um eine Ehe, nicht um Mord.« Auch wenn sie scherzhaft klingen wollte, wurde der Blick ihres Vaters düster wie Gewitterwolken.
»Ich habe dir ein Messer in die Reisetruhe gepackt«, wiederholte er. Sie widerstand dem Impuls, die Augen zu verdrehen. Bei all seiner Scharfsinnigkeit konnte ihr Vater natürlich nicht wissen, dass ein Messer bei Aris nicht ausreichen würde. Aber wenn es ihn beruhigte, sollte es ihr recht sein. »Gut, dass du es mir sagst, bevor ich mich versehentlich damit erdolche. Ich danke dir für das Geschenk, werde aber keine Verwendung dafür haben.«
Elijah fuhr unbeirrt fort. »Ich möchte, dass du mir jede Woche schreibst, jedenfalls in den ersten Monaten. Beende jeden Brief mit einer Belanglosigkeit, sodass ich weiß, dass er von dir stammt. Und sollte irgendetwas passieren, solltest du mich brauchen oder krank sein, erwähne deine Mutter namentlich. Dann komme ich sofort.«
»Ich gehe ja nicht ans Ende der Welt«, entgegnete sie. »Wisteria Gardens ist keine Tagesreise entfernt.«
»Aris wird doch wohl nach Verena zurückkehren wollen?« Ihr Vater sah sie herausfordernd an. Blythe hätte ihm nur zu gern erzählt, dass es diesen Ort überhaupt nicht gab. Als sie einmal Verena auf der Karte hatte finden wollen, war ihr sofort alles vor den Augen verschwommen, und sie konnte sich nicht mehr erinnern, wonach sie überhaupt gesucht hatte. Mangelnde Gründlichkeit konnte man Aris wahrlich nicht vorwerfen.
»Nach unserer Hochzeitsreise werden wir erst einmal hier in der Stadt bleiben.« Über ihre Pläne hatten Aris und sie noch gar nicht gesprochen. Sie hatten überhaupt kaum gesprochen, seit sie ihr Blut auf seinem Gobelin vergossen hatte. Wo sie leben würden, hatte sie sich gar nicht gefragt, denn da es Verena nicht gab, lag die Antwort für sie auf der Hand: auf Wisteria Gardens. Ihr Vater ließ es dabei bewenden, wirkte aber bedrückt über ihr blindes Vertrauen.
Als die Musik leiser wurde und das Stück allmählich ausklang, zog ihr Vater sie fester an sich. »Du schreibst jede Woche, egal, wo auf der Welt du bist. Versprich es mir.«
Darum kam sie wohl nicht herum. »Also schön, wenn ich nicht selbst mit der Kutsche kommen kann, schreibe ich dir. Und du schreibst mir auch, damit ich weiß, dass du oder Thorn Grove nicht zugrunde gehen, wenn ich den Laden nicht zusammenhalte«, scherzte sie. Das Lächeln wollte ihr allerdings nicht so ganz gelingen. Während es für die meisten jungen Frauen selbstverständlich war, dass sie eines Tages ihr Zuhause verlassen und in einen neuen Lebensabschnitt eintreten würden, hatte sie selbst das nie gereizt. Sie liebte Thorn Grove, genauso wie sie ihre Familie liebte. Und nach allem, was ihr Vater in den letzten Jahren durchgemacht hatte, wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, ihn zu verlassen.
Der Walzer war zu Ende, doch Blythe hielt ihren Vater weiterhin fest. Schließlich löste sich Elijah zögerlich von ihr.
»Ich hoffe, mein Misstrauen ist nur meinem Alter zuzuschreiben«, raunte er. »Ich hoffe auch, dass Aris dir ein guter Mann sein wird und ihr euch eines Tages so liebt wie deine Mutter und ich. Und wenn nicht … wenn irgendetwas passiert, gibt es ja immer noch das Messer.«
Als Blythe auflachte, musste selbst Elijah kurz schmunzeln, bevor er wieder als Gastgeber gefragt war. Die ersten Gäste strebten zum Innenhof, wo eine elfenbeinfarbene Kutsche mit vier grauen Pferden wartete.
Elijah drückte ihr die Hand. »Mach dich nicht klein. Verbieg dich nicht. Bring ihm bei, wie er dich zu behandeln hat. Und vergiss nicht, du verdienst nur das Beste im Leben.«
Als ihr Tränen in die Augen schossen, wandte sie rasch den Blick ab. Sie sah, dass Aris schon im Hof wartete. »Ich vergesse es nicht.«
Kurz entschlossen ließ sie ihren Vater los und ging auf Aris und damit auf ihr neues Leben zu. Mit jedem Schritt zerbrach ihr Herz ein klein wenig mehr.
Kapitel 3
Blythe fragte sich, ob es Umstände gäbe, unter denen sie eine Hochzeit genossen hätte. Wäre es vorstellbar, dass sie beim Abschied von ihren Freunden und ihrer Familie Tränen der Rührung vergossen hätte? Hätte sie lachend Hand in Hand mit ihrem Liebsten zu einer güldenen Kutsche rennen und sich unter dem Reis- und Blumenregen der jubelnden Gäste wegducken können?
Bestimmt wären ihre Gedanken auch ganz schnell bei den Flitterwochen gelandet. Traditionell wurde die Braut über die Pläne ja im Dunkeln gelassen, doch sie hätte sicher keine Ruhe gegeben, bis sie herausgefunden hätte, wohin die Reise ging und wie sie am besten dafür packen könnte.
Wahrscheinlich konnte sie froh sein, dass sie nie hatte heiraten wollen und so auch keine hochgesteckten Fantasien hatte, was sie erwartete. Aris stieß sie in die Kutsche und fiel hinterher. Kaum dass die Tür geschlossen und die Samtvorhänge zugezogen waren, erstarb sein Lächeln. Als die Kutsche den Berg hinunterrollte, ließ er sich in den Sitz gegenüber fallen und zog die Beine an, sodass er sie nicht berühren musste. Gott bewahre!
Spöttisch zog sie die Nase kraus. Eine kleine rachsüchtige Stimme flüsterte ihr zu, sie sollte die Beine ausstrecken und so viel Platz wie möglich in der engen Kutsche einnehmen. Also legte sie die Füße neben ihn aufs Lederpolster und massierte sich die Zehen.
»Was ist denn? Hast du etwa Angst, ich könnte dich verderben?« Einst hatte ihr Aris diese süßlichen Worte an den Kopf geworfen, als sie ihn auf Wisteria Gardens überrascht und ihn angefleht hatte, ihrem Vater zu helfen. Aris verzog den Mund. Sollte er doch ruhig vor sich hin schmollen und sein Los beklagen. Konnte er gerne tun, aber ihr selbst war das hier in der engen Kutsche einfach zu bedrückend. Während sie sich lose Haarsträhnen aus dem Nacken strich, grübelte sie, wie sie die Fahrt auch nur halbwegs erträglich gestalten konnte.
Unterdessen rieb Aris an dem goldenen Band um seinen Ringfinger, als wollte er es mit aller Macht loswerden. Dabei starrte er missmutig auf die Vorhänge, als wären sie an allem schuld. Blythe nahm kaum Notiz von seinen Bemühungen. Die konnte er sich sparen, sie hatte es selbst schon unzählige Male versucht.
Als sie mit der Schuhspitze versehentlich gegen sein Bein kam, fuhr er aus der Haut. »Du bist eine scheußliche, schlampige …« Er stockte und riss die Brauen hoch. »Was in aller Welt tust du da?«
Blythe versuchte vornübergebeugt, die Schnürung ihres Mieders zu lösen. »Du erwartest doch nicht im Ernst, dass ich stundenlang in diesem Teil sitze, ohne Luft zu kriegen. Von deiner schlechten Laune ist es hier drinnen so heiß geworden, dass ich mir unbedingt ein wenig Kühlung verschaffen muss. Außerdem sind wir jetzt verheiratet. Da solltest du mir dieses elende Ding vom Leib reißen.« Erleichtert seufzte sie, als sich ein Band löste und sie ein wenig mehr Luft bekam. Fürs Erste musste es reichen.
Mit zusammengepressten Lippen beobachtete Aris ihre Anstrengungen; er sah aus, als wollte er jeden Moment vor Wut platzen. Aber das kannte sie ja schon. »Warum solltest du stundenlang in der Kutsche sitzen?«
Blythe deutete um sich. »Wir sind nach unserer Trauung in eine Kutsche gestiegen. Natürlich fahren wir in die Flitterwochen, wohin sonst?«
Als Aris verächtlich lachte, kam es ihr vor, als wären die losen Bänder Schlangen, die ihr über die Haut krochen.
»Lieber würde ich mir einen Pflock ins Herz treiben, als mit dir irgendwohin zu fahren. Flitterwochen.« Aris schnaubte und seine Augen glühten wie goldene Lava. »Hast du den Verstand verloren? Sobald die Gäste gegangen sind, kehren wir um und fahren zurück.«
Im nächsten Augenblick wimmelte es vor Goldfäden. Keine durchscheinenden Marienfädchen, sondern glänzend und scharfkantig wie Metall, die schon bei der kleinsten Berührung die Haut durchbohren würden. Blythe drängte sich ans Fenster, zog den Vorhang zurück und spähte hinaus. In der Ferne verließen die Gäste den Palast, tapsten wie Schlafwandler zu ihren Kutschen.
Aris steuerte sie. Natürlich, warum auch nicht?
»Du hast alle Macht der Welt und setzt sie so ein?« Blythe drückte sich in die Polster, um nicht noch ihren Vater oder Signa sehen zu müssen. Sie atmete tief durch. Wenn sie jetzt einen Aufstand machte, würde sie ihn nur noch weiter anstacheln. »Du hättest mich wenigstens ans Meer bringen können. Gegen eine Safari hätte ich auch nichts einzuwenden gehabt.«
»Lieber hacke ich mir den Arm ab«, entgegnete er bloß.
»Die Leute werden Fragen stellen, wenn sie mitbekommen, dass wir hiergeblieben sind.« Nach knapp zehn Minuten trabten die Pferde schon wieder zurück nach Wisteria Gardens.
»Keiner wird Fragen stellen, weil sie uns nicht finden werden. Ich habe genug von deinen lästigen Freunden. Wir sind für die Dauer der Flitterwochen aus der Stadt verschwunden, kehren nach angemessener Zeit zurück und sagen Lebwohl …«
»Einander?« Da kam Leben in Blythe.
»Der Stadt, du Närrin!«
Im ersten Moment hielt sie es für einen Scherz, wartete, dass er lachen oder dass ein blasiertes Grinsen um seinen Mund spielen würde. Doch Aris zeigte keinerlei Regung, auch nicht, als der Palast in Sicht kam.
Blythe war fassungslos. Ihr Mund wurde trocken, als sie an die warnenden Worte ihres Vaters dachte. »Bitte?«
»Die ganze Stadt hält mich für einen Prinzen«, sagte er mit einer ausladenden Geste. »Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, dass wir hierbleiben würden.« Auch wenn es keine Frage war, ließ Blythe es sich nicht nehmen, ihm zu antworten.
»Und wessen Schuld ist das? Wenn du nicht so ein eingebildeter Schnösel wärst, säßen wir jetzt nicht in diesem Schlamassel.«
Als er die Hände in den Sitz krampfte, traten seine Knöchel weiß hervor. »Und wenn du dich nicht in meinen Handel mit Miss Farrow eingemischt hättest, säßen wir jetzt auch nicht in diesem Schlamassel.«
Blythe verschränkte so vehement die Arme vor der Brust, dass es ihr fast die steifen Spitzenärmel zerriss. Nun hatten sie den Palast fast erreicht, mit jedem Meter, den die Kutsche vorwärtsschaukelte, drückte sich Blythe mehr in den Sitz, um möglichst viel Distanz zwischen sich und Wisteria Gardens zu schaffen.
Ihr war von Anfang an klar gewesen, dass sie mit der Ehe eine überhastete Entscheidung getroffen hatte. Trotzdem hatte sie es nicht bereut. Jedenfalls nicht bis zu diesem Augenblick, wo eine Zukunft ohne ihren Vater drohte. Bei dem Gedanken wurde ihr schlecht vor Angst, doch sie ließ sich nichts anmerken. »Ich gehe nirgendwohin.«
»Und ob du gehst. Alle erwarten, dass ich dich nach Verena …«
»Verena gibt es gar nicht!«, fauchte sie. »Ist doch egal, was die anderen erwarten. Und sollte sich jemand wundern, dass ich hiergeblieben bin, hast du die Macht, sie zu beschwichtigen.«
Der Innenhof, den sie jetzt erreichten, war kaum wiederzuerkennen. Alle Anzeichen einer Hochzeit waren verschwunden, als hätte sie nie stattgefunden. Wenn sie selbst doch nur dieses Glück hätte.
»Vielleicht habe ich die Macht«, sagte Aris, »aber das heißt nicht, dass ich sie auch für dich einsetze. Mein Zuhause ist beweglich. Ich bleibe nicht länger als nötig.«
Blythes Mutter war gestorben und kurz darauf auch ihr Bruder Percy. Ihr Onkel Byron hatte mit seiner jungen Braut die Stadt verlassen, damit sie ihr Kind zur Welt bringen konnte, ohne dass es Fragen zur Vaterschaft aufwerfen würde.
Damit bliebe Elijah mutterseelenallein zurück. Und nach allem, was er durchgemacht hatte, fand sie die Vorstellung unerträglich.
Als die Kutsche in dem tadellos gepflegten Innenhof hielt, sprang Aris hinaus, doch Blythe blieb sitzen.
»Ich gehe nirgendwohin.« Obwohl die Worte bloß geflüstert waren, war ihre Heftigkeit nicht zu überhören. »Wenn du mich zwingst, kratze ich dir die Augen aus. Dann binde ich mich im Wald an einen Baum und beiße jedem, der mich wegziehen will, die Hand ab.«
»Du bist ein Teufel in Menschengestalt.« Aris raufte sich die Haare und schaute ratlos gen Himmel. »Wo nimmst du solchen Schwachsinn her?«
Blythe stemmte trotzig die Hacken rechts und links gegen die Türöffnung und krallte sich mit den Händen im Lederpolster fest. »Ich bleibe hier so lange sitzen, bis du mir versprichst, dass wir bleiben.«
Er musterte sie seelenruhig, die Hände lässig im Rücken verschränkt. »Ach ja? Na schön, dann wollen wir mal sehen, ob es dir wirklich ernst ist.« Ohne zu zögern, schlug er die Kutschtür zu. Sie konnte noch gerade eben die Füße wegziehen, landete aber vor Schreck am Boden. Nachdem sie sich wieder aufgerappelt hatte, sah sie noch, wie Aris einem der Pferde auf die Hinterbacke klatschte. Wer immer auf dem Kutschbock saß, musste entweder verhext oder nicht ganz bei Trost sein, denn die Pferde trabten erneut den Hang hinunter.
Blythe war sprachlos vor Entrüstung. Aris winkte ihr noch hinterher, dabei spielte ein aufreizend zufriedenes Lächeln um seine Lippen.
Blythe hatte keinen Schimmer, wohin die Kutsche sie bringen würde, aber es war ihr auch egal. Im Brautkleid, mit halb offenem Mieder und zerzaustem Haar hatte sie die letzte Stunde ihren verhassten Ehemann mit allen nur erdenklichen Schimpfwörtern überschüttet. Während sie überlegte, wie sie die Kutsche kapern und nach Foxglove fliehen könnte, um den Winter bei Signa zu verbringen, hatte sie gar nicht mitbekommen, dass die Kutsche zum Stehen gekommen war.
Erst das Schnauben der Pferde riss sie aus ihren Gedanken.
»Warum halten wir hier?«, rief Blythe dem Kutscher zu. Keine Antwort. Ihr war unheimlich zumute.
Sie linste aus dem Fenster.
Für jeden anderen hätten die Bäume ringsherum zu einem xbeliebigen Wald gehören können, doch Blythe hatte ihre gesamte Kindheit hier verbracht, sodass sie auf Anhieb wusste, wohin die Kutsche sie gebracht hatte: in den Wald hinter Thorn Grove.
Dem Wald, in dem der Garten ihrer Mutter lag.
Augenblicklich fiel alle Anspannung von ihr ab. Beim Aussteigen nahm sie die Goldfäden, die sich um sie geschlungen hatten, kaum wahr, dennoch lenkten sie sie vorbei an windschiefen Bäumen, die sich vor ihr, ihrer einstigen Herrscherin, zu verneigen schienen. Die Schönheit des Waldes hatte ihren Preis, schluckte er doch alle Wärme und alles Sonnenlicht, bis nur noch eine bittere Kälte übrig blieb, die ihr durch die Slipper drang. Blythe wappnete sich innerlich dagegen. Warum hatte Aris sie bloß hierhergebracht? Anfangs spähte sie noch hinter jeden Baum, in der Erwartung, er werde jeden Moment hervorspringen und sie grausam auslachen. Doch je tiefer sie in den Wald vordrang, desto überzeugter war sie, dass Aris hier nirgendwo lauerte.