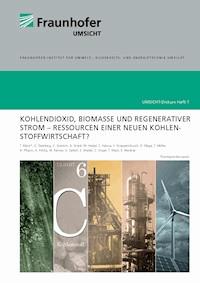Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl Maria Laufen Buchhandlung und Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In der deutschen Wissenschaftsszene und Forschungspolitik hat das Interesse an einer biologischen Technik unter Anwendung der Begriffe "Biologisierung oder "Biologische Transformation" in den letzten Jahren zugenommen. In dem vorliegenden Titel geht es um die Fragen: Entsteht durch die Übertragung biologischer Prinzipien in andere Bereiche eine verträglichere Technik oder Wirtschaft? Was sind das für Komponenten, Erkenntnisse, Prinzipien oder Methoden, die übertragen werden können und was liegt seinem Wesen nach dann vor: Etwas Lebendiges oder etwas Technisches? Um sich Antworten auf diese Fragen anzunähern, muss auch nach den Unterschieden zwischen technischen Verfahren und Lebewesen gefragt und nach Gemeinsamkeiten zwischen diesen gesucht werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UMSICHT-Diskurs Heft 2
FRAGEN ZU EINER BIOLOGISCHEN TECHNIK
Thomas Marzi, Volker Knappertsbusch, Anne Marzi, Sandra Naumann, Görge Deerberg, Eckhard Weidner
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Osterfelder Str. 3
46047 Oberhausen
Telefon 0208 8598-1230
URLwww.umsicht.fraunhofer.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-87468-381-4
Warenzeichen und Handelsnamen in dieser Publikation sind geschützt.
Autorinnen, Autoren und Herausgeber haben sich bemüht, alle Bildrechte zu klären. Sollte dies im Einzelfall nicht oder nicht zutreffend gelungen sein, wird um Nachricht an den Verlag gebeten.
Titel
Einzelfotos: ©shutterstock, Gestaltung: Anja Drnovsek
© Verlag Karl Maria Laufen
Oberhausen 2018
www.laufen-online.com
Das Neue kommt nicht durch immer wieder veränderte und reaktive Problemlösungsstrategien in die Welt.
Und auch nicht durch das bloße Vorhandensein von Mannigfaltigkeit oder kulturellen und gesellschaftlichen Farbenreichtums.
Es entsteht vielmehr durch eine kreative Veränderung des Gemisches aus Fragen und Antworten.
Michael Reitz, Publizist, 20151
Fragen zu einer biologischen Technik – worum geht es?
Was denken Sie, wenn Sie die Begriffe biologische, biologisch transformierte oder »biologisierte« Technik hören? Sie werden sich wahrscheinlich zunächst fragen, was das denn eigentlich ist, eine biologische oder biologisch transformierte Technik. Handelt es sich bei Biologie und Technik nicht um völlig verschiedene Dinge? Beschäftigt sich die Biologie nicht mit der Erforschung von Lebewesen, während Technik etwas Künstliches schafft, das etwas völlig Anderes ist als ein Lebewesen? Nach kurzem Nachdenken fallen Ihnen wahrscheinlich die Begriffe Biotechnologie und Gentechnik als Beispiele für eine biologische Technik ein, da diese Themengebiete anscheinend sowohl etwas Biologisches als auch etwas Technisches enthalten. So kommt die Kombination aus Biologie und Technik in den Begriffen Biotechnologie und Gentechnik sogar sprachlich zum Ausdruck, da in ihnen die biologisch geprägten Silben »Bio-« und »Gen-« mit den technisch geprägten Silben »-technologie« und »-technik« kombiniert werden.
Doch nicht nur Biotechnologie und Gentechnik können als biologische Technik aufgefasst werden. Auch Themen, die zunächst gar nicht biologisch klingen, wie das Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz (KI), lassen sich als biologisch transformierte Technik auffassen, da sie versuchen, Eigenschaften von Lebewesen, im Fall der KI kognitive Leistungen, auf technische Systeme zu übertragen. Was also mit einer biologisch transformierten Technik gemeint ist, ist nicht »pure« Biologie, sondern die Übertragung von Komponenten, Erkenntnissen, Prinzipien oder Methoden aus der Biologie in technische Verfahren und Systeme. Auch eine Übertragung auf weiter gefasste Bereiche wie die Industrie, die Wirtschaft und vielleicht sogar die Gesellschaft scheint möglich zu sein.
Vielleicht verstehen Sie unter einer biologischen Technik oder Wirtschaft aber auch etwas, was besser und nachhaltiger ist als bisher, biologisch eben, so wie ein Bioprodukt. Aber stimmt das? Entsteht durch die Übertragung biologischer Prinzipien in andere Bereiche wirklich eine verträglichere Technik oder Wirtschaft? Was sind das überhaupt für Komponenten, Erkenntnisse, Prinzipien oder Methoden, die übertragen werden können und was liegt seinem Wesen nach dann vor: Etwas Lebendiges oder etwas Technisches? Um sich Antworten auf diese Fragen anzunähern, muss auch nach den Unterschieden zwischen technischen Verfahren und Lebewesen gefragt und nach Gemeinsamkeiten zwischen diesen gesucht werden.
Darum geht es im Folgenden bei den »Fragen zu einer biologischen Technik«.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Fragen zu einer biologischen Technik – worum geht es?
1 Biologische Transformationen – eine Einführung
1.1 Vorbemerkungen
1.2 Was sind »Biologische Transformationen«? – eine Begriffsklärung
1.3 Exkurs 1: Konvergierende Technologien
1.4 Was ist eine »Biologische Transformation«? – Eine Strukturierung
1.5 Fragen zur Bewertung biologischer Transformationen
2 Lebewesen und Technik – Teil 1
2.1 Zielgerichtetheit in Natur und Technik
2.2 Exkurs 2: Teleologie
3 Lebewesen und Ökosysteme
3.1 Was sind Lebewesen
3.2 Leben – eine emergente Eigenschaft?
3.3 Evolution
3.4 Ökosysteme
4 Was ist Technik?
4.1 Philosophie der Technik
4.2 Wie entsteht Technik?
4.3 Mensch, Technik, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft
5 Lebewesen und Technik – Teil 2
5.1 Evolutionäre technische Entwicklungen?
5.2 Evolutionäre Ökonomik und Evolutionsmanagement
5.3 »Künstliche Lebewesen«
5.4 Menschen und Maschinen im »Parlament der Dinge«
5.5 Exkurs 3: Einzeller als Vorbild für »lernende« Agenten
5.6 Technik im Menschen
5.7 Muskelbetriebene Roboter
5.8 Lebewesen in maschinellen Strukturen?
5.9 Die »biologische Dimension« von Technik
6 Biologische Transformation – Ethische Fragen
7 Resümee
8 Anhang
8.1 Autorinnen und Autoren
8.2 Danksagung
8.3 Tabellenverzeichnis
8.4 Abbildungsverzeichnis
8.5 Abbildungsnachweise
8.6 Literaturverzeichnis
1Biologische Transformationen – eine Einführung
Abbildung 1: »Vitruvianischer Mensch« von Leonardo da Vinci, ca. 1490 Diese Zeichnung von Leonardo da Vinci zeigt die einen Menschen mit idealisierten Proportionen. Die Abbildung wird als vitruvianischer Mensch bezeichnet, da die vorgenommene Idealisierung von Formen und Proportionen sich an Vorstellungen des antiken Architekten Vitruvius orientiert. Die Autorinnen und Autoren assoziieren mit dem Bild, dass durch Menschen sowohl eine biologische, als auch eine technische Dimension sichtbar wird. So sind Menschen einerseits biologische Wesen, andererseits aber auch die schöpferische Quelle für Technik.
1.1 Vorbemerkungen
»I think the biggest innovations of the twenty-first century will be the intersection of biology and technology. A new era is beginning, just like the digital one…«2, Steve Jobs (Isaacson 2011).
»Kommen technische Innovationen zukünftig hauptsächlich aus der Biologie?« Glaubt man dem Unternehmer Steve Jobs, der als Gründer des Unternehmens »Apple« einer der bekanntesten Pioniere der digitalen Entwicklung war und den Ruf eines Visionärs innehatte, sind aus der Biologie zukünftig technische Entwicklungen zu erwarten, die von großer Bedeutung für unser Leben sein werden. Aber hat Steve Jobs mit seiner Prognose recht, dass biologische Innovationen sogar mit der digitalen Revolution vergleichbar sind und eine neue Ära prägen werden? Auf den ersten Blick verwundert seine Prognose doch sehr. Waren es in der Vergangenheit nicht überwiegend Erkenntnisse aus der Physik oder Chemie, die die naturwissenschaftlichen Grundlagen für technische Entwicklungen lieferten, während Innovationen aus dem Bereich der Biologie seltener waren und viel später einsetzten? Handelte es sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als physikalische und chemische Forschungen bereits technische Entwicklungen wie die Dampfmaschine oder elektrische Anlagen ermöglichten, bei der »Lebenswissenschaft Biologie« nicht noch um eine eher beschreibend und naturphilosophisch arbeitende Wissenschaft ohne erkennbares technisches Entwicklungspotenzial? Die Innovationsfähigkeit, die Steve Jobs der Biologie heute zuspricht, muss deshalb mit einer Entwicklung zusammenhängen, durch die die Biologie zu einer experimentell arbeitenden Naturwissenschaft mit vielen Teildisziplinen (Ingensiep 1997) wurde, was auch das Entstehen angewandter Richtungen3 ermöglichte.
Doch auch wenn sich mithilfe einer angewandten biologischen Forschung neue Technologien entwickeln lassen – führen diese wirklich zu Innovationen, die mit der digitalen Revolution vergleichbar sind? Bei der Beantwortung dieser Frage lohnt sich erneut ein Blick auf das Zitat von Steve Jobs, der die von ihm erwarteten Innovationen nicht der Biologie als Einzelwissenschaft zuschreibt, sondern eine Verbindung (»intersection«) von Biologie und Technik als treibende Kraft für Innovationen annimmt. Erst die Verbindung aus Biologie und Technik, so lässt sich aus dem Zitat schließen, führt zu Entwicklungen, die mit den Innovationen im digitalen Bereich vergleichbar sind. Worum es sich bei einem solchen Zusammenwachsen von Biologie und Technik handeln kann, lässt sich anhand eines Beispiels erahnen, das in einem Sammelwerk der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft (Spektrum der Wissenschaft 2015), das den gar nicht biologisch klingenden Titel »Roboter« trägt, aufgeführt ist. Dort wird u. a. die Entwicklung eines Mikroroboters beschrieben, der aus biologischen und anorganischen Bestandteilen besteht (Dönges 2015). Bei den biologischen Komponenten handelt es sich um Muskelzellen, durch die der Roboter bewegt werden kann.
Konzepte, die auf einer Interaktion zwischen Biologie und Technik aufbauen, sind jedoch nicht vollkommen neu. Neben bionischen Konzepten, die u. a. Material- und Formeigenschaften aus der Natur auf technische Anwendungen übertragen, ist in diesem Zusammenhang auch eine von den Vereinigten Staaten ausgehende Debatte um konvergierende Technologien (»Converging Technologies«) zu nennen, die auf eine als »NBIC-Konvergenz«4 bezeichnete Wechselwirkung zwischen den Themengebieten Nano-, Bio- und Informationstechnik und Kognitionswissenschaft abzielt. Die Debatte zur NBIC-Konvergenz (Roco 2003; Coenen 2008) wird etwa seit Beginn des 21. Jahrhunderts kontrovers geführt, da vor allem die formulierten gesellschaftlichen und humanen Visionen, die sich auf technologische Veränderungen von Menschen beziehen, zu Recht erheblichen Widerspruch hervorrufen (siehe Exkurs 1). Auch ein im Auftrag der Europäischen Union erstellter Expertenbericht nimmt Bezug auf eine mögliche NBIC-Konvergenz (Nordmann 2004), ohne sich dabei aber die umstrittenen gesellschaftlichen und humanen Visionen zu eigen zu machen.
In der deutschen Wissenschaftsszene und Forschungspolitik hat das Interesse an einer biologischen Technik unter Anwendung der Begriffe »Biologisierung« oder »Biologische Transformation« in den letzten Jahren zugenommen. So erwartet der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer, eine »Biologisierung der Industrie«, die dadurch gekennzeichnet sein wird, dass sich Biologie und Technik immer mehr »verzahnen« (Neugebauer 2017). Eine solche Biologisierung sprach auch die ehemalige Bundesforschungsministerin Johanna Wanka auf einem Innovationsdialog5 zum Thema Biotechnologie an, auf dem sie eine »Agenda Biologisierung« in Aussicht stellte, die die Forschungsprogramme der Bundesregierung zukünftig wesentlich bestimmen soll (bioökonomie.de 2017). Spätestens seit dieser Ankündigung haben die Begriffe »biologische Transformation« und »Biologisierung« einen forschungspolitischen Charakter, sodass es nicht verwunderlich ist, dass das Thema auch in den aktuellen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aufgenommen wurde. Im Koalitionsvertrag heißt es: »Wir werden die Nutzung von Prinzipien der Natur vorantreiben und eine ressortübergreifende Agenda ′Von der Biologie zur Innovation′ gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erarbeiten« ((CDU, CSU, SPD 2018), S. 35). Zur Vorbereitung dieser Agenda, die den Titel »Von der Biologie zur Innovation« tragen soll, erfolgte inzwischen auch eine durch die Fraunhofer-Gesellschaft im Auftrag des Ministeriums für Bildung und Forschung durchgeführte Voruntersuchung, die die industrielle Wertschöpfung potenzieller biologischer Transformationen bewerten sollte. Die Ergebnisse der Voruntersuchung wurden auf zwei Konferenzen im Juni 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt (Fraunhofer-Gesellschaft 2018b, 2018a).
Zitat 1 – Carl Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
»Das Verhältnis von Philosophie zur sogenannten positiven Wissenschaft lässt sich auf die Formel bringen: Philosophie stellt diejenigen Fragen, die nicht gestellt zu haben die Erfolgsbedingung des wissenschaftlichen Verfahrens war.«
((Anzenbacher 2010), S. 24)
Auch wenn auf den genannten Konferenzen erste Ansätze zur Definition biologischer Transformationen erfolgten, sind die zu erwartenden Auswirkungen dieser Transformationen immer noch eine offene Frage. Ohne einer notwendigen Diskussion zu diesem Thema vorgreifen zu wollen, geht jedoch aus den Beiträgen der o. g. Konferenzen hervor, dass die Teilnehmer einer Übertragung von biologischen Prinzipien auf technische, wirtschaftliche und soziale Bereiche das Potenzial zusprechen, umfassende Veränderungen anzustoßen, deren Wesen und Auswirkungen heute noch nicht zu überblicken sind. Zur Untersuchung dieser Aspekte werden deshalb, obwohl es sich bei der Biologie um eine Naturwissenschaft handelt, nicht nur die Ingenieur- oder Naturwissenschaften benötigt, sondern eine Reihe sehr unterschiedlicher Disziplinen, zu denen auch die Kultur- und Formalwissenschaften zählen.6 Vor allem mit Blick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge lassen sich so weitere Erkenntnisse zu biologischen Transformationen gewinnen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es ein wesentliches Merkmal der Wissenschaften ist, dass sie thematisch fokussiert sind und jeweils eine spezifische Methodik anwenden. Auch wenn sie, wie Carl Friedrich von Weizsäcker schreibt (Zitat 1), dieser Fokussierung ihren Erfolg verdanken, schränkt sie sie zugleich aber auch in ihren Erkenntnismöglichkeiten ein, da etwas, das außerhalb der thematischen und methodischen Grenzen liegt, nicht in Betracht gezogen werden kann.7 Diese Beschränkung hat zur Folge, dass eine Transformation als »Ganzes« sowie das, was die Transformation eigentlich ausmacht, von keiner Einzelwissenschaft abgebildet werden kann. Zwar lassen sich Erkenntnisteile aus einzelnen Wissenschaften durch interdisziplinäre Herangehensweisen möglicherweise zu einem größeren Bild zusammensetzen, der Blick auf das Ganze erschließt sich so jedoch nicht. Die von den einzelnen Wissenschaften erschlossenen Teile können nur zu einem sinnvollen Ganzen zusammengesetzt werden, wenn zumindest eine Vorstellung darüber existiert, was das eigentliche Wesen dieses Ganzen denn ausmacht. So schwierig es ist, dieses Ganze in den Blick zu nehmen, so wichtig ist es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, kontinuierlich den Versuch hierzu zu unternehmen, wie schon Erwin Schrödinger, einer der Begründer der Quantentheorie, im Vorwort seines Buches »Was ist Leben?« bemerkt ((Schrödinger 1989), S. 29 f., Zitat 2). Schrödinger versucht seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, in dem er sich als Physiker zu dem eigentlich anderen Wissenschaftsdisziplinen vorbehaltenen »Phänomen Leben« äußert. Er scheut sich dabei nicht, auch philosophische Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Textes sprechen sich deshalb dafür aus, neben einzelwissenschaftlichen Aspekten auch philosophisches Denken in die Entwicklung und Bewertung biologisch-technischer Transformationen einzubeziehen. Sie sind davon überzeugt, dass das, was wir über Welt, Lebewesen, Technik, Menschen und uns selbst denken, z. B. Beispiel unsere jeweilige Vorstellung von Natur, auch unseren Umgang mit biologischen Transformationen prägen wird. Umgekehrt wird auch die Art, wie wir mit einer biologischen Transformation umgehen, unser Denken nicht unbeeinflusst lassen.
Zitat 2 – Erwin Schrödinger (1887 – 1961):
»Wir haben von unseren Vorfahren das heftige Streben nach einem ganzheitlichen, alles umfassenden Wissen geerbt[…]. Aber das Wachstum in die Weite und Tiefe, das die mannigfaltigen Wissenszweige seit etwa einem Jahrhundert zeigen, stellt uns vor ein seltsames Dilemma. Es wird uns klar, dass wir erst jetzt beginnen verlässliches Material zu sammeln, um unser gesamtes Wissensgut zu einer Ganzheit zu verbinden. Andererseits ist es einem einzelnen Verstande beinahe unmöglich geworden, mehr als nur einen kleinen spezialisierten Teil zu beherrschen.
Wenn wir unser wahres Ziel nicht für immer aufgeben wollen, dann dürfte es nur den einen Ausweg aus dem Dilemma geben: dass einige von uns sich an die Zusammenschau von Tatsachen und Theorien wagen, auch wenn ihr Wissen teilweise aus zweiter Hand stammt und unvollständig ist – und sie Gefahr laufen, sich lächerlich zu machen[…]
Dublin, September 1944. E.S. (Schrödinger 1989)
Der vorliegende Text ist als Versuch zu verstehen, verschiedene Aspekte in die aktuellen Diskussionen um biologische Transformationen einzubeziehen. Hierzu erfolgt zunächst eine Spezifizierung der Begriffe »Biologische Transformation« und »Biologisierung« in Kapitel 1.2, eine Strukturierung der damit verbundenen Technikfelder in Kapitel 1.4 und eine erste Bewertung verschiedener Transformationen in Kapitel 1.5. Anschließend werden in Kapitel 3 spezifische Wesensmerkmale von Lebewesen und in Kapitel 4 von technischen Artefakten und Verfahren herausgearbeitet. Beide werden in Kapitel 2 und 5 miteinander in Beziehung gesetzt. In Kapitel 5 werden dabei auch unterschiedliche biologische Transformationen betrachtet. In Kapitel 6 sprechen sich die Autorinnen und Autoren für die Berücksichtigung ethischer Aspekte aus.
Die Autorinnen und Autoren und dieses Textes sind in einem ingenieurwissenschaftlichen Umfeld tätig. Ihnen ist bewusst, dass sie den Themenkomplex »Biologische Transformationen« nicht in allen seinen fachlichen Aspekten umfassend darstellen können. Trotzdem orientieren sie sich an der Aufforderung Erwin Schrödingers, über die eigenen Fachdisziplingrenzen hinauszugehen, um nicht zuletzt auch ihre eigene Arbeit besser reflektieren zu können. Aufgrund der thematischen Breite muss hierzu notwendigerweise an vielen Stellen auf Sekundärquellen zurückgegriffen werden, was die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die in einzelnen Teilen des folgenden Textes besser zu Hause sind, den Autorinnen und Autoren nachsehen mögen. Bei der Vielzahl möglicher Herangehensweisen an das Thema erhebt der vorliegende Text keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll aber als Einladung zu einem Diskurs verstanden werden, die sich an unterschiedliche Akteure und Disziplinen richtet.
1.2Was sind »Biologische Transformationen«? – eine Begriffsklärung
Die Entwicklung des Begriffs »Biologisierung«
In Kapitel 1.1 wurden die Begriffe »Biologisierung« und »Biologische Transformation« als Synonyme für eine intensiver werdende Wechselwirkung zwischen Technik auf der einen und biologischen Erkenntnissen und Methoden auf der anderen Seite verwendet. Bei dem Versuch nachzuvollziehen, in welchem Zusammenhang die Begriffe gebraucht werden und welche Entwicklung ihr Verständnis in den letzten Jahren genommen hat, ist es sinnvoll, zunächst mit dem Begriff »Biologisierung« zu beginnen.
Der deutsche Begriff »Biologisierung« ist inzwischen auch im englischen Sprachraum angekommen. So schreibt der irische Wissenschaftler Gerry Byrne8 in einem Diskussionsbeitrag zur Digitalisierung in der Produktion, dass im Jahr 2017 in Deutschland mit dem Wort Biologisierung9 ein neuer Begriff entstanden ist, der zunehmend eine größere Verbreitung findet, obwohl eine präzise Definition des Begriffs noch aussteht (Byrne 2017). Als Themen, die sich dem Begriff »Biologisierung« zuordnen lassen, nennt er Gentechnik, Synthetische Biologie, Medizintechnik, Landwirtschaft, Biotreibstoffe, neue Materialien sowie Nanomaschinen. Ebenso wie Steve Jobs (Kapitel 1.1) erwartet er durch eine Biologisierung gravierende Veränderungen, die er mit den Auswirkungen der Digitalen Revolution vergleicht: »…it is the start of an entirely new revolution which has the potential to impact on the human being in a highly personal and profound manner – more so than the societal, cultural, economic and political impact of digitization to-date… So yes, there is an industrial revolution taking place and Biologicalisation is sitting at the centre of it. « (Byrne 2017)
Tatsächlich wird der Begriff »Biologisierung« in Deutschland schon länger verwendet als seit 2017, allerdings zunächst noch nicht in dem von Gerry Byrne beschriebenen Zusammenhang interpretiert, sondern, im technischen Kontext, nahezu ausschließlich auf biotechnologische Prozesse und das Themengebiet der Bioökonomie (Telgheder 2009; Schüler 2015) bezogen. Biologisierung wird in diesem Zusammenhang in erster Linie als eine zunehmende Verwendung biotechnologischer Verfahren oder als Mittel zu einer biobasierten Wirtschaft verstanden (BMBF 2014, Lipkowski und Gloger 2007; Vogt 2017; EY Client Portal 2016; Hannovermesse 2015). Allerdings bietet auch der Begriff Bioökonomie noch ausreichend Interpretationsspielraum, der, vor allem international, sehr unterschiedlich ausgelegt wird (Wikipedia 2017a). Der deutsche Bioökonomierat, der die Bundesregierung in Fragen der Bioökonomie berät, bezeichnet Bioökonomie als Umdenkprozess (Bioökonomierat 2014) und die »Nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030« nennt für die Bioökonomie fünf wesentliche Handlungsfelder, die unter Berücksichtigung von Aspekten der Kreislaufwirtschaft zu erschließen sind. Dabei handelt es sich um die Themengebiete »Sicherung der Ernährung«, »Nachhaltige Agrarproduktion«, »Gesunde und sichere Lebensmittelproduktion«, »Industrielle Nutzung nachwachsender Rohstoffe« sowie »Energetische Biomassenutzung« (BMBF 2017). Diese Interpretation der Bioökonomie wird in letzter Zeit immer mehr um den Aspekt einer Nutzung von biologischem Wissen (Braun 2014) erweitert, womit auch bionische Konzepte jeglicher Art eingeschlossen werden, die nicht nur Material- und Forminnovationen beinhalten. Da unter Bionik die Übertragung von Erkenntnissen aus biologischen Systemen auf Konstruktionen, Verfahren, Entwicklungsprinzipien und wirtschaftlich-technische Anwendungen verstanden wird (Ferdinand et al. 2012), lässt sich Biologisierung somit auch als Teilaspekt der in Kapitel 1.1 bereits genannten und in Exkurs 1 beschriebenen »NBIC-Konvergenz« auffassen. Wie erwähnt, ist unter NBIC-Konvergenz eine konvergierende Wechselwirkung zwischen Nano-, Bio- und Informationstechnologien und Kognitionswissenschaften zu verstehen. Von der NBIC-Konvergenz werden sehr weitreichende technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erwartet, von denen vor allem die teilweise formulierten gesellschaftlichen Ziele, die sich auch auf optimierte, leistungsfähigere Menschen beziehen, auf erhebliche Kritik gestoßen sind (Roco und Bainbridge 2003; Coenen 2008, 2014). Inwieweit gesellschaftliche Veränderungen mit dem Begriff Biologisierung verbunden sind und welche Veränderungen angestrebt oder in Kauf genommen werden, ist somit eine Frage, die im aktuellen Diskurs nicht ausgeklammert werden darf.
Biologisierung der Gesellschaft?
Was sich unter einer Biologisierung in Bezug auf die Gesellschaft verbergen kann, lässt sich anhand der Argumentation nachvollziehen, die Alfred Nordmann (Nordmann 2015) in seinem einführenden Buch zur Technikphilosophie auf die Prozesse »Technisierung«10, »Medikalisierung« und »Digitalisierung« anwendet. Wird diese Sichtweise auf biologische Transformationen übertragen, handelt es sich bei einer Biologisierung nicht nur um die Zunahme oder Ausbreitung von biologisch inspirierten Verfahren, sondern um einen historischen Prozess, der auch eine Veränderung der Gesellschaft einschließt. Wie eine solche Veränderung aussehen kann, wird am von Nordmann gewählten Beispiel der Medikalisierung deutlich. Er beschreibt, dass durch eine Medikalisierung medizinische Begriffe wie »Gesundheit« und »Krankheit« auf Gesellschaftsbereiche übertragen werden, die eigentlich nicht dem Bereich der Medizin angehören und leitet hieraus ab, dass menschliche Verhaltensweisen oder Auffälligkeiten vermehrt als behandlungsbedürftige Krankheiten bezeichnet werden. Auch Wirtschaftszweige oder Unternehmen (Voigtländer und Demary 2016) werden so entweder als »gesund« oder »krank« diagnostiziert. Unternehmen, die die Diagnose »krank« erhalten, gelten dann als »behandlungsbedürftig«. Das Verwenden der Bezeichnungen »gesund« und »krank« in nichtmedizinischen Bereichen ist mehr als eine Analogie, denn es weist auf eine veränderte Sichtweise hin, die zu entsprechenden Handlungen führen kann. Eine Biologisierung wirkt in ähnlicher Weise und hat die Übertragung biologischer Begriffe auf andere Bereiche zur Folge. Dass dieser Prozess bereits stattfindet, zeigt beispielsweise die zunehmende Verwendung der Begriffe »Evolution« und »Ökosysteme« im wirtschaftlichen Umfeld (Lambertz 2016; Beinhocker und Bertheau 2007; Melcher 2011; Hebenstreit 2016) und nicht zuletzt auch die hier geführte Diskussion um eine biologische Transformation selbst.
In Zusammenhang mit der Gesellschaft ist der Begriff »Biologisierung« jedoch sehr kritisch zu hinterfragen,11,12 da biologische Erklärungsmodelle außer Acht lassen, dass das Verhalten von Menschen und menschlichen Gesellschaften nicht nur biologisch beschrieben werden kann und noch durch andere Faktoren beeinflusst wird, als sie in der Biologie untersucht werden. So ist beispielsweise die für den Zusammenhalt von Gesellschaften wichtige Frage nach Gerechtigkeit kein Thema der Biologie. Wie kritisch eine einfache Übertragung von biologischen Erkenntnissen auf Menschen und Gesellschaft sein kann, wird deutlich, wenn berücksichtigt wird, dass sich auch politische Ideologien wie der Nationalsozialismus am Verhalten von Tieren orientiert haben, um ihr jeweiliges Gesellschaftsmodell zu begründen (»Sozialdarwinismus«) (Wikipedia 2017c; Richter 2005). Auch die Erschaffung »neuer« Menschen, wie sie heute noch in trans- und posthumanistischen Visionen (Exkurs 1) propagiert wird, war Gegenstand dieser Ideologie.
Es müssen jedoch nicht unbedingt Extrembeispiele wie das einer faschistischen Gesellschaftsstruktur herangezogen werden, um auf Fehlinterpretationen bei der Übertragung biologischer Erkenntnisse auf Gesellschaften hinzuweisen. Auch bei Ansätzen aus der Wirtschafts- und Managementbionik finden sich hierfür Beispiele. So lassen sich als »bionisch« bezeichnete Angebote für das Training und Coaching von Führungskräften finden, die sich auf Vorbilder aus der Tierwelt beziehen. Sylvia Lipkowski und Svenja Gloger berichten, dass z. B. das Sozialverhalten in Wolfsrudeln in Führungsseminaren als Vorbild verwendet wird (Lipkowski und Gloger 2007). Matthias Nölke (Nölke 2011) propagiert einen »biologistischen Ansatz«, der paradoxerweise das Ziel eines »menschengerechten Managements« haben soll.13
Wie die o. g. Argumente zeigen, sollte der Begriff »Biologisierung« nicht als Zielvorstellung für eine gesellschaftliche Veränderung eingesetzt werden. Aus diesem Grund wird anstelle des Begriffs »Biologisierung« zunehmend der Begriff »Biologische Transformation« verwendet, wenn auf eine zunehmende Integration von Prinzipien der Natur in Technik, Industrie und Wirtschaft Bezug genommen werden soll. Allerdings sind diese Bereiche auch Teil der Gesellschaft, sodass biologische Transformationen immer auch einen gesellschaftlichen Bezug haben.
Biologische Transformation von Technik, Industrie und Wirtschaft
Die Vision einer weitgreifenden biologischen Transformation technischer und wirtschaftlicher Prozesse wurde von dem Ökonomen William Brian Arthur in seinem Buch »The Nature of Technology« beschrieben (Arthur 2009). Arthur vertritt darin die Ansicht, dass sich die vorhandene Technik immer mehr von einem stationären, klassischen Maschinenkonzept zu einem vernetzten System verändert, das zumindest in Teilen selbstkonfigurierend, -optimierend und -strukturierend ist (Zitat 3). Seiner Ansicht nach zeigen technische Aggregate zukünftig Eigenschaften, die bisher nur Lebewesen zugeschrieben wurden. Er erwartet eine Verschiebung weg von statischen Produktionssystemen zu neuen Systemen, die sich selbst konstruieren und bauen, selbst reparieren, kognitive Fähigkeiten haben und lernfähig sind. Gerry Byrne bezeichnet diese Systeme als »living systems« bzw. »biointelligent« (Byrne 2018), wobei davon ausgegangen werden muss, dass diese Aussage wohl metaphorisch gemeint ist. Robert Miehe und Alexander Sauer (Miehe und Sauer 2018) verstehen unter biointelligent »lokal abgegrenzte technische Fabriksysteme …[die sich] zu selbstorganisierten, vernetzten und adaptiven Wertschöpfungssystemen wandeln«.
Zitat 3 – William Brian Arthur (* 1945):
»The representative technology is no longer a machine with fixed architecture carrying out a fixed function. It is a system, a network of functionalities – a metabolism of things-executing-things – that can sense its environment and reconfigure its actions to execute appropriately. […] Therefore, increasingly, networks are being designed to »learn« from experience which simple interactive rules of configuration operate best within different environments […] Does this constitute some form of “intelligence”? To some degree it does. One simple definition of biological cognition – as say with E. coli bacteria sensing an increased concentration of glucose and moving toward that – is being able to sense an environment and react appropriately. Thus, as modern technology organizes itself increasingly into networks of parts that sense, configure, and execute appropriately, it displays some degree of cognition. […]technology becomes more sophisticated, it is becoming more biological.«(Arthur 2009)
Die Autoren des EU-Berichts »Making Perfect Life« ((van Est et al. 2012), S. 15 ff.) orientieren sich zum Teil mit ihren Argumenten an Arthur und verwenden die von ihm geprägten Schlagwörter »biology becoming technology« und »technology becoming biology« als Synonyme für zwei Megatrends, die sie für das 21. Jahrhundert ausmachen. Der Trend »biology becoming technology« geht dabei auf eine Betrachtungsweise zurück, die Lebewesen als mechanistisch organisierte Objekte betrachtet, sodass Leben auch »konstruiert« werden kann. Der Trend »technology becoming biology« bezieht sich auf die Integration lebewesentypischer Eigenschaften in technische Systeme. Hierzu gehören beispielsweise die auch von Byrne genannten Eigenschaften Selbstorganisation, Kognition und Lernfähigkeit. Die Begriffe »Technisierung« und »Biologisierung« fließen hier ineinander. Nach Sichtweise von Arthur, kann eine biologische Transformation viel weiter gefasst werden, als das bei einer reinen Nutzung biologischer Materialien oder der Anwendung von biotechnologischen Prozessen der Fall ist. Zu berücksichtigen sind dann eine ganze Reihe anderer Bereiche, die beispielsweise auch logistische Konzepte, Robotik, Künstliche Intelligenz (KI) und ökonomische Aspekte beinhalten können. Im folgenden Kapitel erfolgt deshalb der Versuch, diese sehr unterschiedlichen Themen zu erfassen und zu gliedern.
1.3Exkurs 1: Konvergierende Technologien
Unter dem Begriff »Konvergenz« wird im Allgemeinen die Annäherung oder das Zusammenlaufen von verschiedenen Dingen verstanden, beispielsweise wenn unterschiedliche Techniklinien zu einer gemeinsamen Technik »konvergieren« (Coenen 2008; Kornwachs 2013a). Ausgehend von Diskussionen in den 1990er Jahren um eine »Medien- und Informationskonvergenz« sowie um Entwicklungen in der Nanotechnologie hat sich um die Jahrtausendwende herum eine kontroverse Debatte um konvergierende Technologien und Wissenschaften (»Converging Technologies«) entwickelt, die von einer als »NBIC-Konvergenz« bezeichneten Wechselwirkung zwischen Nano-, Bio- und Informationstechnologien sowie Kognitionswissenschaften ausgeht (Roco und Bainbridge 2003; Coenen 2008). Die NBIC-Konvergenz beinhaltet eine Kombination von Erkenntnissen, Methoden und Forschungsaktivitäten, die zwischen den einzelnen NBIC-Feldern bi-, tri- oder tetralateral erfolgen kann (Abbildung 2).
Abbildung 2: Darstellung der NBIC-Konvergenz Tetraederdarstellung nach (Roco und Bainbridge 2003)
Christopher Coenen (Coenen 2008, 2014) unterscheidet in seiner zusammenfassenden Bewertung der NBIC-Konvergenz zwischen einer von den USA ausgehenden Debatte, die sich am Begriff des »Human Enhancements«, also einer Optimierung von Menschen, orientiert und einer eher forschungspolitischen Diskussion, die vor allem in Europa geführt wird (Nordmann 2004). Er ordnet den Beginn der US-amerikanischen Debatte im Wesentlichen der ersten NBIC-Konferenz im Jahr 2001 zu, die von Mihail Roco und Sims Bainbridge organisiert wurde. Roco und Bainbridge gehen von einer zunehmenden Vereinheitlichung unterschiedlicher Wissenschaften und Technologien aus (Roco und Bainbridge 2003). Sie verwenden dabei den Begriff einer »materiellen Einheit auf der Nanoebene« (Coenen 2008; Roco und Bainbridge 2003), der zu einem »hierarchischen Verständnis von Wirklichkeit« führt und zur Erklärung der gesamten Natur, dem menschlichen Gehirn sowie von sozialen und kulturellen Prozessen herangezogen werden kann. Komplexe soziale Zusammenhänge werden hierbei auf Gesetzmäßigkeiten auf der Nanoebene zurückgeführt. (Abbildung 3)
Abbildung 3: »Holistische« Darstellung sozialen Verhaltens (Yonas und Glicken Turnley 2003)