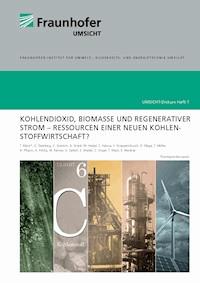
Kohlendioxid, Biomasse und regenerativer Strom - Ressourcen einer neuen Kohlenstoffwirtschaft E-Book
Thomas Marzi
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl Maria Laufen Buchhandlung und Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Will man Erdgas, Erdöl und Kohle ersetzen, kommen als alternative Kohlenstoffträger nur Biomasse unf CO2 in Frage. Doch wie ist es um die Verfügbarkeit dieser Ressourcen bestellt? Reichen die zur Verfügung stehenden Mengen aus, die Industriebereiche Stahl, Zement und Chemie zu versorgen, und wie hoch ist der Energiebedarf zur Erschließung dieser "neuen" Rohstoffe? Im vorliegenden Themenheft werden ausgewählte Aspekte einer Transformation zu einer neuen Kohlenstoffwirtschaft diskutiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT
Osterfelder Str. 3
46047 Oberhausen
ISBN 978-3-87468-361-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Warenzeichen und Handelsnamen in dieser Publikation sind geschützt.
Für Zitate und Bezugnahmen direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien übernimmt der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Einzelfotos ©pixabay.com Torsten Müller, Frauenhofer UMSICHT
© Verlag Karl Maria Laufen
Oberhausen 2017
Dieses Themenheft ist Prof.Dr. rer. nat. Rolf Kümmel gewidmet.
Rolf Kümmel hat maßgeblich den Werdegang unseres Institutes gestaltet und leitete es von 2002 bis 2004.
Kurzfassung
Um das von der Pariser Klimaschutzkonferenz vereinbarte »Zwei-Grad-Ziel« zu erreichen, mit dem drastische, unumkehrbare Umweltveränderungen durch den Klimawandel vermieden werden sollen, dürfen netto in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wahrscheinlich keine Treibhausgase mehr emittiert werden. Hiervon sind neben dem Energiesystem auch wichtige Industrien wie die Stahl-, Zement- und chemische Industrie betroffen, deren Produktionsstrukturen wesentlich auf der Verarbeitung von fossilen Kohlenstoffverbindungen aufbauen. Soll wirklich »Nullemission« erreicht werden, ist auch in diesen Industrien ein Systemwechsel erforderlich, der eine fundamental andere Bewirtschaftung kohlenstoffhaltiger Rohstoffe beinhaltet.
Will man Erdgas, Erdöl und Kohle ersetzen, kommen als alternative Kohlenstoffträger nur Biomasse und CO2 in Frage. Doch wie ist es um die Verfügbarkeit dieser Ressourcen bestellt? Reichen die zur Verfügung stehenden Mengen aus, die o.g. Industriebereiche zu versorgen, und wie hoch ist der Energiebedarf zur Erschließung dieser »neuen« Rohstoffe? Im vorliegenden Themenheft werden ausgewählte Aspekte einer Transformation zu einer neuen Kohlenstoffwirtschaft diskutiert. Eine besondere Rolle spielt dabei die Vision eines zukünftigen Produktionssystems, das Kohlenstoff kaskadenförmig nutzt und die Kopplung verschiedener Branchen vorsieht. Als systemverknüpfende bzw. sektorkoppelnde Technologien kommen dabei Carbon-Capture-and-Utilisation- oder Power2X-Verfahren in Frage, die CO2 in energiereiche chemische Verbindungen umwandeln. Sie ermöglichen es, Kohlenstoff mehrfach zu nutzen, Produktionskreisläufe zu schließen und die insgesamt benötigte Biomassemenge zu verringern.
Zur Umwandlung von CO2 muss regenerative Energie in erheblicher Größenordnung bereitgestellt werden. Unklar ist, ob dies im erforderlichen Umfang gelingen kann. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die zur Erreichung des Zwei-Grad-Ziels erforderlichen Systemveränderungen in sehr kurzer Zeit eingeleitet werden müssen, ohne dass bekannt ist, welchem Rohstoff zukünftig welche Rolle zukommt, und welche Technologien zum Einsatz kommen werden. Hier bietet es sich an, Technologien und Produktionssysteme zu entwickeln, die auf unterschiedliche Kohlenstoffträger anwendbar sind. Der Systemwechsel zu einer neuen nachhaltigeren Kohlenstoffwirtschaft ist dabei als eine die ganze Gesellschaft betreffende Aufgabe anzusehen.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Widmung
Kurzfassung
Zitate
1 Einführung
2 Transformation der Kohlenstoffwirtschaft
2.1 Befinden wir uns in einem fundamentalen Systemwandel?
2.2 Rohstoffe und Energie sind die materielle Basis einer Gesellschaft
2.3 Potenzielle Kolehnstofftransformationspfade in einem Wirtschaftssystem ohne Erdgas, Erdöl und Kohle – orientierende Betrachtungen
- Kohlenstoffkreislauf und Klima
- Der »industrielle Metabolismus«
- Wie kann ein Produktionssystem ohne fossile Rohstoffe aussehen?
2.4 Pariser Abkommen, Klimaschutzplan und Energiewende
3 CO2 als Rohstoff für chemische Produkte und Treibstoffe
3.1 Die Energiewende – Ausgangspunkt für Technologien, die CO2 in chemische Produkte und Energieträger umwandeln?
3.2 Chemische Produkte aus CO2 herstellen? – Eine Pfadanalyse
- Reaktivität von CO2
- Welche Produkte können aus CO2 hergestellt werden?
3.3 Wie viel Strom wird zur CO2-Aktivierung benötigt? – Eine orientierende Betrachtung der Situation in Deutschland
- Exkurs I: Hüttenwerke als Kohlenstoffquelle
- Exkurs II: Chemische Produkte in einem Prozessschritt direkt aus Wasser und CO2 herstellen? – Gibt es eine Renaissance der Elektrochemie?
4 Resümee
5 Dank
6 Anhang
6.1 Literaturverzeichnis
6.2 Abkürzungsverzeichnis
6.3 Tabellenverzeichnis
6.4 Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Das Wesen der Geschichte ist die Wandlung.1
Jacob Burckhardt (1818–1897), Historiker
Die Geschichte – diesen chaotischen, kontingenten Strom singulärer gesellschaftlicher Ereignisse, durch den wir geworden sind, was wir sind – die Geschichte also in Epochen einzuteilen, ist aus pragmatischer Sicht, zumindest zur ersten groben Orientierung, ganz hilfreich.2
Reinhard Haneld (1952–2016), Philosoph
Innerhalb einer Epoche gibt es keinen Standpunkt, eine Epoche zu betrachten.3
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Dichter
1
1 Einführung
Spätestens seit den 1970er Jahren, als der Club of Rome [ClubofRome2017] mit seinen »Grenzen des Wachstums« auf die endliche Verfügbarkeit fossiler (Energie-)Rohstoffe öffentlichkeitswirksam hinwies, ist die Erschließung von alternativen Rohstoffen Gegenstand der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion. Das besondere Interesse richtet sich dabei auf Erdgas, Erdöl und Kohle, die als kohlenstoffhaltige Stoffe sowohl für die Energiewirtschaft als auch für die Produktion von Gütern von systemrelevanter Bedeutung sind. Auch wenn die genannten Stoffe, insbesondere Kohle, vermutlich länger zur Verfügung stehen werden, als es zunächst den Anschein hatte, ist die Rohstofffrage heute aktueller denn je. Grund hierfür ist der anthropogen verursachte Klimawandel, für den im Wesentlichen kohlenstoffhaltige Verbindungen wie Methan und CO2 verantwortlich sind.
Nach den Prognosen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [IPCC2017], das als von der UN beauftragter Ausschuss den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammenfasst, ist mit drastischen, unumkehrbaren Umweltveränderungen zur rechnen, wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dieses sogenannte »Zwei-Grad-Ziel« hat sich die Weltgemeinschaft auf der Pariser Klimaschutzkonferenz zu eigen gemacht. Um es zu erreichen, dürfen netto in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wahrscheinlich keine Treibhausgase mehr emittiert werden, was nur möglich ist, wenn kohlenstoffhaltige Rohstoffe fundamental anders bewirtschaftet werden als bisher. Hiervon ist nicht nur die Energiewirtschaft betroffen; auch wichtige Industriebereiche benötigen Kohlenstoff um Güter und Produkte herzustellen, auf die nicht ohne Weiteres verzichtet werden kann. Als Grundstoffindustrien sind hier vor allem zu nennen: die Stahlindustrie, in der Kohlenstoff als Reduktionsmittel eingesetzt wird, die chemische Industrie, deren Produkte zu einem großen Teil Kohlenstoff enthalten und die Kalk- bzw. Zementindustrie, die Kalkstein verarbeitet, der Kohlenstoff in einer anorganischen Bindungsform enthält. Die produzierten Grundstoffe sind dabei wichtige Ausgangsmaterialien für andere Industriezweige, beispielsweise die Kunststoffindustrie oder den Automotivbereich.
Die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels erfordert die Transformation eines auf fossilen Kohlenstoffressourcen aufgebauten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu einem neuen System, das Kohlenstoffquellen nachhaltig nutzt und industrielle Strukturen so konzipiert, dass netto keine Treibhausgase mehr emittiert werden. Dabei kommt es darauf an, die Transformation so zu gestalten, dass Menschen ausreichend mit Nahrung, Energie und Gütern versorgt werden. Die Transformation darf sich nicht nur auf technologische Innovationen gründen, sondern muss soziale Innovationen integrieren sowie die Beziehungen zwischen Mensch, Technik und Natur neu gestalten. Der Übergang zu einer neuen Energie- und Rohstoffbasis kann mit anderen Entwicklungen, wie der rasanten Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie, interagieren und weitreichende Änderungen unserer Lebensweise mit sich bringen.
Im vorliegenden Themenheft werden ausgewählte Aspekte, die bei einer Transformation zu einer neuen Kohlenstoffwirtschaft von Bedeutung sind, diskutiert. Die Autoren greifen dabei, begründet durch die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte, hauptsächlich technologische, wirtschaftliche und naturwissenschaftliche Fragestellungen auf, wohlwissend, dass andere Disziplinen, wie die Kulturwissenschaften, die hier als Oberbegriff für die Geistes- und Sozialwissenschaften verstanden werden [Anzenbacher2002, S.36], ebenfalls von großer Bedeutung sind. Dabei werden für den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs Informationen zusammengestellt und Anregungen zur Gestaltung von Transformationspfaden geliefert.
Ausgehend vom Gedanken einer Transformation der Kohlenstoffwirtschaft vergleicht die Abhandlung die derzeitige Ausgangslage mit historischen Transformationen. Anschließend wird die Vision eines Produktionssystems diskutiert, das ohne fossile Rohstoffe auskommt. Eine besondere Rolle spielt dabei die Kopplung verschiedener Branchen, die in einem solchen System über die Nutzung des Elements Kohlenstoff verknüpft sind. Es werden Abschätzungen vorgenommen, welcher Kohlenstoffbedarf global in einzelnen Branchen besteht und wie er gedeckt wird. Wichtige branchenverknüpfende Technologien können dabei Carbon-Capture-and-Utilisation-(CCU)- oder Power2X-Verfahren sein, die CO2 unter Zuhilfenahme regenerativer Energie zu Produkten umsetzen und so eine kaskadenförmige Kohlenstoffnutzung oder eine Kreislaufführung von Kohlenstoff ermöglichen.
Die Randbedingungen für die Vision einer neuen Kohlenstoffwirtschaft resultieren aus dem Pariser Klimaabkommen, dem Klimaschutzplan der Bundesregierung und der deutschen Energiewende. Hier wird auf den fluktuierenden Charakter zukünftiger Stromsysteme, mutmaßliche Überschusskapazitäten und Power2X-Konzepte eingegangen. Anschließend werden naturwissenschaftliche Hintergründe betrachtet, die bei der Nutzung von CO2 als Rohstoff von Bedeutung sind, eine orientierende Pfadanalyse für ausgewählte Produkte vorgestellt und Ressourcen abgeschätzt, die für den Bilanzraum Deutschland benötigt werden. Die Autoren greifen hierbei auf Beispiele aus ihren eigenen Arbeiten zurück.
2
2 Transformation der Kohlenstoffwirtschaft
2.1 Befinden wir uns in einem fundamentalen Systemwandel?
Sucht man in der Menschheitsgeschichte nach Übergängen, die einen grundlegenden Wandel der Lebensweise mit sich brachten, sind mit der »Neolithischen Revolution« und der »Industriellen Revolution« vor allem zwei Übergänge zu nennen, denen eine dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zugeschrieben wird. Während die Bezeichnung Neolithische Revolution einen vor mehr als 10.000 Jahren einsetzenden und Jahrtausende andauernden Übergang von einer Jäger- und Sammlerkultur zu einer sesshaften Lebensweise, in der Ackerbau und Viehzucht die Lebensgrundlage bilden, umfasst, wird unter der Industriellen Revolution der in einigen Teilen der Welt Mitte des 18. Jahrhunderts beginnende Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft verstanden. Formen und Verläufe solcher Übergänge werden auch als »Transformationen« bezeichnet; ein Begriff, den auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU)4 in seinen Gutachten anwendet5. Neolithische und Industrielle Revolution werden vom WBGU, als die »beiden fundamentalen Transformationen der Weltgeschichte« bezeichnet6, deren charakteristisches Merkmal es war, dass sie jeweils zu einer erheblichen Veränderung der Bevölkerungszahl und zu einem fundamental anderen – deutlich intensiveren – Umgang mit Energie, Ressourcen und Nahrung führten (Abbildung 1) [WBGU2011, S.87ff.]. Das Wirken von Entwicklungsabläufen und Ereignissen in Transformationen ist äußerst komplex. Transformationen beschreibt der WBGU als nicht lineare Prozesse. Ihrem Wesen nach sind sie eine »Folge von ineinandergreifenden Dynamiken, die sich auf unterschiedlichen Zeitskalen abspielen, aber sich zu einer Richtung des Wandels verdichten« [WBGU2011, S.90]. Es ist innerhalb eines Übergangs grundsätzlich nicht möglich, eine Transformation sicher als eine solche zu erkennen.
Abbildung 1: Entwicklung der Weltbevölkerung bei den Übergängen »Neolithische Revolution« und »Industrielle Revolution« im Vergleich zur Zunahme des Energieeinsatzes in Gigajoule (GJ) pro Kopf und Jahr (Quelle: WBGU [WBGU2011, S.92] mit Verweis auf die Primärquellen [Kates1996] und [Fischer1997]).
Rückblickend auf die Industrielle Revolution ist jedoch festzustellen, dass diese Transformation die Energiebasis, die Bedeutung von Zeit in Wirtschaft und Gesellschaft, die Produktions-, Konsum-, Kommunikations-, Wissens- und Logistikinfrastrukturen sowie Macht- und gesellschaftliche Verhältnisse grundlegend verändert hat [WBGU2011, S.92]. Vergleicht man diese Phänomene mit Entwicklungen in unseren heutigen Gesellschaften sowie mit Veränderungen in bewirtschafteten Energie- und Rohstoffsystemen, weist viel darauf hin, dass sich erneut ein fundamentaler Systemwandel ankündigt, der möglicherweise bereits begonnen hat.
Zu beobachten sind heute bereits mehrere, in komplexer Art und Weise wechselwirkende Entwicklungen, die sich im hohen Maße verändernd auf die Bereiche auswirken, die oben in Zusammenhang mit der Industriellen Revolution genannt wurden. Die Wahrnehmung dieser Veränderungen ist sehr unterschiedlich. Während ökologische Veränderungen wie Klimawandel oder das Aussterben von Arten oft noch nicht angemessen genug wahrgenommen werden, sind Veränderungen in unserer Lebenswelt, die in sozialen und wirtschaftlichen Phänomenen sichtbar werden, zunächst viel unmittelbarer. So ist es zu erklären, dass die Folgen von Migrationsbewegungen7 in der Öffentlichkeit eine größere Aufmerksamkeit erreichen als Folgen und Begrenzung des Klimawandels. Für jeden Benutzer eines Smartphones ist sichtbar und erlebbar, welche Veränderungsprozesse durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) angestoßen werden und was unter dem Begriff »Digitalisierung« zu verstehen ist. Wie die Verwendung des Begriffs »Industrie 4.0« für die Implementierung digitaler, vernetzter Systeme im Industriebereich deutlich macht, weisen viele Befürworter bereits alleine dem Phänomen der Digitalisierung das Potenzial einer weiteren industriellen Revolution zu. Mit der Digitalisierung verbundene Konzepte werden als neue Wachstumsstrategien angesehen, die helfen sollen, wirtschaftliches Wachstum mit einem geringeren Ressourcenverbrauch zu verknüpfen. Dabei geht man davon aus, dass digitale Technologien helfen, die Material- und Energieeffizienz in Produktionsprozessen zu verbessern und dass neue Wirtschaftsmodelle entstehen, die weniger Ressourcen verbrauchen als konventionelle. Zu einem geringeren Ressourcenverbrauch kommt es jedoch nur, wenn es gelingt, »Rebound-Effekte« einzudämmen, die die eingesparten Ressourcen durch einen steigenden Konsum wieder zunichtemachen können [Lange2016].
Das Ziel einer durch Nachhaltigkeit geprägten Transformation hat sich inzwischen zu einem wesentlichen Aspekt internationaler politischer Aktivitäten entwickelt. Es begründet sich vor allem mit den Notwendigkeiten, die sich aus dem anthropogen verursachten Klimawandel ergeben und den Konsequenzen, mit denen zu rechnen ist, wenn die Transformation ausbleibt. So hält der WBGU einen »nachhaltigen weltweiten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft« und die klimafreundliche Wandlung eines bisher auf Nutzung fossiler Kohlenstoffressourcen aufgebauten Weltwirtschaftsmodells für erforderlich [WBGU2011, S.9ff.]. Die Dringlichkeit einer Transformation hat sich dabei, wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)8 in seinem Hauptgutachten aus dem Jahr 2012 feststellt, seit der Rio-Konferenz von 1990, die den Klimawandel zum ersten Mal in einem globalen politischen Rahmen thematisierte, weiter verschärft. Laut SRU ist es – trotz partieller Erfolge bisher – nicht gelungen, Entwicklungspfade in Deutschland, Europa und der Welt systematisch so auszurichten, dass ökologische Grenzen eingehalten werden [SRU2012, S.365ff.





























