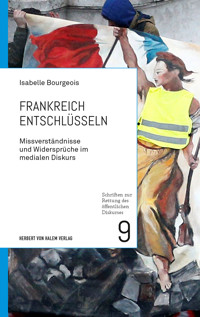
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Für die Zukunft der EU ist die intime Kenntnis der Funktionsweise des jeweiligen Partners heute notwendiger denn je. Doch Deutschland und Frankreich sind sich trotz der engen Bande, die sie seit Kriegsende geknüpft haben, weitgehend fremd geblieben. Weil es sich um zwei Gesellschaftsmodelle handelt, die gegensätzlicher nicht sein können. Weil wie immer Klischees das tiefere Verständnis und somit die konstruktive Auseinandersetzung mit dem Anderssein behindern. Weil schließlich Frankreich wegen seiner besonderen Geschichte für Deutsche eine Projektionsfläche eigener Wunschvorstellungen ist. Und nicht zuletzt, weil viele Begriffe zur Kategorie der "falschen Freunde" gehören: Sie scheinen in beiden Sprachen identisch, bedeuten aber etwas ganz anderes. Besonders für deutsche Journalisten ist Frankreich ein Land der Widersprüche. Das Medienverständnis ist fast das Gegenteil des deutschen. Anspruch und Wirklichkeit, Theorie und Praxis klaffen auch bei den Werten, Prinzipien und Institutionen der Demokratie oft auseinander. Und vor allem: Paris ist nicht identisch mit Frankreich, einem Gebilde, dessen Komplexität nicht zuletzt die Wahlen 2022 offenbarten. Dieses Buch ist ein Versuch, Frankreich verständlicher zu machen. Es zeigt, wie man sich einem fremden Land, von dem man meint, es zu kennen, annähern kann, und wie man die Fallstricke umgeht, die in Klischees und Idealvorstellungen lauern. Frankreich muss man lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Das Buch ist ein Beitrag zum öffentlichen Diskurs über die Zukunft Europas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Isabelle Bourgeois
Frankreich entschlüsseln.
Missverständnisse und Widersprüche im medialen Diskurs
Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses, 9
Köln: Halem, 2023
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme (inkl. Online-Netzwerken) gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
http://www.halem-verlag.de
© Copyright Herbert von Halem Verlag 2023
Print:ISBN 978-3-86962-643-7
E-Book (PDF):ISBN 978-3-86962-644-4
E-Book (EPUB):ISBN 978-3-86962-648-2
ISSN 2699-5832
UMSCHLAGGESTALTUNG: Claudia Ott, Düsseldorf
UMSCHLAGFOTO: picture alliance /Reuters | Stephane Mahe
SATZ: Herbert von Halem Verlag
DRUCK: docupoint GmbH, Magdeburg
Copyright Lexicon © 1992 by The Enschedé Font Foundery
Lexicon ® is a Registered Trademark of The Enschedé Font Foundery.
Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses
Isabelle Bourgeois
Frankreich entschlüsseln
Missverständnisse und Widersprüche im medialen Diskurs
HERBERT VON HALEM VERLAG
Die Reihe Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses
Warum ist der lagerübergreifende öffentlich-demokratische Diskurs gefährdet, ja geradezu ›kaputt‹? Weshalb ist der öffentliche Wettbewerb auf dem Marktplatz der Ideen ins Stocken geraten? Und welche Rolle spielen dabei Digitalisierung und Algorithmen, aber auch Bildung und Erziehung sowie eskalierende Shitstorms und – auf der Gegenseite – Schweigespiralen bis hin zu Sprech- und Denkverboten?
Die Reihe Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses stellt diese Fragen, denn wir brauchen Beiträge und Theorien des gelingenden oder misslingenden Diskurses, die auch in Form von ›Pro & Contra‹ als konkurrierende Theoriealternativen präsentiert werden können. Zugleich gilt es, an der Kommunikationspraxis zu feilen – und an konkreten empirischen Beispielen zu belegen, dass und weshalb durch gezielte Desinformation ein ›Realitätsvakuum‹ und statt eines zielführenden Diskurses eine von Fake News und Emotionen getragene ›Diskurssimulation‹ entstehen kann. Ferner gilt es, Erklärungen dafür zu finden, warum es heute auch unter Bedingungen von Presse- und Meinungsfreiheit möglich ist, dass täglich regierungsoffiziell desinformiert wird und sich letztlich in der politischen Arena kaum noch ein faktenbasierter und ›rationaler‹ Interessenausgleich herbeiführen lässt. Auf solche Fragen Antworten zu suchen, ist Ziel unserer Buchreihe.
Diese Reihe wird herausgegeben von Stephan Russ-Mohl, emeritierter Professor für Journalistik und Medienmanagement an der Università della Svizzera italiana in Lugano/Schweiz und Gründer des European Journalism Observatory.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Teil IEin anderes Medienverständnis, eine andere Informationskultur
1. Meinungskonzentration im Pariser ›Biotop‹
2. Medienpolitik ist Wirtschaftspolitik
3. Eine andere Informationskultur
Teil IIDie République
4. Die République und ihre Werte
5. Frankreich, ›Wiege der Menschenrechte‹?
6. Ausnahmerecht und der Feind im Inneren
7. ›Gewalt‹ und Widerstand
Teil IIIFrankreich, das Land, in dem nicht nur Gott lebt
8. Wie sich der Zentralismus konkret auswirkt
9.Parlez-vous français? – Sprache und Macht
10. Pyramidale Hierarchie in Politik und Arbeitswelt
11. Lebenswelten
Schluss
Literatur
Für René
Zum Gedenken an das Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC) und unsere vergleichenden Systemanalysen
»Heutzutage ist das wichtigste zu lernen, wie man andere Völker versteht. Und zwar nicht nur deren Musik, sondern auch ihre Philosophie, ihre Haltung, ihr Verhalten. Nur dann können sich die Nationen untereinander verstehen.« (HELMUT SCHMIDT: Weggefährten – Erinnerungen und Reflexionen. 1996)
Einleitung
Unsere primäre Informationsquelle über ein anderes Land ist Auslandsberichterstattung. Auch Satire kann diese Aufgabe erfüllen. Da sie eine Kunst der Mehrdeutigkeit ist, ist auch sie aussagekräftig. Man denke nur an den deutschen Meister Kurt Tucholsky und seine Art, uns aus dem Leben gegriffene Details zu schildern, die gehaltvoller sind als jede nüchterne Textmeldung über Frankreich. So etwa in der winzigen Erzählung Der Floh (1932), die uns in der Gestalt einer lustigen, fast spöttischen Anekdote auf etwas viel Ernsteres hinweist: die in der sehr unruhigen III. Republik gängige Praxis, das Postgeheimnis nicht allzu ernst zu nehmen – im Kontext einer sich verschärfenden Überwachung der Bevölkerung. Gleichzeitig legt diese Anekdote – ohne, dass dies je ausdrücklich formuliert wäre – den Finger auf die ersten Anzeichen eines entstehenden Überwachungsstaates in der Weimarer Republik. Ein Stichwort legt uns wörtlich den Floh ins Ohr: der wie beiläufige Hinweis auf die Concierge – damals Inbegriff von Bespitzelung und Denunziantentum, das Pendant des deutschen Blockwarts.
Der Floh ist, wenn auch als Satire getarnt, Auslandsberichterstattung pur: Sie bezieht sich auf Frankreich und meint stets gleichzeitig das eigene Land. Nur muss der Leser zwischen den Zeilen lesen können. Doch wer in der Bundesrepublik hat noch gelernt, die eigene Sprache mehrschichtig zu nutzen bzw. mehreres gleichzeitig auszudrücken? Zumindest im Westen, denn im Osten war dies lange gängige Praxis, wie etwa die Dialoge des Films Good Bye, Lenin! anschaulich vorführen. Genau diese Fertigkeit ist der Hauptschlüssel, um sich Frankreich anzunähern. Kaum ein öffentlich formulierter Satz meint tatsächlich das, was er auszusagen scheint.
Der Auslandskorrespondent hat die Aufgabe, uns über das Geschehen in einem anderen Land zu informieren. Er kann oder muss es, je nach Umständen, zwischen den Zeilen tun. Er kann gleichzeitig auch eine diplomatische Funktion erfüllen, indem er im geeigneten Moment gezielt Positives in den Vordergrund rückt. Oder er formuliert Kritik an Verhältnissen, Positionen oder Politiken in dem Land, über das berichtet wird – insofern diese Kritik die Sichtweisen sowie die Agenda im eigenen Land bestätigt. Ein typisches Beispiel für Letzteres ist der heute in Frankreich extrem negativ besetzte Begriff Austérité (eingedeutscht: Austerität), der stets dann bemüht wird, wenn über die deutsche Schuldenbremse oder einzelne Maßnahmen der Agenda 2010 berichtet wird.
Haushaltsdisziplin, wie sie die Maastricht-Kriterien vorgeben, widersprechen dem französischen Ansatz der Fiskalpolitik. Die französische Sozialpolitik kennt kaum das Prinzip ›Fordern und Fördern‹, Ausdifferenzieren gilt als ungerecht; entsprechend werden auch allein die deutschen Quellen zitiert, die sich diesen Reformen gegenüber extrem kritisch zeigen. Ökonomen wie der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger oder Marcel Fratzscher an der Spitze des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) finden in Frankreich ein Gehör, wovon sie in ihrer Heimat nur träumen können.
Oder aber einzelne Stimmen aus dem Ausland ermöglichen Stellungnahmen, die gegen den Mainstream verstoßen. Ein französisches Vorbild ist der Denker Montesquieu (1689-1755), der 1721 seinen Briefroman Les Lettres persanes (Persische Briefe) veröffentlichte, in dem er zwei fiktive Reisende das höfische Leben in Frankreich entdecken ließ. Aus Vorsicht hatte er seinen Roman zunächst unter Pseudonym in Amsterdam veröffentlicht. Dieses Vorgehen hat in Frankreich Tradition. 2014 zum Beispiel veröffentlichte der Historiker und Wirtschaftswissenschaftler Nicolas Baverez einen lesenswerten Roman, der im Jahr 2040 spielt (BAVEREZ 2014). Frankreich droht Insolvenz, und der neue IWF-Leiter, der aus Benin stammt, reist nach Paris, um Hilfe zu organisieren. In seinen Briefen in die Heimat beschreibt er ein politisches und soziales System, das nach mehreren Dekaden politischen Stillstands kurz vor dem Abgrund steht.
Ein Beispiel aus der Presse: Im Juli 1995, kurz nachdem Jacques Chirac die Nachfolge von François Mitterrand angetreten hatte, berichtete allein die konservative und damals weniger europafreundliche Tageszeitung Le Figaro ausführlich über Margareth Thatchers Memoiren und den darin enthaltenen Warnungen gegen ein Vereinigtes Europa. Die linkere, proeuropäischer eingestellte und Mainstream-konformere Le Monde erwähnte sie mit keinem Wort. Auch das Nichtberichten hat Informationswert.
Die Nutzung der Medienberichterstattung bestätigt das, was wir in der Schule oder während des Studiums gelernt oder was wir im Berufsleben oder als Tourist erfahren haben. Nur bleibt dieses Wissen oberflächlich und zementiert oft unsere voreingenommene Meinung. Zumal über ein Ereignis oder ein Thema aus dem Ausland ja nur berichtet wird, wenn es im Inland eine Projektionsfläche bietet. Paris und sein Eiffelturm als Kulisse finden unmittelbar Abnehmer, ebenso Streiks, Gewaltausschreitungen oder divergierende Meinungen der Regierungen zu europapolitischen Fragen sowie – selbstverständlich – anstehende Präsidentschaftswahlen.
Natürlich dürfen Klischees nicht fehlen, sie stellen ja erst den Bezug zum fremden Land her und bewirken, dass sich der Leser oder Zuschauer mit dem ihm fremden Geschehen identifizieren kann. Eine Figur mit Baskenmütze, und jeder versteht sogleich, dass das ein Franzose ist; ein Pickelhelm, und sofort ist klar, dass es sich um einen Deutschen handelt. Auch der Song Frankreich, Frankreich der Kölner Rockband Bläck Fööss vermittelt uns ein wohliges Gefühl des Wiedererkennens. Wir verbinden damit Urlaub, Savoir-vivre, ein gewisses (auch intellektuelles) Flair und projizieren unsere Wünsche oder Träume auf etwas, was uns eigentlich fremd ist. Das Baguette in dem Song hilft uns, dieses Fremde als etwas zu betrachten, was uns geläufig vorkommt. Ein Trugschluss, denn ein deutsches Baguette ist, anders als das französische, ein Brot der Premiumklasse – eben mit einem gewissen Etwas. So täuschen wir uns selbst, meist ungewollt.
Klischees haben vor allem eine wichtige Katharsisfunktion. Sie befreien uns von dem beängstigenden Fremden. Man weiss, dass ein Ereignis, eine Feststellung, eine Situation, mit der eigenen Vorstellung nicht übereinstimmt oder ihr sogar widerspricht, und sucht händeringend nach einer Erklärung bzw. Interpretation. In solchen Fällen greift man reflexartig auf ›Bekanntes‹ zurück – auf das, was man mal in der Schule gelernt, in der Zeitung gelesen oder in der Arbeitswelt erfahren hat. Und man nutzt dieses ›Bekannte‹ als Interpretationshilfe. Dadurch wird das eigene Selbstwertgefühl wiederhergestellt und die Welt ist wieder in Ordnung. Die Deutschen wollen die Maastricht-Kriterien nicht aufweichen und sind gegen Eurobonds? Ach ja, der deutsche Alleingang in Europa macht sie unsolidarisch, das liegt ja in ihren Genen. Und das teilen sie mit den anderen ›geizigen‹ Ländern.
Außerdem bietet dieser Rückgriff auf Klischees eine Gelegenheit, Selbstzufriedenheit zu beweisen, auch Nationalstolz zu zeigen und auf jeden Fall drohende Konflikte zu vermeiden. Die Franzosen sind von Natur aus undiszipliniert, denken nur an Streik, halten sich an keine Regeln – das genaue Gegenteil der Deutschen. Haben sie es nicht im Frühjahr 2023 wieder einmal mit ihren Protesten gegen die Rentenreform bewiesen? Und der Pomp, mit dem staatliche Zeremonien in Frankreich einhergehen, beweist er nicht im Gegensatz, wie transparent die deutsche Demokratie ist? Die Vorstellung Frankreichs als ›Wiege der Menschenrechte‹ erlöst auch vom Trauma der doppelten Diktatur im Nazireich und in der DDR. Mit Klischees lassen sich zudem die eigenen Widersprüche vertuschen.
Oder aber die Diplomatie macht es erforderlich, sich in geregelten Bahnen vorgefertigter Meinungen zu bewegen, was in der EU natürlich besonders für das Tandem ›Frankreich-Deutschland‹ gilt. Klischees dienen dann der Konfliktvermeidung.
Will man jedoch das Partnerland wirklich verstehen, muss mit dieser bequemen Gewohnheit gebrochen werden. Ein anderer Blick ist notwendig, ein neugieriger Blick, der sich nicht scheut, Altbekanntes zu hinterfragen – sei es um den Preis, Befremden oder gar Unmut auszulösen.
Auslandsberichterstattung ist nie neutral bzw. objektiv, und sie kann es auch nicht sein, weil der Beobachter einer anderen Wirklichkeit diese zwangsläufig mit ›seiner eigenen Brille‹ liest: seinem eigenen Wissen, seinem Sach- und Sprachverständnis, der Ausrichtung des Mediums, für das er arbeitet, der Interessenlage im Inland u.v.a.m. Dieser grundlegende Bezug zum eigenen Land verstellt uns aber oft den Blick für die fremde Wirklichkeit. Nicht nur dem Journalisten und seiner Zentralredaktion, sondern auch der Leserschaft oder den Zuschauern, sprich: der Öffentlichkeit.
Dies gilt umso mehr, je näher sich Inland und Ausland gekommen sind bzw. zu sein scheinen. Der Élysée-Vertrag von 1963 hat enge Freundschaftsbande zwischen Frankreich und Deutschland geknüpft, und die dadurch möglich gewordenen Fortschritte des europäischen Einigungsprozesses haben die Beziehungen enger werden lassen, sodass wir heute meinen, wir hätten ein inniges Verhältnis zueinander. Das ist ein Trugschluss, denn je intensiver die Zusammenarbeit wird, desto größer ist oft der Mangel an eben den Detailkenntnissen, die ein wahres Verständnis erst ermöglichen. Der Teufel steckt im Detail.
Ein schulbuchreifes Beispiel für die Komplexität der Auslandsberichterstattung ist ein Beitrag über die Coronaregeln in Frankreich, der am 12. November 2020 in Die Zeit erschien und dessen Überschrift auch in Frankreich für Schlagzeilen sorgte: ›Autoritäres Absurdistan‹. Eine Zeitlang übernahmen selbst französische Kritiker den Begriff ›Absurdistan‹, um die oft kafkaesk anmutenden Coronamaßnahmen im zweiten Lockdown zu beschreiben.
Annika Joeres Bericht für Die Zeit stellt die Widersprüchlichkeit und Absurdität der Maßnahmen meisterhaft lebendig und nachvollziehbar dar. Ihr Schwerpunkt aber liegt auf dem Ausnahmezustand und dort auf dem Führungsstil des Präsidenten bzw. auf der Intransparenz der im kleinen Kreis und außerhalb der Öffentlichkeit (›Verteidigungsrat‹) getroffenen Entscheidungen: »Macrons Corona-Politik ist beinahe monarchisch.« Der Verweis auf die gängige Bezeichnung ›republikanische Monarchie‹ für die Funktionsweise der politischen Institutionen in Frankreich liegt auf der Hand. Die Verbindung mit Autoritarismus bzw. Willkür entsteht automatisch – das ist der Stein des Anstoßes für einen deutschen Leser und sein eigenes, anderes Demokratieverständnis. Nicht die teils absurden Coronamaßnahmen waren Gegenstand des Beitrags für Die Zeit, sondern die zentralistische und intransparente Entscheidungsfindung in Frankreich.
Klischees sind notwendig – sie dienen als Appetitmacher für den Leser. Auch Pointierung ist unumgänglich, schließlich müssen schlüssige Begriffe gefunden werden, um die fremde Wirklichkeit den eigenen Landsleuten verständlich zu machen – je nach Bildungsstand, Interessenlage oder Verbreitung mehr oder minder explizit. So lässt Annika Joeres zum Beispiel passend zum monarchischen Stil Macrons die französische Politikwissenschaftlerin Chloé Morin, eine ehemalige Beraterin der Regierung unter François Hollande, zu Wort kommen. Morin hatte kurz zuvor in Paris eine treffende Analyse über Eliten und Technokratie veröffentlicht (MORIN 2020).
Nun ist Kritik an den Eliten in Frankreich weit verbreitet, der objektive Reformbedarf ist auf diesem Gebiet enorm. Allerdings spielt der Kontext, in dem diese Kritik formuliert wird, ebenfalls eine maßgebliche Rolle. Seit der Wahl Macrons 2017 hat Frankreich »außer dem rechtsextremen Rassemblement National kaum eine hörbare Opposition«, wie Joeres treffend schreibt. Und hier bietet gerade das Coronamanagement unter Macron der linken, extrem zerstrittenen Opposition den willkommenen Anlass, sich als die Verfechterin schlechthin der demokratischen Transparenz und der Werte der Republik zu profilieren – wobei sie gern außer Acht lässt, dass auch sie Teil des elitären, ›aristokratischen‹ Institutionengefüges ist. Das trifft sich gut mit deutschen Forderungen nach mehr direkter Bürgerbeteiligung, die auch in der Leserschaft der Zeit stark verbreitet sind.
Einem Auslandskorrespondenten stehen meist nur wenige Zeichen oder Sekunden zur Verfügung. Da ist es kaum möglich, ins Detail zu gehen. Denn um das Fremde detailliert darzustellen, braucht man sehr viel mehr Platz – eben ein Buchformat.
»Fremde Freunde«
Frankreich und Deutschland sind auch heute noch »fremde Freunde« (PICHT et al. 1997). Denn auch die wissenschaftliche Literatur, etwa in der Romanistik, kann nur einen kleinen Beitrag leisten. Theoriegetreu wie sie ist und sein muss, bleibt sie oft selbst in vorgefertigten Vorstellungen bzw. Theorien gefangen – wenn nicht gar dem diplomatischen Diskurs –, und dies trotz redlicher Versuche, diesen Rahmen zu sprengen. Pluralistisch ist sie außerdem selten, und sie kann es auch nicht sein, denn Stereotype bzw. Ideologien prägen auch die Wissenschaft, insbesondere die Sozialwissenschaften. Deren Frankreichbild wird in Deutschland in Ost und West mit anderen Vorzeichen zumeist idealisiert. Es reicht indes selten aus, um Frankreich wirklich zu verstehen.
Frankreich ist ein ›erklärungsbedürftiges Produkt‹, wie Marketingfachleute formulieren würden. Überall lauern Stolpersteine und Klischees sowie Idealisierung – vom Leben wie Gott in Frankreich bis hin zur Nostalgie der Revolution von 1789. Und, deutschfranzösische Freundschaft in Ehren, es gibt etliche sogenannte ›falsche Freunde‹, d. h. Wörter und Begriffe, die sich auf den ersten Blick entsprechen, in der anderen Sprache aber etwas ganz anderes meinen als es scheint, weil sie in einen anderen historischen, gesellschaftlichen oder institutionellen Kontext eingebettet sind. Etat bedeutet etwas anderes als ›Staat‹, eine politische ›Partei‹ hat in Frankreich eine andere Funktion als in Deutschland, ›Zivilgesellschaft‹ bezeichnet etwas ganz anderes usw.
Es ist im Interesse Europas, wenn die Menschen beider Länder die Gesellschaft des jeweils anderen Landes, also seine Kultur, Wirtschaft und sein politisches System, besser verstehen. Denn gerade auch in der Europapolitik – bzw. in dem, was davon an die Öffentlichkeit dringt – werden Klischees gezielt bemüht und je nach Interessenlage selbst Freunde oft als Feinde dargestellt. So wird zum Beispiel der deutsche Begriff ›Ordnungspolitik‹ in Frankreich so gelesen, als solle am deutschen Wesen die Welt genesen. Oder in Deutschland wird seit der Entscheidung, in der EU eine gemeinsame Währung einzuführen, in regelmäßigen Abständen über die als ausgabenfreudig und undiszipliniert empfundenen ›Club Med-Staaten‹ geschimpft, zu denen auch Frankreich gehört.
Versuchen wir, uns Frankreich ohne Umschweife anzunähern. Die Darstellung auch der Missstände und des Reformbedarfs gehört dazu, wie sonst soll man die fremde Wirklichkeit in aller Tiefe verstehen können? Oft werden die entscheidenden Aspekte erst dann klar, wenn sie einem anderen Kulturkreis dargestellt werden.
Sollen bestimmte Begriffe in eine andere Sprache übertragen werden, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man kann einmal die gängigen Entsprechungen bemühen, so wie dies meistens geschieht. Doch dann bleibt die Darstellung an der Oberfläche und es besteht die Gefahr, dass Klischees bzw. Missverständnisse verfestigt werden. So etwa bei dem Paar compétence/Kompetenz bezogen auf eine Gebietskörperschaft: Die compétences einer französischen Commune oder Région reduzieren sich auf das Ausführen bestimmter Aufgaben, die ihnen vom Zentralstaat übertragen wurden; sie bedeuten weder Selbstverwaltung noch eigenverantwortliches Handeln, wie sie eine deutsche Kommune oder ein Bundesland kennzeichnen.
Oder aber man hinterfragt diese Begriffe, was meistens dazu führt, dass man sie erklären, in ihren Kontext stellen und ggfs. einen Ausdruck wählen muss, der das Betrachtungsobjekt anders benennt als üblich und so einen Verfremdungseffekt herstellt. Will ich in Frankreich zum Beispiel verständlich machen, was ein deutsches Bundesland ist, muss ich den Begriff Etat (also Staat im Sinne von Hoheitsgebiet) wählen, um die Verwechslung mit einer ausgelagerten Verwaltungseinheit wie der Région auszuschließen. Will ich die Funktionsweise der Bundesrepublik einprägsam darstellen, muss ich sie als ›Vereinigte Staaten Deutschlands‹ bezeichnen, bevor ich den kooperativen Föderalismus erklären kann. Und Olaf Scholz wird dann zum ›Obermoderator‹ eines Landes, das 17 Regierungen und Parlamente zählt – nicht zu verwechseln mit einem Emmanuel Macron, der sich im Vergleich und qua Amt als Alleinherrscher inszeniert.
Will ich in Deutschland den französischen öffentlichen Rundfunk darstellen, darf ich nicht auf den deutschen Begriff ›öffentlich-rechtlich‹ zurückgreifen, denn dieser bedeutet, dass der Träger der entsprechenden Anstalten die Allgemeinheit ist und sie mit dem Recht auf Selbstverwaltung ausgestattet ist; in Frankreich aber gehören sie dem Staat und unterliegen seiner Obhut. Also muss ich RADIO FRANCE oder FRANCE TÉLÉVISIONS als öffentliche Gesellschaften bezeichnen, um gleichzeitig zu vermeiden, dass sie als ›Staatsfunk‹ verstanden werden, was sie entgegen dem Anschein nämlich nicht sind. Ihr Kapital gehört zwar dem Staat, aber sie haben einen Auftrag im Allgemeininteresse auszuführen; eine andere Struktur ist in Frankreich undenkbar. Die beiden Staatsgesellschaften sind Bestandteil dessen, was man Service public nennt.
Dieser Begriff ist besonders vielschichtig: Auf den Rundfunk bezogen meint er also ›public service‹ (Modell BBC). Sind öffentliche Dienstleistungen gemeint, muss man ihn meistens mit ›Daseinsvorsorge‹ übersetzen, oder mit ›Dienstleistungen im öffentlichen (ggfs. wirtschaftlichen) Interesse‹, ansonsten einfach mit ›öffentlicher Dienst‹. Dahinter verbirgt sich eine radikal verschiedene Auffassung von Staat und Gesellschaft.
Nur wenn man sich die Mühe gibt, Begriffe zu hinterfragen und sie ggfs. anders als gewohnt in die Zielsprache zu übertragen, wird es möglich, in die Tiefe der anderen Wirklichkeit einzudringen und auf ein intimeres Verständnis hinzuarbeiten. Dieses Vorgehen wird jedoch zuweilen nicht verstanden, weil der naive Glaube an eine Äquivalenz der Begriffe und das Vertrauen in automatische Übersetzungsprogramme weit verbreitet sind. Es wird noch häufiger missverstanden, weil es auf vorgefertigte Meinungen trifft, etablierte Vorstellungen sprengt und daher sehr schnell als verfälschte Darstellung, wenn nicht gar als Bashing interpretiert wird. Klischees sind eben hartnäckig.
In dieser Hinsicht ist die französische Öffentlichkeit weit empfindlicher als die deutsche. Zum einen, weil eine Darstellung, die den Kontext in seiner Komplexität mit einbezieht (also im Sinne einer Systemanalyse multidisziplinär vorgeht, wie es Wissenschaftler formulieren), die eigene Weltsicht und seine universalistische Prägung infrage stellt. Zum anderen, weil ›es sich nicht gehört‹, interne Debatten über Missstände nach außen zu tragen oder, entscheidender noch, solche Begriffe zu hinterfragen, die in der politischen Kommunikation Hochkonjunktur haben, eine einheitliche Bedeutung zu haben scheinen, aber Konstrukte sind, die je nach ideologischem Lager gezielt genutzt werden, um bestimmte Forderungen durchzusetzen.
Ein typisches Beispiel ist der Begriff Égalité. Diese Instrumentalisierung hat er mit dem deutschen Begriff ›Gleichheit‹ (wie seinem Gegenstück ›Ungleichheit‹) gemeinsam – mit einem wesentlichen Unterschied: In Deutschland darf man ihn öffentlich hinterfragen, auch wenn dies nicht immer beliebt ist; wer dies aber in Frankreich tut, verletzt ein Tabu.
L’esprit versus la lettre
Ein Hinweis noch an den Leser, der sich ja mit seiner ›hauseigenen‹ Sozialisation und Weltvorstellung an die fremde Wirklichkeit heranpirscht. Für einen deutschen Leser ist vieles in Frankreich besonders schwer nachzuvollziehen, weil es (fast) immer der deutschen Erwartung von Eindeutigkeit widerspricht. Theorie und Praxis, Anspruch und Wirklichkeit, das Prinzip (l’esprit) und seine Umsetzung in der Wirklichkeit (la lettre) klaffen fast immer auseinander. Ein Gesetz dem Wortlaut oder Buchstaben entsprechend (à la lettre) anzuwenden bedeutet oft, dass dieses Vorgehen dem Geist oder Sinn (l’esprit) dieses Gesetzes widerspricht oder sie infrage stellt.
Die Philosophie dahinter: Da die Praxis bzw. das konkrete Leben durch eine Unmenge an vielfältigen Einzelsituationen gekennzeichnet ist, muss ein Gesetz so abstrakt und allgemein formuliert sein, dass der allgemeine Gedanke des Gesetzes und somit die Absicht des Gesetzgebers deutlich werden. Diese Absicht oder tiefere – universelle – Bedeutung muss ein Richter, ein Minister oder die Verwaltung vor Augen haben, um den Wortlaut des Gesetzes oder der Bestimmung dann der jeweiligen konkreten Einzelsituation entsprechend auszulegen bzw. auszugestalten. Zwar verhält es sich in der deutschen Rechtsmethodologie ähnlich, doch geht das französische Verständnis dieser Dialektik sehr viel weiter. Aus französischer Sicht ist alles eine Frage der Auslegung. Die Universalität hat Vorrang vor dem partikulären Fall, was zur Nichtanwendung oder einer abweichenden Umsetzung des Gesetzes, Abkommens, Vertrags oder einer Absprache führen kann.
Dieses Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis geht weit über das rein Juristische hinaus. Im Geschäftsleben zum Beispiel sorgt es fast systematisch für Ärger, und nicht selten führt es ein deutsch-französisches Projekt zum Scheitern. Stein des Anstoßes ist dann oft das Sitzungsprotokoll. Für die deutschen Teilnehmer muss es die Sitzung und ihre Ergebnisse objektiv und vor allem sachlich zusammenfassen. Dieses Wort ›sachlich‹ lässt sich nur sehr schwer ins Französische übersetzen. In dem genannten Verhandlungskontext sollte man die deutsche Vorgehensweise als à la lettre bezeichnen. Das französische Sitzungsprotokoll, das deutsche Verhandlungspartner meist als etwas zu abstrakt und nicht tatsachengetreu genug empfinden, entspricht dem Esprit.
Auch in der Politik kann man diesen Gegensatz zwischen Esprit und Lettre beobachten, der dann für Enttäuschung und diplomatischen Unmut sorgt. Ein schulbuchreifes Beispiel ist Macrons große Europarede, gehalten am 26. September 2017 in der Pariser Sorbonne, in der er seine Vision (frz.) des Europa der Zukunft darstellte. Auf deutsche Gegenvorschläge wartet Frankreich seitdem vergeblich – zumindest wird es so empfunden und öffentlich kritisiert. Das Motto: Deutschland fröne mal wieder dem Alleingang und interessiere sich nicht für Europa. In Deutschland wurde über den Begriff ›Vision‹ (dt.) gestichelt, als habe Macron Halluzinationen. Abgesehen davon, dass der Zeitpunkt für den Anstoß einer Debatte über die Zukunft Europas denkbar ungünstig war – nur wenige Tage nach der Bundestagswahl gab es ja noch keine Regierungskoalition –, ist die deutsche Antwort auf Macrons Vorstellung (Esprit) in Frankreich nie verstanden worden, weil sie nicht gesehen werden konnte. Sie kam nämlich à la lettre, in Gestalt einer Auflistung von konkreten Zielen und der Wege, sie zu erreichen. Kapitel 1 des am 7. Februar 2018 unterzeichneten Koalitionsvertrags trug die Überschrift: »Ein neuer Aufbruch für Europa«. Enttäuschende kleine pragmatische Schritte als Antwort auf einen großen Entwurf.
Diese Mehrdeutigkeit ist der Schlüssel für das tiefere Frankreichverständnis. Besonders wenn sie Verfassungsprinzipien betrifft, die in ihrer Anwendung meist ein eigenständiges Leben führen, stellt sie für deutsche Frankreichliebhaber eine extreme Herausforderung dar. Sie widerspricht nicht nur ihrem eigenen Empfinden und Verfassungspatriotismus, sie stellt auch ihr Frankreichideal infrage – Projektionsfläche für ihre eigenen Sehnsüchte.
Es beginnt mit dem Prinzip Liberté. Um es zugegebenermaßen krass zu formulieren: Diesem Prinzip, Erbe der Französischen Revolution, ergeht es nicht anders als dem Prinzip ›Freiheit‹ damals in der DDR. Es ist eine universelle Idealvorstellung, kein ›unmittelbar geltendes Recht‹ wie es die Grundfreiheiten des Grundgesetzes sind. Damit kein Missverständnis entsteht: Frankreich ist kein ›Unrechtsstaat‹, wie die DDR es war. Aber die Freiheitsrechte bewegen sich in einem engeren Rahmen als in einer Bundesrepublik, die die Lehren aus zwei Diktaturen gezogen hat.
Ein anschauliches Beispiel für das engere Verständnis der Umsetzung des Prinzips Liberté ist die Meinungsfreiheit, die in Deutschland nach Art. 5 GG auch ein Recht auf Information beinhaltet. In Frankreich beschränkt sie sich auf das Individualrecht auf freie Meinungsäußerung. Diese gilt ebenfalls für die Medien, was jedoch nicht bedeutet, dass ihre Freiheit als ›Institut‹ (Bundesverfassungsgericht) gewährleistet wäre. Ein Klassiker für französische Doktoranten, die sich mit dem deutschen Mediensystem befassen, ist die (aussichtslose) Suche nach verfassungsrechtlichen Schranken der deutschen Pressefreiheit. Diesen Irrweg müssen sie gehen, denn in Frankreich ist Presse- und Medienrecht einfaches Recht und zum großen Teil sogar Strafrecht. Die Grundlage bildet das Gesetz vom 29. Juli 1881, das trotz zahlreicher Änderungen immer noch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Bismarck’schen Pressegesetzen aufweist.
Nehmen wir zum Schluss noch den Begriff Citoyen, der in Deutschland Hochachtung genießt (aus historischen Gründen im Osten anders konnotiert als im Westen): Während sich der Bürger als ein Mensch mit einem Recht auf Selbstbestimmung definieren lässt, ist der Citoyen kein eigenständiges Individuum, sondern ein abstraktes Atom in einer undifferenzierten und ebenso abstrakten Menge Namens ›Volk‹. Der französische Citoyen hat nur wenig mit dem deutschen ›mündigen Bürger‹ gemeinsam.
Wie gesagt: Frankreich ist ein sehr komplexes und erklärungsbedürftiges Gebilde. Eines, das man lernen muss, ›zwischen den Zeilen‹ zu lesen.
TEIL I
EIN ANDERES MEDIENVERSTÄNDNIS, EINE ANDERE INFORMATIONSKULTUR
Die primäre Quelle, aus der wir unser Wissen über ein fremdes Land beziehen, ist die Medienberichterstattung. Sofern wir über etwas mehr als Schulfranzösisch verfügen, werfen wir gern einen Blick in eine Zeitung, nutzen Podcasts oder genießen französische Filme auf ARTE. Es bleibt jedoch zwangsläufig ein Annäherungsversuch. Denn wir gehen die fremde Berichterstattung an, als wäre sie Hausmannskost. Vieles jedoch unterscheidet nicht nur die Medienlandschaften in Deutschland und Frankreich, auch der rechtliche Rahmen ist grundlegend verschieden, ganz zu schweigen vom Handwerk des Journalisten bis hin zum Selbstverständnis des Journalismus.
Frankreich ist eine Demokratie, und die Medien erfüllen auch dort ihre klassischen drei Funktionen in einer Demokratie: Information und Artikulation, Kritik, Kontrolle. Doch zeigen sich erhebliche Unterschiede. Zum einen sind die französischen Medien ausgesprochene Meinungsmedien, die das politische Spektrum widerspiegeln, vor allem das der Hauptstadt. Zentralismus bestimmt das demokratische Geschehen – auch bei den Medien und den veröffentlichten Meinungen. Das ist ein zweiter wesentlicher Unterschied zu Deutschland und seinen mehreren Medienmetropolen: In Frankreich berichten die Medien vom Zentrum an die Peripherie.
Schockierend für deutsche Journalisten: Es gibt in Frankreich kein ›Hugenberg-Tabu‹, das wie in Deutschland einem Industriekonzern (erst recht einem staatsnahen) verbieten würde, sich mehrheitlich an einem Medienanbieter zu beteiligen. Die privaten Rundfunk- und Fernsehgesellschaften sind in Frankreich fest in der Hand der Industrie – von Luxus bis Rüstung und neuerdings Technologie. Frankreich setzt auch im Medienbereich auf nationale Champions.
Der Kernunterschied schließlich liegt in einem fast entgegengesetzten Verständnis von Pressefreiheit. Gilt sie in Deutschland laut Art. 5 GG generell für die Medien, ist sie in Frankreich ein reines Individualrecht: Einzig der Journalist als Person ist Träger der Meinungs- und Pressefreiheit. Das schwächt ihn, da er sich leichter als seine deutschen Kollegen Druck ausgesetzt sehen kann. Missfällt er gar jemandem aus der Politik oder einem Werbekunden, weil er als zu kritisch betrachtet wird, kommt bald ein Anruf an den Chefredakteur mit der Bitte, ihm doch die Leviten zu lesen – dessen Reaktion darauf richtet sich ebenfalls nach seiner Persönlichkeit bzw. der wirtschaftlichen Gesundheit des Mediums. Oder dem Journalisten wird der ›Informationshahn‹ zugeschraubt, was jedoch heute in der Zeit der sozialen Netzwerke und der Recherchenetzwerke nicht mehr leicht geschieht und geschehen kann. Das alles stärkt nicht sonderlich die Kritik- und Kontrollfunktion der Medien.
Noch einmal: Frankreich ist eine Demokratie mit einem nicht minder funktionsfähigen Mediensystem als Deutschland. Nur funktioniert es ganz anders als das deutsche, das auch heute noch stark durch die Lehren aus zwei Diktaturen geprägt ist. Wer das Mediensystem des Nachbarlandes betrachtet, darf eines nie aus den Augen lassen: Es ist eher Deutschland, das in Europa die Ausnahme bildet.
1. Meinungskonzentration im Pariser ›Biotop‹
Es gibt in Frankreich nur eine Medienhauptstadt: Paris und das angrenzende Umfeld. Dort sind sämtliche führende Medien angesiedelt, Online-Redaktionen inklusive. Und nicht nur sie. In Paris ballen sich alle Gewalten: Exekutive, Legislative, Judikative und Verwaltung (d. h. Zentralverwaltung). Alle Banken und fast alle Großunternehmen haben ihren Sitz in Paris. Die Kreativwirtschaft konzentriert sich fast komplett in diesem Großraum. Auch die führenden Bildungseinrichtungen, darunter Sciences Po oder die staatliche Journalistenschule Centre de Formation des Journalistes (CFJ) befinden sich in der Hauptstadt, in der sowieso über das Schul- und Hochschulwesen ganz Frankreichs entschieden wird, über Polizei, Gendarmerie usw. Da alles, was nationalen Ereignischarakter und Informationswert hat, sich in Paris konzentriert, liegen dort auch Sitz und Zentralredaktion der Nachrichtenagentur Agence France Presse (AFP); in der Provinz gibt es nur in wenigen Regionalmetropolen Büros. Entscheidender für die AFP, die frontal in Konkurrenz zu Reuter und AP steht, ist die Positionierung auf dem Weltmarkt.
Die Auswirkungen dieser pariszentrierten Architektur auf die französischen Medien, ihre Arbeitsweise sowie ihr Selbstverständnis sind erheblich. Sie prägt naturgemäß auch die Frankreichberichterstattung der ausländischen Korrespondenten. Sie haben selbstredend alle ihre Büros in Paris und verlassen die Stadt nur selten. Paris ist eine eigene Welt, eine Festung genauso wie das berühmte Dorf der Gallier; das ist eine der tieferen Bedeutungen der Comics von Uderzo und Goscinny: eine unterschwellige Zeichnung des Zentralismus. In diesem Meinungsbiotop wird der Meinungsmainstream für ganz Frankreich – und darüber hinaus – produziert.
Die Medien verbreiten ihre Inhalte vom Zentrum an die Peripherie. Rückkanäle gibt es (fast) keine, das Geschehen außerhalb des Zentrums dringt kaum in die Hauptstadt und wird in der Berichterstattung nur in seltenen Ausnahmefällen berücksichtigt. So etwa im Sommer bei Waldbränden in Südfrankreich, bei Flutkatastrophen an den Küsten oder bei Gewaltausschreitungen in diversen Städten. Die ›Gelbwesten‹-Bewegung, deren Vorboten viele Jahre vor den ersten Verkehrskreiselbesetzungen unterwegs waren, wurde erst wahrgenommen, als sie auf den Champs Élysées aufmarschierte.
Eine streng pyramidale Medienstruktur
Während die führenden deutschen Tageszeitungen sogenannte ›überregionale‹ Blätter sind, gehören ihre Entsprechungen in Frankreich in die Kategorie der sogenannten ›nationalen Tagespresse‹ (presse quotidienne nationale). Sie haben ihren Sitz und ihre Redaktion in Paris und bedienen vor allem die Pariser Leserschaft, ob Le Monde, Libération, L’Humanité, La Croix, Le Figaro, Le Parisien/Aujourd’hui en France, Les Echos, La Tribune oder die Sportzeitung L’Équipe.
Das Gleiche gilt für die drei Gratiszeitungen 20 Minutes, Direct Matin, Metro, die nur im öffentlichen Nahverkehr in Paris und einigen Großstädten erhältlich sind. Und selbstverständlich für die wöchentlich erscheinenden Nachrichtenmagazine, von denen es weit mehr als in Deutschland gibt: Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point, Marianne, Challenges, Valeurs actuelles, The Economist, Courrier international oder Paris Match. Auch das mittwochs erscheinende Satireblatt Le Canard Enchaîné gehört dazu. Ganz zu schweigen von sämtlichen Frauenzeitschriften und sonstigen Illustrierten und natürlich von reinen Internetzeitungen wie etwa mediapart.fr. Über das Geschehen außerhalb von Paris berichten allenfalls Sonderkorrespondenten.
Regionale Tageszeitungen sind in Paris kaum erhältlich – mit einer Ausnahme: Ouest-France, die ihren Sitz in Rennes (Bretagne) hat und mit über 600.000 Exemplaren die auflagenstärkste französische Zeitung ist, vergleichbar etwa mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Aber das liegt wohl daran, dass die bretonische Community in Paris stark repräsentiert und wirtschaftlich sehr aktiv ist.
Diese Strukturierung kennzeichnet nicht nur die Printfassungen, die es in Frankreich wirtschaftlich noch schwerer haben als in Deutschland, weil sie überwiegend am Kiosk verkauft werden, sondern auch das Online-Angebot der Verlage. Denn jede Zeitung oder Zeitschrift ist ebenfalls im Internet erhältlich, wo sie meist nur gegen Entgelt zu lesen ist. Um es anders zu formulieren: Während in Deutschland die tradierten Abonnementzeitungen ihr Wirtschaftsmodell heute mehr oder minder digitalisieren, werden die französischen Zeitungen, deren Wirtschaftsmodell überwiegend auf Einzelverkauf beruhte, heute durch ihre Internetpräsenz zunehmend zu (digitalen) Abonnementzeitungen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Informationsstand der Bevölkerung, die so kaum noch Zugang zu der Hintergrundinformation hat, die weiterhin allein die Printmedien bieten. Das Fernsehen ist mehr denn je ein reines Unterhaltungsmedium; der Hörfunk ein Zwitter. Wer außerhalb von Paris lebt, dort nämlich, wo Zeitungen schwer erhältlich sind, und sich wirklich informieren will, müsste im Idealfall gleich mehrere Zeitungen online abonnieren, was sich nur wenige leisten können. Auch der Zugang zum Informationsangebot ist somit pariszentriert.
An deutlichsten ist der Zentralismus beim Medium ›Fernsehen‹. Alle Studios und Redaktionen befinden sich in Paris. Außenstellen gibt es (fast) nicht, sodass auch hier bei Bedarf auf Sonderreporter gesetzt wird. Dies hat zur Folge, dass allein Journalisten, Experten oder Politiker aus dem Großraum Paris an den überaus zahlreichen Diskussionsrunden teilnehmen bzw. teilnehmen können, weil Außenstudios und Funkverbindungen in den ›Rest‹ des Landes fehlen und weil die Studiogäste ohnehin in oder bei Paris leben. Zwar wurde während der Lockdowns in der Coronapandemie zunehmend auf Zuschaltung per Skype o. Ä. zurückgegriffen, doch hat sich dies wegen der schlechten Bildqualität sowie der fehlenden ›Chemie‹ im Studio nicht dauerhaft durchgesetzt. Ausnahmen bestätigen die Regel: So debattiert zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit regelmäßig mit Jacques Chiracs ehemaligem Bildungsminister und Philosophen Luc Ferry im Abendmagazin des Nachrichtensenders LCI – er ist fast immer live zugeschaltet. Was in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, hat in Frankreich (noch) Seltenheitswert.
Entsprechend gestaltet sich auch das öffentliche Fernsehprogramm FRANCE 3 – ein ›nationales und regionales Vollprogramm‹ (chaîne généraliste nationale et régionale). Es ist de facto ein einheitliches Pariser Programm. Anders als bei den Dritten Programmen der ARD beschränkt sich das regionale Programm werktags zum Beispiel auf zwei Regionalfenster (12:30 Uhr bis 13:00 Uhr und 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr) mit viel kulturellen, touristischen oder gastronomischen News im Sendegebiet der insgesamt 23 ausgelagerten Studios (die Überseegebiete haben ihre eigenen neun Büros). Nachrichten aus Wirtschaft oder Politik sind dort kaum zu finden, denn sie sind Gegenstand der ›nationalen‹ Hauptnachrichten, die auf die beiden Regionalfenster folgen. So bleibt einem Zuschauer in Marseille oder in Lille das Leben in der Bretagne, den Alpen, auf Martinique oder in Bordeaux weitgehend unbekannt.
Seit der Schließung von FRANCE Ô Anfang September 2020, dem öffentlichen Vollprogramm für die französischen Überseegebiete, das im Inland kaum jemand einschaltete, beschränkt sich die Berichterstattung über diese fernen Landesteile auf die Berücksichtigung der Wetterlage in Guadeloupe, La Réunion, Martinique oder Mayotte am Ende der Wettervorhersage im zweiten öffentlichen Hauptprogramm FRANCE 2.
Paris und das Sonst-Wo
Ein erhellendes Beispiel für den schwierigen Umgang des Pariser Mikrokosmos’ mit dem ›Rest‹ des Landes bot im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2022 die Hauptnachrichtensendung (nach deutschen Kriterien eher ein Magazin) von FRANCE 2 um 13 Uhr: Le 13 heures. Alle vier Wochen bis zum ersten Wahlgang am 10. April 2022 wurde das Studio aus Paris an einen anderen Ort in die Provinz ›ausgelagert‹, und die Nachrichten wurden dort live produziert. Den Auftakt machte am 4. November 2021 die Hafenstadt Dieppe in der Normandie – aus aktuellem Anlassn ging es um den Fischereistreit mit Großbritannien.
Das Aufschlussreichste aber ist der Name, der diesem monatlichen Sonderformat gegeben wurde: Le 13 heures en campagne. Er ist extrem vieldeutig. Beginnen wir mit der ersten Ebene: Auf Deutsch würde es heißen Die 13-Uhr-Nachrichten im Wahlkampf, denn en campagne bedeutet ›im Wahlkampf‹, bezieht sich also auf den Zeitraum bis April 2022. Die zweite Ebene – la campagne – meint auch ›das Land‹ im Sinne von ländlichem Raum. Gemeint ist also alles, was nicht Stadt ist. Doch Dieppe ist immerhin eine, wenn auch kleine, Stadt. Die dritte Ebene spielt auf den Traum des Städters vom Leben auf dem Land an, der auch in Frankreich während des Corona-Lockdowns wiedererwacht ist. Da fällt einem unmittelbar der schon in die Volksweisheit eingegangene Spruch ein »Man sollte die Städte auf dem Land bauen, weil dort die Luft reiner ist.«, die dem Journalisten und Humoristen Alphonse Allais (1854-1905) zugeschrieben wird.
Doch erst das Zusammenspiel dieser drei Bedeutungen ergibt den tieferen Sinn, nämlich Nachrichten ›von sonst woher‹. Campagne klingt idyllischer, um jenes Frankreich zu bezeichnen, das nicht Paris ist. Province ist schon lange nicht mehr politisch korrekt. Seitdem sagt man en régions (in den Regionen), als gehöre Paris nicht auch zu einer Region (nämlich Île de France). Aber der Begriff ist zu stark institutionell konnotiert. Bliebe noch die neugeborene Bezeichnung La France des territoires: das Frankreich der ›Territorien‹ oder der ›Gebiete‹. Doch ist auch dieser Begriff verwaltungstechnisch auf interkommunaler Ebene schon vergeben.
Dieppe war Vorwand und Kulisse. Das ist der Schlüssel: Die Belange, Wünsche und Sorgen der Menschen im Sonst-Wo sollen stärker berücksichtigt werden – das ist die offizielle Parole der Regierung, die sich seit der Amtszeit Hollandes eingebürgert hat. Gemeint ist: etwas weniger Zentralismus. Und Macron, dem man vorwirft, er sei zu wenig geerdet, hat im Sommer 2021 eine Tournee durch La France des territoires unternommen. Bürgernähe ist gefragt, besonders im (Vor-)Wahlkampf. Das alles haben die Zuschauer im Hinterkopf.
FRANCE 2 blieb nur die Wahl des poetischen Ausdrucks campagne, um seine Staatsunabhängigkeit zu bekunden. Wie darüber wohl ein deutscher Korrespondent – falls überhaupt – berichten würde? Vielleicht so? »Macron instrumentalisiert FRANCE 2 zu Propagandazwecken im Wahlkampf.« Die französische Wirklichkeit ist viel subtiler.
Radio, ein nationales Leitmedium
Im Gegensatz zu Deutschland, wo der Hörfunk ein lokal-regionales Medium ist und allein der DEUTSCHLANDFUNK als Quasivollprogramm im gesamten Bundesgebiet empfangbar ist (und das auch erst seit der Wiedervereinigung), ist Radio in Frankreich das ›nationale‹ Medium an sich. Auch der Hörfunk folgt dem zentralen Muster, zumindest was die Vollprogramme angeht, von denen es über ein halbes Dutzend gibt sowie einen führenden Nachrichtensender (FRANCE INFO). Denn die überwiegende Mehrheit der etwa 900 Radios sind Musiksender oder Formatradios, die Nutzersegmente oder lokale Zielgruppen bedienen und wenigen Senderfamilien angehören.
Diese Zentralität ist ein Erbe der Rundfunkgeschichte und stammt aus der Zeit, in der die Langwellenfrequenzen weltweit verteilt wurden. Bis zur offiziellen Erschließung des UKW-Bandes im Jahr 1981 und der damit verbundenen Zulassung privater Anbieter gab es im Inland nur Langwelle, was den Standort Paris begünstigte und dem Eiffelturm das Leben rettete. Er sollte, wie alles, was für die Expo 1889 gebaut worden war, nach der Ausstellung abgerissen werden. Doch bei der Geburt des Mediums ›Radio‹ erwies er sich als ein idealer Sendemast, und er ist es noch heute. Soweit zur Entstehungsgeschichte des heutigen FRANCE INTER, dem Vollprogramm der staatlichen Gesellschaft Radio France. Trotz Digitalisierung ist Radio ein ›nationales‹ Medium geblieben, Inbegriff des Broadcasting, d. h. der Verbreitung von einem Punkt aus an das Massenpublikum.
Als nach dem Krieg die Langwellenfrequenzen in Europa neu verteilt wurden, gelang es Frankreich, drei weitere zu erhalten, und zwar jene, die ursprünglich Andorra, Monaco und Luxemburg zugedacht waren. So entstanden drei weitere Radiosender, SUD RADIO, RADIO MONTE CARLO (RMC) und RTL. Sie haben ihren Sitz und ihre Redaktion in Paris, der Sendemast jedoch steht jeweils außerhalb der Staatsgrenzen. Ein vierter Sender kam bald hinzu, nämlich EUROPE 1: Auch dessen Sitz und Studios befinden sich in Paris, der Sendemast aber steht in Saarbrücken. Das heutige Saarland war bis 1957 Teilgebiet der französischen Besatzungszone. Alle diese Radiosender, die man lange périphériques nannte, sind kommerzielle Sender, und zwar seit jeher – außer EUROPE 1, das der Staat 1955 dem als zu unabhängig empfundenen RTL als Konkurrenten gegenüberstellte und das erst 1987 voll privatisiert wurde. Auch hier ein Unterschied zu Deutschland: In Frankreich sorgen seit jeher privatkommerzielle Radios für Qualitätsjournalismus.
Zusammen mit FRANCE INTER und dem Infosender FRANCE INFO sind RTL und EUROPE 1 die französischen Leitmedien. Radio ist auch seit Kriegsende in Frankreich das glaubwürdigste aller Medien geblieben. Dieses Grundvertrauen verdankt es u. a. dem kommerziellen Sender RTL, dessen Redaktion die Regierung nie kontrollieren konnte, da der Sender in Luxemburg stand und das Kapital seit Beginn in privater und zum großen Teil ausländischer Hand war. Als Symbol der Unabhängigkeit von RTL trug Jacques Rigaud, Geschäftsführer von 1979 bis 2000, stets ostentativ statt einen Schlips eine Fliege – Präsident Giscard d’Estaing konnte Fliegen nicht ausstehen.
Den Mainstream bestimmt die ›Mediaklatura‹
Der Mainstream wird in Paris selbstreferenziell von einer Handvoll etablierter Persönlichkeiten produziert, von Journalisten und Experten sowie Politikern und Stars des Showbiz. Das, was man in Deutschland einigen Fernsehtalkshows vorwirft, nämlich immer wieder dieselben Köpfe vor die Kamera zu holen, ist in Frankreich die Regel. Heute erst recht, wo sich neben den vier Vollprogrammen mit höherem Nachrichtenanteil (die beiden öffentlichen FRANCE 2 und FRANCE 3 sowie die privaten TF1 und M6) fünf Infokanäle angesiedelt haben. Außer dem öffentlichen FRANCE INFO (das Programm ist gefilmtes Radio) und dem Parlamentsfernsehen LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE/PUBLIC SÉNAT gehören dazu LCI (Gruppe TF1), CNEWS (Gruppe Canal+) und BFMTV (Altice Médias). Sie senden live und rund um die Uhr.
Man stelle sich einen ›Presseclub à la française‹ vor, in dem politische Journalisten und Intellektuelle, die in drei Medien das Sagen haben und eventuell noch ein Blog führen, mit immer wieder denselben Pariser Journalisten und Experten, deren Stimmen meist ebenfalls in den drei Medien und im Netz tonangebend sind, ständig untereinander bleiben und aufeinander reagieren. Und »was macht ein Politiker, wenn er sich von den Medien schlecht behandelt fühlt? Er schafft sich seinen eigenen Informationsträger«. So berichtete 2017 Stefan Brändle in der Luzerner Zeitung (BRÄNDLE 2017b) über den damaligen wie heutigen linksextremen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon, der sein eigenes Online-Fernsehen startete. Die Grenze zwischen Medien und Politik ist in Frankreich fließend. Diese Pariser ›Stars‹ aus Politik, führenden Konzernen, Werbeagenturen, Meinungsforschungsinstituten oder aus dem Showbusiness sind alle eng miteinander verbandelt. Sie bilden das, was die Wochenzeitschrift Le Nouvel Observateur (1988) vor gut dreißig Jahren, kurz nach der Marktöffnung des Rundfunks, treffend als »Mediaklatura« bezeichnete.
Diese ›Elite der Eliten‹, die fast ausnahmslos mindestens eine der Bildungseinrichtungen für Eliten besucht haben, aus (gut) bürgerlichen Milieus stammen und es sich leisten können, in einem extrem gentrifizierten Paris zu leben, ist heute im digitalen Zeitalter noch fester etabliert, sie besetzt regelrecht den öffentlichen Raum, was dem Zentralismus geschuldet ist und ihn potenziert. Nicht vergleichbar mit dem Hauptstadtjournalismus, der sich mittlerweile auch in der Berliner Republik etabliert hat.
ARD und ZDF berichteten wie die Regenbogenpresse
Dieser Zentralismus ist für deutsche Beobachter schwer nachvollziehbar und wird schnell als Hofberichterstattung missverstanden, sobald ein Président im Mittelpunkt steht.
Das war unter Sarkozy besonders deutlich, der von den deutschen Medien als ein ›neuer Berlusconi‹ dargestellt wurde, der die Presse über seine befreundeten Medien- und Industriebosse (insbesondere Vincent Bolloré) kontrolliere. Die Zeitung Le Figaro sei zur ›Sarkozy-Prawda‹ mutiert, kritischer Journalismus ins Internet abgewandert.
Und als Sarkozy am 8. Januar 2008 ein großes Reformprogramm auf der Neujahrspressekonferenz ankündigte und nebenbei auch Privates preisgab, wussten Tagesthemen und heute journal über nichts anderes zu berichten als über seine öffentliche Liebeserklärung an seine spätere Ehefrau (BOURGEOIS 2008). Liebesroman im Élysée-Palast – eine Sensation! Und endlich ›mal was anderes‹ in einer deutschen Agenda, die im damaligen Wahlkampf vom Thema ›Umverteilung‹ beherrscht war. Die deutsche Berichterstattung hatte auch eine innerdeutsche Ventilfunktion, womit der Schock, den die vier Ehen des deutschen ›Medienkanzlers‹ Schröder für politische Journalisten bedeutet hatte, bewältigt werden konnte.
Vor lauter Boulevardisierung war selbst ARD- und ZDF-Korrespondenten der Blick für das Land entgangen, aus dem sie berichteten: 1) die Dringlichkeit der endlich angekündigten (aber dann doch nicht durchgeführten) Strukturreformen in Frankreich und 2) der Kontext, der es Sarkozy und seinen Nachfolgern möglich machte, täglich die Agenda zu besetzen, nämlich Zentralismus und Selbstreferenzialität von Politik, Wirtschaft und Medien. Vieles, was einen deutschen Journalisten befremdet oder schockiert, ist eigentlich Normalität im anderen Land. Vielen ist das bewusst. Doch wie soll man das einer ungläubigen Zentralredaktion weitab klarmachen?





























