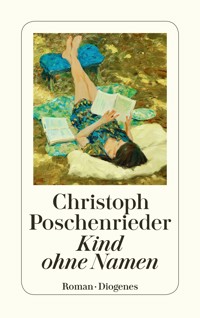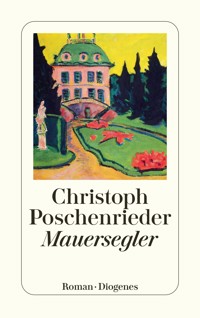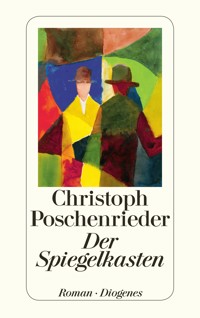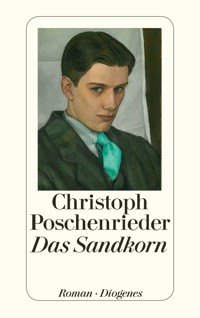21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hedwig ist eine unverheiratete Frau, die auf dem Land als Grundschullehrerin arbeitet. Doch schon in jungen Jahren meldet sie sich immer häufiger krank. Der Pfarrer sieht in ihr eine verirrte Seele, der Arzt eine Nervenkranke – und die Familie versteht sie nicht. Hedwig führt ein stilles, einsames Leben an der Zeitenwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Umso mehr verstören ihre Ausbrüche die Menschen um sie herum. Unter der NS-Diktatur schließlich ist sie als psychisch kranke Frau ihres Lebens nicht mehr sicher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christoph Poschenrieder
Fräulein Hedwig
Roman
Diogenes
Für Hedwig und Marie
Endlich sagte Goethe: Weißt du, warum es mir ganz unmöglich gewesen wäre, das Buch zu schreiben? Ich hätte mich nie entschließen können, die arme Heldin in so unterdrücktem Zustande durchs ganze Werk durch zu erhalten; man interessiert sich durchaus ihres unbeschreiblichen Leidens wegen für sie, das war meiner Natur nicht möglich (…).
Adele Schopenhauer im Austausch mit Goethe über Sir Walter Scotts Roman ›Kenilworth‹ (1821)
Hedwig schreit
Hedwig schreit. Steht am Fenster und schreit.
Hedwig steht am geöffneten Fenster, hinter sich das Zimmer hell erleuchtet, und schreit auf die Straße hinaus. Marie ist mit ihrem Köfferchen längst abgezogen, sofort, als die ersten Sirenen heulen, sie ist immer die Erste im Keller. Und die Erste wieder draußen: Wer weiß, wie lange die Trümmer halten, und außerdem gilt es die Plünderer abzuwehren; da kann man sich auf Hedwig leider nicht verlassen. Es nimmt sie ja auch keiner mehr ernst. Im Keller sitzen sie und denken sich, die Hedwig soll endlich den Mund halten, die beschwört uns ja noch die Bomben auf unsere Köpfe herab, obwohl das jetzt wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr macht. Aber wer weiß, warum es die einen trifft und die anderen nicht. Man kann sich nur wundern. Ja gut, vielleicht die Schutzengel.
Das mit den Schutzengeln ist ein altes Spiel von Marie und Hedwig. Nach einem Opernbesuch. Ist lange her. Da hat der Vater noch gelebt, Bayern war ein Königreich, Hedwig wollte Sängerin werden und Marie Schriftstellerin.
Jetzt hockt Marie im Keller mit den andern, und sie hoffen, manche beten, dass es auch dieses Mal wieder gut gehen wird, dass sie heil, grau bestäubt, bleich wie die Gespenster, wieder herauskommen. Es ist oft schon gut gegangen, das Viertel ist bisher glimpflich davongekommen, obwohl die Bahngleise nicht weit entfernt sind. Neuerdings, seit ein paar Wochen, fliegen sie auch bei Tag. Die anderen kamen immer in der Nacht. Ist aber egal, soweit es Hedwig betrifft. Sie steht am Fenster und schreit, ganz gleich, ob Tag oder Nacht. Die anderen schnappen ihre Köfferchen und verkriechen sich in die Keller wie die Asseln, aber sie ballt die Faust, verwünscht die Flieger, schimpft auf alle und jeden, der noch über die Straße läuft, auch die in Uniform. Kein Wunder, wenn sie jeder kennt und keiner leiden kann. Wer mochte sie denn je?
An einem Tag Ende Juni 1944 läuft sie auf die Straße, zwischen den Trümmern herum, in Pantoffeln und im Hauskleid, sie gerät an einen Posten der Luftschutzpolizei.
»So, jetzt ist einmal Schluss mit dem Geschrei und der Aufführung, wertes Fräulein Poschenrieder, jetzt ist einmal endgültig Schluss«, sagt der Luftschutzpolizist, »Sie machen uns ja alle wahnsinnig.«
Noch bevor der Juli 1944 zu Ende ging, war Fräulein Hedwig Poschenrieder, Studienrat a.D., tot. Ermordet, wie sich 75 Jahre später herausstellt.
Hedwigs jüngere Schwester Marie hat einmal begonnen, die Geschichte der Familie aufzuschreiben, wurde damit aber nicht fertig. In gewisser Weise übernehme ich das jetzt, für Marie und für Hedwig.
Diese Familie
Ich will kurz vorstellen, mit wem ich es zu tun habe.
Aus der Krankenakte der Hedwig Poschenrieder, Nr. 357/28, Psychiatrische und Nerven-Klinik München, Nußbaumstraße, angelegt am 6. Mai 1928:
Autoanamnese.
Vater starb an Herzlähmung mit 44 Jahren, war Gymnasialprofessor, ein sehr ernster Mann. War lange Gallensteinleidend [sic]. Mutter lebt, 78 Jahre, lebhafter in ihrem Temperament. 3 Geschwister:
1 Pat[ientin]
2 Maria, 42 Jahre, Sozialbeamtin, unverheiratet, heiter, wird mit allem gut fertig.
3 Hermann, 38 Jahre, Studienrat, unverheiratet, ernst.
4 Franz, 30 Jahre alt, Studienrat, heiter.
Autoanamnese: So erzählt die Hedwig ihrem behandelnden Arzt an diesem späten Abend im Mai 1928 die Geschichte ihrer Krankheit oder was sie eben von sich erzählen mag. Nein, das ist falsch: So notiert es der behandelnde Arzt an diesem späten Abend im Mai. So oder so, aus den paar Zeilen könnte ich die Geschichte schreiben, die sich hier entfaltet.
Hedwigs Vater, mein Urgroßvater, stirbt an Herzlähmung oder doch wegen des Gallensteinleidens. Ein sehr ernster Mann ist er, Gymnasialprofessor. Aber eigentlich ein Müllerbub, der Erste der Sippe, der studieren ging. »Professor« nennen ihn seine Brüder und auch noch deren Kinder.
Die Mutter ist lebhafter in ihrem Temperament. Vielleicht ein anderes Wort für heiter. Auf 78 Jahre hat sie es bis dahin gebracht, er bloß auf 44. Vielleicht war er zu ernst.
Über 1 Pat, die Heldin, die Patientin, Hedwig, noch einiges, gar dieses ganze Buch.
Von 2 Maria, bei uns die Tante Marie mit der Betonung auf der ersten Silbe, unverheiratet und heiter, wird mit allem gut fertig, ebenfalls noch einiges. Ist halt doch nicht mit allem fertiggeworden, schon gar nicht gut. Sie kannte ich noch, aber nicht eigentlich als heiter. Falls man das Kennen nennen darf. Es war eher so ein Bestaunen. 1973 gestorben, als ich noch keine sieben Jahre alt war.
Zu 3 Hermann, entgegen dem Vermerk in der Akte damals schon seit drei Jahren verheiratet, ernst, immer nur das Nötigste, denn da ist zu viel Peinliches. Bei ihm hat irgendjemand auf dem Akt von Hand vermerkt: (sicher schizoid!!). Fragt sich: Woher wollen sie das wissen? Immerhin kommt der Mann in großer deutscher Weltliteratur vor; dazu später mehr. In Person habe ich ihn nie gesehen. Ich kenne seine Briefe an Nr. 2 Maria, viele Dutzende. Nach 1945 und Entnazifizierung als »Mitläufer« der Kategorie IV eingestuft, war er nie wieder derselbe. Die ganze Welt war nicht mehr so wie vorher, und das hat er nicht verkraftet. 1969 in Burghausen am Inn gestorben, wohin man ihn versetzt hatte, obwohl er doch so gern in München geblieben wäre.
4 Franz – das ist mein Großvater, der Opa, Studienrat und heiter –, seit 1922 mit meiner Großmutter verheiratet. Zum letzten Bild, das ich von ihm habe, gehört ein Schlauch in der Nase. Ich hab auch ein schriftliches Memo von ihm, darin verbittet er sich alle lebenserhaltenden Maßnahmen. In meiner Erinnerung sitzt er dösend im Lehnstuhl, ein Radiosprecher leiert die Börsenkurse herunter, die Sonne fällt durch das Wohnzimmerfenster und wärmt das Parkett, auf dem ich aus den Blöcken des Anker-Steinbaukastens einen schwindelhohen Kamin aufschichte und die Räucherkerze daruntersetze, Hauptsache, es qualmt. Oma mosert, Opa guckt mich – … Hoechst 123, BASF 94, Siemens 23, MAN 77 … – aus zusammengekniffenen Augen an und sagt ohne Worte: Passt schon, nachher können wir lüften. Oder wir sitzen auf dem Sofa unter der komischen Stehlampe mit ihren konischen Schirmen, und der Opa liest aus Wilhelm Busch vor: Wehe, wehe wenn ich auf das Ende sehe.1972 gestorben. Die Tante Marie war die letzte Überlebende dieser Generation.
Die einen sind ernst, die anderen heiter – klingt harmlos, aber vermutlich ist es ein psychiatrischer Code, um die Verteilung der Gemüter in dieser Sippe auszuloten.
Nichts gegen ernst, aber heiter, scheint mir, verschafft einen gewissen Startvorteil. Was nicht bedeutet, dass es einen ins Ziel bringt.
Eine Schublade voll
Eine Schublade voll: Postkarten, Briefe, Dokumente, Notizbüchlein, Totenzettel, Zeitungsausschnitte, 150 Jahre alte getrocknete Wiesenblumen aus Podolien, Fotos, amtliche Dokumente, Testamente, Schulhefte, Geburtsurkunden, Abschriften, der Familienstammbaum, Zeugnisse, Bestätigungen, Formulare, Lebensmittelkarten – Fragmente, Fetzen und Fehlstellen, Unvollendetes und Unvollständiges. Die Tante Marie hat das alles gesammelt. Wenn das Haus, in dem sie lebte, nicht in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 1945 zerstört worden wäre und wenn sie beim Umzug ins Altersheim alle ihre Schätze hätte mitnehmen können – dann hätte eine einzige Schublade niemals gereicht. Es ist ein wenig viel – und gleichzeitig viel zu wenig.
Wenn ich mir diese Fotos ansehe, die Briefe in alter Kurrentschrift entziffere, frage ich mich: Wer waren diese Leute, woher kamen sie, wohin wollten sie? Und was habe ich mit denen zu tun? Überhaupt irgendetwas? Wenn Marie ihre Memoiren zu Ende gebracht hätte, wüsste ich dann alles über Hedwig? Warum sollte ausgerechnet meine alte Tante, die Geschichtenerzählerin, in ihren Erinnerungen wahrhaftiger sein als alle anderen, Schriftsteller eingeschlossen.
Also die Fakten.
Wir heißen Poschenrieder und kommen aus dem bayerischen Alpenvorland. Wir heißen Poschenrieder, weil wir diejenigen gewesen sind, die Busch- und Strauchwerk gerodet haben, um sich Lebensraum zu schaffen: Äcker, Wiesen, Weiden und Platz für unsere Hütten und Ställe. Andere haben das auch gemacht, uns ist der Name geblieben: Poschenrieder. Im Poschen- stecken die Büsche, im -rieder das Roden, das Urbarmachen. Wahrscheinlich haben meine Leute auch noch ein paar Sümpfe trockengelegt, es würde in die Gegend passen, aber das hat sich nicht im Namen unterbringen lassen. Der ist lang genug.
Es heißt allgemein, man müsse sich einen Namen machen: Was aber nicht bedeutet, dass man den Namen, den man nun einmal abbekommen hat, einfach so verändern könnte. Eher ist es andersherum: Der Name besitzt einen. Dort, wo ich herkomme, pflegt man zu fragen: Wem gehörst denn du? Im Dialekt natürlich, dann klingt es direkter, harscher und genau so, wie es gemeint ist: Du schleppst die Geschichte und die Gegenwart deiner Vorfahren mit. Ob du willst oder nicht.
Wem gehörst denn du?
Dann sagst du brav deinen Namen. Der Vorname zählt nicht, nur der der Sippe. Und die Leute hören das und sagen: Soso. Und denken eher nicht an das Roden von Büschen und Sträuchern. Sondern daran, ob du in diese Sippe passt oder nicht, du Bürschchen, du Hund, du verreckter, und ob sie dich nun an den Ohren abschleppen und am Gartentor der beschämten Mutter mitsamt dem aktuellen Strafregister übergeben mussten.
Oder die Leute fragten: »Zu wem gehörst denn du?«
Das möchte ich auch gerne wissen. Und ich möchte wissen: Gehören die zu mir?
Wir sind seit je gewöhnliche Leute.
Der älteste bekannte Poschenrieder meiner Linie hieß Kaspar. Er verließ seinen Geburtsort bei Königsdorf in den bayerischen Voralpen um 1660 und zog mit seiner Frau Richtung Norden.
Durch die Einfälle der Hussiten in die Oberpfalz wurden viele Ortschaften zerstört, Bibliotheken und Kirchenbücher verbrannt. Wald, Wiesen und Ackergründe waren in den entvölkerten Gegenden spottbillig zu kaufen. Dies bewog manchen Bauern Oberbayerns, sich in der Oberpfalz anzusiedeln.
So schreibt das meine Großtante Marie. Sie blieb eine »Einschichtige«: nie verheiratet gewesen. Bis zu ihrem Tod waren alle Briefe an Fräulein Maria Poschenrieder adressiert. Sie starb am 17. März 1973 im alten Barackenkrankenhaus von München-Oberföhring. Sie wollte zweiter Klasse, aber nicht offen aufgebahrt und dritter Klasse beerdigt und nach Regensburg überführt werden, um an der Seite der Eltern und Hedwigs bestattet zu werden.
Zuletzt hatte Marie in einem Altersheim in München-Schwabing gelebt. Von den Besuchen dort – es waren einige – habe ich wenige Bilder behalten, eher Gerüche. Unangenehme Gerüche, muffige, stechende, solche, die einem das Altsein verdächtig machen, solange man jung ist. Manchmal, wenn ich in den alten Sachen blättere, wehen sie mich noch an, diese Gerüche, und sofort bin ich wieder in dem vollgestopften Zimmer, in dem sie liegt, der kleine Kopf in den großen Kissen.
Die Tante Marie wäre gerne Schriftstellerin geworden; wurde spät Angestellte bei einer Versicherungsanstalt; das gelang ihr erst, als sie dem eisernen Griff ihrer Mutter entkommen war. Sie konnte kochen und nähen, hatte Hauswirtschaft gelernt. Bloß ihren eigenen Haushalt hatte sie nie im Griff. Typ Messie, würde man heute sagen. Zu viel Zeug, zu viele Katzen. »Pass auf, sonst wirst du wie die Tante Marie«, das hat meine Cousine mehr als einmal gehört.
Jedenfalls schrieb sie viel, schon immer. Auch sammelte sie alles, Fotos, Briefe, Dinge. Mein technisches Geschick wurde früh an einem Dutzend alter Wecker aus dem Nachlass der Tante Marie geschult. Die habe ich alle zerlegt, weil ich dachte, ich könnte die Zahnräder, Schrauben und Federn einmal für eine – meine – große Weltmaschine brauchen (dabei geht das mit Worten viel besser).
Urahn Kaspar kaufte im Tal der Schwarzen Laber einen verlassenen Hof, schreibt die Tante Marie. Woher sie das weiß, schreibt sie nicht. Überhaupt hat sie es nicht so mit den Quellenangaben; apropos Quelle:
Sie ist bloß ein dürres Flüsschen, aber die Schwarze Laber sammelt auf ihren 77 Kilometern zwischen Quelle und Mündung, bei 184 Metern Gefälle, Kraft genug, um alle paar Schleifen und Windungen ein Wasserrad anzutreiben – nämlich: die Ostermühle, die Haumühle, Polstermühle, Steinmühle, Bienmühle, Hammermühle, Sturmmühle, Pexmühle, Königsmühle, Neumühle, Kohlmühle, Friesenmühle, Mäusermühle, Gleislmühle, Schafbruckmühle, Endorfmühle, Hartlmühle, Türklmühle, Münchsmühle, Hammermühle Schönhofen, Mühle und Sägewerk Poschenrieder, Papierfabrik Mittelalling, Papierfabrik Unteralling, obere Mühle Bruckdorf, untere Mühle Bruckdorf, Ober-, Mitter- und Untermühle Sinzing (und das sind sicher nicht alle) –, bevor die Laber sich erschöpft und abgearbeitet der Donau übergibt. Ist meine Faszination für fließendes Wasser, kleine, große, wilde, sanfte, träge, schnelle, laute, leise, klare, trübe, kalte, warme Fließgewässer – kann das irgendwas mit all den Generationen zu tun haben, die am Ufer der Schwarzen Laber geboren wurden, dort lebten und starben, die mir da irgendetwas in die Gene eingeschleust haben?
Kaspars Sohn Sebastian heiratete 1689 eine Müllertochter, und seitdem sitzen wir – unsere Leute – dort, an diesem kleinen Fluss und betreiben in Bruckdorf unsere Mühle, bis heute.
Die Tante Marie, ein Mensch ohne Nachkommen, hatte es mit den Vorfahren. Abgesehen von dem kommentierten Stammbaum hat sie sich auch an einer Familiengeschichte versucht:
Was einst war
Für alle, die nach mir kommen
von Maria Poschenrieder
Das tippte die Tante Marie auf dünnes, durchscheinendes Durchschlagpapier und steckte es in einen Umschlag, auf den sie mit wackliger Hand schrieb: Sehr wichtig für die ganze Familie! 76 Seiten zählt dieses Vermächtnis. Der Text endet mitten im Satz: Ich war natürlich auch für München, auch schon deshalb
Niemand weiß, wo der Rest ist. Vielleicht in der Bombennacht vom Januar 1945 verbrannt? Oder, niemals geschrieben, mit der Tante Marie ins Grab gegangen? Gegen ihr Ende hat sie vor allem an ihrem Testament gearbeitet. Von Hand, wie es das Gesetz verlangt. Die verschiedenen Versionen zu lesen ist wie einem Zug beim Entgleisen zuzusehen. Oder einem Seismografen, der von Stufe drei auf zwölf geht.
Von den zahlreichen Nachkommen auf der Mühle – zehn bis vierzehn Kinder in früheren Generationen – konnte nur einer der nächste Müller werden. Die Mädchen wurden möglichst vorteilhaft verheiratet oder ins Kloster gesteckt, die überzähligen Buben mussten sich halt umschauen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts brach das auf. Mein Urgroßvater Franz Seraph war der Erste, der an die Universität ging. Sein jüngerer Bruder Peter studierte Elektroingenieur und machte Karriere bei Siemens in Wien, Bruder Ignaz strebte als Jurist die Beamtenlaufbahn an und schaffte es zum Bezirksamtsassessor. Joseph, der als Junge vom Birnbaum fiel, wurde Buchhändler bei Wunderlichs Hofbuchhandlung in Regensburg und starb wahrscheinlich mit 17 an den Folgen ebendieses Baumsturzes. Und Leo – der starb einfach, zehn Tage nach seiner Geburt, weil – niemand weiß, warum, und weil das damals nichts Besonderes war.
Die Tante Marie ist die Erste dieser Sippe, die eine künstlerische Ader zeigt. Schreiben will sie, sie will Geschichten erzählen, kleine, erbauliche, katholische Geschichten. Auch mal eine Gruselgeschichte, aber nichts Verstörendes. Im März 1918 liegt ein Postkärtchen im Briefkasten: Hochwohlgeboren Fräulein M. Poschenrieder, München, Ferdinand-Miller-Platz 10/0.
Das Fräulein M. ist da bereits 32 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter Margarete, der Gymnasialprofessorswitwe, zusammen. Der alteingesessene Regensburger Verleger Friedrich Pustet versucht, seine Absage einfühlsam zu formulieren:
Sehr geehrtes Fräulein!
Die gütigst angebotene Erzählung Aus dem Leben einer Armenhäuslerin ist im Allgemeinen für meinen Marienkalender recht geeignet; störend sind nur die etwas zu große Länge bzw. Weitschweifigkeit und einige allzu wehleidige Stellen, zumal am Schluss. Ich erlaube mir daher, Ihnen das Manuskript mit gleicher Post zurückzureichen, auf dass Sie Ihrer Arbeit gegebenenfalls die letzte Feile angedeihen lassen und mir dieselbe hierauf wieder zur Verfügung stellen.
Mit den besten Empfehlungen
Friedrich Pustet
Letzte Feile. Eine Geschichte zu Ende bringen: Wenn man so eine Aufgabe erben kann, dann übernehme ich, was die Tante Marie nicht vollenden konnte oder wollte. Sie wollte an der Seite ihrer Eltern – Margarethe und Franz Seraph – und ihrer Schwester Hedwig im Familiengrab auf dem Dreifaltigkeitsberg über Regensburg beerdigt werden. Aber da hat sie wohl etwas übersehen. Oder nicht sehen wollen, denn Hedwig ist nicht dort. Das dachte ich jedenfalls am Anfang der Recherchen zu diesem Buch. Und sicher, richtig sicher, bin ich heute noch nicht. Was passierte wirklich mit Hedwig? Wo ist Hedwig?
Kanonen
Bei der Geburt meiner Schwester durften die Studenten mit einer kleinen Kanone Schüsse abgeben.
Aus den Memoiren der Tante Marie
Am Montag, den 3. März 1884, nachmittags halb eins, wird die Frau des Gymnasialassistenten Franz Seraph Poschenrieder von einer Tochter entbunden. Dies geschieht in Metten an der Donau, im Haus des dort ansässigen Buchbinders Kandler, der immer wieder einmal den weltlichen Lehrkräften eine kleine Wohnung vermietet. Seit vier Jahren lehrt der junge Poschenrieder am Klosterinternat die lateinische und griechische Sprache sowie Geschichte. Eine Hebamme bringt das Kind zur Welt, und sie wird es zwei Tage später auch zur Taufe tragen, wohl weil die Mutter, Margarete Poschenrieder, das Wochenbett noch nicht verlassen darf, aber das ist eine Vermutung.
Zuwarten kommt für die katholisch erzogenen Eltern nicht infrage, schon gar nicht in Metten und erst recht nicht unter den Augen der Patres; zu oft sind ungetaufte Kinder plötzlich gestorben, und man hat sie deswegen nicht in geweihter Erde begraben können. Daher die Eile. Deswegen hat auch die als Patin vorgesehene Tante Fanny – Franziska, einzige Schwester von Franz Seraph – nicht kommen können, um die Kleine übers Taufbecken zu halten; sie sei auf solch kurze Notiz im Haushalt unabkömmlich, hat ihr Mann Otto auf die freudige Nachricht barsch und an freundlichen Worten sparend telegrafieren lassen. Weswegen man sich auch noch um eine Vizepatin hat bemühen müssen. Aber die Gattin des Mettener Dorfarztes, wie Tante Marie schreibt, eine geistig hochstehende Frau und liebe Freundin und Beraterin, ist gerne eingesprungen.
Das Klosterinternat von Metten ist die erste Verwendung des Franz Seraph Poschenrieder. Nicht ganz das, was er sich erhofft hat, nach lustigem Studentenleben in der Haupt- und Residenzstadt München, doch wer fragt schon nach den Wünschen eines Gymnasiallehrers am Anfang seiner Laufbahn – zumal der Mann ein gutes, aber kein exzellentes Examen abgelegt hat. Das heißt: Franz Seraph wird sich hocharbeiten müssen. Kaum dass die zwei in Metten heimisch geworden sind, reicht er ein ums andere Versetzungsgesuch ein, wartet ab und verhält sich untadelig. So wird es wohl zu schaffen sein, sich an die angesehenen höheren Lehranstalten Münchens heranzudienen und die Räume im Haus des Buchbinders baldmöglichst für den Nachfolger frei zu machen.
Aber Margarete mag die Überschaubarkeit des Klosterdorfs, die gemütlich eingerichtete Wohnung und freut sich, wenn der Pater Rektor gelegentlich ein Paket Butter aus der Klostermolkerei herüberschicken lässt. Mit der Arztgattin lässt es sich gut Konversation machen, sie selbst, als Gymnasialassistentengattin, besitzt Status und genießt Ansehen im Dorf. Die Schüler reißen die Mützen vom Kopf, wenn sie ihr begegnen. Margarete hat schon einiges von der Welt gesehen; ist Hauslehrerin und Gouvernante gewesen beim Baron Eötvös in Fünfkirchen (das liegt im Süden Ungarns) und Kindermädchen bei dem Großgrundbesitzer Resnikoff, der ein Gut in Podolien unterhielt, irgendwo an der Bahnlinie von Lemberg nach Odessa. Französisch, Klavierspiel und gute Manieren hat sie unterrichtet und kehrte mit den besten Zeugnissen heim. Sagt jedenfalls die Marie und auch, dass es mit dem erträumten Aufenthalt in Paris nicht geklappt habe. Aber in Paris waren viele, in Podolien wenige. So oder so: Margarete ist nicht bloß das Anhängsel am Titel ihres Gatten, sie hat ihren eigenen Kopf und wird die Zeit in der Provinz nicht beklagen und bejammern, sondern das Beste daraus machen. Und jetzt, da noch nicht einmal der zwölfte Monat ihrer jungen Ehe vollendet ist, liegt schon das Kind in der Krippe. Et voilà.
Nun ist es halt ein Mädchen geworden, da wird man also dranbleiben und weiter hoffen müssen. Zu groß darf die Familie natürlich auch nicht werden, denn ein Lehrergehalt ist keineswegs üppig, mit Kindern hat man es sowieso sechs Tage in der Woche zu tun, und am Sonntag sieht man sie in der Kirche schon wieder.
Zur Feier der Taufe kommen die Internatszöglinge in den Genuss einer Freistunde. Sie hängen dicht an dicht in den Fenstern des Seminars, und als die kleine Prozession sich in Bewegung setzt, rufen sie »Vivat, vivat Hedwig« und schauen neidvoll auf die drei Musterschüler, die die Ehre haben, die kleine Salutkanone abzufeuern. Der junge Vater trägt einen geborgten, etwas engen Zylinderhut und zuckt beim ersten Knall zusammen und auch noch beim zweiten. Sehr unangenehm, dieser kurze Marsch aus dem Tor des Seminars zur Klosterkirche, als Dritter hinter Vizepatin und Hebamme, mit rotem Kopf, denn die Beobachtung durch die Pennäler ist ihm widerwärtig, diese Umkehrung der Rollen. Aber morgen früh wird er wieder vom Katheder auf die Rotzbuben hinunterblicken, so wie’s sich gehört, und dann heißt es wieder: »Jawoll, Herr Lehrer«, und aus ist’s mit »Vivat, vivat Hedwig«.
Und überhaupt Hedwig. Das war dann doch überraschend gewesen; über Mädchennamen hatten sie sich nicht viele Gedanken gemacht. Denn die Zeichen hatten auf einen Buben hingedeutet; sofern man den einschlägigen und gewissenhaft konsultierten – wie man das bei bildungsbeflissenen Eltern, noch dazu beim ersten Kind, erwarten darf – Ratgebern vertrauen konnte.
Trägt nämlich die Schwangere einen Knaben, so bleibt in den meisten Fällen ihre Gesichtsfarbe unverändert, auch die weiße Mittellinie und der Nabel bräunen sich wenig oder gar nicht; trägt sie aber ein Mädchen, so färbt sich sehr oft das Gesicht gelbfleckig oder bräunlich, es werden vorhandene Sommersprossen und Leberflecke dunkler, die weiße Unterleibslinie und der Nabel bräunen sich stärker.
Dr. Klencke: Das Weib als Gattin (1872)
Derartige Veränderungen hatte das Paar nicht beobachten können. So waren sie mit ruhiger Gewissheit davon ausgegangen, es sei tatsächlich der Stammhalter unterwegs. Und dann trug die Hebamme ein Mädchen aus dem Schlafzimmer heraus, rund, gesund, rosig, ziemlich laut, aber ein Mädchen. Mit der noch recht ermatteten Mutter nun in eine Abwägung passender Namen zu gehen war ausgeschlossen. Schließlich redet da die gesamte Verwandtschaft mit – oder besser: Sie tuschelt. Leicht ist eine oder einer beleidigt, weil übergangen, entweder in der oder in der anderen Linie, wahrscheinlich in beiden. Als vierundzwanzig Stunden nach der Geburt noch immer keine Klarheit war und der Pater, der die Taufe zelebrieren sollte, schon drängelte, weil er seine Dokumente vor dem Sakrament geregelt haben wollte, griff die junge Mutter, ermüdet von den mehrmaligen Anläufen ihres Mannes zur Namensklärung, nach einem Buch, in dem sie vor dem Einsetzen der Wehen gelesen hatte und das immer noch auf dem Nachttisch lag. Sie blätterte ein wenig herum und las vor, während Franz Seraph zuhörte:
»Wie heißt sie?«, fragte jetzt Hartenstein wieder.
Die Alte sah auf, und ihre Augen ruhten wie wirr bald auf mir, bald auf meinem Freunde. Dann erst sagte sie:
»Wie sie heißt? Sie kann so oder so heißen, meinethalben Hedwig.«
Aber bei uns heißt niemand so, hatte der junge Vater protestiert, und bei den deinigen auch nicht.
Umso besser, sagte die junge Mutter, so wird niemand bevorzugt, und alle werden gleichermaßen benachteiligt.
Und die weiteren Namen?, fragte er.
Nur Hedwig, für mehr habe ich jetzt nicht die Kraft und Fantasie, sagte sie, ein Name wird wohl genügen, um das Kind zu taufen, zu rufen, zu tadeln und zu loben und ihn endlich auf den Grabstein zu meißeln. Wir sind ja nicht von Adel, wo sie ihre ganze elende Ahnengalerie mitschleppen.
Doch wenigstens ein zweiter, sagte Franz Seraph, aber die auf Margaretha Anna Getaufte gab ihm mürrisch Bescheid: Zu Hedwig passt nix, Hedwig muss allein stehen.
Und damit war die Unterhaltung zu Ende, die Hebamme kam herein und verschickte den Franz Seraph.
Einzig Hedwig?, fragte auch der Pater und gab sich zufrieden, nachdem er im Heiligenlexikon nachgeschlagen hatte.
Der kleine Zug nähert sich dem Portal der Klosterkirche, das Vivat! und das Knallen der Salutkanone wird leiser, die Orgel lauter. Links und rechts des Wegs liegen die Gräber der Benediktinerpatres und -fratres, damit es auch niemand vergisst: Wo ein Anfang ist, da ist auch ein Ende. Kurz bevor er die Kirche betritt, denkt Franz Seraph, als er endlich den zwickenden Zylinder abnehmen darf, weil er muss, zehn Mal, nur zehn Mal haben sie die Kanone abgefeuert.
Wäre es ein Junge gewesen, der so begrüßt wurde, so hätten sie noch öfter schießen dürfen.
Die Buben an der Böllerkanone hätten geböllert, bis ihre Gesichter schwarz vom Pulverdampf gewesen wären, durften aber nur lausige zehn Schuss abgeben – das war nun einmal das Protokoll, um die Geburt eines Mädchens zu feiern. So hat es jedenfalls die Tante Marie, wie überhaupt die ganze Taufgeschichte, viele Jahre später vom Stiftsdekan Lindner erfahren und aufgeschrieben.
Um diese nüchternen Tatsachen als Zeichen zu deuten: Hedwig kommt im März zur Welt; im März, dem überflüssigsten aller Monate, nicht mehr Winter, noch nicht Frühling, der Monat, der nie schnell genug vergehen kann, der Monat, den man (für mein Gefühl) aus dem Kalender streichen könnte, und niemand würde es merken. Außer natürlich die im März Geborenen. Wie Hedwig, die Einnamige. Ihre jüngeren Geschwister werden es alle auf drei Taufnamen bringen, und viele Tanten und Onkel werden sich angemessen gewürdigt fühlen.
Nach dem zehnten Knall der Böllerkanone hat Hedwig noch 60 Jahre, 4 Monate und knapp drei Wochen zu leben. Oder 22056 Tage. Menschen wie sie hinterlassen wenige Spuren, zumindest wenige, die überdauern. Bevor ich dies hier begann, wusste ich wenig mehr, als dass es Hedwig gegeben hatte. Die Tante, die in der Nervenheilanstalt starb.
Franz Seraph, der Besorgte
Er muss ein vorsichtiger, etwas ängstlicher Mann gewesen sein. Gewissenhaft, von der Sorte strenger, aber gerechter Lehrer. Von pessimistischer Grundstimmung, geplagt von Ahnungen und Sorgen.
Außer Tante Maries Bericht, der meine wichtigste Quelle ist, existiert noch ein Nachruf auf Franz Seraph im Jahresbericht 1898/1899 des Alten Gymnasiums Regensburg:
Gediegene Tüchtigkeit, Adel der Gesinnung, gewinnende Bescheidenheit und schlichte Anspruchslosigkeit des ganzen Wesens hatten dem trefflichen Manne Hochachtung, Verehrung und treue Anhänglichkeit erworben.
Das bevorzugte Kind seiner Mutter soll er gewesen sein; er war der Erste, der – nach Lateinschule und Gymnasium – studierte. Und ganz ohne Unterstützung von der Mühle wäre das wohl auch nicht gegangen, auch wenn die Mutter ihn lieber als »geistlichen Herrn« gesehen hätte.
In der Absicht, sich dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen, begab er sich im Oktober 1874 an die königliche Universität München. Doch bald erkannte er, dass dieses Studium ihm weniger zusagte als erwartet, und widmete sich nunmehr dem philologischen Studium.
Franz Seraph Poschenrieder, Curriculum Vitae
Er schreibt gewählt in dritter Person über sich; in Tante Maries Klartext heißt es über ihren Vater: Ein Semester hatte er einst Medizin studiert, doch hatte ihn die Tätigkeit in der Anatomie abgeschreckt. So nahe will er den Menschen nicht kommen, gewiss nicht unter die Haut und noch tiefer gehen. Dann doch lieber gefiltert und gesiebt durch das feine Gewebe klassischer Texte.
Franz Seraph hat in der höheren Schule und auf der Universität wohl kämpfen müssen. Die erhaltenen Zeugnisse weisen ihn nicht als Einserschüler aus. Seine Kinder waren da besser – die wurden aber auch in einen bildungsbewussten Haushalt hineingeboren.
Lehrer will er werden, Lehrer wird er. Ich denke, er hat die Sicherheit in der Laufbahn eines königlichen Beamten gesucht, geregeltes Vorrücken und soziale Anerkennung als »Herr Professor«. Er beginnt in Metten an der Donau als Assistent und bekommt eine Tochter, ersucht bald um Versetzung, erhält einen Posten in Bamberg, bittet mehrfach und schließlich erfolgreich um Versetzung nach Regensburg ans Alte Gymnasium, das er einst selbst besucht hat, worauf sich nach den, dynastisch betrachtet, unerheblichen Töchtern der erwünschte »Stammhalter« einstellt und, mit weitem Abstand, noch einer in Reserve. So rundet sich eine bildungsbürgerliche Biografie, die Geschichte eines Aufstiegs aus eigener Kraft, Fleiß und Disziplin. Frau, Familie, sicherer Job, ordentliche Kleidung, schöne Wohnung samt Dienstmädchen – läuft eigentlich. Es wundert mich nur, dass nicht ein einziges Foto dieses Familienidyll dokumentiert; so viele blieben übrig, aber keines, das die ganze Familie in ernster, stolzer Pose zeigt, so, wie man sich damals im Fotoatelier inszenieren ließ.
Und zupacken, wenn glückliche Gelegenheit aufzieht, das liegt Franz Seraph wohl nicht:
Inzwischen war auch das Haus, in dem wir wohnten, verkauft worden um den geringen Preis von 17000 Mark. Viele hatten Papa geraten, es doch zu erwerben; aber da fehlte ihm wieder der Mut. Er glaubte immer, dass ihm gelegentlich der Beförderung vom Gymnasiallehrer zum Gymnasialprofessor eine Versetzung in die Pfalz drohen würde.
Fehlte ihm wieder der Mut.1895 wurde er tatsächlich zum Gymnasialprofessor befördert – und blieb doch in Regensburg, an derselben Schule. Chance zum Hauskauf vertan. Als sorgsamer, äußerst gewissenhafter Lehrer wird er von seinen Vorgesetzten beurteilt; allenfalls mehr Frische und Lebendigkeit im Unterricht seien wünschenswert. In Metten und Bamberg hatte er zwei philosophische Abhandlungen verfasst; eine über die naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles und eine über die platonischen Dialoge nach ihrem Verhältnis zu den hippokratischen Schriften. Vielleicht liegt ihm das mehr als das Unterrichten, vielleicht strebt auch er insgeheim nach »Höherem«. In seinem Alltag hat er den Buben (es sind nur Buben auf dem Gymnasium) die lateinische Kasuslehre einzubläuen, die Welt der Fische und der Wirbellosen zu erklären, die Geschichte der Hohenstaufen aufzufächern und abzufragen, die Odyssee und die Ilias nahezubringen und überhaupt bei den Halbwüchsigen so etwas wie Bildung des Geistes und der Herzen zu produzieren. Und das nachprüfbar. Auch zwei seiner Neffen besuchen das Alte Gymnasium, allerdings mit mäßigem Erfolg. Der eine landete später bei der Post, der andere bei der Bahn. Marie weiß:
Für Papa war es natürlich peinlich, wenn da in den Konferenzen der Name Poschenrieder fiel und darüber abgestimmt wurde, ob man diesen Schüler würde aufrücken lassen können. »Wird doch hoffentlich mit Hermann einmal anders gehen«, sagte er öfters.
Bei den Schulfeiern seiner Kinder drückte er sich gern; für so etwas war er gar nicht zu haben. Lieber verbrachte Franz Seraph seine Zeit allein und still im Arbeitszimmer. Nach der Geburt des Jüngsten, als er seine Töchter am Bahnhof von einer Reise zurückerwartete, beobachtet Marie:
Da stand auch schon Papa. Es schien uns, als hätte er ein noch sorgenvolleres Gesicht als sonst. Nun war ja für vier zu sorgen, und er rechnete, gerade als wäre er von schlimmen Ahnungen gepeinigt, immer schon aus, ob wohl Mama die Pension und die Zinsen des kleinen Vermögens ausreichen würden, wenn ihm etwas zustoßen würde.
Besorgt, mutlos – und wie soll man gewinnende Bescheidenheit und schlichte Anspruchslosigkeit lesen? Formeln in Nachrufen und Zeugnissen haben oft doppelten Boden. Er war immer voller Zweifel und böser Ahnungen gewesen. Vielleicht hat auch ihn, den Müllersohn, die Weiße Frau besucht?
Es ist nämlich so: Um die Bruckdorfer Mühle geht seit je ein Gespenst herum – die Weiße Frau. Sie tut es übrigens noch heute: Ich habe verlässliche Berichte aus jüngster Zeit und keinen Anlass, diese anzuzweifeln. Auch die Tante Marie wusste natürlich Bescheid:
Ich erinnere mich einer Geschichte, die mir von Großmutter Leni erzählt wurde: Ihr kleiner Bruder war krank. Da stand nachts die Weiße Frau vor seinem Bette und sagte: »Komm mit mir hinüber zum Wald. Dort unter einem Felsen ruht ein Schatz, den du haben sollst, damit ich erlöst werde. Tust du es, wirst du glücklich werden. Tust du es nicht, wirst du niemals in deinem Leben Glück haben.« Er erschrak und verkroch sich unter seine Kissen. Sie aber meinte: »Fürchte dich doch nicht, ich bin es ja, deine Mutter. Ich kann erst dann wieder kommen, wenn das Holz eines Baumes so ist, dass man eine Wiege daraus schnitzen kann. Und erst das Kind, das in dieser Wiege liegt, kann mich erlösen.« Dann seufzte sie tief auf und verschwand. Den kleinen Jungen fand man am andern Tage fiebernd am Boden liegend, und es dauerte lange, bis er wieder auf sein konnte.
Die Weiße Frau soll übrigens noch länger in Bruckdorf ihr Unwesen getrieben haben. Jemand sah sie einmal im Altarzimmer knien. Das war ein Zimmer mit Hausaltar und Kniebänken, und oft wurde dort der Rosenkranz gebetet. Dort waren auch die vergilbten alten Legendenhefte, in denen ich mit Vorliebe las, wenn ich längere Zeit in Bruckdorf zu Besuch weilte. Durch den Umbau der Mühle verschwand das Zimmer.
Die Weiße Frau ist keine böse Fee. Sie lässt allerdings jene, die sie besucht, oft ratlos zurück. Das muss man ihr vorwerfen. Wahrscheinlich will sie zum Nachdenken anregen. Den Schatz unter dem Felsen hat übrigens noch keiner aus der Familie geborgen. Oder doch, und nichts gesagt.
Margarete, die Abenteurerin
Mit 17 Jahren war Margarete so weit fortgeschritten, dass sie das französische Examen mit der Hauptnote 1, auch das Deutsche Staatsexamen mit 1 bestehen konnte. Sie wollte aber, da ihr nun der Weg in die Zukunft offen stand, sich noch nicht an einer Schule anstellen lassen, ging deshalb an die Regierung und erläuterte ihnen dort, dass sie vorerst etwas von der Welt sehen wollte und deshalb eine Stellung bei ungarischen Aristokraten annehmen würde.
Hedwigs und Maries Mutter ist wie zwei Personen: die junge Margarete und die alte Margarete, und es ist nicht einfach, diese beiden Personen zur Deckung zu bringen. Die junge Margarete ist ein bisschen so, wie Hedwig einmal sein wird, munter, lebendig, musikalisch. Die alte – sehr anders, wie man sehen wird. Margarete singt gern. Sie würde, wenn sie könnte, Sängerin werden. Ihr Vater heißt Josef Staudigl. Den gleichen Namen trägt ein damals berühmter österreichischer Opernsänger, und das gibt dem Lokomotivführer Josef Staudigl die Idee ein, seine Tochter, die über ein gutes Gehör und eine hübsche Stimme verfügt, als Sängerin ausbilden zu lassen. Deshalb sei ihr auch das Essen von Nüssen streng untersagt worden, damit ihre Stimme schön rein und klar bliebe, sagt Marie. Aber der Nussverzicht nützt nicht:
Allüberall in Nürnberg war infolge des schlechten Trinkwassers der Typhus ausgebrochen, und der Tod hielt reiche Ernte. Auch in der Familie Staudigl waren nacheinander Großmutter, Mutter und Tochter erkrankt. Zuletzt musste auch der Vater noch daran glauben. Während die kaum Genesenen noch müde und matt umherschlichen, packte ihn das Fieber am ärgsten. Als man endlich glaubte, auch bei ihm wäre die Gefahr vorüber, erhielt er Besuch von Kollegen, welche kurz zuvor von der Seuche genesen waren. Und die verleiteten den noch Fiebernden zum Kartenspiel. Der Kranke sehnte sich nach Zerstreuung und spielte, spielte, bis das Fieber neuerdings stieg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember 1868, schloss Vater Josef Staudigl seine Augen für immer.
Mit Margaretes geplanter Sängerinnenlaufbahn war es ein für alle Mal zu Ende. Sie sollte Lehrerin werden.
Die drei Frauen packen ihre Habe zusammen und ziehen nach Regensburg; dort leben Verwandte, ein kleines Spezereiwarengeschäft wirft dürftigen Ertrag ab, doch immerhin. Margarete geht brav zur Schule, lernt Englisch und Französisch, unterrichtet Anfängerinnen im Klavierspiel, besteht die Examina und ist mit 17 Jahren so weit, ihre Heimat zu verlassen.
Die Anstellung als Französisch- und Deutschlehrerin bei dem ungarischen Baron, der mit seiner Familie in der Nähe von Fünfkirchen – heute Pécs – lebt, kommt auf Empfehlung einer Regensburger Bekannten zustande. Margarete wird fast zwei Jahre dort zubringen. Sie versucht dem kleinen Baron Joschi das Klavierspiel und der elfjährigen, arg verzogenen Fanny Manieren beizubringen, muss die Annäherungsversuche des Gärtners abwehren, der sie mit Veilchensträußen beglückt, sie verherrlicht mit ihrer schönen Altstimme die musikalischen Gesellschaftsfeste und findet überall volle Anerkennung.
Daheim, in Regensburg-Steinweg, hat die Mutter inzwischen einen Untermieter aufgenommen, einen Herrn Sauer. Der verliebt sich in das Bildnis Margaretes, das in seinem Zimmer hängt, und bittet um Erlaubnis, ihr schreiben zu dürfen.
Margarete war jung und romantisch veranlagt. Sie willigte ein, und so entstand zwischen beiden, die einander noch nie gesehen hatten, sich nur per Beschreibung der Mutter kannten, eine rege Korrespondenz. Margarete umgab in all ihren Träumen den unbekannten, scheinbar Geliebten mit all den Eigenschaften, die sich ein junges Mädchen wünscht und die er aber in Wirklichkeit gar nicht besaß. Da sie ohnehin vorhatte, zur Verbesserung ihrer französischen Aussprache eine Zeit nach Paris zu gehen, nahm sie das als Vorwand, als sie dem sehr überraschten Baron ihren Entschluss mitteilte. Alles war darob sehr schmerzlich berührt, auch Fanny und Joschi, ihre Zöglinge, die ihr zum Abschied ein Musikalienheft überreichten mit schönen Volksliedern und Stücken. Wie oft sind daraus Lieder gesungen worden, auch als unser Vater noch lebte, der bei dem Bübchen wirst du ein Rekrut leise mitsummte, auch bei Mädle, ruck ruck ruck an meine grüne Seite.
Ums kurz zu machen, mit dem Herrn Sauer leibhaftig lief es ganz und gar nicht. Seine wohlhabende Familie behandelte die mittellose Margarete herablassend, und Sauer selbst war auch nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Er war zwar nach wie vor heftig verliebt, Margarete nahm dennoch Reißaus. Über eine Stellenvermittlerin in Wien, Madame Stein, erhielt sie kein Angebot für Paris, dafür eins von einem vornehmen Haus in Budapest, und schon nach wenigen Tagen saß sie im Schnellzug nach Wien, von frohen Hoffnungen erfüllt.
Auch aus Budapest wurde nichts; die Stelle war inzwischen anderweitig vergeben worden.
Madame Stein tröstete die Enttäuschte, dass ja ständig Stellen gemeldet würden. Sie könne bis zum Entscheid bei ihr nicht zu teuer wohnen und essen. Nach einigen Tagen stellte sie ihr einen Herrn vor, der zu seinen drei mutterlosen Kindern eine Erzieherin suchte. Unsere Mutter unterhielt sich einige Zeit mit dem besagten Herrn, wobei sich dieser große Vertraulichkeiten erlaubte. Sie erklärte ihm gleich klipp und klar, dass die Stelle in seinem Haus nicht für sie infrage käme. Und zu Madame Stein sagte sie entrüstet: »Wie können Sie sich unterstehen, mir eine derartige Stelle anzubieten! Ich habe sofort erfasst, was dieser Herr neben der Erzieherin noch sucht!« Da lächelte Madame Stein und meinte, sie habe eine Menge Fotografien von Damen, die nur in einen frauenlosen Haushalt gehen würden. »Aber ich will nicht zu jenen gehören«, meinte Margarete. Es war eine üble Situation, da ihre Ersparnisse mit jedem Tag zusammenschmolzen.
Da zieht Madame Stein einen neuen Kandidaten hervor: den podolischen Gutsbesitzer Paul Resnikoff, Vater von sechs Kindern. Podolien? Das muss Margarete erst einmal im Atlas nachschlagen – ein Landstrich im Generalgouvernement Kiew, und das Gut liegt nahe der Stadt Proskurow, die heute Chmelnyzkyj heißt, an der Bahnlinie Lemberg – Odessa. Die Gegend sei sehr reizvoll, sie würde sich bestimmt wohlfühlen. Er bot dann auch ein gutes Honorar. Bei dieser Geschichte kommt Tante Marie richtig in Schreibschwung:
Margarete besann sich nicht lange. Sie hatte das Gefühl, dass sie dort würde geborgen sein. In zwei Tagen würden sie abreisen. Zuvor machte Herr Resnikoff noch Einkäufe, und dann wollte er auch noch das Theater besuchen. In der Oper wurde gerade Norma mit sehr guter Besetzung gegeben. Madame Stein bestand aber darauf, dass sie die Pflicht habe, als Garde mitzugehen; wie war sie auf einmal so gewissenhaft geworden! So besorgte Herr R. eben 3 Karten. Die Aufführung war glänzend und bildete einen schönen Abschluss des Wiener Aufenthalts.