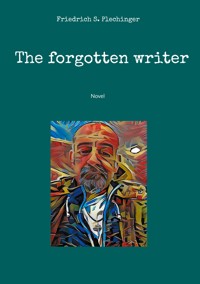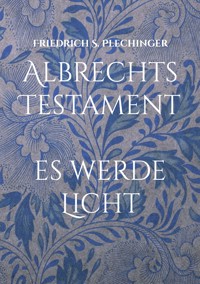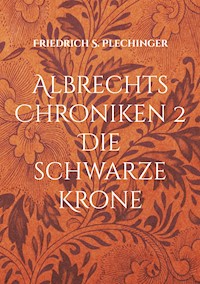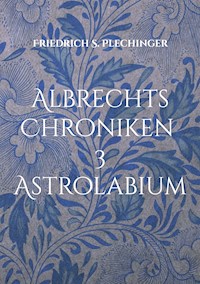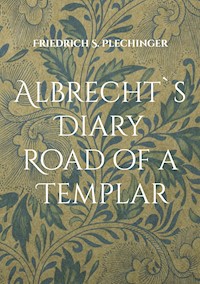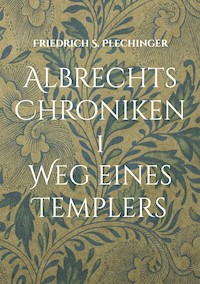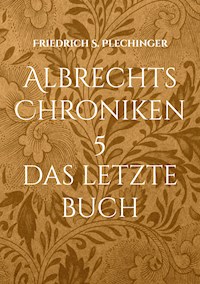Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fred der Flieger ist meine Geschichte. Eine Fliegerlebensgeschichte und zwar die Meine. Viele werden es nicht glauben, andere (besonders die, die mich Jahre lang kannten) werden geschockt sein und dann gibt es diejenigen, die ähnliches erlebt haben, aber nicht darüber sprechen wollen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und ich tue es um zu zeigen, das ich nichts vergessen habe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 869
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung § Vorwort
Es war einmal in Benghazi
Adieu Malta, hallo Deutschland
Der Anfang in der Fliegerei...
Die ersten Enttäuschungen des Lebens
Wehrdienst
Decimomannu 1980
Das Leben auf der „Base“
Der erste Motorenflug
Der zweite Flug und die folgenden
Urlaub und Tod
Auf nach Kanada
Bonnie O`Connor
Fliegen, Fliegen, Fliegen
Ende der Ausbildung
Adieu Kanada, hallo Libyen
Der Oberst
Von der Alb nach Texas
Cameroun
Mein erster Flug in Cameroun und ein Pfarrer aus ..
Freiheit und Gefahren
Herr Breuer
Afrikanische Erleuchtung
Die Deutsche Botschaft in Yaunde
Der Putsch
Veränderung
Albert Gonzales
Menschen und anderes
Gonzales ist verschwunden
Die Wende
Die andere German Wings
DLT
London Heathrow und zurück
LTU
Das Ende und dessen Folgen
The Winter Group
Die Wste hat mich wieder
Larry ist tot
Ende der „The Winter Group“
B737 BBJ
Es ist nicht alles Gold was glänzt
Westmount Investment LTD
Fliegerei der anderen Art
11. September 2001
Das Ende der Westmount LTD
Atlas Air und die B747
Training in Miami
Fliegen für die Amis
Ein Roboter wird Mensch
Madrid, Havanna und ein Hurricane namens Katrina
Der Wecshel nach Korea
Korean Air
Kingdom Hoding und Prinz Whaleed
Umzug nach Riyadh
Die Weltumrundung
Monate ohne Arbeit
Willkommen in Istanbul
Die Zeit nach ACT
SWW und das Ende meiner fliegereischen Laufbahn
Widmung und Vorwort:
An allen Lesern, die mich schon aus den Büchern der Albrechts Chroniken Saga kennen und all denen die folgen werden, sage ich ein herzliches Willkommen in meine Welt, die alles andere als langweilig war.
Auch danke ich meinen Eltern, mögen sie in Frieden ruhen, die es mit mir nich immer leicht hatten.
Besonders gilt mein Dank meiner Familie, die mich angespornt hat, dieses Buch über mein Fliegerleben, zu schreiben, obwohl ich es nicht wirklich wollte, da es zu bewegt und zum Teil auch unglaublich bizarre in manchen Situationen war. Vielen wird es als ein Märchen oder eine Fabel erscheinen, anderen als die persönliche „Vendetta“ eines alten Mannes. Es ist was es ist. Meine Fliegerlebensgeschichte. Manche werden es nicht glauben und andere, besonders die, die mich jahrelang kennen, werden geschockt sein und vielleicht anders über mich denken. Und dann gibt es diejenigen, die ähnliches erlebt haben, aber nicht darüber sprechen wollen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und ich tue es, um zu sagen, daß ich nichts vergessen habe.
Euer
Friedrich S. Plechinger
PS: In manchen Fällen werden die Nachnamen nicht erwähnt
Es war einmal in Benghazi.....
Die Uhrzeit meiner Geburt kenne ich nicht, nur das Datum.
Am dritten Oktober des Jahres 1958 kam ich, in Benghazi (Libyen), als Sohn des Elektrotechnikers Josef Plechinger und Hausfrau Julia Plechinger, ( geborene Duani ), zur Welt.
Warum gerade dort, fragt sich manch einer. Der Sprößling eines deutschen Vaters und einer Sizilianischen Mutter, dürfte normalerweise das Licht der Welt in eine zivilisierteren Welt, wie Europa, erblicken sollen, doch das Wort „zivilisiert“ ist für mich schon eine Diskriminierung an sich. Dazu später eventuell.
Der Grund meiner nordafrikanischen Geburt beruht auf die Tatsache, das Vater im zweiten Weltkrieg ein Soldat des berühmten Afrika Korps war und dem Befehl des Generalfeldmarshall Erwin Rommel unterstand. Seiner Erzählung nach, war er in einer Panzereinheit eingewiesen worden und schon ein Kind Rommels im Frankreichfeldzug gewesen. Nun, wir kennen alle, wie diese Geschichte am Ende ausging, denn Viele kehrten nicht nach Deutschland zurück.
Egal wo man gekämpft hatte, ob in der Ost- oder Westfront, oder wie im Falle meines Vaters in Nordafrika, die meisten fielen auf dem Felde und die, die das Glück hatten als Kriegsgefangene in ein Gefangenenlager zu landen und ein Ende dieser Tortur entgegenfreuen zu dürfen, hatten es nach dem Krieg sehr schwer wieder Fuß in der alten Heimat zu fassen. Viele entschieden sich dort ein Neuanfang zu gründen, wo sie eben in Gefangenschaft gerieten, wenn es nicht gerade Sibirien war. Mein Vater hatte Glück. In Tobruk wurde er von den Engländern gut behandelt, denn dort wurde er, nach den Einsätzen in El Alamein als POW (Prisoner of War) einquartiert. Viele deutsche und italienische Kriegsgefangene mussten nach dem Krieg einen Entschluß fassen, wo ihre Zukunft nach der Gefangenschaft für sie lag. Vater entschied in Libyen zu bleiben, warum, konnte er es mir selbst bis zu seinem Tod nicht sagen und wenn er es mir hätte sagen können, so entschied er sich dieses Geheimnis mit im Grabe zu nehmen.
So fand er Arbeit bei seinen exfeinden, den Engländern, und durfte Fernmelde- und Funkgeräte am Flughafen von Benghazi (Benina), instandsetzen. Damals nannte er sich noch Radiomechaniker soviel ich weiß und irgendwann lernte er meine Mutter kennen. Eine dort geborene und von einer zugewanderten sizilianischen Familie stammend. Libyen war einst eine italienische Kolonie.
Sie lernten sich in einem Schuhgeschäft kennen, wo meine Mutter als Verkäuferin arbeitete. Ich kann mich noch an ihr Lächeln erinnern, wenn sie mir diese, ihr so wertvolle, Geschichte erzählte. Lustig und romantisch zugleich. Mein Vater war nicht gerade ein Adonis und mit einer Körpergröße von 1,64m passte er natürlich hervorragend in einem Panzer rein. Meine Mutter dagegen war eine Schönheit. 1,78m lang, sehr schlank und glich mehr einer Rita Hayworth. Doch sie war nichtsdestotrotz eine sehr bodenständige und bescheidene Frau. Sie erzählte mir wie Vater einst das Geschäft betrat und ein paar Sandalen kaufen wollte. Da sei es um ihm geschehen. Er kam danach regelmäßig und kaufte irgendwelche Sachen wie Schnürsenkel und Socken ein, nur um sie wieder zu sehen. So kamen sie zusammen und ihre Liebesgeschichte began. Laut meiner Mutter war es nicht ohne Schwierigkeiten diese Beziehung allzulang geheim zu halten, denn ihre Famile durfte davon nichts wissen. Warum?
Erstens weil sie Sizilianer waren und nur das Familienoberhaupt entscheidet wem die Tochter als Ehefrau zu genehmigen sei und zum zweiten, was viel mehr einen vernichtenden Keil zwischen Mutters und Vaters Vorhaben hätte treiben sollen, war die Tatsache, daß sie, Mutter, keine Christin war. Sie war Jüdin. Mutter stammte aus einer alt sizilianischen, jüdischen Familie ab, doch wenn das nicht genug gewesen wäre, sie, Mutter, wollte mit einem Deutschen zusammenleben. Auch noch Einen, der aus der einstigen Wehrmacht stammte, nach alldem was in den Konzentrationslagern während des Hitler Regimes oben in der „zivilisierten“ Welt, geschah. Die Familie mütterlicherseits, verbat Mutter meinen Vater wiederzutreffen, doch Mutter ließ sich nicht davon abbringen und wollte ihren Josef haben.
Den kleinwüchsigen Deutschen, der anscheinend ihr Herz, mit seinen Annäherungsversuchen, erobert hatte. Das war und ist heute noch für mich schwer vorzustellen, wie Vater dieses hätte anstellen können, denn ich kannte ihn als scheuen, ruhigen und in sich eingekehrten Menschen und nicht als einen Romeo und romantischen Don Juan. Doch wie gesagt, sie hatten es beide schwer und letztenendlich wurde Mutter aus der jüdischen Familie ausgestoßen. Sie konvertierte zum Katholizismus und verstieß gegen alle Regeln, denen sie seit ihrer Kindheit unterstand. Die Liebe war am Ende stärker als jeder Glaube oder Religion und ich hätte es ihr nicht verübelt, wenn sie nicht einmal dem Christentum beigetreten wäre, denn jede Religion ist in meinen Auge eine Manipulation des menschlichen Bewußtseins, daß einem mit Ketten belegt und jeglichen geistigen Wachstum behindert und einengt. Doch, um gesellschaftsfähig zu bleiben und nicht weiter unangenehm aufzufallen, entschied sie sich für diesen Weg, den sie auch loyal und treu ging. Daß sie eine Jüdin war, erfuhren meine Schwester und ich nur wenige Jahre vor ihrem Tod. Anscheinend wollte sie diese Welt eines Tages nicht mit diesem Geheimnis verlassen. Wir waren beide zutiefst schockiert als wir diese Bekenntniß von ihr erfuhren.
Jahrelang dachten wir, sie stammte aus einer alten christlichen und katholischen Familie ab. Der Schock saß tief, nicht weil sie eine Jüdin war, vielmehr darüber, was sie damals erleben und erleiden mußte und all die Jahre danach, denn sie vermisste ihre Familienangehörigen sehr. Wir liebten unsere Mutter umso mehr, denn sie lehrte uns, daß am Ende nur ein freier Geist die Türen zum Glück öffnete und wahre Liebe kein Platz für Dogmen und geistlichen Hokus Pokus hatte.
Ich schweife aus und bin jetzt etwas aus dem Weg gekommen. Verzeiht.
Vater und Mutter heirateten also in Benghazi im Jahre 1954 und es dauerte nochmals vier Jahre, bis sie einen weiteren „Sünder“ auf die Welt brachten. „Mich“.
Man entschied sich für den Namen Friedrich Severin Plechinger und gleich danach wurde mir die Deutsche Staatszugehörigkeit vom deutschen Konsulat, väterlicherseits bedingt, zugeteilt. Zwei Jahre später kam meine Schwester, Susanne, zur Welt.
Meine Eltern hatten eine Zeit lang, eine Villa in der Nähe des Flughafens Benina, bezogen. Ein großer Obstgarten, worauf Orangen-, Oliven- und Pfirsischbäumen wuchsen, umgaben den Ort mit einem unverkennbarem Duft, daß mir heute noch, als 63 Jähriger, unter der Nase hängt. Der kühle Morgentau, der den Sandboden Libyens befeuchtete, bevor die Mittagssonne es erbarmungslos austrocknete, brachte Wildblumen hervor, die schöner nicht sein konnten, besonders in den Monaten von November bis May. Danach wurde alles von der heißen Sonne „verbrannt“.
Viel Wasser wurde für die Bäume benötigt doch die Mühen lohnten sich, denn die Früchte, die geerntet wurden waren schmackhaft und saftig und waren vor allen Dingen ungespritzt. So unförmig und teilweise unschön sie waren, so stellten sie alles geschmacklich in den Schatten, was wir heute in den Supermärkten vorfinden. Vater hatte einen Land Rover von seinem Arbeitgeber als Dienstfahrzeug zugeteilt bekommen. Einen mit kurzem Radstand (88) und dieses Fahrzeug werde ich nie vergessen, denn es war mit schwarzen und orangenen Quadraten, wie die Flagge eines Follow Me Cars, oder eines Schachbretts, lackiert. Als Kind kam mir dieses Jeep ähnliche Gefährt riesig vor. Kein Sicherheitsgurt, keine Plane und kein Spriegel und alles offen, da sonst die Mittagshitze es zur einer Sauna verwandeln konnte. Wenn ich Vater auf seinen Dienstfahrten in die Wüste begleiten durfte, wo er die Anflgugfunkfeuer und Bodennavigatonsanlagen (NDB und VOR) wartete, so wurde ich, wie ein Spielball, auf der Sitzbank hin und her geworfen. Ich hielt mich fest wo ich nur konnte, denn es gab keine Teerstraßen in der Wüste, die zu den Navigationsanlagen führten, sondern nur aus Sand und Steinen bestehenden Pfaden. Ein Land Rover schaffte diese Hürden ohne Probleme.
„Hebe blos keine Steine hoch und setze dich nicht auf dem Boden hin...“ sagte mir mein Vater immer, denn der ganze Erdreich war mit Schlangen und Skorpionen verseucht. Eines tages hörte ich nicht auf seinen Rat und neugierig wie ein Kinden eben mal ist, hob ich einen etwas größeren Stein hoch. Wie alt war ich? Wahrscheinlich 4 oder 5, keine Ahnung. Ich hörte nur ein Zischen sah aber nichts. Alles auf dem Boden sah gleich aus und hatte die selbe Farbe und nur dieses häßliche und bedrohliche Zischen hinterließ in meinen Bewußtsein einen „ OH, OH,.....!“ Sekunden später schlug mein Vater mit einem aus dem Land Rover ergriffenen Spaten heftig auf dem Boden drauf und dann sah ich es auch, als Blut und Fleischteile in die Luft aufspritzten. Das Zischen verschwand und nur die Grillen und Heuschrecken dieser glühenden Wüste zirpsten weiter. Es war eine Sandwiper. Die Ohrfeige folgte und mit besorgten und ermahnenden Beschimpfungen wurde ich gesegnet. Das war auch das einzige und letzte mal, daß mein Vater seine Hand an mir anlegte, denn ich befolgte seitdem seinen Rat. Zumindest bis zur pubärteren Phase, die mir selbst als unheimlich und irrational erschien. Die Wüste, so schön und mysteriös sie auch ist und nur den Würdigen sie ihre Geheimnisse zuließ, verbarg ebenso Gefahren. Nicht nur das Tierreich sondern auch die Natur konnte zur tödlichen Falle werden, kannte man sich mit den Regeln und Gesetzen der Wüste nicht aus.
Der erwähnte Spaten zum Beispiel, sowie als auch die flachen und gelöcherten Alluminiumplanen, die ebenso and den Seiten des Land Rovers angebracht waren, falls man im Sand stecken blieb, gehörten zum sogenannten Desert Survival Kit.
Zwei 20 Liter Kanister waren ebenfalls am Wagen angebracht.
Ein grünes, gefüllt mit Spritt und ein weißes gefüllt mit Wasser. Der Ersatzreifen war auf der Motorhaube angebracht. Diese waren einige meiner Erlebnisse, die meine Erinnerungen nie verließen. Mein Vater war für mich ein sehr liebe- und verständnisvoller Mentor und nur zu oft durfte ich ihn an diesen Dienstfahrten begleiten und keine zehn Pferde hielten mich davor zurück, denn alles was er tat, bestand aus Abenteuer. Handwerklich war er ein Phänomen. Aus Blechteilen konnte er Behälter und vieles anderers herstellen.
Die Villa, die wir bewohnten, unterhielt ebenso eine Werkstatt, die er einrichtete um Sachen zu reparieren, die in den dort herschenden, harten Bedingungen, sei es durch Überhitzung oder durch den Sand, der in jede Ritze und in jede undichte Stelle eindrang, kaputt gingen . Stur befolgte er die in seiner Kindheit auferlegten, Regeln.
„Ist es kaputt, so repariere es. Was du geliehen oder geborgt hast, gibts du auch zurück. Was dich nicht betrifft, geht auch dich nichts an. Fragt einer nach deiner Hilfe, so helfe auch.
Was du anfängst, führst du auch zu ende. Fünf Minuten zu früh, ist schon fast zu spät. Dein Bestes ist niemals gut genug...usw.!“ Alte Schule eben. Ich kann mich ebenso noch sehr gut erinnern wie Menschen aus der Umgebung, meistens Libyer, mit Bügelesisen, Kühlschränken, Elektroöfen, Radios und vieles mehr, bei ihm erschienen.
„Yusef, kannst mir bitte dies oder das reparieren?“ Sie nannten ihn Yusef el Almani. Josef der Deutsche. Mein Vater reparierte ihnen alles und die, die nicht bezahlen konnten, brachten Eier, Hühner oder Gemüse aus ihren Gärten mit, denn bezahlen war für diese Menschen Ehrensache. Wenn mein Vater eine Bezahlung ablehnte, so wurde dies ebenso abgelehnt, den es wäre für sie beschämend gewesen eine Leistung zu bekommen ohne dafür einen Lohn aufzubringen.
Sie waren stolze und ehrenvolle Menschen und eine tiefe, ehrliche und langhaltende Freundschaft entstand. Leute vom Militär, Händler, Bauern, Nomaden, Reiche, Arme und sehr Arme, gingen bei uns ein und aus. Die Tür stand immer für Jeden offen und nie hatte man die Befürchtung, das etwas fehlen oder gestohlen wurde. Menschlichkeit bestand und man spürte sie täglich in diesen Zeiten.
Ich erwähnte vorhin den fruchtigen Duft des Gartens. Dieser vermischte sich aber ebenso mit dem Duft des Lötzinns und des verbrannten Öl, der aus der Werkstatt meines Vaters entwich, wenn er sich ebenso an Naftamotoren (Diesel) ranmachte, damit diese wieder reibungslos liefen.
Meine Mutter hingegen unterschied sich wie folgt. Eine temperamentvolle Sizilianerin, die ihre Kinder abgöttisch liebte und es zuließ, wenn wir neugierig neben ihr in der Küche standen und sie bei der Zubereitung ihrer traditionellen Gerichte beobachteten. Alles kam frisch auf dem Tisch. Raviolis, Canellonis, Gnocchis, Fisch- sowie Fleischgerichte wurden von Hand zubereitet. Der Teig für die Pasta wurde von Hand hergestellt und die Tomaten, sowie die Zweibeln, der Knoblauch und die Kräuter kamen vom Garten.
Sie züchtete Hühner, Truthähne, Tauben und Hasen und die Schlachtung der Bedauernswerten wurde nur von ihr ausgeführt. Wenn es Fisch gab, dann fuhr mein Vater sie zum Fischmarkt und dies geschah von sechs Uhr morgens bis um zwölf Mittags. Danach war der Fischmarkt nur für Großhändler geöffnet. Direkt am Hafen von Benghazi befand sich dieser und meistens an einem Freitags gab es Fisch bei uns zu essen, wie es sich für gute Katholiken gehörte. Auch sie bekam regelmäßigen Besuch aus der Umgebung, meistens Frauen aus italienischen Familien, die mit ihren Kinder für reichlich Tumult sorgten. Am Abend und nach getaner Arbeit, wurde draußen gegessen und getrunken und das Towowaboho ging bis tief in die Nachtstunden hinein. Wir Kinder wurden erst zu Bett gebracht, wenn wir von selbst einschliefen, denn bei der Hitze konnte man um acht nicht zu Bette gehen. Meistens wurden wir so kurz vor Mitternacht dann zu Bett gebracht. So verlief das Leben auf der Villa.
Eines Tages kam mein Vater zu mir und frug mich, ob ich Lust hätte mit einem Flugzeug der dort betriebenen Linie „Linair“ nach Kufra mitzufliegen. Er, Vater, hat dort irgend ein Funkfeuer zu reparieren und dafür müßte er für zwei Tage tief in den südlichen Teil der Wüßte gelangen. Mit dem Land Rover würde das Tage dauern und sollte der Wagen eine Panne erfahren, wäre das zu gefährlich. Natürlich sagte ich begeisternd zu und so packte Mutter uns ein paar Brote, eine Termoskanne Nescafe und zwei Flaschen Mirinda, sowie selbstgebackenen Kekse für den nächsten Tag ein. Ich schaute sie belustigt an und sagte ihr, daß wir bestimmt im Flieger durch die reizenden Stewardessen etwas zu essen bekämen.
Sie lächelte nur und strich mir über den Kopf. Verwundert ging ich zu Bett und versuchte zu schlafen, doch ich konnte es nicht, denn Reisefieber befiel mich. Am sehr frühen Morgen, fuhren wir mit dem Land Rover, die sehr kurze Strecke zu einem aus Wellblech gezimmerten Hangar und ein großes Schild begrüßte uns mit den Worten „Linair Services Libya“.
Vater parkte den Land Rover außerhalb des Hangars und zwei Libyer halfen uns mit dem Gepäck und dem Werkzeugkasten.
Wir liefen durch den Hangar durch und ein penetranter Geruch bestehend aus Benzin, Öl und Maschinenfett ohrfeigte meine kindlich, empfindlichen Sinne. Doch ich verstummte und mein Kinn fiel zu Boden, als ich zum ersten mal so nah an einer diesen unheimlichen, fliegenden Monster stand und es mit der kleinen Hand am Rad anfassen konnte.
„Fass nichts an Freddy...!“ schrie mein Vater gleich, doch ich bekam den Mund nicht zu, denn dieser Vogel, häßlich und schön zugleich, hatte mich in seinem Bann. Schon oft sah ich diese Ungeheuer von weitem auf der Rampe stehen, denn wie gesagt, wir wohnten um die Ecke, doch niemals stand ich einer so nah. Mechaniker machten sich an einer der Double Wasp Pratt & Whittneys Sternmotoren ran (Damals kannte ich die Typenbezeichnung natürlcih nicht) und ein metallisches Klirren und Scheppern erhallte echohaft durch die Halle. Der Boden war durch den nicht weggewischten Motorenöl, rutschig und zu diser Zeit gab es keine gewerkschaftlich geregelten Sicherheitsbestimmungen und ganz gewiß nicht in good old Libya. Doch man war sich den Gefahren bewußter und irgendwie habe ich den Eindruck, daß der Mensch früher geistig besser mit bestimmten Situationen umgehen konnte. Nur so ein Eindruk. Jedenfalls stand ich da und frug einen der Mechaniker, frech und unbefangen wie ich war, auf english, was das für ein Flugzeug sei. „It`s a DC 3 my boy!” bekam ich kurz und bündig.
Aggresiv wie ein auf mich blickender Adler, schaute mich dieses Flugzeug an und ich verliebte mich sofort. Als Kind erschien mir die DC 3 wie ein riesiger Vogel und ihr rauer Design konnte nur zwei Eindrücke bei Jemanden hinterlassen.
Entweder man vergötterte sie oder man verachtete sie. Ein Zwischending existierte nicht.
“Weiter gehts mein Sohn, unsere Maschine steht draußen.”
So packte mein Vater mich bei der Hand und wir liefen zur einer anderen, vor der Halle stehenden DC 3. Männer mit allerlei Gepäck und ebenso einheimische Nomaden aus den fernen Süden, die einem an Tuaregs erinnerten ( Die Tuaregs gibt es auch in Libyen, jedoch weiter südwestlich des Landes mehr an der Algerischen Grenze), warteten in Reih und Glied.
Ein Mann näherte uns und frug: “Good morning. Are you Joseph Plechinger?” “Yes I am.” Bekam er als Antwort zurück, und da anscheinend die Reparatur der Anlage in Kufra so wichtig war, durften wir als erste einsteigen. Über eine kleine Aluminiumleiter bestiegen wir, durch die am Heck angebrachte Frachttür, das Flugzeug. Ich weiß nicht mehr genau, was ich dabei gefühlt haben musste, als ich den Inneraum zu erstenmal sah, das unisoliert aus Blech und Nieten bestand. Besondrs fielen mir die Stahlseile auf, die über kleine Rollen dem Rumpf entlang angebracht waren.
Ohne Zweifel verfiel ich dieser metallischen, nach Schmierstoff- und Benzinriechenden Welt, denn dieses Bild habe ich heute noch als 63 jähriger, wo ich diese Zeilen schreibe, vor mir. Vater zog mich zu den vordersten Teil der Kabine, gleich an dem Eingang des Cockpits, wo wir auf, einer aus grünem Zeltstoff beplankten Bank, Platz nahmen. Danach stiegen weitere Passagiere ein und zum Schluß schob man die Fracht hinein, daß aus was weiß ich bestand. “Fracht für die Ölfelder”, sagte Vater nur und packte schon mal den Nescafe und zwei Butterbrote aus der Tasche aus, doch ich konnte nichts essen. Wie versteinert blickte ich in den Cockpit rein und erkannte den Mann, der meinen Vater draußen ansprach und der am linken Sitz nun saß. Er war also der Pilot. Neben ihn saß ein weiterer. Der Copilot. Beide Belgier erfuhr ich später.
Meine geographischen Kentinssen reichten zu der Zeit nicht aus, um zu erahnen wo Belgien überhaupt lag, aber was solls.
Für mich wurden diese zwei menschlische Gestallten an diesem Tag zu wahrhaftigen Götter. Plötzlich ein Knall und ein Pfiff und ich erschrak, als einer der Motoren, ohne Vorwarnung, angelassen wurde. Kurze Zeit später der Zweite.
Schnell schnallte mich “Pappi” an und schon rollte die DC 3.
Der englishe Funkspruch aus dem Cockpit erklang krachend und kreischend aus dem Lautsprecher und eine neue, mystische Welt offenbarte sich in meiner kindlichen Unschuld und das mit spätreichenden Folgen. Eine Hand greifte nach den Hebeln die nach vorn geschoben wurden. Die Bestie began schneller und schneller zu werden und ihr stählerner Hintern erhob sich vom Boden. Es wurde so laut, daß ich mich mit beiden Händen die Ohren zuhielt. Endlich erhob sich das Flugzeug und nach tiefrgreifender Observierung meinerseits, wurden mehrere weitere Hebel vorne im Cockpit betätigt.
Metallisch- und elektrisch klingende Geräusche gaben zu verstehen, daß das Fahrwerk nun eingefahren wurde und das die Landeklappen ebenso in die dafür bestimmte Position gebracht wurden. Ein Kauderwelsch aus Funksprüchen erhallte durch den Raum und ich befand mich in einer wunderbaren, neuen Welt. Hier und dort erinnerte uns eine Windböhe oder erhitzte aufsteigende Bodenluft, daß es auch turbulent auf einer Flugreise zugehen kann und schnell trank Vater seinen noch brühend, heißen Kaffe aus, daß in seiner Blechtasse hin und her schwappte. Nach einer Weile wurde es ruhiger und leiser und nun endlich verzehrte auch ich einen der von Mutter eingepackten Brote. Wie lange würde der Flug dauern? Nach einer Stunde plötzlich sagte uns der Pilot, daß man auf einem Ölfeld landen würde um Fracht abzuladen und um Sprit aufztanken. Ich erinnere mich heute nicht mehr and den Namen des Feldes, denn es war kein regulärer Landeplatz und so wurden wieder zig Hebel betätigt doch der Funk blieb aus. Hier hatte man keinen mit dem man Funken konnte und so landete die DC 3 kurze Zeit später auf einer Sandpiste auf. Männer stiegen aus und andere stiegen ein und auch wir gönnten uns eine Pinkelpause während des Tankens. “Heb keine Steine hoch und pinkle nicht in den Büschen!” sagten die ermahnenden Worte des Vaters.
Bohrtürme ragten empor und suchten nach dem schwarzem Gold im Erdreich. Es roch nach Teer und Öl und Metallfässer belagerten das Feld soweit das Auge reichte. Kurze Zeit später ging der Spektakel weiter und wir befanden uns wieder in der Luft. Als der Pilot bemerkte, daß ich neugierig ins Cockpit schaute, winkte er mich zu. Ich sollte zu ihm kommen und Vater genehmigte es. Wie ich den hieße frug mich der Pilot.
Ich nannte ihn meinen Namen und es dauerte nicht lange, bis das Eis gebrochen wurde und ich ihm mit Fragen bombardierte. Wozu ist dies und was macht das ect, ect, ect…bis er es dann satt hatte, mich mit beiden Händen Packte und mich auf seinem Schoß sitzen ließ. Ich soll das Steuer anfassen sagte er. Keine Ahnung was mir damals in diesem Augenblick durch den Kopf ging, denn ich tat es, so als ob eine göttliche Weisung mich dazu bewegte. Irgend etwas geschah dann, den ich mußte mir seitdem einen Virus eingefangen haben. Den Fliegervirus.
Er, der Pilot, hielt natürlich meine kleinen Händchen fest und half mir beim Steuern dieses Ungetüms und ein Lächeln, daß ich für Wochen nicht mehr aus dem Gesicht bekam, würde mich seitdem begleiten. Seit diesem Augenblick stand für mich fest, daß ich nichts anderes mehr wollte als Pilot zu werden. An diesem Tag wurde mir klar, daß meine Zukunft ein Ziel und nur ein Ziel kannte. Ich würde eines Tages selbst auf so einen Sessel sitzen und solch ein Flugzeug fliegen. Kein Weg würde mehr mich davon abbringen können und nicht einemal der Teufel würde es schaffen. Ja, meine Seele würde ich dafür verkaufen.
Der Abend brach ein und die Sonne ging am Horizont unter und als wir in Kufra landeten, bedankte ich mich bei diesen zwei Göttern für dieses wunderbare Geschenk. Auch Vater lächelte und beteiligte sich an meiner Freude. Damals ahnte er nicht, wie ernst es mir war, diese mir auferlegte Quest zu bewältigen.
Wir wurden abgeholt und man quartierte uns in Blechbaracken. Die Klimaanlagen gaben ihr Bestes, denn die Temperaturen in diesem Teil der Libyschen Wüste waren erbarmungslos. Es ging alles sehr laut zu, da die Maschinerie der Ölindustrie nie aufhörte zu arbeiten und Kompressoren, Generatoren, Bohrtürme, fahrende LKWs, Klimaanlagen und vieles mehr, gaben ihr ohrenbetäubendes Konzert von sich, daß mich bis heute wundern läßt, wie die Männer, die dort arbeiteten, das alles nur aushielten.
Dunkle, in Öl verschmierte Gestallten, wanderten scheinbar ziellos um das Gelände herum und schreiende Vorarbeiter brüllten auf Arabisch, English, Italienish und was weiß ich was alles, in die unendlich Weiten der Wüßte hinein. Vater bekam einen Jeep zugeteilt und wir fuhren zu einem riesigem “Kasten”, bestehend aus elektronischen Geräten. Hier und dort wurde etwas ausgeschraubt und gewechselt, da eine Schelle eingeklemmt und dort irgendeine Skala scharfsinnig beobachtet. Ein dünner, schwarzer Zeiger pulsierte nervös von links nach rechts und andersrum und verwundert frug ich mich was “Pappi” daraus ersehen konnte. Machte für mich ales keinen Sinn, aber wer vesrteht schon die Welt der Erwachsenen. Ein Flugzeug zu fliegen jedoch macht Sinn. Hier ein Hebel ziehen, dort eine anderes schieben, war für mich einleuchtender und auch “cooler” erschien. Jedenfalls bewunderte und respektierte ich seine Tätigkeiten, denn er war anscheinend sehr wichtig. Er stand plötzlich fluchend auf, darauf kann ich mich noch gut erinnern, da er mir grob zur Seite schob. Eine Wut schien sich in ihm zu entwickeln und unmißverständlich befahl er mir nicht von der Stelle zu weichen und nichts anzufassen. Die Konsequenzen würde ich sonst kennen.
“Ich muss kurz weg telefonieren ud bin in 5 Minuten wieder hier. Fass nichts an und bleib sitzen, verstanden?”
Ich nickte nur und hoffte inbrünstig, daß es sich wirklich nur um 5 Minuten handeln würde, aber was sind schon 5 Minuten in Nordafrika und wann wurde ich überhaupt in der Verwendung der Zeitberechnung eingewiesen? Ich hatte keine Ahnung was das hieß. Ich wusste nur, 5 Minuten bedeuteten “Ich bin bald wieder hier.” Besser wärs, denn ich fürchtete mich vor diesen Maschinen und den Lärm. Ich saß auf einem Campingstuhl und wartete und wartete und die 5 Minuten wurden zur Ewigkeit. Endlich ging jedoch die Metalltür auf und Vater traf erleichtert ein.
“Ich denke wir werden zwei weitere Tage hier bleiben müssen. Mama wird von David ( damaliger Chef meines Vaters ) darüber unterrichtet werden damit sie sich keine Soegen Macht!”
“Warum müssen wir hier länger bleiben?”
“Ein Ersatzteil wird in zwei Tagen hierhergeflogen. Sonst kann ich meine Arbeit nicht fertigstellen. Verstehst Du?”
Ich nickte nur, doch wie um Himmelswillen soll ich die Zeit hier, in diesem erbärmlichen Loch, als Kind verbringen? Kein Spielplatz, keine Schaukel, keine Freunde und noch schlimmer, ich hatte keine Spielsachen mit eingepackt. Das wird was werden. Doch Vater wußte zu helfen. Er gab mir einen Schraubenzieher, einen Hammer, paar Schrauben und Nägel, kleinere Holzabfälle, die zu Massen aus Kisten und Paletten entsprangen und die auf dem Geländen verstreut herumlagen. Er sagte schließlich: “Bastle dir was! Und wenn das nicht reicht, fahren wir zur Oase mit dem Jeep.”
Ich hatte noch nie eine Oase gesehen und noch weniger wußte ich was es war. Während sich Vater mit Ingenieuren und Technikern in der Mensa unterhielt, versuchte ich aus dem Abfall mir ein Spielzeug zu bauen und was käme eher in Frage als ein Flugzeug herzustellen und siehe da, ich baute eines. Sogar mit drehenden Propeller. Hier und dort schmerzten noch die Stellen an denen ich mich mit den Werkzeugen verletzt hatte, denn ab und zu rutschte der Schraubenzieher in das kindliche Fleisch und mancher Nagel wurde mit dem Hammer nicht ordnungsgemäß getroffen, sodas Blessuren nicht ausblienben, jedoch auch dieser Schmerz verging. Als ich endlich mein vollendetes Werk in den Händen hielt und damit durch das Gelände brummend rannte, um das Geräusch eines Flugmotores nachzuahmen und sogar der Propeller sich vom Fahrt-oder auch Laufwind drehen ließ, erfüllte sich meine Brust mit Stolz. Auch Vater lobte mich anerkennend. Wir aßen in der Mensa und das Essen war nicht schlecht. Eine gemischte Truppe aus Arbeitern, Ingenieuren, Mechanikern, Elektriker, und Ärzte saßen zusammen und natürlich frugen alle, was ein Kind in dieser Hölle zu suchen hatte. Ich brachte, denke ich, eine erfrischend Abwechslung im “CAMP”, denn ich konnte den Mund schon als Kind nicht halten und ging ziemlichen vielen, nach einer Weile mächtig auf die Nerven. Ich stellte einfach zu viele Fragen.
Die Nächte wurden plötzlich kühl, ja gar kalt und sogar die Klimaanlagen wurden teilweise abgestellt, was eine willkommene Abwechslung zu dem ständig herrschenden Lärm war. Es wurde hell nach einem kurzen Schlaf und Vater drängte mich.
Eilig sollte ich Frühstücken, danach zur Toilette gehen, um das notwendigste zu erledigen, denn die Fahrt würde etwas dauern und er wolle nicht alle Nasenlang anhalten damit sein Sohn Pipi oder großes machen mußte. Kurzgesagt, ich sollte mich ausscheißen. Gesagt, getan und schon hoppelten wir durch das Gelände, bis wir die Oase Kufra erreichten. Mitten in der Wüste entsprang ein kleiner See, umringt von einem Palmenwald wo zig Kamele weideten und Beduinenzelte sich aufreihten. Ein Märchen aus tausend und einer Nacht machte sich vor mir auf und sofort wurde ich von meinen Träumen befreit, als neugierige Beduinenkinder mich umgaben und belustigt Schreie und Rufe von sich riefen. Einen Jungen aus der Stadt hatten sie, glaube ich, noch nie gesehen oder zumindest seit längerem nicht. Es nervte mich jedoch etwas, als sie mich dann angrabschten und mich wie ein Wesen aus einer anderen Welt behandelten. Sowas wie mich haben sie hier anscheinend wirklich noch nie gesehen. Ein Ausserirdischer. Ein Lawrence von Arabien in Miniaturgestalt.
Stolz zeigten sie mir ihre selbstgefertigten Speilzeuge. Autos aus Blechen hergestellt, was einst ein 2 liter Olivenölbehälter gewesen sein musste, denn es standen noch die Worte “OLIO DANTE di OLIVA” drauf geschrieben. Unglaublich was diese Kinder aus dem Nichts fertigten und trotz ihrer Armut, glücklich und fröhlich miteinander herumtollten und mit dem was sie hatten durchaus glücklich waren. Waren sie aber wirklich Arm? Ich denke sie waren reicher als jeder andere der aus einer Großstadt kam. Ihr Reichtum bestand nicht aus weltlichen Luxusgütern, sondern aus dem Zusammenhalt ihres Stammes, ihrer Kreativität, ihre Kamele, ihr Stolz und letztendlich diese nie aufhörende Wüste die wirklich so viele Geheimnisse in sich trägt, daß man Diese nur erfährt, wenn man sich ihr vollkommen hingibt. Jetzt, wo ich diese Zeilen als 63 Järiger schreibe, vermisse ich diese Wüste sehr und es wird mir bewust, wie gesegnet und beschenkt ich doch tatsächlich bin, das alles erlebt haben zu dürfen. Vater kaufte Datteln ein und wir tranken viel Tee in ihren Zelten, denn die Gastfreundschaft der Beduinen ist einzigartig auf dieser Welt.
Bei Kamelmilch jedoch hörte der Spaß bei mir auf.
Es roch säuerlich und tausende von Fliegen mussten zunächst weggeweht werden bevor das Weiße der Milch erkannt werden konnte. Es war nichtsdetotrotz ein unvergessliches Erlebnis.
Am vierten Tag kam endlich die DC 3 und brachte das Ersatzteil, das Vater so dringlich brauchte. Die Montage dauerte nur einen Augenblick und am selben Abend noch, bestiegen wir die “Linair” Maschine mit Ziel Benina, dem Flughafen Benghazis. Die Piloten waren andere, doch genauso freundlich uns zugetan wie die vom Hinflug. Auch auf diesem Flug wurde auf einem aderen Flugfeld zwischengelandet, um Fracht auszutauschen und um zu tanken. Endlich, am nächsten, sehr frühen Morgen, waren wir wieder zu Hause und Mutter, wie auch Susanne waren froh uns wieder zu haben. Das Leben in unserer Villa durfte weiterlaufen wie bisher und Normalität kehrte auch in meinem Leben wieder ein. Tat es das wirklich? Ich denke nein. Seit den letzten Tagen, drehte sich alles nur noch um Flugzeuge für mich. Ich träumte davon und sah mich als Kommandanten eines Flugzeuges bereits die Strecken dieser Welt umkreisen. Der Lärm der beiden Sternmotoren brummte noch tagelang in meinen Ohren und ich konnte Diese, metaphorisch gemeint, nicht mehr aus meinen Verstand abstellen. Aus dem Fenster unsere Villa schauend, konnte ich täglich diese fliegende Blechengel starten und landen sehen und dieser Anblick erfüllte mich immer wieder mit Freude.
Eines Tages aber mußten wir umziehen und den Grund dafür weiß bis heute keiner. Von der Villa am Flugplatz, zogen wir mitten in die Innenstadt Benghazis, in die Via Aghib. Ein mehrstöckiges Familienhaus mussten wir beziehen und die Fahrt zur Arbeit verlängerte sich von zehn Minuten auf fast einer Stunde. Der nie aufhörende Lärm von hupenden Autos wie das Geschrei der Händler, veränderte unser Leben zunehmendst. Nicht unbedingt zum Nachteil, denn man konnte vieles nun zu Fuß erreichen. Diesmal begleitete ich des Öfteren ebenso meine Mutter beim Einkaufen und auf dem Weg dorthin liefen wir an Kirchen, Synagögen und Moscheen vorbei. Eine Zeit der Toleranz und des gegenseitigen Respekts herrschte in diesen Tagen, so schien es.
In den Sukhs fand man Händler jeglicher Religionen und Zugehörigkeit und ein buntes und herrliches Beisammensein zeugte von menschlichen und freundlichen Umgang miteinander. Benghazi strahlte im italienischem Glanz der Kolonialzeit und die Spuren eines Italo Balbo fand man überall. Der Aroma von gerösteten Kaffe, frisch gebackenem Brot, Kräuter jeglicher Art hängte in der Luft, jedoch ebenso der ekelerregende Gestank von Esel- und Pferdemist, das unter der glühenden Sonne sich gährend verbreitete und nur Abends weggeräumt wurde. Schiffe aus allen Herren Ländern trafen ein oder fuhren aus dem Hafen raus und ihr ohrenbetäubendes Hupen erschrak uns des Öfteren, als es überraschend aus dem Nichts erklang.
Zu Hause sprachen wir Italienisch, da mein Vater es aufgab uns Deutsch beizubringen und es auch für Mutter leichter war.
Hier waren wir nun. Eine deutsche Familie in Nordafrika, wo nur Vater diese Sprache beherrschte. Meine Schwester und ich besuchten eine italienische Schule, wo auch arabisch in lesen und schreiben unterrichtet wurde. Englisch lernte ich dann beim Spielen, denn meine Spielkammeraden waren meisten die Kinder, der in Libyen gebliebenen englischen Soldaten, die nach dem Krieg dort ebeso Fuß gefaßt hatten.
Libyen war damals eben für alle ein Paradies. Es fehlte an nichts und das Meer, mit seinen goldgelben Strand, war das sauberste was man sich vorstellen konnte, trotzt der ausfahrenden Öltankern aus den fernen Ölhafen.
Vater hatte keine Hobbies oder keine bestimmte Freizeitgestalltung. Ab und zu ging er mit seinen Arbeitskollegen ( Alle Ex-Soldaten Rommels oder Montgomeries ) zur Jagd auf Gazellen, Rebhühner und Fasanen, oder zum Hochseeangeln nach Tunfisch und anderes. Dies erfolgte meistens spontan und an einem Freitag, da dort der Freitag als Wochenende galt und Samstags und Sonttags wie üblich gearbeitet wurde, außer man nahm sich für ein paar Tage frei. Tat er das, fuhr man zum Kampieren mit den Land Rovers hinaus. Nach Barce oder Derna oder zum Ras el Hilal. Unvergessliche Erlebnisse. Die wirkliche Leidenschaft, wenn man dieses so nennen darf, die mein Vater hatte, waren die Merceds Benz Fahrzeuge, die er alle zwei Jahre persönlich in Stutgart von der Fabrik abholte und dafür mit der gesammten Familie, das neugekaufte Auto über der Schweiz, Italien, schließlich über Malta mit dem Schiff dann nach Tripolis überführte. Von Tripolis aus fuhr man mit dem nagelneuen Mercedes, auf der schlechten und mit Schlaglöchern belegten Straße zum Endziel Benghazi.
Um nach Deutschland jedoch zu kommen, flogen wir zunächst mal mit einer Caravelle der Alitalia nach Rom, wo wir den Anschlußflug nach Stuttgart nahmen. Dort, in Rom, mußte man höllisch aufpassen in jener Zeit, da Italien berühmt war für das plötzliche verschwinden von Koffern und Handtaschen. Gestohlen wurde zu dieser Zeit viel und meine Mutter trug nie eine Handtasche mit sich auf diesen Reisen.
In Deutschland angekommen, blieben wir zwei Wochen, wo er, Vater, nachdem das neue Fahrzeug in Stuttgart entgegegengenommen wurde, die notwendigen tausend Kilometer fuhr, um den vorgeschriebenen Ölwechsel des Neufahrzeuges durchführen zu lassen, denn damals mußte man ein neues Auto erstmal einfahren. Die tausend Kilometer wurden von Stuttgart aus nach Hamm durchgezogen, wo er seinen Bruder, unser Onkel Richard, besuchte und wir uns dort mit unseren wahren deutschen Familienmitglieder befassen konnten. Tante Mia, die Ehafrau Onkel Richards, beschenkte uns mit Gummibären und Gummiteufel und alles was so in den deutschen Kiosken für Kinder zu beschaffen war. Ein Eldorado für nordafrikansiche Blagen. Liebevoll behandelten uns unsere Cousinen, doch wir konnten nicht untereinander kommunizieren, denn „Deutsche Sprache, Schwere Sprache...“. Doch als Kinder verstanden wir es uns verständlich zu machen und der rege Austausch von Gummibären, Mäusen, Teufeln ect. vertiefte unser Freundschaft wie ein Pakt. Nach besagten tausend Kilometern auf deutschen Autobahnen mit dem Neufahrzeug, fuhren wir zurück nach Stuttgart zum Werk, wo der Ölwechsel stattfand und wo auch gleichzeitig mein Vater ein neues Auto bestellte, denn die Lieferzeiten für ein Neufahrzeug zu dieser Zeit belief sich auf zwei Jahren.
In Libyen angekommen, war das neue Auto mit dem guten Stern auf allen Straßen, bereits beim eintreffen wieder verkauft, doch auch hier mußte der Käufer zunächst mal zwei Jahre waten, denn natürlich wollte Josef, sein neues Auto, erstmal selbst fahren. Der Mercedes wurde nur Sonntags oder für bestimmte Anlässen aus der Garage geholt. Der Land Rover musste für alles andere reichen. Denke ich an die Zeit zurück, so durchliefen die folgenden Modelle seinen Besitz.
Mehrere 190 Ponton, 200, dann 220 ebenso Ponton, später der 220s mit den langen Heckflügel, einen 280 S ( 108 Serie) und zuletzt einen 280 S (116er Serie). Der Wertverlust spielte hier keine Rolle, denn die Libyer schlugen sich damals für diese Autos und ein lächelnder Vater, machte guten Profit.
Doch dann kam eine Zeit der Unruhen in Libyen und unsere Eltern spürten gewisse Veränderungen im Land.
Veränderungen, die besorgniserregende Vorahnungen unter den dort lebenden Ausländern erregte. Jahrelang wurde das Land, durch das dort befindliche Erdöl, vom Westen ausgebeutet. Libyen war das viertgrößte ölexportierende Land der Welt, doch wohin der Profit aus dessen Verkauf verlief, wussten nur wenige. Korruption im Königshaus der Senussis, sowie andere aus den mittleren Osten dort lebenden Gestalten, bereicherten sich auf unverschämter Art und Weise, ohne einen Pfennig für die libysche Bevölkerung im Lande oder in eine Verbesserung der Infrastuktur zu investieren. Wir Kinder spürten das alles natürlich nicht, doch unsere Eltern sprachen, fast flüsternd, des Öfteren bei Tisch darüber. Mehr und mehr Araber gingen auf die Straße um zu protestieren und die dort amtierende Polizei ging nicht alzu zimperlich gegen die Demonstrierenden vor. Es gab täglich Tote und Verletzte und die Nachrichten aus den Radios und aus den ersten Fernsehgeräten der Marke Imperial, Telefunken und andere, hatten nichts gutes zu berichten. Ihr Haß galt besonders den Ex- Kolonialisten aus Italien und danach wurden Amerikaner, Engländer und Juden (Da Israel in der Arabischen Welt teilweise bis heute nicht anerkannt ist) auf heftigtste beschimpft. Ausländer wurden auf der Straße überfallen und teilweise schwer verletzt. Es herrschte der Aufruf aus den Mündern des Abdel Nassers und des Yassir Arafats, gemeinsam gegen den westlichen Ausbeutern vorzugehen und einen gemeinsamen Arabischen Staat zu gründen und die Aufrufe zeigten Wirkung. Es war 1965, als dann der erste Putschversuch gegen König Idris und das Königshaus verübt wurde. Ja, sogar das Militär beteiligte sich mit zwei Militärjets indem sie den Palast angriffen. Das ganze hatte jedoch keinen Erfolg und der Putsch wurde zunächst mal niedergeschlagen. Die Verantwortlichen wurden öffentlich durch Aufhängen hingerichtet und das Gefühl der wiedereingekehrten Ruhe vorgeheuchelt. Doch Vater ahnte, daß dies nur die Ruhe vor dem Sturm war und daß es vielleicht ratsam wäre die Familie für eine gewisse Zeit außer Landes zu bringen. So wurden wir irgendwann in 1965 nach Düsseldorf, über den üblichen Alitalia-Caravelle Dienst, von Benghazi nach Rom und schließlich direkt nach Düsseldorf, gebracht. Ein alter Kriegskamerrad meines Vaters aus Afrika Korps Zeiten, nahm sich unserer an. Onkel Herbert und seine Frau Tate Käthe. So nannten wir diese zwei überaus freundlichen Menschen, die uns durch diese Tage der Verwirrung und der Ungewissheit halfen. Was besonders dabei zu erwähnen sei, ist die Tatsache, daß wir jetzt, 1965, als deutsche Staatsangehörige die Möglichkeit hatten endlich unsere Landessprache zu erlernen, denn Susanne und ich wurden in einer deutschen Volksschule zugewiesen. Und wir lernten schnell. Doch hier blieben wir nur zwei Monate und als sich Vater davon überzeugte, daß die Lage in Libyen sich stabilisierte und keine weitere Gefahren zu erwarten waren, holte er uns ab und wie immer tat er das mit Stil, denn ein neues Auto mußte von Stuttgart aus abgeholt und nach Libyen runtergefahren werden. Das übliche Procedere wurde hierfür angwendet und als die tausend Kilometer zum Einfahren gefahren wurden, begaben wir uns auf dem Weg.
Über den Sankt Gothard Pass, Rom, Napoli, Palermo, Malta, mit dem Schiff nach Tripoli und schließlich über eine von den Italienern gebauten Austostrada (eine bessere Landstraße), erreichten wir Benghazi. Wir bezogen wieder das Haus in der Via Aghib, doch kaum waren wir dort angekommen, hatte Vater andere Pläne mit mir vor, denn keine Woche später saßen er und ich in einer Fokker 27 der Kingdom of Libyan Airlines wieder auf dem Weg nach Tripolis, um dort auf einer Viscount der BEA nach Malta zu fliegen. Was er vorhatte und warum ich mit mußte ahnte ich nur einen Tag später. Das ganze kam mir eigenartig vor, da meine Mutter viel weinte in den letzten Tagen und sich meine Eltern heftig stritten. Mit einem Taxi verließen wir den Flughafen namens Luqa und fuhren Richtung Hafen, bis wir an einem Steingebäude ankamen. Das Areal sah mehr wie ein Refugium oder eine Kaserne aus. Ein großes Schild, daß an einen der Torsäulen hängte, enthielt die Inschrift „Virtus Et Honor“ unter einem Wappen. Ich las etwas tiefer den Namen dieser Institution und erkannte sofort, was mein Vater mit mir vorhatte.
„Saint Edward`s College“. Ein Schock und eine Furcht durchfuhren meine Glieder, denn ich spürte, daß ich Mutter und Susanne für lange Zeit nicht wieder sehen würde. Aber warum mein Vater so etwas fertig bringen konnte, seinen 6 einhalb jährigen Sohn einfach in einem Internat abzuliefern und das ohne jeglichen Gefühl, verstand ich damals nicht.
Heute weiß ich es besser. Erziehung war für ihn Alles und es muß ihn ein Vermögen gekostet haben mich da unterzubringen, denn nur hochkarätige Söhne hoher Wichtigkeiten besuchten diese Schule. Ich gehörte da nicht hin, so dachte ich zumindest und das Ganze ging sehr schnell vor sich. Der Dirkteor wurde mir kurzerhand vorgestellt, ein Pater Bernard, kurz einen Kuß und ein Streicheln über dem Kopf verabreicht und schließlich drehte sich Vater um und verließ mich. Eine Welt brach für mich zusammen und alle Versuche des Paters mich zu besänftigen scheiterten. Als ich zur Ruhe kam und man mir die Nummer 78 zugeteilt hatte, nachdem man mir mein Bett in einer der Schlafkammern zeigte, wo genau 78 Schüler quartierten, began ich mein neues Leben. Eine Schuluniform, bestehend aus einer roten Jacke mit dem Wappen drarauf gestickt, zwei Flanell Schorts, vier weiße Hemden, zwei Krawatten, vier Paar graue Socken und eine Inetrnatskappe warf man mir regelrecht zu und mit militärischem Ton machte man mir bewußt, daß hier ab sofort ein anderer Wind pfiff. Keine sizilianische Mutter mehr, die mich mit Liedern in den Schlaf wiegte, tonnenweise Kekse backte oder Spaghetti für ihre zwei Lieblinge kochte. Keine Schwester mit der ich mich ständig streiten konnte und dessen Puppen ich den Kopf abriss, doch am schlimmsten war für mich, keine Begleitung mehr zu den Dienstfahrten meines Vaters zum Flughafen um Flugzeuge starten und landen zu sehen und ebenso keine Fahrten mit dem Land Rover, das für mich zu einer Reliquie der Freiheit wurde. Ich wußte nun warum sich meine Eltern, die letzten vergangenen Tage stritten und warum meine Mutter ständig weinte. Hier war ich nun, umgeben von fremden Gesichtern, die nur englisch sprachen und von Prefects, (Aufsehern) die einen ständig nur Befehle zuschrien. Das Essen war außerdem unter aller Kanone. Das Frühstück war ungenießbar und außer Poridge, Toast und Marmelade und manchmal Spiegeleier mit Baked Beans, gab es Tee, was das einzige war, das gut schmeckte.
Die Butter war ranzig und der Haferschleim widerlich. Dann ging es zur Kapelle, wo man singen und beten musste. Danach zum Unterricht bis zur Mittagstunde, folgend vom Mittagessen, das eine weitere kulinarische Qual darstellte.
Eines Tages wurde ein Brief von mir an meiner Mutter abgefangen und zensiert und ich musste mir VIER mit dem Stock (Cain) abkassieren wegen der geschriebenen „LÜGE“.
Darin stand...Liebe Mutter, heute gab es ein Stück zähes Fleisch mit zwölf Erbsen und drei Kartoffeln. Nach dem Mittagessen ging es zurück zur Klasse. Ab 4 Uhr (PM oder 16 Uhr) versammelte man sich am Hof zum Tee. Ja, es gab tatsächlich das traditionelle Tea Time, das Schüler und Lehrer zusammen in der Esshalle einehmen mußten. Dies war ansich ein High Light, denn wie gesgat, der Tee schmeckte hervorragend und die Butterkekse ebenso. Samstags und Sontags gab es eine etwas verbesserte Kost. Nach dem Tee, mussten wir uns in unsere Sportbekleidung begeben und wie der Name schon sagte, Sport tätigen. Dies beinhaltete Fußball, Cricket Rugby und Leichtathletik. Gegen Aufpreis konnte man Reitunterricht oder sich in den Ruderclub eintragen lassen, was aber nur kurze Zeit sich bewährte, denn in Malta gab es keine Flüsse und das Meer war dazu nicht geeignet. So blieb Reituntericht übrig und was soll ich sagen.
Angenehm war es am Anfang nicht. Dieser tägliche Ablauf fing um 6 Uhr morgens an und hörte, nach dem Supper (Abendbrot) ab 19 Uhr auf. Danach wieder Kapelle, Duschen und schließlich landete man toterschöpft um 20 Uhr 30, ins Bett. Samstag und Sonntag waren die einzigen Tage, wo man bis um 9 Uhr morgens ausschlafen konnte und zur freien Gestaltung einem überlassen wurde. Natürlich erst nachdem man sich gewaschen hat und die Kapelle besucht wurde. Doch die ersten vierzehn oder fünfzehn Tage, mußte ich mich behaupten, denn meine Schulkammeraden hatten allerlei Schabernak auf dem Petto um Neuankömmlinge willkommen zu heißen. Eine Art Aufnahmeritual mußte man durchlaufen und die Nerven wurden aufs äußerste geprüft. So wurde einem in die Schuhe geschissen, oder man reibte wieße Zahnpasta in den weißen Handtuch ein, bis hin zur Hinterlegung manches Ungeziefer unter dem Kopfkissen. Ich erwischte eines Tages die Bande, die das tat und verlor die Fassung. Die erste Prügelei meines Lebens erlebte ich dort und wir schlugen uns, daß die Balken sich bogen, bis alle sich wieder beim Head Master melden mußten um die „Cain“, ein sehr dünner und elastischer Stock, auf den Hintern sich spüren zu lassen. Erst dann, wurde man akzeptiert und aufgenommen. Freundschaften wurden gegründet und Disziplin einem reingeprügelt. Ich muß heute jedoch zugeben, daß die Schulbildung, die ich dort erfahren durfte, zu den besten gehörte und nicht einen Tag davon würde ich missen wollen. Gitarre wollte ich spielen, doch die Klasse war überfüllt, also steckte man mich zum Klavierunterricht. Was solls. Ich lernte perfektes Englisch und redete nach kurzer Zeit wie ein „Distinguished Gentleman“. Krawatte konnte ich in jeglicher Form binden, Schuhe konnte ich putzen und Betten machen, daß nicht eine einzige Falte zu sehen war. Nach einigen Monaten, durften wir Kinder zu den Ferien nach Hause, was bedeutete, das wir zum Flughafen gefahren, als „uncompanied minors“ (Kinder ohne Begleitung) in den Flieger gestezt wurden und schließlich zu unseren Destinationen geflogen wurden. In meinem Falle nach Benghazi, über Tripolis. Je nach art der Ferien, beliefen sich Diese von drei Wochen bis zwei Monaten. Vater holte mich direkt vom Flieger ab und auch ohne durch den Zoll zu laufen oder das Gepäck im Terminal zu holen, ging es zum Land Rover. Vater durfte nämlich direkt, als Flughafenpersonal, die Koffer nach dem Abladen, annehmen. Dies aber nur wenn der Flug als Regional deklariert wurde. Warum Malta dazu gehörte wissen nur die Götter. Zu dieser Zeit war eben alles anders. Natürlich war die Freude groß beim Wiedersehen und Mutter war außer sich, wenn sie mich in ihren Armen schloß.
Die Erziehung hinterließ Bewunderung und Stolz bei den Familienmitgliedern, denn ich zeigte ihnen, wie man richtig Betten bezog, wie man Krawatten band und wie man Tee richtig zubereitet. Es erfüllte Sie mit entzücken. Auch durfte ich, während der Ferienzeit, mein Vater zu seinen Tätigkeiten begleiten und mehrmals flogen wir mit der DC 3 in die Wüste.
Ihm wurde nun klar, was er angerichtet hatte, denn Pilot wollte ich werden und das war mein Ziel. Die Jahre danach verliefen routinenhaft im geleichen Rythmus, bis zu den Sommerferien 1969. Wir spürten nichts außergewöhnlcihes und der Altag verlief normal. Doch eines Morgens im August des erwähnten Jahres, weckte mich meine Schwester aufgeregt auf und ich erinnere mich, wie häftig ihre kleinen Hände mich schüttelten.
„Wach auf, wach auf, Freddy. Draußen wird geschosssen!“ Es war meine Mutter, die schließlich mich vom Bett riß und uns beiden unter den Eßtisch zog. Ein Geräusch, daß ich als Kind nicht kannte, erklang laut und furchterregend und ein Geruch, daß penetrant in unseren Nasen kroch, verwieß daß etwas sehr schlimmes da draußen ablief. Es waren Maschinengewehrsalven und Autos die brannten.
Tiefschwarze Rauchwolken schwebten draußen vor dem Fenster und auf arabisch wurden Propagandarufe aus Lautsprechern geschrien. Die blanke Furcht erfüllte uns, doch das schlimmste an diesem Tag war, daß unsere Mutter die Fassung verlor, denn Vater war noch bei der Arbeit und keiner konnte wissen wie es ihm ging. Plötzlich flogen Jets tief über die Häußer und über den Straßen. So klang der Krieg also, mußte ich mir damals gedacht haben. Nach Stunden der Angst, wurde es endlich ruhiger. Ein heftiges Klopfen erschrak uns und einer schrie laut. „Öffnet die Tür. Wirds bald?“
Vater war es nicht, denn er hatte einen Schlüssel und so würde er niemals schreien. Außerdem war es auf Arabisch.
Angsterfüllt öffnete meine Mutter die Tür und Soldaten betraten die Wohnung. Ohne zu fragen durchsuchten sie alles und hinterließen einen Chaos, bevor sie auch ohne ein Wort zu hinterlassen wieder gingen. Wir hatten nichts im Haus, denn Mutter wollte an diesemTag noch einkaufen, doch dazu kam es nicht. Es vergingen zwei Tage und keine Spur von Vater oder eine Nachricht über seinem Befinden, daß vielleicht durch einem seiner Bekannten zu uns hätte übermittelt werden können. Wir sorgten uns wahnsinnig und, dann, wie ein Wunder, öffnete Jemand die Tür und Josef, stand vor der Tür. Vater hatte in aller Ruhe den Schlüssel gedreht und die Eingangstür geöffnet und begrüßte uns so als ob nichts gewesen wäre. Doch Mutter rastete auf ihre sizilianischer Art und Weise aus und vor lauter Verzweiflung schrie sie ihn an. „Giuseppe...wie kannst du es wagen uns hier....!“ Doch mien Vater umarmte sie nur und versuchte sie zu beruhigen. Wir weinten viel an diesem Tag und waren überglücklich ihn wieder bei uns zu haben. Nur er, Vater, blieb unbeeindruckt.
Täglich verfolgten wir die Nachrichten im Fernsehen und Radio. Der Flughafen war geschlossen und die Sperrstunde erlaubte nur bedingten Ausgang, um den notwendigen Einkauf zu tätigen. Marschmusik und Propagandaberichterstattungen verkundeten, daß er, Muamar al Ghadaffi, der neue Herrscher im Lande sei und daß das Königshaus gestürzt wurde. Dieser Herr Ghadaffi lies auch nicht lange auf sich warten, um ein Exempel zu statuieren, denn er warf alle Italiener binnen 48 Stunden aus dem Land raus und ihre Bankkonten wurden kurzerhand beschlagnahmt. Freunde und Familien, die wir kannten und die ein Vermögen sich dort erarbeitet hattten, wurden über Nacht bettelarm. Ein Exodus an Flüchtlingen, bestehend aus libyschen Juden, Italienern und anderen, begaben sich an allen Häfen Libyens. Von Tripolis, über Misurata nach Benghazi, flohen tausende in Sicherheit und dabei ging es alles andere als sanft zu. Mutter und auch wir Kinder wollten ebenso nur weg, denn wir hatten unendlich Angst, doch Vater beruhigte uns und sagte, daß dies uns nicht betreffen würde und trotzdem wollten wir dort nich mehr bleiben. Man merkte die Veränderungen. Die Libyer wurden anders und nicht mehr so gastfreundlich. Fernsehen konnte man sich nicht mehr anschauen, denn alles was dort lief, war einschüchternd und furchterregend. Es trat jedoch wieder Ruhe ein und wäre meine Mutter nicht mit einem Deutschen verheiratet gewesen und besäße sie nicht inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft, so hätte auch sie fliehen müssen. Ihre Konvertierung zum christlichen Glauben hatte auch ihr übriges gebracht. Als nächstes wurden alle englischen und amerikanischen Militärstützpunkte annektiert und auch sie verließen das Land. Dann, als die Sommerferien zu Ende gingen und anscheinend wieder „RUHE“ einkehrte, was jedoch alles andere war, flog ich wieder nach Malta.
Besorgt und widerwillig, verließ ich meine Familie, doch Vater meinte, daß man nach vorne schauen sollte und Panik jetzt das verkehrteste sei. So verlief die Zeit auf dieser Steininsel und ich übergab mich dem täglichen Internatsalltag. Ja, die Revolution Libyens geriet fast in Vergessenheit, wenn nciht eines Dezembertages des selbigen Jahres und kurz vor den anstehend Weihnachtsferien, Graham Ellis mich beim Cricketspiel störte und sagte.
„Fred, the head-master wants to see you immediately!“
Auf Deutsch: Fred, der Dirketor will dich sofort sehen. Etwas eingeschnappt und nachdenklich verließ ich den Platz und eilte den Korridor, mit all den zig Steinstufen, hoch und hoffte innerlich, daß ich nichts angestellt hatte, um wieder Bekanntschaft mit der „Cain“ machen zu müssen. Doch als ich anklopfte und ein freundliches „Come In!“ erklang, stand mein Vater neben dem Direktor im Raum.
„Freddy, pack deine Sachen ein. Wir fliegen nach Deutschland. Mama und Susanne sind schon dort!“
Adieu Malta, Hallo Deutschland
ch weiß es nicht mehr, welcher Dezembertag es war, als wir ind diesem Jahr 1969 in Frankfurt angekommen waren. Der Flug von Malta beging mit einer Alitalia-Caravelle. Diese machte dann einen Zwischenstop in Rom, wo wir in einer B-707 der Lufthansa umstiegen. Ich kann mich darauf genau erinnern, denn eine B-707 war der Traum eines jeden Flufzeugfans. Als wir in Frankfurt landeten und auf einem Außenstellplatz ausstiegen, fiel mir eine rotweiße Caravelle, die direkt neben unserer 707 stand, auf. Sie trug die großen Buchstaben „LTU“ am Heck, genauer gesagt auf dem Seitenleitwerk. Eine deutsche Fahne reihte sich vor der Kennung D-A irgendwas.
Erstaunt, daß es außer der Lufthansa noch andere Fluggeselllschaften in Deutschland gab, frug ich mein Vater, was denn dies sei? Er schüttete nur den Kopf und so wußten wir beide es nicht. Jedoch würden mir diese drei Buchstaben, Jahre später, im Mannesalter, neun Jahre lang begleiten, denn LTU wurde eines Tages zu meinen Arbeitgeber. Das gehört aber jetzt nicht hierher, da ich gerade erst 11 Jahre alt war an diesem kalten Dezembertag. Erstaunlich jedoch, mit welchen Hinweisen einem das Schicksal im Voraus darauf aufmerksam macht. Nachdem wir unsere Koffer am Baggage Claim entgegengenommen hatten, fuhren wir mit einem Taxi zum Frankfurter Hauptbahnhof. Der Duft frischgebratener Bratwürste, Pommes Frites, Kartoffelpuffer und vieles mehr, hing mir unter der Nase, denn die Schnellimbisse hatten am Bahnhof hochbetrieb. Düfte, die mir nicht ganz fremd waren, denn manche Bratwurst hatte ich schon vier Jahre zuvor in Düsseldorf als Kind verdrückt. Ein Pommes Kind eben, doch die Zeiten im Internat, hatten mir diese Erinnerungen eingedämmt, die hier jetzt plötzlich wachwurden und mir einen Hunger bereiteten, sodaß wir fast unseren Zug verpassten, als mein Vater mir noch schnell eine Bratwurst kaufte.
„Eat it slowly!“ sagte er mir. Wir sprachen Englisch, da ich im Internat das Deutsche etwas verlernt hatte und Englisch für lange Zeit, auch in Deutschland, meine Hauptsprache blieb. In einer Stadt namens Kornwestheim stiegen wir ab und mit nochmals einem Taxi fuhren wir Richtung Innenstadt. Vater erklärte mir, daß einige seiner Verwandten hier wohnten, ja sogar seine leibliche Tante. Ich nickte nur und konnte es kaum erwarten meine Mutter und meine Schwester wieder zu sehen. Eine große Fabrik huschte an meiner linke Fahrseite vorbei und eine große Echse hängte als Firmenlogo an dessen Backsteinwand. „SALAMANDER“ durchzog sich in leuchtenden Buchstaben auf dessen Dach. Eine Schuhmarke, die wir kannten, da wir diese auch in Libyen kaufen konnten.
Beste Qualität lobte meine Mutter immer. Hier also wurden sie hergestellt. Etwas außerhalb, hielt das Taxi an und Vater bezahlte den Taxometerbetrag und noch bevor ich die Taxitür öffnen konnte, rannten Mutter und Susanne aus dem Haus um mich zu Empfangen. Wie immer wurde ich von Mutter liebevoll und unter Träenen erdrückt. Auch Susanne freute sich und alles wollten sie von mir wissen.
Zunächst aber wurde der Bauch vollgeschlagen, denn natürlich hatte Mutter gekocht und es hätte für eine Garnison gereicht, doch so war sie eben.
Ich mußte mich zunächst mal aklimatisieren, denn die letzten Eindrücke aus Malta steckten noch in meinem Unterbewußtsein fest. Noch war ich geistig beim Cricketspiel und bei meinen Freunden, die mir plötzlich fehlten. Noch hatte ich diese Schuluniform an, da ich keine Zeit hatte mich umzuziehen. Vater sagte „packe deine Sachen sofort“. Ich hätte jedoch die lange Hosen anziehen sollen und nicht die Flanell-Shorts, da ein Dezembertag in Deutschland sehr kalt war, verglichen zu den mediteranen Süden. Mutter hatte vorgesorgt und legte mir eine Jeans aufs Bett, die bestens passte. Ein Hemd und ein Pullover, daß ich mir heute niemals anziehen würde, doch für die Anfang Siebzigern hochmodern waren, liegten daneben. Ich duschte mich vorher, um wusch von mir die letzten Erinnerungen Maltas vom Leib, doch irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Diese Kälte und diese Dunkelheit da draußen und es war gerade Spätnachmittags.
Dann plötzlich ein Klopfen an der Decke und einer der auf Deutsch „Ruhe da unten!“ fluchend schrie, nur weil wir uns etwas laut unterhielten in der Aufregung des Wiedersehens.
Mein Vater zuckte mit den Achseln und lächelte. Dann kamen die Worte, „Welcome to Germany my son!“ und sein sarkastisches Lächeln verriet mir, daß auch er nicht ganz so glücklich über die Situation war und sich nicht heimisch fühlte.
Ich wurde eingeschult und natürlich mußte ich mir neugierige und teilweiße mißbilligende Blicke über mich ergehen lassen, denn ich paßte bildlich nicht rein. Dunkler Typ mit schwarzen Haaren, einen Türkenkind ähnlich und der kein Deutsch sprach, sondern nur dieses sehr britische English. Meine englisch Lehrerin war jedoch sehr zugetan und fand mich amüsant. Sie nannte mich immer, „Mein Kleiner Lord!“ und besonders die Mädels in meiner Klasse fanden das witzig. Sie kicherten immer albern hinter vorgehaltenen Händchen. Die Jungs sahen in mir natürlich etwas anderes. Ein Außenseiter.
Eines Tages kam es zu einem Zwischenfall am Schulhof während der Pause vor. Der Bretzelwagen fuhr auf und anständig wie ich nun mal war, reihte ich mich ein, um mir eine Bretzel zu kaufen, doch plötzlich stellten sich vier Jungs vor mir, nachdem sie mich grob zur Seite schoben. Sie stammten nicht einemal aus meiner Klasse. Die Worte, die sie mir zuwarfen, als ich sie bat sich hinten anzustellen, verfolgten mich Jahre danach. Ich erkannte auch, daß es isch hierbei nicht um den Aufnahmeritual eines Englischen Internats handelte um sich seiner Würdigkeit zu beweisen.
Nein, hier war blanker Hass im Spiel, was aus ihnen, meiner Person gegenüber, deutlich ausstrahlte.
„Halt die Fresse Du Dreckskanacke!“
Das klang nicht gerade melodisch, besonders nicht in der Art, wie es mir vorgebracht wurde. Ich wurde etwas deutlicher und sagte. „Get you ass behind the quew mate...!“ Ein Wort gab das andere und plötzlich lagen zwei von ihnen mit blutigen Nasen zu Boden. Die anderen zwei suchten das Weite.
Wie konnte es sein, frugen sich manche, daß dieser liebe kleine Junge, der immer wie ein Gentleman die Tür einen offen hielt und immer ein Lächeln für jeden übrig hatte und niemals laut wurde, egal wie zweideutig die Situation, plötzlich hier seine innersten Demonen walten ließ? Mit Verachtung wurde ich sogar von meiner English-Lehrerin betrachtet und ein eiskaltes „Also Friedrich nein, ich...ich....
bin entesetzt!“ kam schrillend aus ihr raus.
Die vier Jungs hatten angefangen und jeder konnte es bezeugen, doch die Tatsache, daß eben ein Kind mit ausländischen Merkmalen hier zwei Ortszugehörigen plattgelegt hatte, war nicht die Norm. Mein Vater wurde beordert und man erklärte ihm was vorgefallen war. Doch er blieb, ...wie sagt man gleich?... Cool.