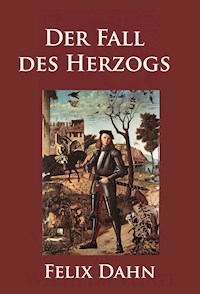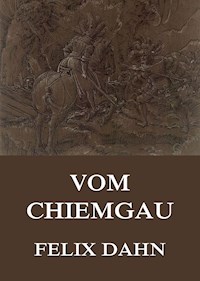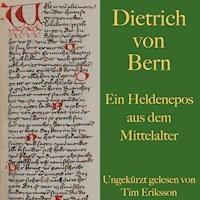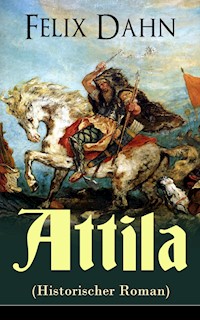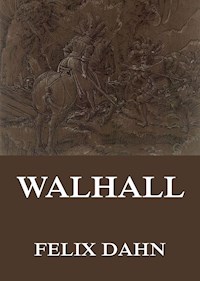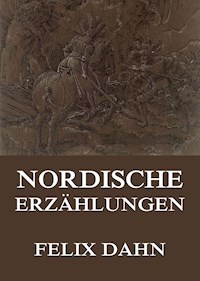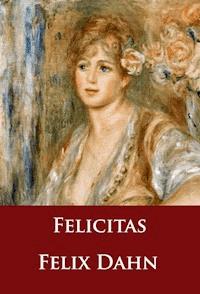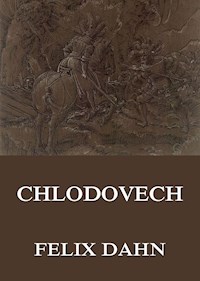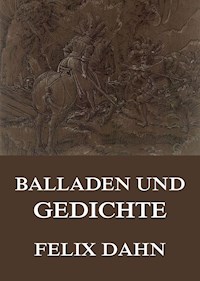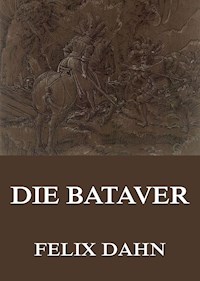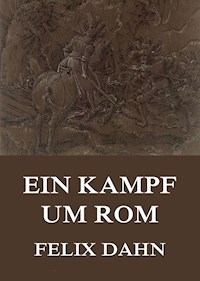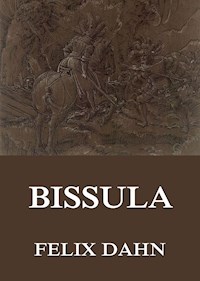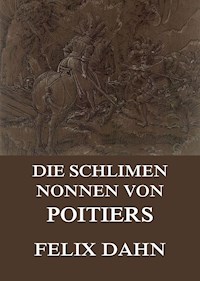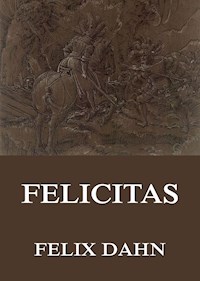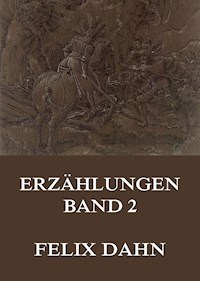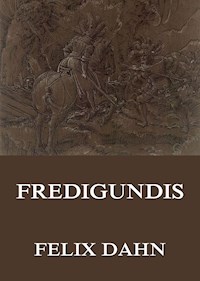
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist Band 5 der historischen Romane aus den Zeiten der Völkerwanderung. Dahns Popularität gründete vor allem auf den historischen Romanen, die sich in den Gründerjahren des Deutschen Reiches außerordentlicher Beliebtheit erfreuten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fredigundis
Felix Dahn
Inhalt:
Felix Dahn – Biografie und Bibliografie
Fredigundis
Erstes Buch
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Zweites Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Drittes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Viertes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel
Fünftes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Sechstes Buch.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Siebentes Buch.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel.
Fredigundis, F. Dahn
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849608842
www.jazzybee-verlag.de
FelixDahn – Biografie und Bibliografie
Rechtsgelehrter, Geschichtsforscher und Dichter, geb. 9. Febr. 1834 in Hamburg als Sohn von D. 1) und dessen erster Gattin, Konstanze D. (gebornen Le Gay), studierte 1849 bis 1853 in München und Berlin Rechtswissenschaft, Philosophie und Geschichte und habilitierte sich 1857 in München als Dozent für deutsches Recht, wurde 1862 außerordentlicher Professor daselbst, 1863 ordentlicher Professor in Würzburg, 1869 korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München, 1872 Mitglied des Gelehrtenausschusses des Germanischen Museums in Nürnberg und ordentlicher Professor für deutsches Recht in Königsberg, von wo er 1888 an die Universität Breslau berufen wurde. 1885 ward er zum Geheimen Justizrat ernannt. Als juristischer Schriftsteller hat sich D. bekannt gemacht durch folgende Arbeiten: »Über die Wirkung der Klagverjährung bei Obligationen« (Münch. 1855), »Studien zur Geschichte der germanischen Gottesurteile« (das. 1857), »Das Kriegsrecht« (Würzb. 1870), »Handelsrechtliche Vorträge« (Leipz. 1875), »Deutsches Rechtsbuch« (Nördling. 1877), »Deutsches Privatrecht« (Leipz. 1878,1. Abt.), »Die Vernunft im Recht« (Berl. 1879), »Eine Lanze für Rumänien« (Leipz. 1883), »Die Landnot der Germanen« (das. 1889). Auch besorgte er die 3. Ausgabe von Bluntschlis »Deutschem Privatrecht« mit selbständiger Darstellung des Handels- und Wechselrechts (Münch. 1864). Von seinen geschichtlichen Arbeiten sind hervorzuheben: die Monographie »Prokopius von Cäsarea« (Berl. 1865) und das umfassend angelegte rechtsgeschichtliche Werk »Die Könige der Germanen« (Bd. 1–6, Münch. u. Würzb. 1861–71; Bd. 7–9, Leipz. 1894–1902), ferner: »Westgotische Studien« (Würzb. 1874); »Langobardische Studien« (Bd 1: Paulus Diakonus, 1. Abt., Leipz. 1876); »Die Alamannenschlacht bei Straßburg« (Braunschw. 1880); »Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker« (Berl. 1881–90, 4 Bde.); »Geschichte der deutschen Urzeit« (als 1. Band der Deutschen Geschichte in der »Geschichte der europäischen Staaten«, Gotha 1883–88). Von Wietersheims »Geschichte der Völkerwanderung« bearbeitete D. die zweite Auflage (Leipz. 1880–81, 2 Bde.). Seine kleinen Schriften erschienen gesammelt u. d. T.: »Bausteine« (1.–6. Reihe, Berl. 1879–84). Sehr umfangreich ist auch Dahns belletristische Produktion, in der er zumeist altgermanische Stoffe mit modernem Leben verbrämt und eine entschieden nationale Gesinnung zur Schau trägt. Seine gründlichen historischen Studien kamen dem Dichter zu gute. Weitaus das beste dieser Werke war der erste historische Roman »Ein Kampf um Rom« (Leipz. 1876, 4 Bde.; 31. Aufl. 1901). Ihm folgten: »Kämpfende Herzen«, drei Erzählungen (Berl. 1878; 6. Aufl., Leipz. 1900); »Odhins Trost« (1880, 10. Aufl. 1901); »Kleine Romane aus der Völkerwanderung« (1882–1901, 13 Bde., und zwar: 1. »Felicitas«, 2. »Bissula«, 3. »Gelimer«, 4. »Die schlimmen Nonnen von Poitiers«, 5. »Fredigundis«, 6. »Attila«, 7. »Die Bataver«, 8. »Chlodovech«, 9. »Vom Chiemgau«, 10. »Ebroin«, 11. »Am Hofe Herrn Karls«, 12. »Stilicho«, 13. »Der Vater und die Söhne«, von denen die meisten in einer Reihe von Auflagen vorliegen); hierzu kommen: »Die Kreuzfahrer«, Erzählung aus dem 13. Jahrh. (1884, 2 Bde.; 8. Aufl. 1900); »Bis zum Tode getreu«, Erzählung aus der Zeit Karls d. Gr. (1887, 15. Aufl. 1901); »Was ist die Liebe?« (1887,6. Aufl. 1901); »Frigga's Ja« (1888, 2. Aufl. 1896); »Weltuntergang«,[419] geschichtliche Erzählung aus dem Jahre 1000 n. Chr. (1889); »Skirnir« (1889); »Odhins Rache« (1891, 4. Aufl. 1900); »Die Finnin« (1892); »Julian der Abtrünnige« (1894, 3 Bde.); »Sigwalt und Sigridh« (1898); »Herzog Ernst von Schwaben« (1902), sämtlich in Leipzig erschienen. Ferner schrieb D. die epischen Dichtungen: »Harald und Theano« (Berl. 1855; illustrierte Ausg., Leipz. 1885); »Sind Götter?. Die Halfred Sigskaldsaga« (Stuttg. 1874; 7. Aufl., Leipz. 1901); »Die Amalungen« (das. 1876); »Rolandin« (das. 1891). Seine dramatischen Werke sind: »Markgraf Rüdiger von Bechelaren« (Leipz. 1875); »König Roderich« (1875, u. Ausg. 1876); »Deutsche Treue« (1875,3. Aufl. 1899); »Sühne« (1879,2. Ausg. 1894); »Skaldenkunst« (1882), und die Lustspiele: »Die Staatskunst der Frau'n« (1877) und »Der Kurier nach Paris« (1883); endlich das Festspiel »Funfzig Jahre« (1962, sämtlich Leipzig). Auch verschiedene Operntexte hat D. verfaßt: »Harald und Theano« (Leipz. 1880, nach seiner epischen Dichtung); »Armin« (das. 1880, Musik von Heinrich Hofmann); »Der Fremdling« (das. 1880); »Der Schmied von Gretna-Green« (das. 1880). Desgleichen war D. als Lyriker rege tätig: auf seine »Gedichte« (Leipz. 1857; 2. durchgesehene Auflage u. d. T.: »Jugendgedichte«, das. 1892) folgten: »Gedichte, 2. Sammlung« (Stuttg. 1873, 2 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1883); dann: »Zwölf Balladen« (das. 1875); »Balladen und Lieder«, 3. Sammlung der »Gedichte« (das. 1878, 2. Aufl. 1896); 4. Sammlung, mit seiner Gattin Therese (das. 1892); 5. Sammlung (»Vaterland«, das. 1892); endlich eine »Auswahl des Verfassers« (das. 1900). Außerdem sind zu nennen Dahns Schriften: »Moltke als Erzieher« (5. Aufl., Bresl. 1894) und die sehr breiten »Erinnerungen« (Leipz. 1890–1895,4 Bücher in 5 Bänden). Seine »Sämtlichen Werke poetischen Inhalts« erschienen Leipzig 1898–1899 in 21 Bänden; neue Folge 1903ff. Mit seiner Gattin Therese (gebornen Freiin von Droste-Hülshoff, geb. 28. Mai 1845 in Münster) verfaßte er: »Walhall. Germanische Götter- und Heldensagen« (12. Aufl., Leipz. 1898). Von ihr allein erschien noch mit einer Einleitung des Gatten: »Kaiser Karl und seine Paladine. Sagen aus dem Karlingischen Kreise« (Leipz. 1887).
Fredigundis
Erstes Buch
Erstes Kapitel.
Bei dem Dorfe Fleury, östlich von Rouen, sucht von Norden her in den stolzen, den königlichen Seinestrom eines schönflutigen Wildbachs rasche Welle ihren Weg.
Hastig, unberechenbar schießt sie dahin, launenhaft die Richtung wechselnd, wie in neckischem Spiel. Aber, fühlt sich die ungestüme Kraft stark genug, wandelt sie plötzlich das Spiel in drohenden Ernst: bösartig zerreißt sie jeden Widerstand auf ihrer Bahn, verschlingt sie alles Leben; »die Furieuse« heißt sie jetzt, »die Wut-Ach« nannten sie die Franken. Nah ihrer Mündung in die hier nach Westen biegende Seine erhebt sich auf dem linken Ufer jener kleinen Wildflut ein mäßiger Hügel; er trug damals das stattliche Herrenhaus, zu welchem die Ländereien weithin gehörten. Am Fuße des Abhangs lagen ein paar ärmliche Lehmhütten, der Unfreien traurige Heimstätten.
Es war ein heißer Sommernachmittag; weißgrau Gewölk zog langsam an dem dunstigen Himmel nach Nordwesten, stromabwärts, dem Meere zu. Drüben, auf dem rechten Ufer des Flüßchens, wo steilere Hebungen ansteigen, kletterten verstreut etliche Ziegen, aus kargem Sandboden salzige Halme rupfend. Da kam aus dem dichten Walde, der hier, auf diesem rechten Ufer, den Höhenzug krönte, ein Knabe von etwa sechzehn Jahren. Den dunklen Jägerhut zierten ihm die bunten Federn des Grauspechts; Bogen und Pfeilköcher trug er auf dem Rücken; aber die netzgestrickte Jagdtasche an seiner Seite war leer.
Unter den letzten Bäumen des Waldrandes – mächtigen, hochragenden Eichen – blieb er stehen. Er hielt nun die Hand vor die Augen – die blinkenden Wasserspiegel da unten blendeten –, er spähte so, vorgebeugt, über die vor ihm umher weidenden Ziegen hin. Kopfschüttelnd ging er weiter; er streichelte das nächste der magern Tiere, das er erreichte und sprach zu ihm; er schien es um etwas zu befragen. Und wieder schaute er ringsumher: dann ging er rasch bergab, dem Wildbach in der Tiefe zu. Der Boden war hier wellig, von langen Falten durchzogen. Der Knabe wollte eben eine tiefe Furche dieser Art überspringen, als er mit einem Schrei des Schreckens, als habe er auf eine Natter getreten, zurückfuhr.
»Fredigundis! du!« sprach er jetzt. »Ich suche dich überall und du ...! Wie du mich erschreckt hast!« Er schwieg; stark klopfte sein Herz.
Ein helles, kicherndes Lachen schlug zu ihm empor.
In der dunkeln Furche niedergeduckt lag, auf beide Ellbogen gestützt, ein Kind von noch nicht vollen sechzehn Jahren, das langgestreckte, sehr schmale, blasse Gesicht ganz umrahmt und umflutet von prächtig rotem Haar; ein Paar graue Augen blitzten lustig und listig aus den vornüber gefallenen Locken; die Kleine lehnte das eirunde Kinn auf die Ballen der zarten, außerordentlich feinknochigen Händlein und blickte zu dem Erschrockenen empor, ohne sich zu regen. Plötzlich sprang sie auf die Füße, richtete sich hoch vor ihm auf – sie war klein für ihr Alter – und rief: »Schäme dich, Herrensohn, das Bettelkind hat dich überlistet,« Und siegesfroh, höhnisch, warf sie das rote Gelock in den Nacken mit einer raschen, leichten Bewegung, die ihr sehr wohl ließ. Dann strich sie langsam das Hemd von grauem Ziegenfell herab. Es war ihr einzig Gewand; viel durchlöchert und, wo es endete, unter den Knieen, ausgefranst. Der alte Gürtel, der es um die allzuschmalen Hüften zusammenhielt, hatte die Spange verloren; ein kleiner, starker Zweig von Wildrosen mit seinen festen Dornen mußte die Spangennadel nun ersetzen.
»Immer so bösartig,« sprach der Knabe mißbilligend, verweisend. Aber er brachte die ernsten, gutblickenden, dunkeln Augen nicht weg von diesem schmächtigen, weißen Gesicht; und seine Miene strafte den strengen Ton der Rede Lügen. »Du wirst es auch mit mir noch verderben,« schloß er, fast traurig. »Geh zu,« lachte sie und drehte ihm den Rücken. »Ich brauche dich nicht. Dich so wenig wie deinen Bruder.« – »Armer Prätextatus!« – »Wo ist er hin?« Blitzschnell hatte sie sich umgedreht. »Fort! – Fortgebracht! Nach Rouen! In ein Kloster.« – »Schade!« – »Nun recht, – das freut mich. Du vermissest ihn doch, den treuen Gespielen.« – »Gar nicht! – Aber er lehrte mich Lesen und Schreiben. Das muß ich lernen.« – »Warum?«
»Dumme Frage! Nur die auch in die Ferne hin reden können – schmeicheln, befehlen, bitten, wollen in die Ferne hin – und geheim –, so daß nur der Vertraute es vernimmt und blindlings rasch es vollführt – nur solche Menschen machen sich gefürchtet und gewaltig.«
»Und willst du das werden? Du?«
»Die Bettelgundis, willst du sagen?« schrie das Kind und lachte dann höhnisch, grinsend, daß der halb offene Mund die schönsten, zierlichst gereihten, weißesten Zähne zeigte. »Die Bettelgundis genannt, weil mich die Großmutter anhielt, sobald ich schreiten konnte, jedem, der als Gast in reichem Gewand in das Herrenhaus zu euch hinauf ritt, nachzulaufen und Gabe zu heischen. Hui, viele Hiebe mit der Reitgerte trug ich davon, aber wenig Gaben! Bis ich größer wuchs –« fügte sie langsam bei und in seltsamem Stolze funkelten ihre Augen, »Jetzt streichen mir die stolzesten Männer gern, – recht gern! – im Vorüberreiten über das Feuergelock hin.«
Der Knabe furchte die Stirn: »Du darfst nie mehr betteln, wenn du mich lieb hast.« – »Ich hab' dich aber nicht lieb! Und nun bettel' ich erst recht. Das heißt, nicht die Frauen: – die geben mir bloß fromme Lehren; – nur die Männer bettel' ich an.« – »Ich verbiet's dir.« – »Ha, ha, Landerich, stolzer Herrensohn! Du bist nicht mein Muntwalt.« – »Nein, denn die Unfreie hat keinen. Aber dein Herr bin ich.« – »Dein Vater ist mein Herr, nicht du. Und schlecht geht es dir bei dem, erzähl' ich ihm, daß du mir gerade so nachläufst wie dein älterer Bruder gethan hat. Und daß ich nicht häßlich bin, – das weiß ich doch schon lang.« – »Du bildest dir doch nicht ein, – schön zu sein?« – »Noch bin ich's nicht: aber bald werd' ich's sein. Ich lag auf meinem Stroh in der Hütte und schlief; das heißt: sie meinten es – als deine Mutter, – sie war mir immer feind: bin froh, daß sie begraben ist! – kurz vor ihrem Tode die Großmutter aufsuchte, und drohte, sie und mich geißeln zu lassen, wenn sie Prätextatus nochmal in unsrer Hütte treffe. ›Denn‹ sagte sie – und nun gieb acht! – ›noch ist die kleine Natter ein mager, ein fast häßlich Ding: aber –‹; und hier funkelten wieder und blitzten Fredigundens Augen – ›mir ist: die wird einmal das verführerischeste Weib auf Erden. Man sollte sie vordem ins Feuer werfen.‹« – »Und das hast du alles ...–?« – »Verstanden? Bin nicht so dumm. Warum hat mich Prätextatus geküßt? Warum läufst du mir immer nach? Bis zum Langweilen! Warum kann ich denn bei dir alles erlangen, was ich will? Hast du nicht sogar deiner Mutter aus der Truhe für mich den kleinen Silberspiegel ... –? Bange nicht! Er liegt versteckt, wo ihn niemand findet. Und ich spiegle mich und meine weißen, nackten Glieder nur darin, wann mich niemand also spielen sieht.«
»Das ist Sünde.« – »Still! Was flattert dort über die Wiese hin?« Sie bückte sich und hob einen Stein auf. »Ein Vögelein!« – »Ist es nicht ein Rotkehlchen?« – »Freilich! Wie glänzt im Sonnenschein sein schönes Rot.« – »So? Auch du? Warte!« Sausend flog der Stein. Aufjammernd stürzte, schwer getroffen, der Vogel, und zappelte am Boden. Schon stand Landerich dabei. Schonend hob er das Tierchen auf: noch einmal zuckte das kleine, warme Leben in seiner Hand – und starb. Mit einem Sprung, wie eine Katze, war das Mädchen an seiner Seite, faßte den toten Vogel an einem der Flügelein und schleuderte ihn in hohem Bogen in die unten dahinschießenden Wellen.
»So!« – »Pfui, du Unholdin! Warum..?« – »Dein dummer Bruder. Er lobte mein Haar. ›Nichts auf Erden‹, sagte er, ›hat schöneres Dunkelrot. Ausgenommen‹, fügte er bei, ›des Rotkehlchens Brust.‹ Da schwur ich zornig, alle Rotkehlchen zu töten, deren ich mächtig würde. Es soll nichts Schönres leben als Fredigundis.« – »Du bist abscheulich! – Ich gehe!« – »Das ist ja doch nicht dein Ernst! – Ich muß dir was sagen. Komm! Duck dich nieder in die Furche zu mir. Sonst sehn sie uns von der Herren-Villa aus. Komm, Landerich.« Und plötzlich sprang sie an ihm empor, umschlang seinen Hals mit beiden Armen und riß ihn zu sich in die Vertiefung herunter. Willenlos ließ er's geschehen.
»Meinst du, ich sah es nicht, wie du, scheinbar um der Jagd willen, zu Walde gingst? – Aber nur mich,« fuhr sie nun eifrig flüsternd fort, »mich suchtest du auf dem Geißhügel. Und dann standest du – unter den Eichen – den Bogen gespannt, den Pfeil auf der Sehne: aber nicht auf die Rehe lauertest du, die gegen Abend aus dem Walde treten. In die Mark-Eiche hast du ein Frauenbild geritzt – mit langem, flatterndem Haar – leider hast du das Gelock nicht rot malen können –! Und in das Herz des Frauenbildes hast du gezielt! – Uralter Liebeszauber! Aber daneben hast du geschossen! Hi, hi!« – »Fredigundis! – Du bist ...« – »Fredigundis. Und dann sah ich dich mich wieder suchen: – wie duckt ich mich und wie freut' ich mich, dich so arg zu erschrecken! Aber nun sei gut. – Versprich, mich vollends lesen und schreiben zu lehren – und ich schenke dir die Locke, um die du solange schon batest. Und ich lehre dich dafür« – nun flüsterte sie ganz sacht, leise bebten dabei die Nüstern ihrer fein gebogenen, schönen Nase – »die Zauberkünste meiner Ahnfrau. Nicht alle freilich!« – lachte sie gleich wieder höhnisch. – »Die besten behalt' ich für mich. Was hilft auch dir die Kunst, Männer wahnsinnig zu machen durch Spruch, Sud und Sang oder blind gehorsam?« – »Mein Vater wird nicht verstatten...« – »Der merkt es ja nicht! Gieb acht. Unter den Weiden – dort an der Wutach – ist ein Versteck, nur vom Fluß aus erreichbar. Ich schwimme wie eine Otter – so leise.« – »Aber die Fischer ...« – »Fischen nur bei Tage. Wir kommen bei Mondlicht zusammen.« – »Und wenn du nun lesen und schreiben kannst... –?« – »Und die Zauberkunst der Ahnfrau dazu? Und wenn ich so schön geworden, wie deine Mutter – widerwillig! – geweissagt, – dann schlag' ich in meine lichten Hände und lasse meine Feuerlocken wallen und breite die Arme in die Nachtluft und rufe: »Kommt, ihr Dämonen, vor denen die Priester sich fürchten. Ich fürcht' euch nicht – ich rufe euch! Gebt mir die Fülle der Kleider und der Macht und der Schätze und der Lust und des Glanzes, gebt mir die Welt zu eigen und nehmt mich dafür hin mit Leib und Seele!« – »Höret sie nicht, ihr Heiligen da oben!« – »Ist nicht nötig! Wenn mich nur die Unheiligen hören da unten.«
»Fürchtest du denn nicht die Höllenpein? Arg sollen sie brennen, die Flammen. Und ewig – denke nur!« – »Das ist nicht so! Man muß nur recht, recht viel Gold haben. Die Höllenstrafen kann man abkaufen. Man kann den Heiligen allen Zorn wieder abschmeicheln, schenkt man ihnen was.« – »Ihnen! Sie wohnen über den Wolken, bei dem Herrn Christus. Sie brauchen nichts.« – »Aber ihre Kirchen auf Erden; die brauchen gar viel! Altardecken! Und goldne Schalen! Und Becher mit Edelgestein und viel, viel Wachslichter. Und breite Äcker, viele Höfe mit Unfreien und Zinsleuten und Herden. Aber auch den Armen kann man schenken und so die Heiligen bestechen.« – »Wer hat dich solches gelehrt?« – »Die Großmutter. – Und wir haben's ja selbst erlebt, in diesem Jahr! Weißt du's nicht mehr? Herzog Eulalius hat seine eigne Mutter ermordet. Er zahlte dem Bruder hundert Pfund Gold und kaufte so die Rache ab, er schenkte dem Herrn König einen Wald voll von Hirschen und ward der Strafe frei, dem Heiligen Martinus aber schenkte er drei Weingüter an der Rhone und für die Armen von Tours monatlich eine Speisung. Und alsbald erschien dem Bischof im Schlaf Sankt Martinus und sagte, er habe den Herrn Herzog von allen Strafen losgebeten bei dem Himmelskönig. So siehst du! Seit ich das gelernt, versteh' ich erst, was um mich her geschieht: es kommt alles nur auf Gold an, im Himmel und auf Erden. Darum ist arm sein, wie ich es bin, das elendeste Los. Im Staub bin ich geboren! Könnt' ich nicht gerade so gut als Königstochter geboren sein? – O stünd ich auf der Höhe oben bei denen, welche die andern treten können! O wär' ich so reich wie deine hochfahrende Mutter war! Dürft' ich nur einmal – nur einen Tag! – einen Festtag aber, wann alle Nachbarn in euer Bethaus kommen! – in ihrem goldgestickten blauen Kleide gehen und ihre breite Gürtelspange...« –
Da tönte ein greller Pfiff von jenseit des Flüßchens, von den Hütten her.
Erschrocken fuhr die Kleine auf. »O weh, o weh!« jammerte sie. »Ich habe die Stunde des Heimtreibens, des Abendmelkens, verpaßt. Und nun erst wieder durch die Furt mit den verfluchten Tieren! Daß sie doch alle ersöffen! Jetzt geißelt mich der Großhirt wieder schwer! O, das thut so weh! Erwürgen möcht' ich ihn mit meinem Haar! – Ducke dich, bleib noch liegen! Sonst läßt auch dein Vater mich geißeln. Aber in der nächsten Mondnacht: – im Weidicht! Bring den Psalter mit. In dem lernt' ich lesen. – Vorwärts, des Donnerteufels Ingesind, ihr Ziegen! Vorwärts!«
Zweites Kapitel.
Die »Hütte des Ziegeners«, wie man sie im Herrenhof nannte, lag nah an dem Wildbach; das gar elende niedrige Gelaß, ganz aus Lehm, bloß von ein paar Balken zusammengehalten, hob sich nur wenig vom Boden; es schien zu verschwinden, sich zu verstecken unter dem mächtigen Stamm einer Stumpfweide, der seine knorrigen Äste mit den wehenden Blättern breitete oder vielmehr stützte auf das braune Moosdach; vielgeflickt war es und doch löcherig; nicht bloß arm, – verwahrlost, wie das Dach, sah das ganze Hüttlein aus; der Gatterzaun, der das winzige Gärtlein vor dem Eingang, von nur ein paar Schritten im Geviert, umhegte, lag an vielen Stellen zerbrochen, die Latten hingen lose herab in dem Weidengeflecht, das die Nägel ersetzen sollte; mit leichter Mühe hätte man sie zurechtschieben mögen; aber diese Mühe, so schien es, gab sich niemand.
Der für die Menschen bestimmte Wohnraum war eine einzige Stube, die zugleich als Küche diente; auf dem Herd, der schmalen Thüre gegenüber, glimmten oder schwelten, übel qualmend, ein paar Kohlen; neben dem Herd, auf dem aus Lehm gestampften Fußboden, lag eine Streu von Schilf, Weidenblättern und Waldmoos. Der gelbe Rauch zog langsam die Wände entlang, den Ausgang suchend durch eine schmale Luke, die das Fenster vertrat. Auf der Streu lag, die Füße verhüllt mit einem alten, schlimm enthaarten Wolfsfell, eine greise Frau; lange Strähne grauen Haares hingen in ihr hageres Gesicht; mit halb geschlossenen Augen raunte sie leise mit sich selber, in den knochigen Fingern ein paar Streifen von Bast seltsam knüpfend und knotend.
»Wo sie nur wieder bleibt?« rief die Alte jetzt lauter, sich etwas aufrichtend auf einem Ellbogen und nach der halb offenstehenden Thüre blickend. »Die Schatten fallen länger. Was treibt sie wieder? Gutes gewiß nicht! Wie könnte sie auch! – He, Fredigundis!«
Da verfinsterte sich der Eingang einen Augenblick, mit einem Satz sprang die Gerufene über die Schwelle: »Da bin ich!« rief sie, schadenfroh lachend über den Schreck der Alten. »Wer mich ruft, der hat mich am Nacken.« – »Jawohl, wie üble Elben! – So spät! Der Großknecht wird dich wieder schlagen.« – »Nein! Der schlägt mich nie mehr. – Ich weiß was! Ich habe gerade was gelernt.« – »Was Böses: – weil's dich freut.« – »Du hast immer gedroht, du wirst mir nie sagen, wann ich kein Kind mehr bin, damit ich. . –« »Nicht noch frecher werde,« schloß die Alte. – »Eben hab' ich's erfahren. Der Großhirt packte mich mit der Linken und hob die Rechte, er schlägt gar grimmig. – Ich wollte mich losreißen, das Gewand fiel mir von der Schulter; da stockte er, ließ die gehobene Faust sinken und gab mich frei mit einem sanften – ja, denke dir nur! – einem fast kosenden Streich Er ging, mit sich selber redend, recht leise, aber ich habe Ohren wie ein Wiesel. »Sie ist kein Kind mehr, s'ist ein Weib. Und wie schön!« Hell auflachend schlug sie beide Hände zusammen und hüpfte auf einem Fuß, mit dem andern den flatternden Kittel in die Höhe schlagend. »Nun weiß ich's doch! Und alle, – aber auch alle! – sagen's! – Das heißt: alle Männer.« Und verschmitzt, triumphierend, blitzten die dunkelgrauen Augen.
»Ach,« brummte die Alte, »wird dir auch nichts helfen. Im Gegenteil! Schaden wird es dir, dich verderben, wie deine...– Ja, wenn du reich wärest! Vornehm geboren! Und dann nur ein Tausendteil so – bethörend! Dann–! Aber so! – Elend geboren, elend erwachsen, elend gelebt und elend gestorben: so wird es gehen. – Wenn ich dir nicht helfe!« schloß sie leise und knüpfte wieder an ihren Bastknoten.
»Dann hilf mir bald: ich werde ungeduldig.« – Sie hob den Deckel von einer alten Truhe aus rohem Tannenholz, die neben dem Herde stand und warf ihn heftig wieder zu. »Wieder nichts zum Abendbrot als den alten Ziegenkäse! Den mißratenen! Denn den guten behält der Großhirt für sich. Und mich hungert immer so heiß! Aber doch! Da geh' ich lieber hungrig schlafen, – wie schon so oft,« rief sie trotzig. »Und da droben, im Herrenhaus, da schmausen sie jetzt und schlürfen den dunkeln Wein, der mir durch die Adern glühte wie Feuer, als mir einmal Prätextatus davon gab. O wie ich sie alle hasse! Nein: beneide! – Ich bin schön, sagen alle, und muß hungern!« – Sie stampfte mit dem kleinen Fuß und sie weinte vor Zorn.
»Still, still, Liebling,« flüsterte jetzt die Alte. »Warte nur, bis es ein wenig dunkler geworden, dann streu' ich dir wieder den braunen Saft in die Wutach, wo die Forellen stehen unter den alten Weidenwurzeln; mit Händen dann magst du sie greifen. Aber bei Tage wag' ich's nicht mehr. Die Fischer haben gedroht, mich des Zaubers zu zeihen bei unserem Herrn Landbert.«
»Dein Zaubern! Wenn's nur was helfen wollte! Warum, wenn du zaubern kannst, verwandelst du nicht diese Spreu da in Gold und die Kohlen am Herd in Rubine?« – »Geduld, Kind, Geduld! – Ich kann doch nur einiges, nicht alles! Und dann: mit den Heiligen möcht' ich's doch auch so ganz nicht verderben.« – »Großmutter, das ist dumm. Gieb acht! Kannst du Gold, kannst du Schätze herzaubern, – freilich ist's arge Sünde! – aber haben wir das Gold, dann kaufen wir den Heiligen ja ihre Strafen ab: hast's mich selbst so gelehrt! Dann haben wir Gold auf Erden und doch das Himmelreich sicher. Aber du kannst nichts! Was knüpfest du da wieder?«
Zornig schleuderte die Alte den Bast auf die Kohlen, daß er hell aufflackerte und brannte und flink haschte sie das Mädchen am langen Haar; unsanft riß und raufte sie daran »Ja, schrei nur und winsele! Mich bestechen sie nicht, deine weißen Schultern. Verdorben durch vorlaute Frage das ganze mühsame Werk vieler Stunden! Und alles für dich, undankbare rote Natter. Einen Liebesknoten, unter dem Gürtel zu tragen! Nun muß ich von neuem beginnen. Warte du – da!« – »Laß mich los oder –!« – »Hei, schlage doch zu! Schlage doch deine alte Großmutter, der du das Leben dankst.« Fredigundis hatte sich nun frei gemacht; »ich denke, das dank' ich – wie andre – Vater und Mutter,« höhnte sie. – »Deinem Vater!« schrie die Alte grimmig. »Ja, dem hast du freilich zu danken! Hast ihn nie gesehen!« – »Nicht seine Schuld, hast du mich gelehrt. Er ward gleich, nachdem er die Mutter geheiratet, in den ersten Tagen –« »Der – ? Ja freilich – der! Ja, ja. In den ersten Tagen!« nickte die Greisin bösartig – »in den Krieg geschickt. Und kam nie wieder.«
»Auch meine Mutter hab ich ja nicht gekannt. Sie starb ... –« – »Bevor du sie Mutter nennen konntest. Wohl ihr, daß sie starb.« – »Warum?« »Weil ... – weil ihr erspart blieb zu sehen, wie bös, wie frech, wie unbändig du bist. Ihr hatte geträumt, wiederholt klagte sie's, kein richtig Menschenkind, rot fressend Feuer werde sie gebären. – Und so geschah's!« schloß die Alte. »Wie konnt's auch anders werden,« brummte sie nach. »O wär's doch so geschehen! Wär' ich doch rot fressend Feuer! Lustig und wild und heiß und stolz ist der Flamme lodernd Leben! Verderben den Feind, verzehrend umarmen auch den Freund, hoch emporlohen, gefürchtet und doch geliebt, und im höchsten Aufsteigen, im Sieg – verlöschen. Ha, eine Königin ist sie, die rote Flamme! – Und Fredigundis ist ein hungernd Bettelkind, eine unfreie Magd, von allen getreten, von keinem geehrt oder gefürchtet – ! O wär ich tot! Ich will, ich will nicht leben in Niedrigkeit.« Und in Thränen ausbrechend des Zorns, der unbestimmten Sehnsucht, der Heißgier nach Genuß, griff sie in ihr reich flutend Haar und preßte es an die Augen. – »Horch! Schritte? Da kommt der Geschorene, der aus der Kapelle des Herrenhauses, auf unsere Hütte zugeschritten. Demut predigt er und Entsagen! Prätextatus hat ihm anbefohlen, meine Seele zu retten, sagt er. Ich kann's nicht mehr anhören! Mein ganzes Herz schreit dawider. Ich fahr' ihm an die Gurgel. – Fort! – Ins Freie! In die Nacht! In die Wildnis! Aber nur ins Freie!«
Mit einem wilden Sprung war sie draußen.
Sie kehrte der Hütte den Rücken und rannte dem Wind entgegen, beide Arme ausbreitend, als wollte sie ihn umfangen; weit flatterte hinter ihr nach das rote Haar.
Drittes Kapitel.
Zwei Monate waren ins Land gegangen.
Ein warmer Tag neigte schwül zu Ende. Schwarze, drohende Wolken hatten sich lange schon im Süden dicht emporgeballt; aber die Luft schien müde; kein Windhauch regte sich. Aus der Ziegnerhütte schlüpfte behutsam heraus Fredigundis; leise, ganz leise ließ sie die Thüre einfallen, lauschend. Noch einen Augenblick hielt sie an. Alles blieb ruhig. Sie nickte und schritt nun rasch gegen den Wildbach hin; in der Linken trug sie ein kleines Bündel; es war ein altes Gewandstück, dessen vier Zipfel sie oben zusammengeschnürt hatte.
Ernsthafter war heute der Ausdruck ihrer Züge, fest zusammengenommen, wie nach gefaßtem schweren Entschluß.
Als sie in der Richtung nach dem Ufer um eine dichte Hecke bog, hob sie erschrocken den schönen Kopf: – sie spähte scharf. »Du bist's, Rulla,« sagte sie dann ruhig. »Schon wieder einmal wartend, hinter der Hecke.«
Ein großes starkes Mädchen mit dunkelbraunem Haar und schwarzen Augen richtete sich nun auf aus dem Heckengraben, in welchem es sich versteckt hatte; sie war auch hübsch, sehr hübsch sogar, diese üppige, strotzende Braune von neunzehn Jahren mit den vollen sinnlichen Lippen; und sie war besser gekleidet, zumal viel sorgfältiger war ihr Gewand in stand gehalten – kein Riß, kein Loch wie in dem Rock der Ziegenhirtin – und doch! Gegenüber Fredigundis sah sie aus wie eine dralle Magd vor einer Königin sehr böser, aber sehr schöner Geister.
»Verrate mich nicht,« klang es ängstlich. »Dein Oheim, der reiche Müller, mag sein Mündel selber hüten! Bewahre! Mich freut's, wenn die freigeborenen Mädchen, die wohl anständigen, es ärger treiben als die Sklavin, die Ziegenmagd. – Aber ich – an deiner Stelle – ich thät's nicht. Warum thust du's?« – »Weil ich muß.« – »Warum mußt du?« – »Das Blut! Das Blut zwingt mich. Es reißt mich fort. Wenn ich weiß, er, mein Rando, steht hinter der Hecke hier, – er wartet auf mich, wenn ich denke, wie er mich empfängt, in die Arme schließt, als wollte er mich erdrücken – dann muß ich! Es reißt mich fort – bei Tag oder Nacht! Aus dem Gebet, von der kranken Mutter Lager – ich muß!«
Fredigundis verzog die schöne Lippe. »Du bist dumm. Er kann dich ja heiraten, der Fischersohn.«
Das wird er auch! Sowie er den Brautschatz zusammengespart hat.« – »Nun also!« – »Aber – einstweilen –!«
– »Nun?« – »Er liebt mich so heiß? Er kann's nicht erwarten.«
»Aber du?« »Ich! – Ich noch weniger! Ich vergehe um ihn!« Ganz leise kam es heraus. Und das glühende Geschöpf drückte den vollen, üppigen Arm vor beide Augen und seufzte – vor Liebe. – »Siehst du, Rulla, das eben nenne ich dumm!« – »Dumm! Weil du nicht weißt, was es ist, einen Mann lieben, – einen Mann lieben müssen, – wie das brennt!« »Nein!« lachte die andre, das Haar lustig schüttelnd. »Freilich nicht! Habe noch keinen Mann gesehen.« – »Ei, wenn das Landerich hörte –!« – »Ist das ein Mann? – Und dein Fischer – mit den plumpen roten Händen!« – »Mach, daß du weiter kommst, willst du ihn schelten. Zwar, ich bin froh, daß du nichts von ihm wissen willst. Er ist dir lange nachgelaufen.« – »Wie alle!« – »Aber er hat's eingesehen: du hast keine Seele, kein Herz, ja auch nicht einmal Blut und Verlangen. Er hat mir's gesagt: halb wahnsinnig war er um dich. Er wollte dich küssen – nur einmal –, mit Gewalt und dann mit dir in die Seine springen. Allein – die Heiligen haben ihn gerettet und damals statt deiner – mich ihm in den Weg geschickt. Dann hat er's eingesehen: du bist nicht geheuer: du bist von den Elbischen. Er hat gesagt, man sollte dir mit deinen eignen roten Haaren einen Mühlstein um den Hals binden und dich in die Seine werfen, wo sie am tiefsten rinnt. Du habest nur daran deine Freude, zum Spiel die Männer zu entzünden. Ich glaub's. Du bist eiskalt. – Du kannst gar nicht lieben.«
»Vielleicht!« sprach Fredigundis langsam, sinnend. »Vielleicht hat er recht! Und doch, – wenn du wüßtest, – wohin ich gehe! – Leb wohl Rulla, braune, heißblütige Rulla, Nachbars Kind vom Wildbachufer. Ich glaube fast, ich habe dich gern. Du wärst die einzige dann! Aber es ist wohl nur eine Gewohnheit. – Leb wohl, Rulla.« –
»Wohin willst du? Fort? Ganz fort! – Bleibe!«
Und bestürzt, in warmer Liebe, reckte sich die Große, über die Hecke hinwegzusehn.
Aber Fredigundis war schon verschwunden. Aus dem Uferschilf, von der Furt her, blitzte nochmal ihr leuchtend Haar.
Rasch hatte sie jene Furt, über die künstlich gelegten und befestigten Schreitsteine wie die Bachstelze leicht und sicher hüpfend, durchschritten; nochmal warf sie einen scheuen Blick auf die Ziegnerhütte zurück; dann rannte sie, wie um sich selbst zu zwingen, den steilen Berg der Geißenhalde hinauf, ohne auch nur einmal Halt zu machen. Auf der Höhe angelangt blieb sie stehen und schöpfte tief Atem; aber sie schaute nicht mehr um. Dann ging sie langsamer auf den Wald zu; an dem Saume desselben machte sie Halt, mit den Augen suchend.
»Das ist die Mark-Eiche. Da ist die Mädchengestalt eingeritzt mit dem flatternden Haar. Die Fratze! Und das soll ich sein! – Hier soll ich auf ihn warten. Ich! Auf ihn, – auf den Werber! Aber freilich – er muß erst bei dem Diakon im Herrenhause die Vesper beten – eh' er davon kann – zu mir!« Sie warf ihr Bündel unter die Eiche. »Da liege, Fredigundens ganze Aussteuer und ganze Mitgift! Ein gestohlener Spiegel, ein paar bunte Fetzen, ein paar Zaubersprüche und Zaubergeräte der Alten.«
Sie ließ sich leise zu Boden gleiten und lehnte den Kopf an den Stamm der Eiche, nun hinüberblickend nach der andern Seite des Baches.
»Staunen wird sie, die Ahne! Und schelten! Und fluchen: ›Bei allen übeln Wichten!‹ – Eh was! Sie muß sich drein finden. Wie lange kann sie noch leben? – Und bin ich reich, – aber sehr reich –! geworden, schenke ich ihr vielleicht einmal etwas – aber werd' ich reich werden? – Fürs erste einmal sicher nicht! – Erst muß der Hofherr da drüben tot sein. – Bah, ist auch schon alt! – Und Landerich muß dann das Erbe haben. – Prätextatus erbt ja nicht mit. Hat sich ja zum Priester oder gar zum Mönch machen lassen! Aus Gram? Um die Ziegenmagd seines Vaters! Oder zur Buße? Weil er mich geküßt, da er fast noch ein Knabe war und ich ein Kind! Der Thor! – Landerich muß mir freilich sicher bleiben. Ganz sicher! Ei« – sie warf das Haupt in den Nacken. »Er wird schon! Er kommt mir nicht mehr los vom Angelhaken! – Aber vorher: manches Jahr der Entbehrung – der Verborgenheit: er will mich einstweilen unterbringen in waldverstecktem Jägerhaus eines Freundes, eines Forestarius des Herrn Königs. Das kann lange währen! – Und langweilig wird es werden, sehr! – Denn zur Kurzweil – als einzigen Besuch – nur Landerich. – Aber wann sein Vater tot, dann, Fredigundis! – Dann zieh' ich gleich seiner Mutter blaues Festkleid an – es liegt noch in der Truhe, sagte er. – Und vor allem: ich halte dies Leben nicht mehr aus! Not, Hunger, Schmutz, die Zaubersprüche der Alten, die nichts hervorzaubern! – Und Landerich ist nicht mehr abzuwehren. – Ich glaube fast, ich hab's zu arg gemacht, ihn zu entzünden,« lachte sie. »Brauchte keinen Liebesknoten dazu! Nur immer ›Nein‹ sagen! Und ihn dabei anschauen als wäre es ›Ja‹. – Was er eigentlich von mir will? – Ich weiß es nicht! – Sein Weib soll ich werden, sagt er, vor Gott, bis ich dereinst es vor den Menschen werden könne. Und dabei küßte er mich – bis zum Wehe thun; ich wehrte ihm nicht mehr stark – und er fragte: ›Glühst du denn nicht ganz von innen?‹ Ich mußte lachen. – Denn ich dachte gar nicht an ihn! An den Goldbecher seines Vaters dacht' ich, der in der Halle auf dem Eckbrett prangt, und ob ich dann wohl täglich daraus trinken würde? – Aber er drohte, davonzulaufen in die weite Welt, wenn ich ihn nicht endlich ›erhöre‹ –, was immer das nun auch bedeuten mag. Und lesen und schreiben und alles was er lehren kann an Wissen, das hab ich von ihm gelernt. Und so versprach ich denn, heut' abend unter der Mark-Eiche auf ihn zu warten. Und sein Weib zu werden heute noch. Und mich dann von ihm in jene Försterhütte flüchten zu lassen, viele Stunden weit. Und jetzt sitze ich also hier, unter der Eiche. Und warte.«
Sie war müde, sie schloß die Augen.
»Ich möchte schlafen,« sagte sie gähnend. »Es ist so schwül. – – Ein leiser Wind hebt sich in den Bäumen.«
– Sie reckte die Hand empor. »Südwind ist's. Der macht noch viel heißer. – Und der bringt das aufgeballte Gewölk von da drüben her – wie rasch es naht ....! Ich kann von hier die Thüre sehn, aus der er treten, den Pfad, den er einschlagen muß. Er kommt noch nicht....
Er kommt noch nicht. Oh, wenn er doch gar nicht käme! – Seltsam! – Ich sollte ihm zürnen, dem Bräutigam, der säumt, zur Braut zukommen. Ach! Und ich wollte, er käme gar nicht, der Bräutigam! Ei ja! Ich nehme mein Bündel wieder auf und laufe zurück zur Ahne und sage, das Gewitter – denn jetzt kommt's mit Macht! – hat mich aufgehalten. – Oh je, wieder in der Ziegenhütte! Und wieder Hunger und Öde und – eitel nichts! Komm, Bräutigam! – Oh hießest du doch nicht Landerich! Aber wie sollte er heißen, mir zu gefallen? Keiner gefällt mir! Ich kann vielleicht wirklich nicht lieben! Rulla mit den glühenden Wangen hat wohl recht.
Hei, das Wetterleuchten! Das war schaurig schön! Ein Wink, ein stummer, des Donnerherrn, des roten, ein Götterzeichen, sagt die Ahne: ein Teufelszeichen, sagt der Diakon. – Wie der Wind jetzt heult und pfeift! Staub wirbelt auf der Geißenhalde empor! Wie der Sturm den Rauch niederdrückt über den Dächern im Dorf! – Hui, jetzt Blitz und Donner! – Und horch! Was war das? Fern im Wald hinter mir. Ein Hornruf? Ein Jäger? Im Bannwald jagen bei solchem Unwetter? Das ist der wilde Jäger wohl, der im Gewittersturme jagt! Hei, der wäre mir gerade recht, der starke Buhle! Komm, roter Donnerkönig, oder wer du auch bist, der im Gewitter dahinrast über mir: – Wildjäger, Rotjäger, Rotkönig, komm! Hier harrt eine Braut eines Bräutigams. Komm!
Da! Blitz auf Blitz! Und der Donner jetzt ganz nah! Ist es der Sturm, was mich so wild macht, so berauscht, so freudig? Oh, wüchsen mir Flügel, durch die Lüfte mich zu tragen – zu ihm. Ja, zu wem denn?«
»Hei, hilf Sankt Martinus!« kreischte sie und sprang auf mit Entsetzen: ein furchtbarer Schlag krachte über ihrem Haupt, in langhin rollendem Donner sich entladend.
Sie sah zitternd empor. »Die Eiche brennt! Der Blitz! Er schlug in unser Brautbett, Landerich! – Und horch! Gewiß, gewiß, das ist ein Horn! Ein Jagdhorn! Es naht! Er naht! Ein Reiter! aus dem innersten Wald! Auf rotem Roß! Rot flattert im Sturmwind sein Mantel. Rot aus dem Jägerhut fluten die langen Locken. Ja, es ist der rote Dämon des Blitzes! Schützt mich, ihr Heiligen! – Oder nein, schützt mich nicht: er hat meinen Ruf gehört – der Bräutigam ist 'kommen.«
Und vor ihr hielt ein Reiter, der mit dem rechten Arm weit vom schnaubenden Rotroß herab nach ihr griff. Sie schmiegte sich zitternd an den nächsten Baum. Der brennende Eichenwipfel beleuchtete grell beide Gestalten.
Regungslos stand das Mädchen, an den Stamm geduckt, und starrte auf den stolzen Reiter, seine reiche Tracht, seinen blitzenden Goldschmuck: nie hatte sie solche Pracht geschaut. »Wer bist du?« fragte sie bebend, aber sie konnte das Auge nicht von ihm wenden. »Wer ich bin? Dein Herr! – Wer du bist? Ich frag' es nicht, denn du bist zauberschön! Ich bin ein Jäger und du – meine Beute! Willst du nicht? Muß ich dich zwingen!« »Ich will!« rief sie leidenschaftlich und sprang von dem Baume weg auf ihn zu. Rasch hatte er nun die schlanke, fast noch kindliche Gestalt um die Hüfte gefaßt und vor sich in den Sattel gerissen. Er breitete seinen langen roten Flattermantel um sie und jagte mit ihr davon in den dichten Wald unter lohendem Blitz und hell nach prasselndem Donner.
Zweites Buch.
Erstes Kapitel.
Der Frühling war wunderschön eingezogen in das Land der Rosen und der Reben, in die blühende Provence. Reichen Schmuck hatte er gebreitet über die stolze Stadt Marseille. Und herrlich war von der Burg aus, wo jetzt auf steilem Kalkfels die Wallfahrtskirche Notre Dame de la Garde weithin den Schiffer grüßt, der Ausblick auf das blaue, das leuchtende Meer im Westen und auf die von blühenden Obstbäumen bedeckte »Campania« rings vor den Wällen der Stadt.
In der Bogenhalle des königlichen Palatiums in jener Burg standen und saßen in ernstem Gespräch zahlreiche geistliche und weltliche Große des Frankenreichs; ein mächtiger Marmortisch war mit Urkunden und mit Schreibgerät bedeckt. Ein hoher Greis in reichem bischöflichem Gewand beugte sich über eine der Urkunden und schrieb langsam, fast feierlich, mit schönen, festen Zügen unter den Text seinen Namen: »Germanus, durch die Gnade Gottes Bischof der Stadt Paris.« Er legte das Schreibrohr weg und erhob sich! »So! Nun möge Gottes Segen walten über unsrem Werk, daß diesem vielgequälten Reich der Franken endlich Friede werde. Amen.« »Amen!« wiederholten alle.
»Verzeiht, ehrwürdige Bischöfe und große Herzoge,« begann ein stattlicher junger Krieger, dessen schönes Antlitz von südlicherer Sonne gebräunt schien, – er sprach das Latein mit andrem Anklang als die Franken, – »wenn ich ein paar Fragen an euch richte. Die Dinge in euren drei – oder vier? – Reichen liegen etwas kraus. Wir Goten kennen nur Einen König, der mächtig zu Toledo thront. Mir ist nicht alles klar geworden aus euren Reden; auch aus den Urkunden nicht ganz. Eure Stadt, Herr Bischof, Paris, scheint mehreren Königen zu gehören? Wie kam das?«
»Das kam so, Herr Marschall Sigila. Wir haben noch Zeit: rechtzeitig ruft uns das Zeichen, bevor das Hochzeitschiff den Hafen erreicht. – Ihr könnt dann Eurer jungen Herrin und Königin alles genau klarlegen. Sie ist – das fand ich bald, als ich in Toledo um ihre Hand warb bei ihrem Vater, König Athanagild, – sie ist gar hohen herrschgewaltigen Geistes, eine echte Königstochter vom Wirbel bis zur Sohle.«
»Herrlich ist Frau Brunichildis, meine Herrin,« sprach der Gote mit blitzenden Augen. »Glückliches Frankenreich, das sie zur Königin empfing. ›Die neue Perle, die Hispania gebar,‹ wie Venantius Fortunatus gesungen hat. Wie rühmt er sie doch?:
›Schön, anmutig und klug, echt königlich: hehr und doch gütig, Mächtig durch Reiz und durch Geist wie durch ihr fürstlich Geschlecht.‹
»Ja, sie ist unvergleichlich,« sprach ein jüngerer Priester, über die edeln, sehr bleichen Züge flog ein leiser Schimmer hin. »Ei, Prätextatus,« lächelte der Bischof. »Seit Ihr sie mit mir geschaut in Toledo, seid Ihr so begeistert wie jener Poet. Aber ich darf nicht schelten. Ging mir es doch ebenso wie Euch.« »Reinheit thront auf ihrer Stirn,« sprach Prätextatus mit tiefem Ernst, »und hoher Seelenadel leuchtet aus ihrem klaren Auge. Reinheit und Seelenadel! Wie dringend bedarf dieser Tugenden der arge, im Schmutz der Lüste versunkene Hof der Merowingen.«
»Nicht unser Herr!« rief da laut ein junger Franke, »nicht König Sigibert. Wer wagt es, ihn zu vergleichen mit jenem geilen Fuchs, dem roten ... –« »Gemach, Herr Charigisel!« unterbrach ein andrer der Großen, ein älterer Mann mit leicht ergrautem Haar, von schönem Antlitz und ruhiger, vornehmer Haltung, der auf der Marmorbrüstung des Bogenfensters saß: der reiche Schmuck seiner Gewandung überstrahlte bei weitem alle andern. – »Zwar sind wir – leider! – keineswegs sonderlich zufrieden mit unserm Herrn – gar nicht! Und die Zeit mag kommen, fürcht' ich, da er das erfährt! – Aber wenn über König Chilperich gescholten wird, so wollen wir das selber thun, nicht von andern gegen ihn schelten hören, Herr Kämmerer!« – »Freilich, Herzog Drakolen, Ihr seid diesem Rechte der nächste! Doch gesteht selbst: ragt nicht Herr Sigibert, der junge Held, wie ein Erzengel Gottes hoch über den guten, aber trägen König Guntchramn von Orleans und über Euren schlauen, ja geistvollen, erfindungsreichen Herrn? Von König Chilperichs Hinterlist, von seiner Wollust ist ganz Gallien voll, – von seinen Heldenthaten hat noch niemand was gehört.« »Daß Gott erbarm!« rief der Herzog, unwillig aufspringend: »Kommt, ihr Getreuen König Chilperichs! Wir können ihn nicht verteidigen mit Gründen – mit den Waffen dürfen wir's nicht – in Gegenwart der heiligen Reliquien, vor denen wir soeben den Frieden beschworen. Aber unsern Herrn schmähen hören ohne dem zu wehren, das stößt mir gegen das Herz. – Wir gehen voran! – Habt ihr ausgescholten, so kommt uns nach.« – Waffenklirrend verließen der Herzog und die übrigen Mannen des Königs von Neustrien den Saal.
Der Gote sah ihm nach. »Ein wack'rer Held! Und seinem Herrn getreu.« »Treu wie Gold,« sprach der Bischof. »Gott hat seine Tugend auch auf Erden schon belohnt.« »Ja,« rief der Kämmerer, »das muß wahr sein. Der Herr Herzog von Aquitanien ist wohl der glücklichste Mann im ganzen Reich der Franken; reich wie kein andrer – im schönsten Land des schönen Rhonestroms! – begütert, hochangesehen: in Krieg und Frieden gleich gerühmt; König Chilperich hat ihm seine starke Feste Chartres zur Behütung anvertraut; an der Seite einer trefflichen Gemahlin, umgürtet und umblüht von sechs trefflichen Söhnen, wackern Eidamen vermählt sind die zwei schönen Töchter. – ›glücklich wie Herzog Drakolen.‹ sagt man im Volk.«
»Ich sehe aber noch immer nicht klarer,« mahnte der Gote. »So hört,« begann Bischof Germanus. »Als König Chlothachar, der das ganze Frankenreich in seiner Hand vereinigt hatte, zu sterben kam, verteilte er es unter seine vier Söhne: Charibert, Guntchramn und – den Jüngsten – Sigibert, welche drei Königin Ingundis und Chilperich, den ihm deren Schwester Aregundis geboren.« »Wie?« staunte Sigila, »Zwei Schwestern nacheinander?« Beschämt schwieg der Bischof. Aber der Kämmerer lachte. »Nacheinander? Ha, ha! Zugleich, nebeneinander hat er sie gehabt. Als Ehefrauen! Alle beide!« »Die Kirche verbietet das,« fiel Prätextatus eifrig ein, »im Frankenreich, wie überall... –« »Aber,« fuhr Charigisel fort, »ein Merowing läßt sich auch von der heiligen Kirche nicht viel einreden.« – »Und am wenigsten,« seufzte Prätextatus, »wo es sich um Weiber handelt.« »Hei, das war schnurrig,« lachte der Kämmerer, »wie König Chlothachar die zweite Schwester dazu nahm, nur um der ersten einen rechten Gefallen zu erweisen.« »Wie das?« staunte Sigila. – »Je nun, so! Frau Ingundis sprach eines schönen Morgens, da sie sich vom ehelichen Lager hob, zu ihrem Gatten: ›Alles hab ich nun, mein königlicher Herr, erreicht durch deine Liebe und Gnade, was deine Magd ersehnen konnte. Nur Ein Wunsch übrigt noch: siehe, o Herr, Aregundis, meine Schwester, ist allmählich gar schön aufgeblüht; sie sollte nun doch auch bald der Liebe, der Ehe Glück genießen; o thu' mir die Gnade, such' ihr einen ihrer würdigen Gatten. Denn gar sehr begehrenswert ist die reizvoll üppige Gestalt. Du hast sie über Jahr und Tag nicht mehr gesehen. Sie wohnt im Hofe Clichy bei Paris.‹ Der König schwieg und nickte mit dem Kopfe. Zwei Tage darauf trat er vor seine Königin und sprach: ›Aus Clichy komm' ich. Wahr hast du gesprochen. Sehr schön ist deine Schwester geworden, die weißarmige Aregundis. Und ich weiß ihr in meinem ganzen Reich keinen ihrer würdigen Mann – als mich selber. So hab ich sie denn gestern mir vermählt.‹ Und Ingundis, wohl gezogen, sprach: ›Was mein Herr thut, das ist wohl gethan. Wenn nur auch ich... –‹ Darüber beruhigte sie sofort der gnädige Herr König. Und so ist nun Chilperich, Aregundens Sohn, zugleich der Vetter und der Bruder von Ingundens drei Söhnen.« »Das ist ja himmelschreiend,« rief der Gote. »Merowingisch ist es!« meinte Charigisel. – »Und die Kirche – die Bischöfe?« »Leider,« zürnte Prätextatus, »schwiegen sie damals zu solcher Fleischeslust und Vielweiberei. Heute, nicht wahr, ehrwürdiger Vater, würden wir nicht schweigen!« »Wir nicht, mein eifriger Sohn,« sprach Germanus. »Aber auch heute giebt es gar manche Bischöfe und Äbte, welche die Herren Könige aus Herzogen und Grafen plötzlich in Priestergewande steckten und die weltlich denken, nach wie vor der Weihe.« »Aber,« fuhr Charigisel fort, »damit hatte Herr Chlothachar noch lange nicht genug! Im ganzen hat er es, teils neben-, teils nacheinander, auf sieben Weiber gebracht – Eheweiber, – die Buhlinnen nicht gezählt, die er im ganzen Reich sich aufgriff, Hirtinnen, Bäuerinnen, Unfreie, wie Freie und Edle.« Der Gote schüttelte das Haupt; Bischof Germanus aber fiel ein: »Laßt diese Dinge ruhen, die der Kirche und ihrer lässigen Zucht zur Schmach gereichen. – Also König Chlothachar gab vor dem Sterben seinem Sohn Charibert Paris und Aquitanien, Guntchramn Orleans und Burgund, Sigibert Reims und Austrasien, Chilperich Soissons mit Neustrien.« »Aber kaum,« ergänzte der Kämmerer, »hatte er die Augen geschlossen, als, trotz dem Erbvertrag, der Bruderkrieg begann.« »Warum?« fuhr Prätextatus fort. »Weil König Chilperich in maßloser Habgier sofort den Frieden brach, des Vaters Schatzhaus zu Braine überfiel und plünderte und Paris, das er so heiß begehrt, wie sonst nur noch ein schönes Weib ... –« »Wegschnappte,« zürnte Charigisel, »das heißt, durch seine Feldherren, durch seine drei Söhne von Audovera.« »Wie?« fragte Sigila, »Ja, wie alt ist er denn, dieser König Chilperich?« »Etwa zweiundvierzig,« antwortete der Bischof. »Die Merowingen haben meist schon mit sechzehn, siebzehn Jahren Kinder.« »Sogar eheliche,« grollte Prätextatus, »von den andern zu schweigen!« »Das ist ja Unzucht!« rief der Gote entsetzt. »In welchen Pfuhl haben wir dich verpflanzt, o Lilie von Toledo!« »Ihr Gemahl, unser Herr Sigibert, ist frei von solchem Schmutz,« rief Charigisel. – »Durch seine Söhne: Theudibert, Merovech und Chlodovech, vollführt Herr Chilperich seine Heldenthaten.«
»Er selbst bleibt klüglich zu Hause, verführt Frauen und Mädchen...« – eiferte Prätextatus. »Oder dichtet zur Abwechslung fromme Lieder,« lachte Charigisel. »Oder erfindet neue Buchstaben,« meinte der Bischof. »Oder neue Steuern,« seufzte ein Kaufherr aus Chartres. »Oder stiftet und beschenkt Klöster, hat ihm der ehrwürdige Vater Germanus das Gewissen wieder einmal geweckt,« meinte der Kämmerer. »Oder widerlegt Juden in scharfsinniger theologischer Disputation« –, fuhr Prätextatus fort. »Sie dürfen ihm aber nicht antworten!« lachte Charigisel. »Und kann er sie nicht zur Taufe bereden ...« – sprach der Bischof – »So führt er sie auf der Folter gelinde zu besserer Einsicht« – meinte Prätextatus. »Und verbrennt die Rückfälligen!« rief der Kämmerer. »Oder behauptet ihren Rückfall, d.h. der Reichen, um sie verbrennen und dann beerben zu können!« schloß der Kaufherr. »Nun also,« begann der Bischof aufs neue, »die drei vollbürtigen Brüder thaten sich zusammen, jagten ihm Paris und seinen übrigen Raub wieder ab und zwangen ihn, Ruhe zu halten.« »Herr Charibert wollte den schlimmen Bruder bestraft wissen; der dicke Guntchramn schwankte,« fuhr Charigisel fort. »Wie gewöhnlich!« meinte der Kaufmann. »Doch unser edler König, Herr Sigibert,« rief der Kämmerer, »erwirkte ihm Verzeihung.« »Der Dank blieb nicht aus,« seufzte Prätextatus. – »Jawohl! Wenige Monate, später ward er heimgezahlt! Kaum hatte Herr Sigibert den ganzen Heerbann Austrasiens ins Thüringland geführt, die Avaren, diese greulichen Unholde, hinauszuschlagen, als Herr Chilperich unsere Länder überfiel.« »Schmählich!« rief der Gote. – »Und da vollführte er denn selbst große Heldenthaten: er nahm Reims, Herrn Sigiberts Königssitz, – freilich: nur Weiber standen auf den Wällen! – und andre Städte mehr. Aber er faßte sich das Herz dazu doch nur, weil ein Gerücht unsern Herrn in der Schlacht geschlagen und gefallen gemeldet hatte. Allein Herr Sigibert war nicht tot. Nach heißem Kampf hatte er den Avaren-Chan bezwungen und auf die Nachricht von dem Fall von Reims flog er aus Thüringland über den Rhein zurück, zornig und rasch, dem Adler gleich, der den eingedrungenen Geier aus dem Horste jagt.« »Herr Chilperich hatte sich zwar längst davongemacht. Nicht einmal in seinem eigenen Königssitz Soissons glaubte er sich sicher,« erzählte der Kaufmann weiter. – »Nur Theudibert, sein ältester Sohn, verteidigte die Stadt: und zwar recht tapfer. Aber wir nahmen sie mit Sturm. Und Herr Sigibert griff mit eigner Hand seinen Neffen, umarmte und küßte ihn, lobte seinen Mut und – ließ ihn frei.« »Ein edler, wahrhaft königlicher Herr!« rief Sigila. »Nur mußte er schwören,« schaltete Prätextatus ein, »niemals wieder gegen Herrn Sigibert das Schwert zu heben. Und da bald darauf Herr Charibert starb, vermittelte Herr Guntchramn den Frieden. Abermals verzieh Sigibert dem besiegten Bruder.« »Aber Soissons behielten wir,« lachte Charigisel. »Herr Chilperich mußte seinen Sitz in das kleine schmale Tournay verlegen. Gewaltig soll es ihn wurmen.« – »Das Erbe Chariberts – Aquitanien – ward unter den drei Brüdern geteilt. Nur über Paris konnten sie sich nicht verständigen. Schon drohte neuer Kampf darüber auszubrechen...« »Da fand,« sprach Prätextatus, »die Weisheit des Bischofs der Stadt, stets bemüht, Blutvergießen zu verhüten, den Ausweg, daß Paris Gemeingut der drei Brüder werden sollte.« »Aber mit so mißtrauischen Augen,« rief der Kämmerer, »betrachten sich die Merowingen, daß keiner den andern in jenen Wällen weilen wissen mag.«
»Daher ward,« belehrte Germanus, »von den drei Brüdern, unter fürchterlicher Selbstverwünschung für den Fall des Eidbruches, auf die heiligsten Reliquien von Sankt Hilarius und Sankt Martinus den Bekennern, und zumal von Sankt Polyeuktus dem Martyr, dem furchtbaren Rächer des Meineids, ein schwerer Schwur geleistet, daß keiner ohne die beiden andern Brüder je einreiten solle durch die Thore von Paris.« »Ich erschauerte,« schloß Prätextatus, und ein leises Zittern flog über seine Glieder. »Ich stand nur als Zeuge dabei. Aber Grauen ergriff mich in die Seele der Schwörenden hinein, da sie nun, die heiligen Pfänder, den Reliquienschrein, berührend, die fürchterlichen Worte wiederholten, die der hochwürdige Bischof hier ihnen vorsprach.« »Ich aber hätte das Friedenswerk nicht zu stande gebracht,« beteuerte dieser, »ohne die eifrige Unterstützung dieses jungen Freundes hier. Der Sohn Herrn Landberts, in kurzer Zeit zum Archidiakon des Bischofs von Rouen emporgestiegen, ist ebenso gewandt in weltlichen Geschäften wie eifrig im Gebet und in fast allzustrenger Askese.« »Und als nun unser König Sigibert Friede hatte vor seinem bösen Bruder,« rief der Kämmerer freudig, »da eilte er, das Verlöbnis abzuschließen mit der Königstochter der Westgoten. Der reine Mann, den nie, wie seine Brüder, der Schmutz der Lust besteckt, er wollte nun in seine Halle die edle Gattin führen.« »Und keine herrlichere wahrlich,« sprach Prätextatus, »hätte er wählen können, als diese königliche Brunichildis.« »Ja, gewiß!« rühmte Charigisel. »Wie er bisher schon seine Brüder an Heldenkraft, an Siegesruhm, an edlen Sitten überstrahlte, so wird nun vollends diese Königstochter an seiner Seite seinen Hof, seine ganze Herrschaft weit erhöhen über seine beiden Brüder, die mit unfreien Mägden in Buhlschaft, mit vielen Weibern zugleich leben, ein Zerrbild echter Ehe.«
»Und vergeßt nicht, ihr Herren,« sprach der Gote stolz sich aufrichtend, »wie auch seine Kriegsmacht gestärkt wird durch das enge Waffenbündnis mit König Athanagild. Auf sechzig Tausendschaften tapfrer Goten kann er fortab als Rückhalt seines Heerbanns zählen, – wider jeden Feind.« »Horch!« unterbrach der Kaufmann, »das Hornzeichen! Es meldet, daß das Hochzeitsschiff demnächst einlaufen wird.« »Auf! mahnte Germanus. »Schon hör' ich das Psallieren der Geistlichen und Mönche. Der ehrwürdige Herr Bruder, der Bischof von Marseille, zieht mit seinem ganzen Klerus dem Brautpaar entgegen bis in den Hafen.« »Auf, hinunter in den Hafen!« scholl es nun ringsum. Und eilfertig verließen Bischöfe, Äbte, Krieger und Kaufherren den Saal und stiegen die steile Felsentreppe hinab, welche in die untere Stadt führte.
Zweites Kapitel.
Die Ausschiffung der neuvermählten Gatten, auch der Einzug derselben und ihres zahlreichen Gefolges durch die reichgeschmückten Straßen von Marseille war nahezu vollendet. Nur noch der Weg über den Platz des großen Schutzheiligen der Stadt, Sankt Viktor, war zurückzulegen, dessen eine Seite das Palatium in der »Neustadt« füllte. Hier drängte sich am dichtesten das Volk: denn die vielen Stufen der Basilika gegenüber dem Palast gewährten gute Ausschau und bei dem Einritt in das schmale Thor des Königshauses mußte der Zug notwendig stocken oder sehr langsam vorschreiten und so längere Zeit dem Auge sich darbieten.
Auf der breiten Terrasse vor den Thüren der Basilika und auf den Stufen bis hinab zu dem staubigen, ungepflasterten Platz wogte die Menge: man hatte Wasser gesprengt, den Staub zu mindern, aber nun waren vielfach Pfützen und Lachen schmutzigen, staubverdichteten Wassers entstanden.
»Jetzt kommen sie!« rief ein Bürger von Marseille. »Eben biegen sie um die Ecke! Seht! König Sigiberts Gefolgschaft in vollem Waffenschmuck!« – »Auf trefflichen Rossen!« – »Ja, alamannischer Zucht!« – »Und nun die Goten, die Begleiter der jungen Königin! Wie glänzt da alles an ihnen von Gold und Silber und bunten Steinen.« – »Ja, sind reiche Herren. Große Schätze soll die Braut von Toledo Herrn Sigibert zubringen.« – »Horch, Trompeten!« – »Was bedeutet das?« – »Ein König reitet an! – Das ist das Brautpaar! Seht nur, seht! Herr Sigibert! Hoch zu Roß! Wie herrlich flutet ihm das dunkel-goldne Gelock aus dem Kronhelm auf die Schultern! Wie Sankt Georg, der den Drachen sticht, auf Goldgrund gemalt, drüben in dem Oratorium! – Was drängst du so, Weib? – 's ist wieder die junge Rothaarige! – Mußt du durchaus den König sehen? Mußt du?«
»Ja, ich muß!« – Und eine schlanke junge Frau in schlechtem Gewand, wie es unfreie Mägde trugen, drängte sich keck durch die vor ihr dicht gereihten Männer; es gelang ihr wirklich; aalgleich glitt sie vor; nun stand sie hart an dem Bug des herrlichen weißen Rosses, das den König trug; jetzt sah sie voll sein Antlitz! da rieselte ein süßer Schauer durch ihren Leib: Lohen schlugen ihr in die Wangen, sie suchte gierig sein Auge, aber er sah sie nicht. Ganz versunken in seinen Anblick, machte sie noch einen Schritt weiter vor, da scheute, vielleicht über ihr plötzlich aufleuchtend Rothaar, – denn die Kapuze des Mantels war ihr bei der raschen Bewegung herabgefallen, – ein Pferd neben dem des Königs, – es bäumte sich; das Weib wollte rasch ausbiegen und trat dabei heftig in eine der Pfützen; hoch auf spritzte das gelbbraune Wasser.
»Verfluchte Sklavin!« schrie Sigila, welcher jenes zweite, ebenfalls weiße Roß am Zügel führte. »Beschmutzest Frau Brunichildens Hochzeitskleid! Über und über! Da! Freche Magd!« Und mit der Reitpeitsche gab er ihr einen leichten Hieb über das Gesicht.
Grimmig schrie die Getroffene auf: beide Hände und das rote Haar vor die Augen drückend.
»Was ist, meine geliebte Königin?« fragte Sigibert. Wie wohllautend scholl diese schöne klangreiche Stimme! »Nichts, mein Gemahl!« – die Stimme Brunichildens war fast tiefer, – »einer Plebejerin Keckheit. Sie fand bereits, was solcher Brut gebührt.«
Schon waren Braut und Bräutigam vorüber. –-
Die Geschlagene warf beiden einen langen, langen Blick nach; sie stand unbeweglich. Sie hemmte so den Zug. »Aus dem Wege, Straßenunkraut!« rief ein fränkischer Reiter vom Pferd herab. Die Gescholtene hörte nicht: sie starrte dem Paare nach. –
»Vorwärts! Was stockt da? Was staut den Zug?« rief Charigisel, der Kämmerer, und spornte seinen Rappen. »Eine Dirne? Eine Bettelmagd? Packe dich aus dem Wege! Du trotzest? So stampfe ich denn Kot zu Kot!« Und ein Sprung des Rosses: das Weib lag in der Schmutzlache. Sofort war sie wieder auf den Füßen; sie sah dem Kämmerer stumm ins Auge: der erschrak und sprengte rasch hinweg.
»Ha, schau einer die rote Katze! Die ist flink!«
»Zurück, Weib!«
Über und über beschmutzt schlich die junge Frau wieder hinter die vorderste Reihe. Und sie hielt sich, offenbar mit Mühe, aufrecht an einem auf dem Platz eingemauerten hochragenden Kreuz.
»Horch! Wieder ein Trompetenstoß!« – »Wieder ein König?« – »Gewiß! Aber welcher?« – »Guntchramn von Orleans?« – »Nein! Der liegt ja krank zu Bett in Chalons.« – »Dann muß es Chilperich sein!« – »Jawohl! Der ist's auch! Seht! Da trägt schon sein Bandalarius seine scharlachrote Heerfahne.« – »Mit der goldnen Schlange.« – »Ja, unter dem Meerwicht mit dem Fischleib.« – »Den haben alle Merowingen.« – »Jawohl! Und da kommt er selbst! Auf seinem roten Roß! Auch ein gar schöner Herr!« – »Bah! Aber neben seinem Bruder!« »Wie Loge neben Paltar,« murmelte ein eisgrauer Mann. »Du alter Heide, schweig von den Dämonen, daß dich keiner der Geschorenen hört!«
Da flog ein Blick des Königs über die Gruppe hin; hastig duckte sich die junge Frau hinter das breite Kreuz.
»Aber wer ist das Weib auf dem goldbraunen Zelter an seiner Seite?« – »Ha, wird eine seiner vielen Buhlinnen sein. Wohl Audovera ...« –
»Oder die neue, die er sich vor ein paar Monden im Wald gegriffen haben soll. Wie heißt sie doch?«
»Nein, nein! König Sigibert soll ihm zur Bedingung gemacht haben bei der Einladung zu seiner Hochzeit, daß er keines seiner Weiber ... –« – »Dirnen sinds! Nicht Frauen!« – »Mitbringen darf, sieben Meilen weit von Marseille!«
Hoch auf horchte das Weib an dem Steinkreuz.
»Und das, bei Sankt Julianus ...« – »Das ist keine Buhle!« »Laßt sehen, laßt sehen!« riefen alle, zumal die Frauen, und drängten sich vor. »Schaut nur, Nachbarin,« rief ein Weib dem andern zu, wie herrlich die fremde Jungfrau geschmückt ist!« – »Ja, wie ein echtes Königskind.« – »Sehet nur hin! Was glänzt da so weiß an ihrem Halse?« – »Das sind Perlen!« – »Nicht möglich! Nie sah ich soviele auf einmal!«
»Wieder stockt der Zug. Man kann alles bequem mustern.« – »Was thut ihr?« – »Vier – fünf! – Ich zähle. – Sieben Schnüre der größten Perlen trägt sie um den Hals!« – »Ja, die reichen Goten! Das stammt all' aus dem Königsschatz zu Toledo.« »Oh,« rief ein junges Mädchen, »welch wunderholde Züge!« – »Nicht so stolz königlich wie Brunichildis.« – »Aber ihr sehr, sehr ähnlich! Nur gar so bleich! Ob sie krank ist?« – »Und gar so schlank!« – »Und gar so jung noch! Seht nur, wie sie so schüchtern den Worten König Chilperichs lauscht.«
»Wie er in ihr Ohr flüstert!« – »Wie er sich vorbeugt! Ihr weißes Haar... –« – »Ja, das ist nicht mehr blond, 's ist fast weiß,« – »Es mischt sich mit seiner roten Merowingenmähne.« – »Aber Weib, dränge doch nicht so!«