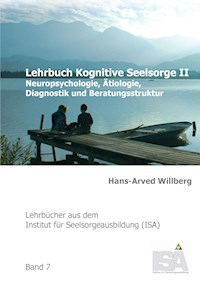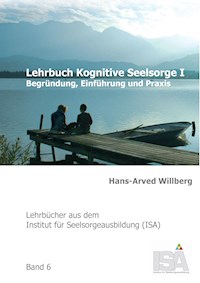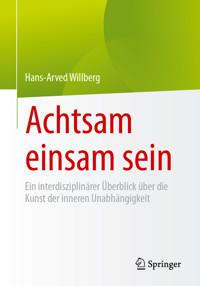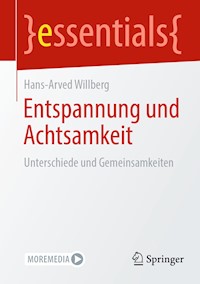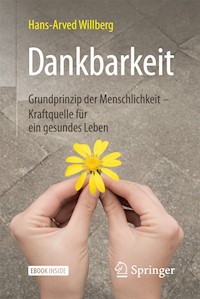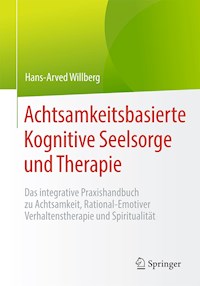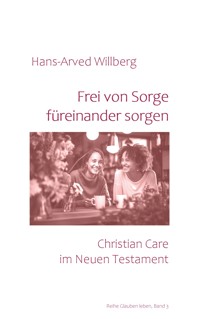
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Krise des Gesundheits- und Sozialwesens, die Abkühlung des sozialen Klimas und die Schwächung des sozialen Zusammenhalts veranlassen viele Menschen, neu darüber nachzudenken, worum es beim Sorgen füreinander eigentlich geht. Man sagt jetzt Care und Caring dazu. Dieses Buch widmet sich der Frage, was Care aus christlicher Perspektive eigentlich meint. Es geht also um Christian Care. Um das zu klären, fängt man am besten mit der Bibel an. Die ersten 6 der 12 eingängigen Kapitel stellen dar, was im Neuen Testament über die Sorge als Problem steht. Es zeigt sich, dass die Aussagen dafür sehr deutlich und hilfreich sind. Wenn uns der Sorgengeist beherrscht, hindert uns das daran, so füreinander zu sorgen, wie es eigentlich angemessen wäre. Ebenso klar und eindringlich redet das Neue Testament vom Sorgen füreinander. Darum geht es in den 6 Kapiteln des zweiten Teils.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Dr. phil. Hans-Arved Willberg ist Theologe, Philosoph und promovierter Sozialund Verhaltenswissenschaftler. Seit vielen Jahren arbeitet er als Praktiker in Seelsorge, psychologischer Beratung, Coaching und Seelsorgeausbildung. Unter anderem er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am internationalen Forschungsinstitut für Spiritualität und Gesundheit (FISG) und Partner von M/TRAINING.
www.life-consult
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Teil I: Den Sorgengeist besiegen
1. Sorglos frei sein - Mt 6,24-34
2. Das Unkraut der Sorge - Lk 8,5-15
3. Verhängnisvolle Sorge - Lk 12,15-20
4. Sorglose Geistesgegenwart - Lk 21,12-15
5. Sorgenfreie Demut - 1Pt 5,6-7
6. Freude statt Sorge - Phil 4,4-14
Teil II: Füreinander sorgen
7. Die Haltung des Sorgens - Joh 10,11-14
8. Die Selbstlosigkeit des Sorgens - Phil 2,19-21
9. Das Maß des Sorgens - Joh 12,4-6
10. Die Pflicht des Sorgens - 1Kor 9,9-10
11. Die Vernunft des Sorgens - Tit 3,8
12. Die Gemeinschaft des Sorgens - 1Kor 12,20-31
Ertrag
Einführung
Ausgangspunkt für dieses Buch sind Wortexegesen. Das heißt: Ich habe festgestellt, welche Wörter für „Sorge“ und „Sorgen“ im Neuen Testament verwendet werden und wo sie vorkommen. Von dorther erfolgte die Auswahl der Texte; sie habe ich dann ebenfalls genau angeschaut und so wörtlich wie möglich übersetzt. Was jetzt vorliegt, ist ein Gesamtbild des Themas „Sorge und Sorgen“ im Neuen Testament. Es ist ein Gesamtbild, nicht das Gesamtbild. Es ist ein Bild, das sich darauf beschränkt, die Texte zu ergründen und für uns heute zu aktualisieren, in denen diese Wörter enthalten sind. Darüber hinaus gibt es viele weitere Texte in der Bibel, wo das Thema eine genauso wichtige Rolle spielt. Für das Gesamtbild schlechthin müssten all diese Texte verwendet werden.
So viel lässt sich allerdings über den Unterschied sagen: Das Gesamtbild schlechthin besteht aus denselben Farbtönen und es stellt auch nichts anderes dar als dieses eingeschränkte Gesamtbild, denn das Thema „Sorge und Sorgen“ im Neuen Testament ist sehr homogen. Anders gesagt: Diese Texte, in denen die Wörter „Sorge“ und „Sorgen“ vorkommen, sind repräsentativ für das gesamte Thema „Sorge und Sorgen“ im Neuen Testament. Das Gesamtbild schlechthin , das die Texte einschließt, die von der Sorge und vom Sorgen sprechen, ohne die Wörter zu gebrauchen, wäre nur viel umfangreicher und detaillierter.
Die Krise des Gesundheits- und Sozialwesens, die Abkühlung des sozialen Klimas und die Schwächung des sozialen Zusammenhalts veranlassen viele Menschen, neu darüber nachzudenken, worum es beim Sorgen füreinander eigentlich geht. Man sagt jetzt Care und Caring dazu. Das neue Nachdenken ist notwendig. Auch in den Kirchen macht man sich diese Gedanken, obwohl sie mit Caritas und Diakonie bei den Institutionen der Health Care und der Social Care eine Hauptrolle spielen und nach wie vor mit den verschiedenen Formen der Seelsorge einen wesentlichen Beitrag zur Spiritual Care geben. Aber nicht Einrichtungen erwärmen das soziale Klima, sondern Menschen. Es kommt darauf an, was Menschen in diesen Einrichtungen für andere Menschen tun und wie sie es tun. Begegnen sie den Sorgen der Menschen so, dass eine echte Resonanz der Dankbarkeit entstehen kann, weil sie sich wirklich angenommen, ernstgenommen und verstanden fühlen? Die Resonanz der Dankbarkeit, das ist ist der Geist, durch den sich das soziale Klima erwärmt.
Einige Christen im Gesundheitswesen beschäftigen sich seit ein paar Jahrzehnten mit der Frage, wie sich eine explizit Christliche Heilkunde definieren und von nicht-christlicher Heilkunde unterscheiden lässt. Sie sind dazu übergegangen, stattdessen von Christian Care zu sprechen. Das ist eine deutliche Entgrenzung, spannend, herausfordernd, vor allem aber auch hoffnungsvoll. Das Heilen, Pflegen und Begleiten kranker Menschen kann durch die Begriffserweiterung programmatisch in den angemessenen ganzheitlichen Zusammenhang gestellt werden, den es auch schon im Neuen Testament hat. Care kann nur christlich sein, das zeigen die Texte zum Thema „Sorge und Sorgen“, wenn stets der ganze Mensch im Blick ist. Christlich ist das Sorgen für andere, wenn es immer von der Frage ausgeht, was diese Person jetzt gerade braucht. Dazu muss man sie ernstnehmen, sich mit ihr verständigen, vorsichtig mit schablonenhafter Sachlichkeit umgehen und gut mit anderen vernetzt sein, die es ihr geben und vermitteln können, wenn man selbst dazu nicht in der Lage ist. Damit ist angedeutet, worauf das Bild des Sorgens im Neuen Testament den Blick vor allem zieht: Das ist nicht die Health Care oder Spiritual Care, sondern das ist Social Care. Soziales Sorgen also: Beziehungsstiftend, persönlich zugewandt und verlässlich, zugänglich, freundschaftlich, integrativ, inklusiv.
Soziale Kälte war auch schon zur Zeit des Urchristentums ein sehr schweres gesellschaftliches Problem. Wenn Jesus vom Reich Gottes predigte, meinte er das Reich der Barmherzigkeit und Liebe. Daraus entsteht ein Gemeinwesen, in dem sich die Verhältnisse umkehren, die sonst in aller Welt herrschen: Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Außenseiter, Verachtete, Abgelehnte, Unterdrückte, Ausgestoßene werden Insider, geschätzte Respektpersonen, frei, selbständig, mündig und gerecht behandelt. Dort achtet einer den andern höher als sich selbst.
Davon handelt der zweite Teil des Buchs, in dem es um das Sorgen füreinander geht. Der erste Teil handelt von der Sorge, die wir uns machen, der notvollen Sorge also. Er trägt die Überschrift „Den Sorgengeist besiegen“. Hier zeigt sich die Homogenität der Texte besonders eindrücklich. Die Protagonisten des Neuen Testaments, allen voran Jesus, reden übereinstimmend im Klartext darüber: Ihr könnt nicht nach dem Willen Gottes füreinander sorgen, weil ihr euch von der Sorge beherrschen lasst. Was dazu in der Bibel steht, ist zeitlos gültig und für alle nachvollziehbar, die den Mut haben, ehrlich zu sein.
Ist Christian Care ein Etikett und ein mehr oder weniger fromm aussehender Rahmen für eine Kategorie des Sorgens, in der Christen verdichtet vertreten sind oder sogar dominieren? Ja, mehr ist Christian Care nicht, wenn sie nicht von Personen bestimmt und durchdrungen wird, die wenigstens auf dem Weg zur inneren Unabhängigkeit sind. Es sind Menschen, die das Loslassen üben und dadurch gelassen werden. Das befreit sie dazu, von Herzen gern und unbekümmert mit Hingabe für andere da zu sein.
Teil I
Den Sorgengeist besiegen
1. Sorglos frei sein
Matthäus 6,24-34
24 Niemand kann zwei Herren dienen: Denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen anhängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz (Mammon)..
25 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht in eurer Seele, was ihr essen oder trinken sollt, auch nicht, was ihr eurem Leib anziehen werdet. Ist nicht die Seele mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung?
26 Seht die Vögel des Himmels an, wie sie nicht säen und nicht ernten und nicht in ihre Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater nährt sie: Seid ihr nicht mehr wert als sie?
27 Wer unter euch kann mit seinen Sorgen seinem Lebensalter eine einzige Elle hinzufügen?
28 Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Beobachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht;
29 ich sage euch aber, dass auch Salomon in aller seiner Pracht sich nicht wie eine von diesen bekleidete.
30 Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so bekleidet, wird er er es nicht viel mehr euch tun, Kleingläubige?
31 Ihr sollt euch nun nicht sorgen und sagen: Was sollen wir essen; was sollen wir trinken; was sollen wir uns anziehen?
32 Denn all dies verlangen die Völker; denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles braucht.
33 Sucht aber zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch zuteil werden.
34 Ihr sollt nun nicht um das Morgen sorgen, denn das Morgen wird für sich selbst sorgen; es genügt, dass der Tag seine Übel hat.
Ein wesentliches Merkmal von Süchten ist die Unfähigkeit der Betroffenen, sie als solche zu erkennen. Ich bin gefangen, aber ich bilde mir ein, frei zu sein. Das hat zwei Gründe: Erstens habe ich etwas von meiner Sucht. Das Suchtmittel erzeugt, solange es wirkt, eine sehr komfortable Komfortzone, eine Glocke des Wohlbefindens, und das erlebe ich als genaues Gegenteil des Gefangenseins. Daraus folgt der zweite Grund: Ich merke gar nicht, dass ich gefangen bin, weil ich kein Interesse daran habe, die Komfortzone zu verlassen. Darum will ich auch nicht hören, wenn jemand besorgt über meine Verschlossenheit draußen vor der Tür steht und klopft und ruft. Wenn ich die Türklinke betätigen würde, dann müsste ich entdecken, dass ich die Tür nach draußen verschlossen habe. Aber ich will ja gar nicht raus. Ich weiß sehr wohl, dass es diese Tür gibt, doch ich versuche gar nicht erst, sie aufzumachen. Darum antworte ich, wenn von draußen oder in mir selbst Zweifel an meiner Freiheit auftaucht: „Ach was, selbstverständlich ist die Tür immer offen, ich kann jederzeit aufhören mit meiner angeblichen Sucht.“ So werde ich mir also weiterhin einbilden, dass die Tür nach draußen offen ist, obwohl ich mich selbst eingeschlossen und vielleicht sogar verbarrikadiert habe.
Dieser Teil der Bergpredigt ist überaus provokativ, weil er uns damit konfrontiert, dass Sucht kein Spezialproblem gewisser willensschwacher Leute ist, sondern das gesellschaftliche Grundproblem schlechthin. So ist das überall bei den Völkern, sagt Jesus, anders ausgedrückt: die Seuche ist global und nichts vorübergehend Fremdes wie eine Pandemie. Die Erscheinungsformen der Krankheit sind vielfältig, aber das aggressivste und ansteckendste Virus darunter ist die Selbstsucht. Davon ist die Menschheit derzeit wieder so sehr infiziert, dass wir aufs Neue mit den allerschrecklichsten Folgen rechnen müssen.
Das weltumspannende Suchtmittel ist der Mammon, sagt Jesus. Wir denken dabei an Geld und das ist auch richtig so. Doch das Wort „Mammon“ meint nicht nur das Geld, sondern überhaupt den Besitz. Jesus behauptet: Alle Welt ist süchtig nach Besitz. Doch das ist noch gar nicht die Speerspitze seiner Provokation. Adressaten der ursprünglichen Bergpredigt sind ja in erster Linie Gläubige und religiös besonders Interessierte. Das waren die Leute, die damals zum See Genezareth kamen, um ihm zu lauschen. Sie wollten wissen, wie man Gott am besten dienen kann. Ihr werdet Gott überhaupt nicht dienen können, antwortete Jesus, solange ihr noch wie alle Welt süchtig nach Besitz seid.
Eingehüllt in unsere Komfortzonen glauben wir nicht, dass uns das persönlich betrifft. Ja, man ist auch nur Mensch und hat seine Schwächen, man süchtelt auch ein bisschen hier und dort. Aber das ist doch nicht so schlimm. Natürlich bin ich jederzeit bereit zur Veränderung, wenn Gott das will. Meine Tür ist ja immer offen. Und ich lebe doch auch fromm und wohltätig genug. Das, was mir fehlt, ergänzt die große Gnade Gottes. Sicher freut sich Gott, wenn ich so denke, denn damit beweise ich, dass ich demütig bin und ihm vertraue.
Wie beim Coronavirus gibt es eine übergreifende Gattung, der die Mammonsüchte angehören. Corona ist eine Unterform der Gattung Covid. Jesus nennt die Gattung der Süchte beim Namen: Es ist die Sorge.
Süchte sind seelische Krankheiten und auch viele andere seelische Krankheiten kommen zu großen Teilen ebenfalls durch Erreger aus der Gattung Sorge zustande. Angst- und Zwangsstörungen nähren sich aus der Sorge, dass etwas katastrophal Schreckliches geschehen wird, und entfalten ein suchtartiges Getriebensein, unter allen Umständen der fantasierten Katastrophe vorzubeugen. Depressionen nähren sich aus der Sorge, dass die Katastrophe schon eingetreten ist: Ich habe alles verloren, es ist zu spät, ich habe am Leben vorbeigelebt und keine Zukunft mehr; alles ist aus. Krankhafte Ängste und Zwänge, Depressionen und Süchte stellen miteinander die allermeisten der außerordentlich vielen psychischen Erkrankungen in der heutigen Gesellschaft dar. Von der Sorge wie besessen zu sein macht die Menschen psychisch krank.
Jesus nennt auch das Heilmittel für alle Krankheiten beim Namen, die aus der Sorge stammen. Es ist ganz einfach und anscheinend doch auch seltsam schwer: Wenn das Kernproblem die Sorge ist, dann wirst du gesund, wenn du dich nicht von der Sorge beherrschen lässt. Aber wie schaffe ich das?
Kein Suchtmittel erzeugt aus sich selbst heraus die Sucht. Drogen zum Beispiel, durch die sich der Körper so programmieren lässt, dass er abhängig davon wird, können bei verantwortlicher Anwendung ein medizinischer Segen sein. Geld auf dem Konto zu haben ist für sich genommen so wenig ein Problem wie schöne Kleider zu haben und sich gutes Essen zu gönnen. Aber alles, was ich habe, macht mich krank, wenn es mich beherrscht.
Wenn ich dem diene, was ich habe, dann vergiftet es mich. Es nimmt mein Herz in Besitz, weil ich mich selbst dafür entscheide. Süchtig zu sein heißt also nicht, dass ich gebunden werde, sondern das ich mich selbst binde. Nicht das Suchtmittel hält mich fest, sondern ich halte das Suchtmittel fest. Frei zu werden von der Sorge ist darum immer ein Loslassen. Ich gebe frei, was ich an mich gebunden habe. Bei Beziehungssüchten heißt das zum Beispiel: Ich gebe diesen Menschen frei. Beziehungssüchte sind wahrscheinlich ein Hauptgrund für sehr viele Konflikte, Störungen und Zerwürfnisse in Partnerschaften und Familien. Ich mag die größte Fürsorglichkeit an den Tag legen, aber eigentlich betrachte ich dich als Besitz. Du bist mein Mammon. Eheleute halten ihren Partner oder ihre Partnerin krankhaft eifersüchtig wie in einem goldenen Käfig gefangen und Helikoptereltern sind zwanghaft darauf bedacht, ständig ihre Kinder zu beglücken und zu beglucken. Viele Kinder hocken noch als Erwachsene im elterlichen Nest, weil niemand sich dafür interessierte, dass sie flügge werden. Ihre Komfortzone ist das Hotel Mama.
Frei werden von der Sorge heißt frei geben. Manchmal muss das ein Aufgeben sein: Endlich lasse ich meine kranken Forderungen und Erwartungen los.
Die große Mühe, die wir mit dem Loslassen haben, entsteht aus der logischen Konsequenz, danach mit leeren Händen dazustehen. Davor haben wir Angst. Wir haben Angst vor der Armut: vor der finanziellen Armut und vor der Armut, verlassen zu sein und allein zurechtkommen zu müssen, wir haben Angst, keine Anerkennung zu erfahren. Das heißt: Wir haben Angst davor, dass unsere tiefsten Bedürfnisse keine Erfüllung finden. Wenn sich die Tür aus der Komfortzone wirklich öffnen würde und wenn wir wirklich über die Schwelle hinaustreten sollten, was erwartet uns denn dann? Uns graut davor, da draußen ganz einsam und elend zu sein und daran zugrunde zu gehen.
Jesus sagt, dass Gott als unser wahrer Vater unsere Bedürfnisse ganz ernst nimmt: „Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.“ Eindringlich fordert er uns auf, uns keine Sorgen zu machen, sondern darauf zu vertrauen, dass der Vater für uns sorgt. Aber wenn wir uns in einsame oder gemeinsame Komfortzonen einschließen, dann verschließen wir uns damit auch der tröstlichen Erfahrung, dass der Vater wirklich für uns sorgt. Eingesponnen in den Kokon der eigenen Sorge werden wir unempfänglich für sein Sorgen. Um uns über Gottes Fürsorge ehrlich freuen zu können, müssen wir die Komfortzone verlassen.
„Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch zuteil werden“, sagt Jesus: Dann werdet ihr erleben, dass Gott wirklich eure Bedürfnisse kennt und ernst nimmt und sich um ihre Erfüllung kümmert. Wir müssen nicht lang grübeln, was er eigentlich meint mit „Gottes Reich“ und „seiner Gerechtigkeit.“ Er wird es ein Kapitel später in der Bergpredigt dann auch noch sehr präzise auf den Punkt bringen mit der so genannten Goldenen Regel: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.“ Anders gesagt: Das ist der ganze Wille Gottes. So wie im Himmel soll er auch auf Erden geschehen. Das ist im Vaterunser gemeint mit „Dein Reich komme“. Die Goldene Regel ist das Liebesgebot.
Wenn ich dem Anruf und Anspruch des Liebesgebots folge, dann stehe ich auf, gehe zur Tür, öffne sie und trete über die Schwelle hinaus. Ich bleibe nicht mehr verschlossen in mir selbst, ich komme aus mir heraus. Ich schütze mich nicht mehr vor den andern, damit sie mir nicht wehtun. Ich mache mich verletzlich. Ich lasse los und habe leere Hände. Ich komme mir arm und hilflos vor und bin es auch. Jesus preist die Armen selig.