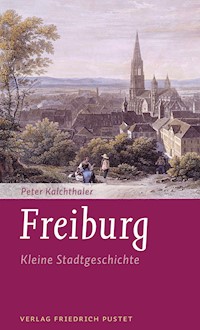
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
Die Kleine Stadtgeschichte macht neugierig auf Menschen und Ereignisse, die das Leben der Stadt in den letzten neun Jahrhunderten geprägt haben. Sie zeichnet gut verständlich den Weg Freiburgs von den Zähringern bis in die Gegenwart nach. Auch wichtige Aspekte der Kunst und Architektur werden in Text und Bild vorgestellt. Die Bürger der Stadt, die ihre Heimat näher kennenlernen wollen, und die zahlreichen Besucher, die mehr über den Ort erfahren wollen, in dem sie zu Gast weilen, erwartet eine ebenso informative wie spannende Lektüre. "Jede Besucherin und jeder Besucher der Stadt Freiburg sollte in seinem Rucksack … Platz haben für diese lebhafte und gut dokumentierte kleine Freiburger Stadtgeschichte." Schau-ins-Land
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Kalchthaler
Freiburg
Kleine Stadtgeschichte
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATION DERDEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
3., aktualisierte Auflage 2021
© 2006 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3268-8eISBN 978-3-7917-6193-0
Reihen-/Umschlaggestaltung und Layout: Martin Veicht, Regensburg
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2021
eISBN 978-3-7917-6190-0 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie im Webshop unter www.verlag-pustet.de
Inhalt
Vorwort
Topographie und Frühgeschichte
Die ersten Menschen im Breisgau / Kelten und Römer / Spätrömische Zeit und frühes Mittelalter
Der Aufstieg der Zähringer (1091–1218)
Die Gründung Freiburgs / Der Name »Freiburg« / Die Gestalt des frühen Freiburg / Marktgründung und Stadtrecht / Straßennetz und Mauer / Bächle, Brunnen, Sickergruben / Die drei letzten Zähringer / Die Stadt wächst / Das erste Münster
Die Grafen von Freiburg als neue Stadtherren (1218–1368)
Freiburg wird größer – die Vorstädte / Die Freiburger Wirtschaft im 14. Jahrhundert / Der Freiburger Rappen / Klöster in Freiburg / Das Spital / Der »schönste Turm auf Erden« – Bau und Finanzierung des Münsters / Münsterfabrik und Bauhütte / Die Turmvorhalle / Stadtherr, Bürgerschaft und Rat / Offener Kampf der Bürger gegen den Stadtherrn / Metzger Hauri / Juden in Freiburg / Das Pogrom von 1349 / Das Ende der Grafenherrschaft / Bertold Schwarz / Der neue Chor des Münsters / Das Münster und die Parler
Freiburg unter den Habsburgern (1368–1803)
Martin Malterer und die Schlacht von Sempach / Die Zünfte und die Ratsverfassung / Freiburg als Reichsstadt (1415–1427) / Freiburg als Residenz – Herzog Albrecht VI. von Österreich / Die Gründung der Universität 1457 / Habsburg und Burgund / Die Stadt als Territorialherr / Die Vollendung des Münsters / »Der Kaiser in seiner Stadt« – Freiburg und Maximilian I. / Der Schuh ohne Spitze / Persönlichkeiten der Maximilianszeit / Ein Freiburger als Taufpate Amerikas / Der Freiburger Reichstag von 1497/98 / Das »Collegium Sapientiae« und sein Stifter / Bautätigkeit um 1500 / Freiburg und die Reformation / Der Bauernkrieg / Die Reformation in Basel: Flucht nach Freiburg / Erasmus in Freiburg und Basel / Die Jesuiten in Freiburg / Hexenwahn in Freiburg / Im Dreißigjährigen Krieg / Die Lorettokapelle / Nach dem Krieg ist vor dem Krieg / Freiburg unter der Krone Frankreichs (1677–1697) / Vauban – Ingénieur de France (1633–1707) / Die Rückkehr zum Reich / Die Heldentat des Stadtschreibers / Die Beurbarungsgesellschaft / Die Reformen Maria Theresias / Der »Weiberkrieg« von Freiburg / Die Fortsetzung der Reformen unter Joseph II. / Das Ende der vorderösterreichischen Herrschaft im Breisgau
Freiburg fällt an Modena (1803–1805)
Das Haus Baden – Freiburgs neue Landesherren
Freiburg im Großherzogtum Baden (1806–1918)
Die Befreiungskriege / Freiburg wächst – Die neuen Vorstädte / Die Gründung des Erzbistums – Das Münster wird Dom / Die evangelische Gemeinde / Liberale Tendenzen – und ihr Scheitern / Fortschritt – Industrie und Eisenbahn / Die Revolution 1848/49 in Freiburg / Die Odyssee eines Denkmals / Freiburg nach der Revolution – Die Aussöhnung mit der Staatsmacht / Freiburg wird Großstadt – Die »Wintererzeit«
Freiburg in der Republik Baden (1918–1945)
Freiburg im Nationalsozialismus / Sympathie und Widerstand / Der Bombenkrieg
Französische Besatzung und politischer Neubeginn (1946–2000)
Der Wiederaufbau / Die Expansion nach Westen / Freiburg »Hochburg der Grünen«
Freiburg in der Gegenwart
Anhang
Zeittafel / Herrscher über Freiburg / Bürgermeister und Oberbürgermeister ab 1783 / Erzbischöfe von Freiburg / Literatur / Register / Internetadressen / Bildnachweis / Karte von Freiburg
Vorwort
Eine »Kleine Freiburger Stadtgeschichte« zu schreiben, mag zunächst leicht klingen, denn spätestens seit dem Erscheinen der dreibändigen »Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau« zwischen 1992 und 1996 kann man auf einer soliden Basis aufbauen. Für einen umfassenden Überblick musste man zuvor ins 19. Jahrhundert zurückgehen, bis zu Heinrich Schreibers vorbildlicher Darstellung von 1857/58 oder zu der zweibändigen Stadtgeschichte Joseph Baders von 1882/83. Eine kurzgefasste Darstellung der Freiburger Stadtgeschichte ist seit Leo Alexander Rickers zuletzt 1970 neu aufgelegtem Buch »Freiburg – Aus der Geschichte einer Stadt« von 1964 nicht mehr erschienen.
Bei der ersten Auflage der »Kleinen Freiburger Stadtgeschichte« konnte Freiburg auf ein erfolgreiches 875. Stadtjubiläum elf Jahre zuvor zurückblicken. Schon das Festjahr hatte zu zahlreichen neuen Publikationen angeregt, was sich seither regelmäßig fortgesetzt hat. So darf ich als Autor dankbar auf der Vorarbeit vieler Kolleginnen und Kollegen aufbauen.
Der mit viel Enthusiasmus und Herzblut von Stadt und Bürgerschaft vorbereitete 900. Geburtstag Freiburgs im Jahr 2020 ist durch die weltweite Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Ein Großteil der Veranstaltungen musste abgesagt oder ins Folgejahr verschoben werden. Dennoch sind auch dieses Mal zahlreiche neue Bücher erschienen, in die sich die nunmehr dritte Auflage der »Kleinen Freiburger Stadtgeschichte« einreihen darf.
Der Weg Freiburgs beginnt nicht in den Gründungsjahren der Stadt zwischen 1091 und 1120, sondern hat seine Voraussetzungen in der Topographie der Region und ihrer historischen Entwicklung in vorgeschichtlicher Zeit. Hier setzt die »Kleine Freiburger Stadtgeschichte« ein und spannt den Bogen über Jahrhunderte: von den Herzögen von Zähringen über die Grafen von Freiburg, die Habsburger und die badischen Großherzöge bis in die Gegenwart.
Zu den Aufgaben des Museumsmanns zählt es, größere Zusammenhänge sichtbar und nachvollziehbar aufzubereiten. Ich hoffe, dass mir dies mit der »Kleinen Freiburger Stadtgeschichte« gelungen ist, die sich an Freiburgerinnen und Freiburger ebenso wie an all jene wenden will, die sich für die Geschichte unserer Stadt interessieren. Ich erinnere mich hier in tiefer Dankbarkeit an Frau Prof. Dr. Ingeborg Krummer-Schroth (1911–1998), die uns junge Kunstgeschichtsstudenten seinerzeit im Augustinermuseum in die Museumsarbeit eingeführt hat. Ihr Wirken als akademische Lehrerin, vor allem aber ihre große Fähigkeit, Stadt- und Regionalgeschichte für alle Kreise lebendig und verständlich zu vermitteln, ist mir stets Vorbild und Ansporn für meine eigene Arbeit gewesen. Ich bin dem Pustet-Verlag dankbar, dass er die »Kleine Freiburger Stadtgeschichte« in seine 1999 begonnene Reihe aufgenommen hat. Dankbar bin ich meinem Freund und Kollegen Dr. Hans-Peter Widmann vom Freiburger Stadtarchiv für die kritische Durchsicht schon der ersten Textfassung und seine Anmerkungen. Dem Lektorat des Verlags bin ich ebenso dankbar, weil es in manchen Fällen die Sicht des eingeborenen Freiburgers auf Details, die allzu selbstverständlich vorausgesetzt wurden, relativiert und die eine oder andere Neugewichtung und Ergänzung vorgeschlagen hat, um das Werk auch für einen Leserkreis außerhalb der Stadt zu erschließen.
Freiburg, Frühjahr 2021
Peter Kalchthaler
Topographie und Frühgeschichte
Im Westen durch die Vogesen und im Osten durch den Schwarzwald begrenzt, zeigt sich die südliche Oberrheinregion als breites, in Nord-Süd-Richtung gestrecktes Tal. Klimatisch wie verkehrstechnisch bedeutend ist die nach Südwesten gerichtete Verbindung ins Zentrum Frankreichs über das Becken der Sâone und das Rhônetal zum Mittelmeer durch die zwischen dem Jura und den Südvogesen gelegene Burgundische Pforte. Das Hochrheintal erschließt südlich des Schwarzwaldes einen Weg nach Osten in den Bodenseeraum.
Auf Höhe des Kaiserstuhls, der als Rest eines Vulkans auf die Entstehung der Oberrheinischen Tiefebene als tektonischer Grabenbruch vor 35 bis 20 Millionen Jahren hinweist, treten die Schwarzwaldberge im Bogen nach Osten zurück und formen die Freiburger Bucht. Mehrere Flusstäler bilden Zugänge in den Schwarzwald und die weiter östlich gelegenen angrenzenden Landschaften: im Norden das Elztal und das Glottertal, in der Mitte das Dreisamtal, im Süden das Münstertal mit dem Neumagen. Vor dem Schwarzwald erhebt sich durch das Hexental abgetrennt der Schönberg. Er bildet die höchste Erhebung der Vorbergzone. Kleinere Formationen wie Tuniberg und Nimberg liegen in der Ebene zum Kaiserstuhl.
Das 1994 aufgenommene Luftbild der Altstadt von Süden zeigt den seit der Stadtgründung in allen wesentlichen Zügen erhaltenen Straßengrundriss.
In der Breisgauer Bucht entstand die Stadt Freiburg am Austritt der Dreisam, die zwischen Schlossberg und Sternwald ihr Tal verlässt. Östlich des schmalen Durchbruchs weitet sich das Tal zum Zartener Becken. Die Altstadt liegt am rechten Dreisamufer auf dem durch den Fluss herantransportierten Schwemmfächer aus Kies. Trotz seiner naturgegebenen, strategisch wie verkehrstechnisch außerordentlich günstigen Lage ist Freiburg wesentlich jünger als die beiden anderen Großstädte des südlichen Oberrheins. Straßburg und Basel – beide linksrheinisch gelegen – erlangten auf älteren Wurzeln die Grundlagen ihrer städtischen Entwicklung in der Römerzeit. Auch das einst für die Region namengebende Breisach ist wesentlich älter als der heutige Hauptort des Breisgaus, der seine Entstehung inmitten eines alten Siedlungsraums der Initiative einer adeligen Familie im Hochmittelalter verdankt.
Die ersten Menschen im Breisgau
Archäologische Funde belegen die frühe Besiedlung des Breisgaus seit etwa 200 000 Jahren. Im Freiburger Raum hat der Mensch in der späten Altsteinzeit (12000–8000 v. Chr.) erste Spuren hinterlassen. Mit der Zuwanderung neuer Volksstämme änderte sich die Lebensweise der nomadisch umherziehenden Jäger und Sammler in der Jungsteinzeit (Neolithikum 5600–2200 v. Chr.). Nun betrieben die Menschen Feldanbau und Vorratshaltung von Getreide. Tiere wie Schaf, Ziege, später Schwein und Rind wurden gezähmt und als Haustiere gehalten. Die Einwanderer fanden am Oberrhein ideale Bedingungen: ein gutes Klima, Lössboden, der leicht zu beackern war, Lagerstätten mit Feuerstein für ihre Werkzeuge.
Die Steinzeit endete wiederum mit der Zuwanderung fremder Völker, die neben der bestehenden Bevölkerung lebten und sich allmählich mit dieser vermischten. Sie brachten die Kenntnis der Metallverarbeitung und leiteten den allmählichen Wechsel von der Steinzeit zur Bronzezeit (2200–800 v. Chr.) ein. In der teilweise zeitgleichen Urnenfelderkultur (1200–800 v. Chr.) und in der Hallstattzeit (bis 480 v. Chr.) nahm die Zahl befestigter Höhensiedlungen zu. Gleichzeitig setzte die Differenzierung der Bevölkerung zu verschiedenen spezialisierten Gruppen – Bauern, Krieger, Handwerker – ein. Handwerk und Handel konzentrierten sich zunehmend in den Höhensiedlungen, die auch zum Sitz einer Oberschicht wurden. Neben die Bronze trat das Eisen als metallischer Werkstoff. Ungeklärt ist, ob man schon damals die spätestens seit der Römerzeit ausgebeuteten Erzlagerstätten der Region nutzte.
In der Späthallstatt- und Frühlatènezeit (um 600–ca. 400 v. Chr.) befand sich auf dem Breisacher Münsterberg ein Fürstensitz, für den sich wie in anderen gleichartigen Siedlungen Handelsverbindungen bis in den Mittelmeerraum nachweisen lassen. Dies belegen auch die Funde in den zahlreichen imposanten Hügelgräbern jener Zeit. Die Bewohner Breisachs und seiner Umgebung waren Kelten und gehörten vermutlich dem Stamm der Rauriker an, der seinen Siedlungsschwerpunkt am Rheinknie bei Basel hatte.
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts wurden die Höhensiedlungen aufgegeben und es entstanden Großsiedlungen, die man mit dem von Cäsar übernommenen römischen Namen als »Oppida« bezeichnet. Ihr mögliches Ausmaß verdeutlicht das Oppidum Tarodunum im Zartener Becken, das eine Fläche von 200 ha einnahm und von einer sechs Kilometer langen Mauer umgeben war.
Kelten und Römer
Nach der durch Cajus Iulius Cäsar vollendeten Eroberung Galliens drangen die Römer zur Regierungszeit Kaiser Augustus’ (27 v. Chr.–14 n. Chr.) vom Elsass her auf rechtsrheinisches Gebiet vor. Unter Kaiser Claudius gelang die endgültige Eroberung des so genannten Dekumatlandes. In den beiden folgenden Jahrhunderten schufen die Römer jene Infrastruktur, die für die weitere geschichtliche Entwicklung der Region wegweisend bleiben sollte. Zur Sicherung des Hinterlandes und zur Gewährleistung des Nachschubs bauten sie Militärstationen wie das Versorgungs- und Legionslager bei Sasbach oder das Kastell in Riegel. Neben den genannten Stationen sicherten in der Spätantike militärische Einrichtungen wie die Kastelle bei der Burg Sponeck und auf dem Breisacher Münsterberg diese Grenzregion des Römischen Reiches.
Außer der wichtigen Nord-Süd-Verbindung gab es vom Rheintal aus mehrere Fernwege in den Schwarzwald. Das Kastell Riegel war über Denzlingen und das Glottertal mit dem Kastell bei Hüfingen verbunden. Am Ausgang des Dreisamtals, von wo eine zweite, ältere Aufstiegsroute über das Zartener Becken und das Wagensteigtal nach Osten in den Schwarzwald führte, gab es aber offenbar keinen Militärstützpunkt. Weder für das wegen dort gefundener Mosaikreste vermutete Kastell auf dem Schlossberg noch für eine Villa rustica im Bereich der späteren Burg haben sich weitere Belege finden lassen, und auch die wenigen römischen Scherben, die bei Grabungen in der Freiburger Altstadt zutage gekommen sind, beweisen keineswegs die Existenz einer Siedlung in der Römerzeit.
Neben dem guten Ausbau des Straßennetzes begann in dieser Zeit die Erschließung von Bodenschätzen in größerem Ausmaß, wie archäologische Funde bei Sulzburg belegen. Ansonsten war der Breisgau in der relativ friedlichen Phase bis zum 3. Jahrhundert weitgehend ländlich geprägt, das heißt durch wenige Vici – ausgedehnte Siedlungen wie Breisach, Riegel, Umkirch und Krozingen – und vor allem durch Gutshöfe. Ein Beispiel ist die Villa urbana von Heitersheim, die sich durch Größe und architektonischen Anspruch als Sitz einer einflussreichen Familie ansprechen lässt. Das einzige bedeutende städtische Zentrum des südlichen Oberrheins und des Hochrheins war Augusta Raurica nahe Basel, das in augusteischer Zeit als Veteranenkolonie gegründet worden war.
Spätrömische Zeit und frühes Mittelalter
Im 3. Jahrhundert traten zunehmend die Alamannen auf den Plan, die in den Quellen zur römischen Geschichtsschreibung seit 213 genannt werden. Den Namen kann man keinem bestimmten Volk zuordnen; es handelt sich vielmehr um den Zusammenschluss einzelner, jeweils von Kleinkönigen oder Kleinfürsten regierter, kriegerischer Stämme. Nach dem Fall des Limes 259/60 drängten sie die Römer mehr und mehr an den Rhein zurück. Nun wurde der Breisacher Münsterberg zum starken Grenzkastell ausgebaut. Ein Edikt Kaiser Valentinians nennt 369 erstmals seinen Namen: Brisiacum.
Bis zum Abzug der Truppen über die Rheingrenze nach dem Jahr 400 blieb Breisach mit römischem Militär belegt und wurde danach von den Alamannen übernommen. Trotz der Berichte über kriegerische Auseinandersetzungen überwogen im Verhältnis der Römer zu den Alamannen die Zeiten friedlichen Miteinanders. So gab es im römischen Heer Alamannen in hohen Positionen, und in deren Siedlungen und Gräbern lässt sich seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts die weitgehende Übernahme der römischen Zivilisationsgüter beobachten. Somit bildete der Breisgau als Teil des Dekumatlandes keine eigentliche Grenzregion, in der sich zwei Völker feindlich gegenüberlagen, sondern ein gemeinsam genutztes und bewohntes Zwischengebiet.
Auf dem schon in keltischer Zeit besiedelten Zähringer Burgberg nördlich von Freiburg war bereits im 4. Jahrhundert eine alamannische Höhensiedlung entstanden. Auf einem künstlich geschaffenen Plateau wurde hier ein repräsentativer Königsitz angelegt, der nach Ausweis der archäologischen Funde zumindest für den nördlichen Breisgau eine zentrale Funktion besaß. Die beherrschende Lage am Rand des Schwarzwaldes hatte schon zuvor für eine Besiedlung des Burgbergs gesorgt und war in der Folge wohl auch ausschlaggebend für die Auswahl dieses Platzes durch die Herzöge von Zähringen als Ort, der dem Geschlecht den Namen gab. Die alamannische Siedlung scheint jedenfalls bis um 500 bestanden zu haben. In spätmerowingisch-karolingischer Zeit war der Berg nochmals besiedelt, wiederum mit einer großen Anlage, doch auch dieser im 8. und 9. Jahrhundert bestehende Ort wurde aus unbekannten Gründen wieder aufgegeben.
Die Ansicht der Burgruine Zähringen stammt aus Johann Daniel Schöpflins »Historia Zaringo Badensis«, die im Auftrag von Markgraf Karl Friedrich von Baden verfasst wurde und 1763/66 in Karlsruhe erschienen ist.
Nach der »dunklen«, weil urkundenarmen Zeit zwischen dem Ende der römischen Herrschaft und der Karolingerzeit im 8. Jahrhundert bilden große Klöster einen bedeutenden Herrschaftsfaktor im Breisgau. Dies gilt in erster Linie für St. Gallen in der Schweiz, Benediktiner-Reichsabtei seit Beginn des 9. Jahrhunderts, das hier umfangreiche Güter, vor allem am Schönberg, erwerben konnte. Auch das Zartener Tal war im frühen Mittelalter Sankt Galler Besitz. Kirchenpatrozinien wie Sankt Gallus in Merzhausen und Kirchzarten weisen noch heute auf die ehemaligen Besitzverhältnisse hin. Das 762/63 von einem Breisgaugrafen gegründete, ebenfalls königliche Kloster Lorsch an der Bergstraße unweit von Worms hatte Besitztümer am Nimberg, am Kaiserstuhl und am Schönberg. Die Pfarrkirche Sankt Hilarius in Ebnet sowie der von verschiedenen Gemeinden im Breisgau abzuleistende »Säckinger Zehnt« zeigen eine alte Verbindung zum Frauenkloster in Säckingen am Hochrhein.
Herzog Burchard II. von Schwaben und seine Frau Reginhild gründeten im frühen 10. Jahrhundert das Frauenkloster Sankt Margarethen in Waldkirch und statteten es mit umfangreichen Gütern in der Umgebung aus. Nach der Mitte des Jahrhunderts übertrug Kaiser Otto I. der Schweizer Benediktinerabtei Einsiedeln zahlreiche Besitzrechte im nördlichen Breisgau, darunter Betzenhausen und Ebnet. Die Königsmacht wurde wie in anderen Regionen des Reichs auch im Breisgau durch Grafen vertreten, die hier seit der Mitte des 8. Jahrhunderts bezeugt sind. Sie hatten im Auftrag des Königs für Frieden und Recht zu sorgen, waren für Wege- und Brückenbau zuständig und kümmerten sich um militärische Belange wie das Ausheben von Truppen.
Der Aufstieg der Zähringer (1091–1218)
Die Situation wenige Jahrzehnte vor der Gründung Freiburgs beleuchtet eine Urkunde, mit der Kaiser Heinrich II. dem Basler Bischof Adalbero im Jahr 1008 seinen Wildbann im nördlichen Breisgau übertrug. Mit einem solchen Jagdprivileg waren nicht unerhebliche Einkünfte verbunden. Die Beschreibung der Grenzen des Jagdgebietes nennt zahlreiche Orte in der unmittelbaren Umgebung der späteren Stadt, darunter die heutigen Stadtteile Herdern, Zähringen, Tiengen, Uffhausen, Adelhausen und die Wiehre. Der Bischof von Basel war einer der bedeutendsten Herrschaftsträger im Breisgau. 1028 übertrug ihm Heinrichs Nachfolger Kaiser Konrad II. seine Rechte an Breisgauer Silbergruben, darunter jenen bei Sulzburg.
Im Jahr 1004 wurde mit Bertold (auch »Bezzelin von Villingen«) erstmals ein direkter Vorfahr der Zähringer als Graf im Breisgau genannt und 1016 als Graf in der Ortenau fassbar. Die alte alamannische Adelsfamilie der »Bertolde« oder »Alaholfinger« saß ursprünglich in Weilheim unter Teck und hielt auf der Baar und im Neckartal umfangreichen Besitz. Im Jahr 999 hatte Bertold von Kaiser Otto III. ein Marktprivileg für seinen Ort Villingen erhalten. Seinem Sohn Bertold I. »dem Bärtigen«, Graf im Albgau, im Thurgau, in der Ortenau und im Breisgau sowie Vogt des Stiftes Bamberg, hatte Kaiser Heinrich III. angeblich die schwäbische Herzogswürde zugesagt. Die Kaiserwitwe Agnes vergab den Titel nach 1056 jedoch an Rudolf von Rheinfelden. Als Ausgleich wurde Bertold I. im Jahr 1061 mit dem Herzogtum Kärnten belehnt, wonach er alle Grafschaften bis auf die des Breisgaus seinem Sohn Hermann übertrug, der nun zusätzlich den Titel »Markgraf« nach der Kärnten zugehörigen Mark Verona führte. Er ist der Stammvater des Hauses Baden.
Kaiser Heinrich IV. entzog Bertold I. im Jahr 1077 das Herzogtum Kärnten, da dieser sich der südwestdeutschen Fürstenopposition gegen den König angeschlossen und die Wahl Rudolfs von Rheinfelden zum Gegenkönig unterstützt hatte. Den Breisgau erhielt Bischof Werner II. von Straßburg zu Lehen. Mit militärischen Mitteln setzte hier Bertold II. nach dem Tod seines Vaters 1078 die Herrschaft seiner Familie durch. Er verwüstete den Breisgau, eroberte unter anderem die Burg Wiesneck im Dreisamtal, beschlagnahmte Besitztümer des Klosters Sankt Gallen und setzte mit seinen Aktionen die Bischöfe von Straßburg und Basel als wichtige Parteigänger Heinrichs IV. unter Druck.
Erst im Jahr 1090, nach dem Tod Bertolds von Schwaben, dem Sohn Rudolfs von Rheinfelden, konnte Bertold II., der sich als Erster »von Zähringen« nannte, den 1080 verstorbenen Gegenkönig, mit dessen Tochter er verheiratet war, beerben und kam so in den Besitz größerer Gebiete am Hochrhein und in der Westschweiz. Damit rückte der Breisgau endgültig in den Mittelpunkt des Familieninteresses. Bertold II. verzichtete auf den Wiederaufbau des 1077 zerstörten Hausklosters seiner Familie in Weilheim unter Teck und gründete stattdessen die Benediktinerabtei Sankt Peter im Schwarzwald, deren erste Kirche 1093 geweiht wurde.
Die Gründung Freiburgs
Im Gegensatz zu der als Lehen des Reichs gehaltenen Burg Zähringen hatte die Familie das Gelände am Ausgang des Dreisamtales als Eigenbesitz inne. Hier gründete Bertold II. seinen Ort Freiburg. Es gibt keinen Grund, an dem erst in späteren Quellen genannten Gründungsdatum 1091 für Burg und Stadt zu zweifeln. Mit dem Jahr 1120 für die Einrichtung des Marktes durch Konrad, den Sohn Herzog Bertolds II., haben wir die Eckdaten der Stadtentstehung. Sie scheint in der Tat auf weitgehend unbebautem Gelände inmitten wesentlich älterer Siedlungen entstanden zu sein, die allerdings keinesfalls als Vorgänger oder »Keimzellen« Freiburgs angesprochen werden können. Bemerkenswert ist jedoch die Übernahme eines bestehenden, alten Straßensystems in die neue Stadt.
Die alte Kirche Sankt Peter – mit einigen Häusern an der Straße nach Breisach im Westen der späteren Stadt gelegen und im 17. Jahrhundert im Zuge des Festungsbaus abgebrochen – war Filiale von Umkirch, das wiederum dem Bischof von Basel unterstand. Offenbar waren Kirche und Weiler altes Reichsgut, denn noch im Spätmittelalter hatten die Bewohner Zinsen an den Reichsvogt auf Burg Zähringen zu zahlen.
Ein weiterer vorstädtischer Siedlungskern wird um die Martinskirche angenommen, doch fehlt auch hier jeglicher archäologische Befund. Ausgangspunkt der These ist die Vermutung, es habe sich bei der 1246 an die Franziskaner geschenkten Martinskapelle um die Hauskirche eines fränkischen »Herrenhofs« gehandelt. Das bei den Franken häufige Martinspatrozinium gilt dabei als Indiz für das hohe Alter der Kirche. Wann der spät erwähnte Hof bei der Martinskirche jedoch entstand und zu welchem Zeitpunkt er in den Besitz der Zähringer kam, lässt sich nicht klären. Deshalb bleibt die Existenz einer vorstädtischen Siedlung bei Sankt Martin nach wie vor eine offene Frage.
Zur Burg auf dem Schlossberg gehörten eine in der Oberau gelegene Mühle und ein Wirtschaftshof, der zwischen dem späteren Schwabentor und Kloster Neu-Adelhausen lokalisiert wird. Daneben gab es eine kleinere Siedlung für Dienstleute des Herzogs zu Füßen der Burg, ebenfalls in der »Oberen Au«. Vielleicht entstand schon damals eine erste Brücke über die Dreisam und verband die südlich des Flusses verlaufende Talstraße mit der alten Weggabelung bei Oberlinden. Um 1100 hat Bertold II. dann im Bereich Oberlinden eine neue Siedlung angelegt, die sich südlich der schon zuvor vorhandenen Salzstraße nach Westen zog. Sie bildete die nördliche der drei Gassen des ersten Wegenetzes. Die beiden anderen Wege sind die heutige Grünwälderstraße und die Gerberau. Wo das Vorbild Bertolds II. für seine Gründung lag, ist unklar. Vermutlich hat die in Burgund und im westfränkischen Raum häufig anzutreffende Siedlungsform des »burgus« eine Rolle gespielt, jene auf herrschaftliche Initiative zurückgehenden, nicht mehr rein agrarisch geprägten, sondern auch Handwerk und Handel gewidmeten, nicht ummauerten Orte bei einer Burg oder einem Kloster.
HINTERGRUND
DER NAME »FREIBURG«
Die Siedlung Bertolds II. trug bereits den Namen »Freiburg«. Man bezog diesen Namen gerne auf die rechtliche Stellung der Bewohner, denen der Stadtherr zahlreiche Privilegien zukommen ließ. Inzwischen wurde aber darauf hingewiesen, dass man die Namensgebung ganz anders deuten muss:
1090 war König Heinrich IV. nach Italien gezogen, wo er sechs Jahre blieb und das Reich damit königslos hinterließ. Im selben Jahr wurde Bertold II. von Zähringen Erbe des rheinfeldischen Hausbesitzes und übernahm auch den Anspruch auf das Herzogtum Schwaben, das einst seinem Vater zugesagt und zugunsten Rudolfs von Rheinfelden verweigert worden war. Heinrich IV. wiederum hatte Rudolf die Herzogswürde aberkannt und Friedrich von Staufen als Herzog in Schwaben eingesetzt. 1092 wählten die Gegner Heinrichs IV. den Zähringerherzog Bertold II. dann tatsächlich zum Gegenherzog des Staufers. Schon bei seiner Stadtgründung 1091 hatte Bertold vermutlich auch über Reichsgut verfügt und übte damit in seinem Anspruch als höchster Vertreter des Reichs in Schwaben »freies«, das heißt »königliches« Recht aus, was er im Namen seiner Gründung zum Ausdruck brachte.
Nach dem Ausgleich mit den Staufern im Jahr 1098 und dem Verzicht auf den schwäbischen Herzogstitel erhielt Bertold II. von Kaiser Heinrich IV. die Stadt Zürich als Reichslehen und dürfte auch wieder die Verfügung über die erstmals 1128 urkundlich genannte Reichsburg Zähringen erlangt haben, nach der er »dux de Zahringen« genannt wird. Der noch immer geführte Titel eines Herzogs belegt den neu gefestigten Status der Zähringer trotz des Verzichts auf Schwaben. Manche Zeitgenossen sahen in diesem vom König verliehenen Herzogtum jedoch einen »leeren« – weil nicht mit einem Herrschaftsgebiet verbundenen – und somit angemaßten Titel. Der den Staufern nahe stehende berühmte Chronist Otto von Freising empfand sogar eine Störung der gottgewollten Ordnung. Dieser scheinbare Makel erklärt, warum die Zähringer stets danach trachteten, sich gegenüber dem Königtum durch Leistungen verdient zu machen. Nur damit konnten sie den Titel dauerhaft für die Familie sichern.
Die Gestalt des frühen Freiburg
Noch bei der 850-Jahrfeier im Jahr 1970 war man davon ausgegangen, dass sich keine Bausubstanz aus der Gründungsphase der Stadt erhalten hat. Durch Grabungen und Bauuntersuchungen hat sich seither aber in vielen Details eine Neubewertung ergeben. Die um 1980 einsetzende Erforschung der vor allem um Oberlinden zahlreich vorhandenen Tiefkeller förderte bedeutende Reste der Zeit zwischen 1135 und 1180 zutage. Der umfangreiche Baubestand der spätromanischen Zeit belegt auch die Förderung des jungen Gemeinwesens durch die Stadtherrschaft. Die bisher ältesten baulichen Zeugnisse fanden die Archäologen des Landesdenkmalamtes auf dem Areal der »Harmonie« zwischen Grünwälderstraße und Gerberau, das 1990 nach dem Abbruch der alten Bebauung und vor dem Neubau eines Kinokomplexes untersucht werden konnte. Die Befunde weisen auf die Zeit um 1100, eine intensive Nutzung scheint allerdings erst im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts, nach Fertigstellung der 1120/30 begonnenen Stadtmauer, eingesetzt zu haben.





























