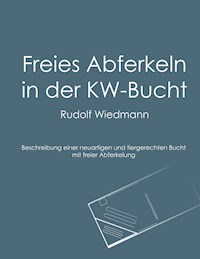
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Fixierung der Sauen über lange Zeiträume in Kastenständen geht dem Ende zu. In diesem laufenden Prozess ist der Schritt in die freie Abferkelung wohl der größte und zugleich schwierigste. Schließlich geht es nicht nur um die Forderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft sondern um das Wohl der in den Ställen arbeitenden Menschen und um die gleichwertige Achtung gegenüber Geschöpfen, egal ob es sich um ein 1.000 Gramm schweres Ferkel oder um eine 300 kg schwere Zuchtsau handelt. Dieser Veränderungsprozess, der sicher nicht mehr umkehrbar sein wird, braucht mit Sicherheit eine Zeitspanne von mindestens 10 Jahren. Nötig ist die Unterstützung und Begleitung, sei es von der Zucht, der Fütterung, dem Management und vor allem auch von der Haltung. Dieses Buch liefert vor allem die Grundlagen für möglichst vorhersehbare Funktionsabläufe im Abferkelbereich aus Sicht der Haltung. Im Vordergrund stehen dabei nicht die gesetzlichen Minimalforderungen sondern der Blick auf das langfristige Ganze und mögliche künftige Entwicklungen. Die Berücksichtigung der Ansprüche der Tiere führt im Ergebnis zu langlebigen Sauen mit relativ niedrigem Medikamenten- und Betreuungsaufwand. Letztendlich ist für die Wirtschaftlichkeit der Sauenhaltung nicht nur die Zahl an abgesetzten Ferkeln je Sau und Jahr entscheidend sondern die Optimierung von Kosten und Leistungen. Letztendlich sollen die Schweineställe einen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz und zur Freude seiner Bewirtschafter leisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kraft für große Dinge
kommt aus der intensiven Betrachtung der kleinen Dinge
(Gerd Brucerius)
Inhalt
Vorwort
Ferkelführende Sauen in Kastenständen zu halten, ist laut Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung nach dem aktuellen Tierschutzrecht nicht verboten. In der Tierschutzdiskussion sollen aber künftig im Deck- und Abferkelstall nur noch kurze Zeiträume für die Fixierung gelten. Ferkelführende Sauen dürfen spätestens ab dem 9. Februar 2036 nur noch 5 Tage rund um die Geburt fixiert werden. Aber schon vor Fristende gilt, dass bei Neu- und Umbauten sofort mindestens 6,5 m2 große Bewegungsbuchten zu planen sind.
Wer nach Mindestanforderungen plant, läuft Gefahr von den politischen Vorgaben getrieben zu werden. Diese ständige Anpassung wird für Betriebe nicht zu vermeiden sein, die weiterhin im Export bestehen wollen. Dieser Markt ist großen Preisschwankungen und vor allem einem großen Kostendruck ausgesetzt, dem die Mehrzahl der deutschen Schweinehalter nicht standhalten kann. Bau,- Arbeits-, Energie-, Genehmigungskosten usw. sind in Deutschland auf einem Niveau, das es in ähnlicher Höhe nur in der Schweiz, Norwegen und Schweden gibt. Für diese Länder sind bekanntlich Exporte keine Frage, weil ihre Produktionskosten dafür zu hoch sind. Deshalb liegt in diesen Ländern der Selbstversorgungsgrad an Schweinefleisch unter 100%, z.B. in Schweden bei 75%.
Der starke Rückgang der Ferkelerzeugerbetriebe in Deutschland spricht eine deutliche Sprache: Viele wollen und können sich nicht mehr dem ständigen Druck von der Kostenseite als auch von der Gesellschaft aussetzen, immer noch kostengünstiger erzeugen zu müssen. Vielen ist längst klargeworden, dass es für ein angemessenes Familieneinkommen das Weiter und Größer als bisher nicht geben kann.
Da in Deutschland die Tierwohl- und Tierschutzthemen nicht mehr wegzudenken sind und die Kostenführerschaft nicht gelingen kann, spricht einiges dafür, auf die gesellschaftlichen Forderungen einzugehen. Dieser finanziell sehr aufwendige und beschwerliche Weg hat das Ziel, mehr Einkommen durch Qualität als durch Quantität zu erzielen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Haltung der ferkelführenden Sauen. Wie groß können oder müssen Freilaufbuchten sein? In welchen Phasen ist ein Kastenstand überhaupt noch erlaubt? Wieviel Platz braucht man, um Saugferkelverluste möglichst niedrig zu halten und die Arbeitswirtschaft nicht zu überfordern?
Die KW-Abferkelbucht ist das Ergebnis von mehr als 65 Jahren Beobachtung von Verhaltens- und Arbeitsabläufen in Abferkelställen, verbunden mit der Suche nach praktikablen Lösungen. Dieses Buch gibt einen Überblick über Bau, Funktionsweise, Bewirtschaftung und alle relevanten Details.
Ohne sehr weitsichtige und engagierte Schweinehalter hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können. Deshalb gilt mein Dank allen jungen und jung gebliebenen Schweinehaltern und -halterinnen, Angehörigen und Freunden, die Tag für Tag durch ihr Tun, ihr kritisches Urteil, ihre Kommunikationsbereitschaft und nicht zuletzt ihr Durchhaltevermögen die Entwicklung der KW-Bucht ermöglichten.
Thomas König aus Willstätt hat als Erster 72 KW-Buchten eingebaut. Deshalb trägt sie auch den Namen KW-Bucht: K steht für König und W für Wiedmann.
1 Rechtliches und gesellschaftliches Umfeld
Abferkelbuchten sind in Ferkelerzeugerbetrieben der aufwendigste und anspruchsvollste Stallbereich. Einerseits sind dafür die Baukosten relativ hoch und andererseits verlangt der Abferkelstall auch den relativ den höchsten Arbeitsaufwand. Letztlich entscheidet der Abferkelstall über die Zahl und Qualität der abgesetzten Ferkel, nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen in der Ferkelerzeugung. Die Frage steht im Raum wie die künftigen Abferkelställe mit den Forderungen unserer Gesellschaft in Einklang gebracht werden können, deren erklärtes Ziel die freie Abferkelung ist.
1.1 Blick über die Grenzen
Nach der Richtlinie 2008/120/EG – Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen – muss ein freier Bereich vorgesehen werden, um ein selbstständiges oder unterstütztes Abferkeln zu ermöglichen. Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Regelungen freier Abferkelsysteme in EU- und Nicht-EU-Ländern.
CH
CZ
DK
DE
NL
NOR
SWE
UK
AUT
Kastenstände
-
+
+
+
+
-
-
+
+
Verbot ab
2007
2036
2009
1971
2033
Übersicht 1: Regelungen in verschiedenen europäischen Ländern
1.2 Bewegungsbuchten sind nur Zwischenschritte
Die nur kurzzeitige Fixierung der Sau während der Geburt und/oder einige wenige Tage danach in sogenannten Bewegungsbuchten ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zur freien Abferkelung. Ein solches Szenario beruht auf der trügerischen Hoffnung, dass man mit solchen Bewegungsbuchten bei Problemen ohne weiteres wieder zurück zum Kastenstand gelangen kann. In Bewegungsbuchten als eine Art Zwitterlösung von fixierter und freier Haltung ist es jedoch nicht möglich, die relativ anspruchsvollen Herausforderungen zu meistern. Sie werden eher für manche den Beweis liefern, dass die freie Abferkelung zu hohe Saugferkelverluste verursacht, darüber hinaus für das Stallpersonal gesundheitsgefährdend ist und nur zu einem Mehr an Investitions- und Arbeitskosten führt. Mittel- und langfristig heißt deshalb die Devise: Freies Abferkeln und kein kostenträchtiger Umweg über Bewegungsbuchten.
Eine starke Hervorhebung des Tierschutzes birgt in einem globalisierten Markt, in dem es vor allem nach dem Preis geht, die Chance, sich von der Konkurrenz abzuheben. Lebensmittel finden nicht nur durch Regionalität ihre Wertschätzung, sondern vor allem durch eine Führerschaft in der Prozessqualität. Das freie Abferkeln ist eine Art Prüfstein auf diesem Weg. Zwei zentrale Anliegen der Abschaffung des Kastenstandes – die ungestörte Ausübung des Nestbauverhaltens und die Trennung von Liege- und Eliminationsbereich – sind mit Bewegungsbuchten und der zeitweisen Fixierung der Sau nicht zu erreichen (E. GROSSE BEILAGE). Da Sauen immer weniger Erfahrungen mit der Eingewöhnung in Kastenständen sammeln können, ist deren Fixierung in einer besonders herausfordernden Phase der Geburt kontraproduktiv, insbesondere trifft das für Jungsauen zu. Da es in Bewegungsbuchten keine klare Trennung zwischen Liege- und Kotbereich gibt entsteht bei Einstreuverfahren ein erheblicher Arbeitsaufwand.
1.3 Gesetzliche Vorgaben sind nur Minimalanforderungen
Immer wieder wird irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass die gesetzlichen Vorgaben für die Tiere optimal sind. Dabei handelt es sich aber über weite Strecken nur um Mindestvorgaben, die man nicht unterschreiten darf. Sie bieten weder die Gewähr für hohe Produktionsleistungen, noch für günstige Arbeitsabläufe, noch für möglichst gesunde Tiere. Ferkelerzeuger sollten sich also nicht auf die gesetzlichen Mindestanforderungen zurückziehen – diese können sich oft schnell durch Urteile ändern - sondern fragen, was die absehbare Zukunft gebietet.
2 Schwachstellen der Abferkelung im Kastenstand
Neuere Entwicklungen entstehen dann, wenn vorhandene Systeme Schwachstellen aufweisen, die auf Dauer nicht akzeptiert werden können. Ganz abgesehen von der sehr geringen Akzeptanz der Kastenstände von Seiten der Konsumenten gibt es auch eine Reihe fachlich begründeter Schwachstellen, die mit Kastenstandhaltung verbunden sind:
Zu allererst steht das Nestbauverhalten, das in Kastenständen nicht durchgeführt werden kann. Einerseits kann sich die Sau in Kastenständen weder vorwärts bewegen noch drehen und andererseits erfüllt Nestbaumaterial in Form von Jutesäcken am Kastenstand oder geringen Mengen an Kurzstroh für Nestbauverhalten nicht ausreichend den Zweck. Damit wird ein deutlich negativer Einfluss auf die Geburtsdauer insgesamt und den zeitlichen Abstand zwischen der Geburt einzelner Ferkel hingenommen.
Verminderte Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zwischen Sau und Ferkeln.
Höheres Erkrankungsrisiko durch Milchfieber (MMA-Syndrom). Die Haltung der Sauen findet über fast das ganze Leben in Gruppenhaltung statt (nicht nur in der Aufzuchtphase bis zum deckfähigen Alter sondern auch über die gesamte Trächtigkeit hinweg). Gruppenhaltung ermöglicht artspezifisches Verhalten, da die Funktionsbereiche für Liegen, Fressen, Trinken, Koten und Harnen mehr oder weniger deutlich räumlich voneinander getrennt sind. Dieses Verhalten wird durch die Aufstallung der Sauen in einen Kastenstand jäh verhindert. So verwundert es nicht, dass durch die massiv eingeschränkte Bewegungsfreiheit ein Teil von Sauen mit Kotverhalten reagiert.
Behinderung der Ferkel beim Säugeakt durch das Gestänge des Kastenstandes, insbesondere bei großen Würfen.
Schulterläsionen durch das vermehrte Liegen an immer derselben Stelle. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Tiere direkt hinter dem Trog auf feuchtem Untergrund liegen.
Verschmutzung empfindlicher Körperbereiche wie der Vulva, da säugende Sauen in einem Kastenstand Liegen, Fressen, Koten und Harnen müssen.
Unnatürliches Abliegen, aber vor allem sehr erschwertes Aufstehen. Beim Aufstehen ohne Einschränkungen durch Stalleinrichtungen wie den Kastenstand, geht die Sau zunächst von der Seiten- in die Bauchlage über. Dies ist in Kastenständen nur ansatzweise möglich. Danach rutscht die Sau nach hinten (auch dafür ist nur sehr wenig Platz), um sich auf die Vorderbeine zu stellen. Nun holt die Sau Schwung nach vorne, um die Hinterbeine hochzubringen (Dafür sind die Kastenstände zu kurz). Die Abliegevorgänge beim Schwein sind also denen des Pferdes ähnlich. Anders ist es beim Abliegen: Dazu gehen Schweine zunächst mit den Vorderbeinen in die Kniestellung, um danach behutsam ihr Hinterteil auf dem Bauch abzulegen (wie es auch beim Rindvieh üblich ist). Aufgrund der Einschränkungen im Kastenstand kann angenommen werden, dass Sauen weniger aufstehen, um zu fressen, zu trinken oder eine bequemere Liegeposition einzunehmen.
Das beschriebene unnatürliche Aufstehen begünstigt auf perforierten Böden Zitzenverletzungen. Dies gilt insbesondere bei rutschigen Böden oder Tieren mit beeinträchtigten Fundamenten wie z.B. bei älteren Sauen.
2.1 Entscheidend ist die Gesamtmortalität
Für die Bewertung der Wurfleistung wird die Gesamtmortalität – die Summe der totgeborenen und während der Säugephase verendeten Ferkel – herangezogen. Da die Mehrzahl der totgeborenen Ferkel üblicherweise lebensfähig wäre, muss die Reduzierung der Saugferkelverluste auch hier ansetzen (E. GROSSE BEILAGE). So lag in Deutschland die Gesamtmortalität bis Ende der Säugezeit im Wirtschaftsjahr 2017/2018 im Durchschnitt bei 22,9% entsprechend 3,7 totgeborenen/verendeten und 12,3 abgesetzten Ferkeln pro Wurf (E. GROSSE BEILAGE). Nachfolgende Übersicht zeigt die Gesamtmortalität in verschiedenen europäischen Ländern mit und ohne Fixierung im Kastenstand.
Land
Haltung in der Abferkelbucht
Gesamtmortalität
Totgeborene/verendete Ferkel pro Wurf
Abgesetzte Ferkel pro Wurf
Deutschland Dänemark
Kastenstand Kastenstand
22,9% 22,6%
3,7 4,3
12,3 14,7
Norwegen
Ohne Fixierung
18,8%
2,9
12,3
Schweden
Ohne Fixierung
23,7%
3,8
11,9
Schweiz
Ohne Fixierung
19,4%
2,6
11,6
Übersicht 2: Gesamtmortalität von Ferkeln bis Ende der Säugezeit (E. GROSSE BEILAGE)
Die freie Abferkelung führt also nicht zu einer höheren Gesamtmortalität bei den Ferkeln, was die Ergebnisse aus Praxisbetrieben in den angeführten Ländern deutlich zeigen. Es gilt als gerechtfertigt, die verschiedenen Todesursachen bei Feten und neugeborenen Ferkeln als gleichwertig zu behandeln. Es macht keinen Unterschied, welches Ereignis letztlich zum Tod geführt hat. Auch für den Tierhalter ist aus wirtschaftlicher Sicht die Gesamtmortalität in Verbindung mit der Anzahl der abgesetzten Ferkel entscheidend. Zielführend sind nicht nur die finalen Todesursachen wie „Erdrücken“ oder „Verhungern“, sondern die primären Ursachen wie z.B. Wurfgröße, Körpergewicht, Geburtsdauer, Unterkühlung, Sauerstoffmangel, Kolostrumaufnahme, Stall- und Bodentemperatur, Zugang zum Gesäuge, Nähe zum Ferkelnest, usw.
2.2 Was steht der freien Abferkelung entgegen
In erster Linie sind dies die höheren Saugferkelverluste. Es ist eine Mammutaufgabe im „Magischen Dreieck“ zwischen den Anforderungen des Muttertieres, denen neugeborener Ferkel und den wirtschaftlichen Zwängen des Halters eine Balance für alle Beteiligten zu finden. Nicht zu akzeptieren und sehr gravierend sind ohne Zweifel höhere Saugferkelverluste. Während in Kastenständen ca. 15% Saugferkelverluste auftreten, liegen sie bei aktuellen Gegebenheiten beim freien Abferkeln meist zwischen 5 bis 10% höher.
Die Saugferkelverluste können auch noch darüber liegen wie folgende Übersicht zeigt:
Saugferkelverluste in Abhängigkeit von der Zahl lebend geborener Ferkel bei freiem Abferkeln (n=51)
Ferkelverluste, St.
Anteil Sauen, %
Lebend geb. Ferkel je Wurf
Abgesetzte Ferkel je Wurf
Ferkelverluste, %
0-1
47
10,2
9,8
4





























