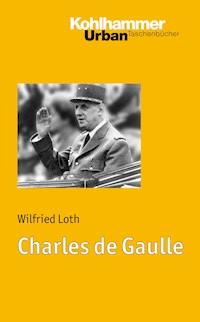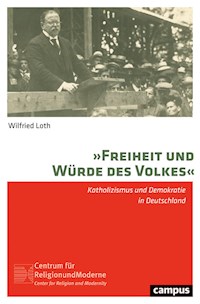
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Religion und Moderne
- Sprache: Deutsch
Der Katholizismus zählte nicht zu den Pionieren der Demokratisierung in Deutschland. Gleichwohl ergaben sich aus den sozialen Bewegungen, mit denen er verknüpft war, und der Oppositionsrolle, die ihm im Zuge des "Kulturkampfs" zuwuchs, Impulse, die die Entwicklung zu einer Demokratie förderten. Dieses Buch zeichnet das Verhältnis von Katholizismus und Demokratie nach - von der Stigmatisierung in der Bismarckära über ihren Beitrag zur Parlamentarisierung der Weimarer Republik und zum Widerstand im "Dritten Reich" bis hin zur Entstehung der Nachkriegsordnung nach 1945.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried Loth
»Freiheit und Würde des Volkes«
Katholizismus und Demokratie in Deutschland
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Der Katholizismus zählte nicht zu den Pionieren der Demokratisierung in Deutschland. Gleichwohl ergaben sich aus den sozialen Bewegungen, mit denen er verknüpft war, und der Oppositionsrolle, die ihm im Zuge des »Kulturkampfs« zuwuchs, zahlreiche Impulse, die die Entwicklung zu einer parlamentarischen Demokratie förderten. Dieses Buch zeichnet die konflikthafte Entwicklung des Verhältnisses von Katholizismus und Demokratie in Deutschland nach – von der Stigmatisierung der Katholiken zu »Reichsfeinden« in der Bismarckära über ihren Beitrag zur Parlamentarisierung des Deutschen Reichs im Übergang zur Weimarer Republik und zum Widerstand im »Dritten Reich« bis hin zur Entstehung der deutschen und europäischen Nachkriegsordnung nach 1945.
Vita
Wilfried Loth ist emeritierter Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Duisburg-Essen.
Inhalt
Einleitung
1.Katholizismus und Moderne – Überlegungen zu einem dialektischen Verhältnis
I. Ultramontane Abwehr
II. Bewegung in der Moderne
III. Der deutsche Katholizismus
IV. Erfolg und Niedergang
2.Bismarcks Kulturkampf – Modernisierungskrise, Machtkämpfe und Diplomatie
I. Die Formierung der Zentrumspartei
II. Kulturkampf-Maßnahmen
III. Windthorst gegen Bismarck
IV. Schwierige Verhandlungen
V. Ein stabiler Kompromiss
3.Soziale Bewegungen im Katholizismus des Kaiserreichs
I. Das katholische Deutschland
II. Ultramontanismus und Milieubildung
III. Der ländliche Populismus
IV. Der bürgerliche Aufbruch
V. Die katholische Arbeiterbewegung
VI. Integration und Erosion
4.Katholische Milieubildung, katholische Subgesellschaft und Zentrumspartei
I. Milieus als sozio-kulturelle Gebilde
II. Milieubildung im katholischen Deutschland
III. Katholische Subgesellschaft
IV. Pluralisierung und Integration
5.Georg Friedrich Dasbach – Kulturkämpfer und Baumeister des Katholizismus
6.Die deutschen Sozialkatholiken in der Krise des Fin de siècle
I. Aus dem Turm heraus
II. Sozialpolitischer Empirismus
III. Sozialer und zivilisatorischer Fortschritt
IV. Getrennte Wege
7.Der Volksverein für das katholische Deutschland
I. Eine Notgeburt
II. August Pieper und die Kraft der Organisation
III. Erfolg mit der Arbeiterbewegung
IV. Grenzen und Krisen
8.Bischof Karl Joseph Schulte von Paderborn (1910–1920) und der Streit um die Christlichen Gewerkschaften
I. Die katholische Arbeiterbewegung unter Verdacht
II. Die Bischöfe, der Volksverein und die Gewerkschaften
III. Die Intervention des Papstes
IV. Schultes Vermittlung
V. Schulte gegen Kopp
VI. Halbherzige Duldung
9.Der Katholizismus und die Durchsetzung der Demokratie in Deutschland
I. Pragmatischer Konstitutionalismus
II. Stärkung des Reichstags
III. Verschleppte Demokratisierung
IV. Polarisierung im Weltkrieg
V. Aufbau und Untergang
VI. Das Ende der Ambivalenz
10.Zentrum und Kolonialpolitik
I. Bekehrung zur Weltpolitik
II. Opposition der »Zentrumsdemokraten«
III. Bürgerlicher Imperialismus
11.Das Reichskonkordat und der Untergang des politischen Katholizismus
I. Ein ursächlicher Zusammenhang?
II. Einwände
III. Was bleibt?
12.Katholische Kirche und Widerstand im »Dritten Reich«
I. Halbherziger Protest
II. Anprangerung des Unrechtsstaats
III. Die Frage des Widerstands
IV. Ergebnisse
13.Nikolaus Groß – Christliche Existenz in totalitärer Zeit
I. Ein katholischer Arbeiterführer
II. Katholische Arbeiterbewegung im »Dritten Reich«
III. Engagement im Widerstand
IV. Die Unterstützung des Attentats
14.Katholizismus, Pluralismus und die moderne Demokratie
I. Eine grundsätzliche Ambivalenz
II. Rerum novarum und Demokratisierung
III. Antimodernismus und autoritäre Versuchung
IV. Die Christdemokratie nach dem Zweiten Weltkrieg
Quellen und Literatur
Archive
Quellensammlungen
Darstellungen
Verzeichnis der ursprünglichen Druckorte der Beiträge
1.Katholizismus und Moderne – Überlegungen zu einem dialektischen Verhältnis
2.Bismarcks Kulturkampf – Modernisierungskrise, Machtkämpfe und Diplomatie
3Soziale Bewegungen im Katholizismus des Kaiserreichs
4.Katholische Milieubildung, katholische Subgesellschaft und Zentrumspartei
5.Georg Friedrich Dasbach – Kulturkämpfer und Baumeister des Katholizismus
6.Die deutschen Sozialkatholiken in der Krise des Fin de siècle
7.Der Volksverein für das katholische Deutschland
8.Bischof Karl Joseph Schulte von Paderborn (1910–1920) und der Streit um die Christlichen Gewerkschaften
9.Der Katholizismus und die Durchsetzung der Demokratie in Deutschland
10.Zentrum und Kolonialpolitik
11.Das Reichskonkordat und der Untergang des politischen Katholizismus
12.Katholische Kirche und Widerstand im »Dritten Reich«
13.Nikolaus Groß – Christliche Existenz in totalitärer Zeit
14.Katholizismus, Pluralismus und die moderne Demokratie
Personenregister
Einleitung
Ein gutes Vierteljahrhundert nach dem Zusammenbruch des sowjetkommunistischen Blocks gehören westlicher Pluralismus, parlamentarische Demokratie und europäische Einigung plötzlich nicht mehr zu den gesicherten Besitzständen gesellschaftlicher Ordnung in Deutschland und in Europa. Eine dramatische Entfremdung zwischen politischen und kulturellen Eliten einerseits und Teilen der Mittel- und Unterschichten, die sich vom allgemeinen Fortschritt abgehängt fühlen und auf die dramatischen Umwälzungen der Globalisierung mit Angst und Abschottung reagieren, wird von verantwortungslosen Populisten zur Beförderung der eigenen Macht benutzt und bedroht so den Bestand der freiheitlichen Ordnung ebenso wie die notwendige Solidarität unter den Europäern. Es wird wieder deutlich, dass die parlamentarische Demokratie und die Europäische Union der Verteidigung und der Pflege bedürfen, wenn sie auf Dauer Bestand haben sollen. Aufrufe zum Kampf für eine »wehrhafte und streitbare Demokratie«, wie sie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Abschiedsrede gefordert hat, werden häufiger.
In dieser Situation dürfte es hilfreich sein, den Beitrag, den Katholiken und der Katholizismus zur Durchsetzung der Demokratie in Deutschland und zu seiner Einbettung in die europäische Gemeinschaft geleistet haben, in Erinnerung zu rufen. Der Katholizismus zählte nicht zu den Pionieren der Demokratisierung in Deutschland; dagegen stand der antimoderne Grundimpuls, der zu seiner Entstehung im 19. Jahrhundert führte. Gleichwohl ergaben sich aus den sozialen Bewegungen, mit denen er verknüpft war, und der Oppositionsrolle, die ihm im Zuge des »Kulturkampfs« zuwuchs, zahlreiche Impulse, die die Entwicklung zu einer parlamentarischen Demokratie förderten. Diese konflikthafte (und selten richtig verstandene) Entwicklung mündete nach dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« in eine Situation, in der der deutsche Katholizismus zu einem der Architekten der Nachkriegsdemokratie und der europäischen Einigung avancierte.
Es ist daher kein Zufall, dass etwa die katholischen deutschen Bischöfe zu den Mahnern gehören, die in der gegenwärtigen Situation mit deutlichen Worten vor einem Verfall von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Solidarität warnen. Ebenso wenig sollte es überraschen, dass sich der deutsche Laienkatholizismus bewusst dafür entschieden hat, den 101. Deutschen Katholikentag, der im Mai 2018 in Münster stattfindet, in klarer Abgrenzung von den demokratie- und fremdenfeindlichen Ambitionen der »Alternative für Deutschland« zu einem Forum der »streitbaren Demokratie« werden zu lassen.
Eine historische Darstellung des Wegs der deutschen Katholiken zur Demokratie und ihres Beitrags zu ihrer Durchsetzung dürfte dieses Engagement besser verständlich machen und zugleich zu seiner Bekräftigung beitragen. Sie soll in diesem Band durch eine Auswahl von Beiträgen zur Geschichte des deutschen Katholizismus geleistet werden, die aus unterschiedlichen Anlässen entstanden sind und bislang nur dem jeweils einschlägigen Fachpublikum bekannt waren.1 Zusammen genommen bieten sie einen umfassenden Überblick über die konflikthafte Entwicklung des Verhältnisses von Katholizismus und Demokratie von der Stigmatisierung zu »Reichsfeinden« im »Kulturkampf« der Bismarckära über den Beitrag zur Parlamentarisierung des Deutschen Reiches im Übergang zur Weimarer Republik bis zur Entstehung der deutschen und europäischen Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Problematische Aspekte dieser Entwicklung wie der kompensatorische Nationalismus des späten Kaiserreichs, die Kapitulation vor der nationalsozialistischen Herausforderung und das sehr begrenzte Engagement im demokratischen Widerstand werden nicht verschwiegen. Es werden aber auch die Pioniere der Demokratisierung innerhalb des Katholizismus deutlich benannt.
Der Band beginnt mit einer Erörterung des ambivalenten Verhältnisses von Katholizismus und Moderne: Auf der einen Seite hat sich die katholische Bewegung, die den Katholizismus im Laufe des 19. Jahrhunderts prägte, gegen die Umsetzung der Ideen der Aufklärung in der französischen Revolution formiert und Prinzipien verfochten, die den »Ideen von 1789« diametral entgegengesetzt waren. Gegen die Idee der Volkssouveränität hielt sie am göttlichen Ursprung der Staatsgewalt fest, ebenso am Anspruch der Kirche auf Gestaltung der öffentlichen Ordnung. Auf der anderen Seite bediente sie sich selbst der Mittel des modernen Rechtsstaates, um die Stellung der Kirche zu befestigen, soweit sie durch die Auflösung der vorrevolutionären Geschlossenheit der Lebensordnungen bedroht war. Mit dem Kampf für die Befreiung der Kirche von staatlicher Bevormundung wirkte sie zugleich an der Erweiterung der Freiheitsrechte des Einzelnen und der gesellschaftlichen Gruppen in einem pluralistischen Staatswesen mit. Darüber hinaus aktivierte der Katholizismus mit der Mobilisierung breiter Bevölkerungskreise eine ganze Reihe von Gruppeninteressen, die über das Interesse an der Restaurierung kirchlicher Freiheiten und Machtpositionen weit hinausgingen. Vielfach wurde er erst dadurch zu einer politischen Kraft, die an der Gestaltung der modernen Staatsordnung mitwirkte. Er trug damit selbst zur gesellschaftlichen Durchsetzung der Moderne bei; und soweit er sich dabei von der ultramontanen Verengung zu lösen vermochte, wurde er auch zu einem Bestandteil der Moderne.
In Deutschland fiel dieser Prozess mit der Konstituierung des modernen Nationalstaats in Form des Kaiserreichs von 1871 zusammen. Das offensive Eintreten einer Minderheit ultamontaner, ganz auf die Macht des Papsttums konzentrierter Katholiken für die Wiederherstellung des Kirchenstaates verleitete Bismarck und seine liberalen Verbündeten, den Kampf um die Einordnung der katholischen Kirche in diesen nationalen Staat mit allen Machtmitteln des Staates zu führen. Bismarcks Kulturkampf war damit, wie im zweiten Beitrag gezeigt wird, in der Hauptsache erfolgreich. Er hatte freilich den Nebeneffekt, dass die große Mehrheit der deutschen Katholiken und die Kirchenführer unter ultramontanen Vorzeichen zusammenrückten und die parlamentarische Vertretung der Ultramontanen, die »Deutsche Zentrumspartei«, zu einem Machtfaktor anwuchs, der zu einer festen Größe im politischen System des Kaiserreichs wurde. Damit wurden nicht nur Bismarcks Hoffnungen auf eine Konsolidierung des Obrigkeitsstaates in Frage gestellt; es stellten sich auch den liberalen Ambitionen auf seine Parlamentarisierung neue Schwierigkeiten entgegen. In der »stabilen Krise« des Kaiserreichs, die daraus resultierte, nahm das Zentrum eine Schlüsselrolle ein.
Wozu das Zentrum diese Schlüsselrolle nutzte, war grundsätzlich offen. Wie in dem Beitrag über Soziale Bewegungen im Katholizismus des Kaiserreichs argumentiert wird, war der Kampf für den Erhalt der traditionalen Freiheiten und Machtpositionen der katholischen Kirche von Anfang an mit unterschiedlichen sozialen und politischen Bestrebungen verbunden: Im Widerstand gegen die aufklärerisch-repressive Kirchenpolitik artikulierten sich zugleich die Vorbehalte traditioneller Eliten gegen den modernen Nationalstaat; katholische Bürger verbanden die Opposition gegen das Staatskirchentum mit dem Kampf für die eigenen Freiheitsrechte im konstitutionellen Staat; Angehörige der traditionellen Unterschichten ließen sich für die katholische Sache gewinnen, weil sie zugleich der Abwehr liberaler Führungs- und Modernisierungsansprüche zu dienen schien; katholische Arbeiter erlebten den Katholizismus als Fluchtpunkt vor den Zumutungen der industriellen Arbeitswelt und möglichen Bundesgenossen bei der Abwehr der Ausbeutung durch liberale Unternehmer. Mit dem Durchbruch zur modernen Industriegesellschaft in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre machten sich diese unterschiedlichen Bestrebungen stärker bemerkbar. Heftige Auseinandersetzungen innerhalb des politischen Katholizismus waren die Folge. Sie mündeten in soziale und ideologische Zerklüftung, die die Zentrumspartei und den verbandlich organisierten Katholizismus zu einem leichten Opfer des totalitären Machtanspruchs der Nationalsozialisten werden ließen.
Das Aufzeigen der inneren Gegensätze im politischen Katholizismus Deutschlands und der geringen Prägekraft seines religiösen Kerns, erstmals in meiner 1984 veröffentlichten Habilitionsschrift2, hat für Irritationen gesorgt. In dem Beitrag über Katholische Milieubildung, katholische Subgesellschaft und Zentrumspartei wird mit dem Abstand von über drei Jahrzehnten Bilanz aus den dadurch ausgelösten Diskussionen und weiteren Forschungen gezogen. Es wird bekräftigt, dass die besondere Sozialform des deutschen Katholizismus zwischen Kaiserreich und früher Bundesrepublik mehr und anderes war als ein sozialmoralisches Milieu und dass Milieus innerhalb des Katholizismus vielfältiger und entwicklungsfähiger waren, als es das in der Forschung lange Zeit populäre statische Bild einer Segmentierung der deutschen Gesellschaft in vier historische Großmilieus – neben dem katholischen ein ostelbisch-konservatives, ein liberal-bürgerliches und ein sozialistisches – suggeriert. Während die Formierung der Frömmigkeit im ultramontanen Sinn und die Ausgrenzung der Katholiken durch den Kulturkampf milieubildend wirkten, sorgten die Emanzipationsbewegungen eines katholischen Bürgertums, ländlicher Unterschichten und einer katholischen Arbeiterbewegung für eine Ausdifferenzierung dieses Milieus. Diese ging jedoch mit der Zeit über das Milieu als Lebensform hinweg. Politikfähig waren nach der Erfahrung der totalitären Bedrohung nur noch jene Fraktionen des Katholizismus, die schon lange einer Überwindung der Grenzen von Milieu und Subgesellschaft das Wort geredet hatten: die bürgerlichen Modernisierer und die katholische Arbeiterbewegung.
Die Verbindung von religiösem und politischem Engagement wird exemplarisch in einem Beitrag über Georg Friedrich Dasbach vorgeführt. Der Trierer Kaplan mobilisierte 1875 zunächst mit einem Sonntagsblatt und dann auch mit einer Tageszeitung das katholische Volk der Moselregion zur Verteidigung seines Bischofs Matthias Eberhard, der wegen Verweigerung der Anzeigenpflicht bei Besetzung der Pfarrstellen gerade 300 Tage im Gefängnis verbracht hatte. Wie ultramontane Vorkämpfer in anderen Teilen des Reiches nutzte Dasbach das allgemeine und gleiche Wahlrecht, das bei den Wahlen zum Reichstag zum ersten Mal galt, um die »kleinen Leute« zu politisieren und damit eine Waffe im Kampf mit der preußischen Obrigkeit und dem liberalen Gegner zu schmieden. Da er sich dazu auch der weltlichen Interessen seiner Leser und Wähler annehmen musste, entstand auf diese Weise eine mächtige soziale Bewegung und politische Kraft. Dasbach wurde in der Ausübung seiner seelsorglichen Tätigkeit behindert, bezog daraus aber weitere Impulse für den Aufbau eines gewaltigen Presseimperiums, half bei der genossenschaftlichen Organisation von Landwirten und Winzern und regte die erste gewerkschaftliche Organisation von Bergarbeitern im Kohlerevier an der Saar an. Als Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus und im Reichstag gehörte er zu den führenden »Zentrumsdemokraten«, die die Reichsleitung ebenso das Fürchten lehrten wie die bürgerlichen Honoratioren der Zentrumspartei.
Neben den »roten Kaplänen« wie Dasbach trugen auch die deutschen Sozialkatholiken, die an der Wende zum 20. Jahrhundert hervortraten, zur Formierung einer katholischen Arbeiterbewegung bei. In dem Beitrag, der ihnen gewidmet ist, wird zum einen der habilitierte Philosoph und sozialpolitische Sprecher der Zentrumsfraktion Georg von Hertling vorgestellt, der das soziale Denken der Katholiken aus der Bindung an mittelalterlich-zünftigen Ordnungsvorstellungen löste und einer Kombination von starken Sozialgesetzen und gewerkschaftlicher Organisation der Arbeiter das Wort redete. Zum anderen wird die Entwicklung von katholischen Priestern wie Franz Hitze, August Pieper, Heinrich Brauns und Otto Müller skizziert, die Hertlings Anregungen aufgriffen, weiterentwickelten und vor allem gegen vielfache Widerstände umsetzten – als sozialpolitische Theoretiker, Partner der katholischen Gewerkschaftsführer und hauptamtliche Direktoren des Volksvereins für das katholische Deutschland. Einige dieser Sozialreformer – so Heinrich Brauns – engagierten sich schließlich nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs für eine überkonfessionelle, demokratisch und sozial orientierte Partei-Neugründung, die die Sozialdemokraten als natürliche Verbündete bei der Festigung der deutschen Demokratie betrachtete. Andere hingegen – darunter August Pieper – flüchteten sich angesichts der Schwierigkeiten praktischer Sozialpolitik allerdings wieder in romantische Vorstellungen von ständestaatlicher Ordnung.
Der praktische Beitrag der katholischen Sozialreformer zur Formierung einer katholischen Arbeiterbewegung bestand vor allem in der Entwicklung des Volksvereins zu einer Massenorganisation, die hauptsächlich von sozial und politisch engagierten Arbeitern getragen wurde. Ursprünglich als »Vereinigung zur Verteidigung der christlichen Wahrheit« geplant, nutzte sein langjähriger Generaldirektor August Pieper (ab 1892) den Verein zur Bildung einer »soziale Fortbildungsschule für das gesamte katholische Deutschland«. Sein Bildungsangebot an Schriften, Abendveranstaltungen und mehrwöchigen »Volkswirtschaftlichen Kursen« wurde vor allem von sozialpolitisch engagierten Arbeitern wahrgenommen; aus ihren Reihen rekrutierten sich die Funktionäre und Führer der katholischen Arbeitervereine und der Christlichen Gewerkschaften. Katholische Arbeiter unterstützten dieses Bildungswerk mit ihren Mitgliedsbeiträgen; so kam der Volksverein nach schwierigen Anfängen bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs auf über 800.000 Mitglieder – nur ein Fünftel weniger, als die Sozialdemokratische Partei für sich gewinnen konnte.
Die Mobilisierung katholischer Arbeiter für die Idee der Sozialreform und das Engagement in den Christlichen Gewerkschaften wäre vermutlich noch erfolgreicher gewesen, wenn sie nicht auf das Misstrauen und die Feindschaft kirchlicher Kreise gestoßen wäre. Der Beitrag über Bischof Karl Joseph Schulte von Paderborn und der Streit um die Christlichen Gewerkschaften zeigt, wie dieses Misstrauen zu Bestrebungen führte, die Beteiligung von Katholiken an interkonfessionellen Gewerkschaften zu verbieten, und diese Bestrebungen teilweise Erfolg hatten: Mit der Enzyklika Singulari quadam vom September 1912 wurde den katholischen Arbeitern die Zusammenarbeit mit Nichtkatholiken in den Christlichen Gewerkschaften nur unter Vorbehalten und nur vorläufig gestattet. Nur die geschickte Intervention des Paderborner Bischofs sorgte dafür, dass diese Misstrauenskundgebung nicht zum Bruch der Christlichen Gewerkschaften mit dem kirchlich gebundenen Katholizismus führte. Der Beitrag beleuchtet das Selbstbewusstsein, das die katholischen Arbeiterführer unterdessen entwickelt hatten, aber auch die Weltfremdheit und das taktische Gerangel im deutschen Episkopat, die zwei Jahrzehnte später in der Konfrontation mit dem NS-Regime noch weit verheerendere Folgen haben sollten.
Was folgte aus diesen Spannungen und Entwicklungen für die Durchsetzung der Demokratie in Deutschland? Das Eintreten für die »bürgerliche Freiheit aller Angehörigen des Reiches«, die Wahrung der Rechte der Einzelstaaten, Kommunen und Provinzen sowie die Ausdehnung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts auf alle Bundesstaaten (auch auf das im Reich dominierende Preußen) gehörten, so wird in dem jetzt folgenden Längsschnitt argumentiert, unter den Bedingungen des Kulturkampfs zur programmatischen Grundausstattung der Zentrumspartei. Mit dem Abklingen des Kulturkampfs bahnte sich allerdings eine konservative Reorientierung des Zentrums an. Sie wurde durch den Erfolg der »Zentrumsdemokraten« gestoppt, die damit eine Einschränkung der Reichstagsrechte und eine Abkehr vom gleichen Wahlrecht im Reich verhindern konnten. Ein Kompromiss mit der Reichsleitung im Zeichen imperialistischer »Weltpolitik« wurde von ihnen 1906 aufgekündigt. Es folgte nach einer Phase strategischer Offenheit eine Konstellation, die auf die Parlamentarisierung des Reiches hinauslief, seine Demokratisierung (insbesondere durch die Übertragung des Reichstagswahlrechts auf Preußen) aber in ungewisse Fernen verschob. Unter den Belastungen des Weltkrieges war diese Konstellation freilich nicht länger tragfähig. Matthias Erzberger konnte jetzt mit der »Friedensresolution« vom Juli 1917 den Übergang zur parlamentarischen Demokratie anbahnen. Nach der Novemberrevolution arbeitete das Zentrum konstruktiv an der Etablierung der Weimarer Republik mit. Die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie, die zu ihrer Konsolidierung notwendig war, wurde jedoch schon im Spätherbst 1923 wieder aufgegeben; für eine prinzipielle Verteidigung der republikanischen Staatsform engagierte sich nur eine Minderheit der Partei. Mit der Wahl des Prälaten Ludwig Kaas zum Parteivorsitzenden im Dezember 1928 rückten Politiker in Schlüsselpositionen ein, die auf eine autoritäre Umgestaltung der Republik hinarbeiteten. Dass sie dabei gegenüber der Hitler-Partei den Kürzeren zogen, war angesichts der inneren Spaltungen ihrer Formation nur konsequent. Es bedurfte der Erfahrung der Konsequenzen dieser Niederlage, um den deutschen Katholizismus definitiv auf einen demokratischen Kurs zu verpflichten.
Nach dem Überblick über diese wechselvolle Geschichte der politischen Interventionen des Zentrums in der Demokratisierungsfrage schildert das Kapitel Zentrum und Kolonialpolitik den Wendepunkt von 1906 in exemplarischer Verdichtung. Es zeigt einen jugendlichen Matthias Erzberger, der, auf die Erbitterung der »kleinen Leute« gestützt, die skandalösen Verhältnisse in den deutschen Kolonien gnadenlos offenlegte und damit das prekäre Machtgleichgewicht zwischen der bürgerlichen Zentrumsführung dieser Zeit und der Reichsleitung zum Einsturz brachte. Antikatholische Vorurteile der Liberalen hinderten sie, die damit gegebenen Chancen zur Demokratisierung des Reiches zu nutzen, und brachten das Zentrum selbst immer mehr auf das Gleis der wilhelminischen »Weltpolitik«. Mehr als ein vorübergehendes Stagnieren im Parlamentarisierungsprozess war damit aber nicht erreicht.
Von den Halbheiten der Parlamentarisierung und Demokratisierung des Kaiserreichs führt ein direkter Weg zum Untergang nicht nur der Weimarer Republik sondern auch des politischen Katholizismus. In dem Beitrag Das Reichskonkordat und der Untergang des politischen Katholizismus wird eine Bilanz der Kontroverse gezogen, die der katholische Historiker Konrad Repgen Ende der 1970er Jahre mit der Kritik an einer Darstellung des evangelischen Kirchenhistorikers Klaus Scholder entfacht hat. Sie mündet in die Feststellung, dass Hitlers Angebot eines Reichskonkordats den Widerstand des Zentrumsvorsitzenden Ludwig Kaas gegen eine Auflösung der Partei schwächte und bei der Entscheidung der Zentrumsfraktion für das Ermächtigungsgesetz neben Drohungen und Belästigungen auch Verlockungen eine Rolle gespielt haben. Nachdem die Wahl von Kaas zum Vorsitzenden den Konsens, der die Zentrumspartei zusammenhielt, schon auf den kirchenpolitischen Kern reduziert hatte, fiel dieser mit dem Angebot des Reichskonkordats ebenfalls weg. Da blieb nichts mehr, was den Kampf für die Fortexistenz der Partei hätte rechtfertigen können – jedenfalls dann nicht, wenn für diesen Kampf mit beruflichen und gesellschaftlichen Nachteilen oder sogar mit Verfolgung gezahlt werden musste.
Von Katholischer Kirche und Widerstand im »Dritten Reich« ist in diesem Zusammenhang zu berichten, dass Widerstand im Sinne einer Verweigerung verbrecherischer Befehle oder eines aktiven Hinwirkens auf eine Beseitigung des Regimes nur von einzelnen Katholiken, Laien wie Kleriker, geleistet wurde. Wegen der Risiken für Leib und Leben, die damit verbunden waren, durfte die Kirche ihren Gläubigen die Verantwortung für die Entscheidung zum Widerstand auch nicht abnehmen. Allerdings hätte die mobilisierende Kraft kirchlicher Verlautbarungen durchaus größer sein können, wenn die deutschen Bischöfe denn den Unrechtscharakter des NS-Regimes deutlicher und früher erkannt hätten und illusionäre Hoffnungen auf Sicherung der kirchlichen Belange nicht manche von ihnen bis zuletzt von energischeren Stellungnahmen abgehalten hätten. Die Auseinandersetzungen innerhalb der Bischofskonferenz um die Deutlichkeit öffentlicher Stellungnahmen offenbaren einmal mehr ein hohes Maß an Weltfremdheit und Kleinmut.
Sensibilität und Mut, die bei einzelnen und letztlich nicht ganz wenigen Vertretern des Katholizismus zu finden waren, werden am Beispiel von Nikolaus Groß vorgeführt, der als Mitverschwörer des 20. Juli 1944 am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. Nikolaus Groß gehörte zu den katholischen Bergleuten des Ruhrgebiets, die die »Galopp-Universität« des Volksvereins absolvierten und auf dieser Grundlage hauptamtliche Funktionen in der katholischen Arbeiterbewegung übernahmen. Von 1927 an leitete er die Redaktion der Westdeutschen Arbeiterzeitung, des Organs der Katholischen Arbeiterbewegung Westdeutschlands. Politisch trat er für einen »demokratischen Volksstaat« ein, und dieses Engagement führte ihn von 1935 an zusammen mit den anderen Führungskräften der KAB in den Widerstand. Als sich die Führer des konservativen Widerstands 1943 auf die Notwendigkeit eines baldigen Staatsstreichs verständigten, trugen die KAB-Führer diese Entscheidung nicht nur mit. Sie beteiligten sich aktiv an der Organisation des Umsturzregimes und an der Gewinnung von zuverlässigen Personen, deren Mitarbeit für die Etablierung des neuen Regimes unabdingbar war. Das Risiko, dieses Engagement für »für die Freiheit und Würde seines Volkes« (wie er es nach seiner Verhaftung formulierte) mit dem Tod bezahlen zu müssen, nahm Groß in vollem Bewusstsein auf sich.
Abschließend wird der Blick auf das Verhältnis des deutschen Katholizismus zur Demokratie unter dem Titel Katholizismus, Pluralismus und die moderne Demokratie noch einmal zusammengefasst und in Ausführungen zur Situation in den europäischen Nachbarländern eingebettet. Der ambivalente Charakter des Katholizismus im Hinblick auf die demokratische Ordnung tritt damit noch deutlicher hervor. Die Angst vor der Moderne ließ die kirchlichen Autoritäten wiederholt intervenieren, wenn sich Gruppierungen des sozialen oder politischen Katholizismus allzu stark für die Sicherung von Freiheitsrechten und Emanzipation engagierten. Die Vorstellungen von einer korporatistischen Neuordnung des Staates, wie sie etwa in der Enzyklika Quadragesima anno von 1931 sichtbar wurden, begünstigten die Abkehr von der republikanischen Staatsform. Die fatalen Konsequenzen dieser Entscheidungen führten dann aber nach 1945 zu einem umso stärkeren Engagement für die parlamentarische Demokratie. Es wird in der Zusammenschau deutlich, dass dieses heute mehr denn je gebraucht wird.
Die vierzehn Beiträge können je nach Interesse unabhängig voneinander gelesen werden. Um den Gang der Forschung nachvollziehen zu können, sind sie im Wesentlichen unverändert gelassen worden. Es wurden lediglich Standardisierungen in der Präsentation vorgenommen; und bei Beiträgen, die schon vor längerer Zeit publiziert wurden, wurden Hinweise auf die seither erschienene Literatur hinzugefügt. Der Leser kann sich damit jeweils rasch über den aktuellen Forschungsstand informieren. Der Band lässt sich aber auch als eine fortlaufende Erzählung des Beitrags des Katholizismus zur Entstehung der deutschen Demokratie lesen – mit einigen unvermeidlichen Wiederholungen, aber in der Hauptsache doch mit unterschiedlichen Blickrichtungen, Schwerpunktsetzungen und exemplarischen Verdichtungen, die insgesamt ein umfassendes Bild ergeben. Der deutsche Katholizismus, soviel dürfte dabei deutlich werden, ist voller unterschiedlicher Facetten, aber wenn man die Geschichte des deutschen Nationalstaats und der deutschen Demokratie verstehen will, muss man sich die Mühe machen, sie im Einzelnen auszuleuchten.
Ich danke dem Centrum für Religion und Moderne der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und insbesondere den Herausgebern seiner Schriftenreihe Religion und Moderne für ihre Unterstützung bei der Realisierung dieses Buches. Ebenso danke ich Jürgen Hotz vom Campus-Verlag, der sich auch dieses Projekts mit Sorgfalt und Weitblick angenommen hat.
1.Katholizismus und Moderne – Überlegungen zu einem dialektischen Verhältnis
I. Ultramontane Abwehr
Im Verständnis einer aufgeklärten Geschichtswissenschaft wird der Katholizismus in der Regel zu den Kräften gerechnet, die dem Projekt der Moderne entgegenstanden und gegen die sich die Modernisierer erst einmal durchsetzen mussten. Daran ist so viel richtig, dass sich die katholische Bewegung, die den Katholizismus im Laufe des 19. Jahrhunderts prägte, gegen die Umsetzung der Ideen der Aufklärung in der französischen Revolution formierte und Prinzipien verfocht, die den »Ideen von 1789« diametral entgegengesetzt waren. Gegen die Betonung der menschlichen Vernunft und des Fortschritts propagierte sie die Verbindlichkeit der göttlichen Offenbarung und der Tradition des kirchlichen Lehramts. Gegen die Idee der Volkssouveränität hielt sie am göttlichen Ursprung der Staatsgewalt fest und am Anspruch der Kirche auf Gestaltung der öffentlichen Ordnung. Gegen die Tendenzen zur Herausbildung einer modernen Industriegesellschaft predigte sie die Einbindung in eine zeitlos harmonische ständestaatliche Ordnung. Gegen die Explosion der modernen Wissenschaften setzte sie auf die Weisheit der mittelalterlichen Scholastik. Und gegen den modernen Nationalismus entwickelte sie den Ultramontanismus, die absolute Bindung an den Papst in Rom.3
Die antimoderne Ausrichtung des Katholizismus ist immer wieder durch päpstliche Erklärungen bestätigt und bekräftigt worden. Das begann mit Pius VI., der sich nicht damit begnügte, die Zivilkonstitution der französischen Nationalversammlung zu verurteilen, weil sie die Kirche, gallikanischer Tradition entsprechend, ganz als Staatsinstitution behandelte, sondern ausdrücklich die Erklärung der Menschenrechte als mit der katholischen Lehre unvereinbar ablehnte: unvereinbar im Hinblick auf den Ursprung der Staatsgewalt, auf die Religionsfreiheit und auf die gesellschaftliche Ungleichheit. Und es erreichte seinen Höhepunkt mit der prägnanten Verurteilung der liberalen Ideen, die Pius IX. 1864 mit der Enzyklika Quanta cura und dem beigefügten Syllabus errorum vorlegte: Sie richtete sich ausdrücklich gegen die Vorstellung, die Gesellschaft könne ohne Rücksicht auf die Religion und ohne Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen organisiert werden, und verurteilte dann Volkssouveränität, Glaubens- und Kultusfreiheit, Pressefreiheit, Säkularisierung der gesellschaftlichen Institutionen und Trennung von Kirche und Staat als Ausdruck dieses Irrglaubens, ebenso wie Rationalismus, Ökonomismus und Sozialismus.
Die globale Absage des Katholizismus an die Moderne war kein Zufall und auch nicht nur die Folge unbedachter Eskalation der Gegensätze kirchenpolitischer Auseinandersetzungen. Die Aufklärung stellte einen Angriff auf den Monopolanspruch der katholischen Weltdeutung dar, und die Revolution bedrohte die materiellen Grundlagen der kirchlichen Machtstellung, besonders seit sie sich zum Zugriff auf die Kirchengüter und die geistlichen Fürstentümer entschlossen hatte. Da war es ganz unwahrscheinlich, dass es der Kirche gelingen würde, sich rechtzeitig von den traditionalen Verhältnissen zu lösen und die christlich gestaltbaren, zum Teil sogar christlich fundierten Momente des Umbruchs zur Moderne zu erkennen. Viel näher lag es, sich in der Abwehr von Aufklärung und Revolution mit all jenen Kräften zu verbünden, die gegen die Entwicklung zur Moderne opponierten, und in idealistischer Verklärung der vorrevolutionären Verhältnisse auf die Schaffung eines neuen christlichen Weltreiches zu hoffen. In den innerkirchlichen Auseinandersetzungen, die auf die Erschütterung durch Revolution und Säkularisation folgten, hatte der Ultramontanismus darum von vorneherein die besseren Karten; und auch bei der Formierung des Katholizismus im gesellschaftlichen und politischen Raum stand er bald im Vordergrund, während Ansätze zur Bildung eines liberalen Katholizismus immer Episoden blieben.
Die Frontstellung gegen die Moderne wurde noch dadurch zusätzlich gefördert, dass der Papst als Herrscher über den Kirchenstaat selbst Teil der alten Ordnung war und der Klerus auch in den übrigen italienischen Staaten über starke Machtpositionen verfügte. Das legte es allein schon aus Gründen des Machterhalts nahe, für die Restauration der alten Ordnung zu kämpfen, förderte den Glauben an die Durchsetzbarkeit der theoretischen Visionen und bestärkte die liberale Bewegung in ihrer Neigung, den Katholizismus pauschal mit der Reaktion zu identifizieren und entsprechend zu bekämpfen. In der Tat nahm der Kirchenstaat nach seiner Restauration 1815 bald die Züge eines christlichen Polizeistaates an, der modernem rechtsstaatlichem Empfinden Hohn sprach, und die Päpste wandten sich nach 1848 wie nach 1870 dem Bündnis mit den konservativen Mächten zu, um ihre Herrschaft über den Kirchenstaat wiederherzustellen. Beides stärkte die ultramontanen Positionen und zog denjenigen, die an einem Ausgleich der Kirche mit der modernen Welt arbeiteten, den Boden unter den Füßen weg.
II. Bewegung in der Moderne
Dennoch – dies muss nun gegen eine Auffassung betont werden, die immer noch allzu sehr von dem Kampf geprägt ist, den die Kräfte der Aufklärung gegen die katholische Kirche zu führen hatten – lässt sich der Katholizismus auch in seiner ultramontanen Ausprägung nicht ohne Einschränkungen als eine Bewegung gegen die Moderne charakterisieren. Dagegen spricht zunächst, dass er, aus den Initiativen vieler Einzelner und Gruppen, nicht etwa aus Weisungen der kirchlichen Hierarchie hervorgegangen, sich selbst der Mittel des modernen Rechtsstaates bediente, um die Stellung der Kirche zu befestigen, soweit sie durch die Auflösung der vorrevolutionären Geschlossenheit der Lebensordnungen bedroht war. Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Parlamente und ihre Mitspracherechte wurden von den Anwälten der katholischen Bewegung dazu genutzt, das katholische Volk für die Anliegen der Kirche und des Papstes zu mobilisieren und die Kirche als gesellschaftliche Kraft in der nachrevolutionären Ordnung zu verankern.4 Der Katholizismus stellte damit selbst eine moderne Bewegung dar, dessen Existenz an die Voraussetzung der Errungenschaften der Revolution und der Säkularisierung gebunden war – eine moderne Bewegung gegen die Moderne sozusagen, die aber allein schon aus Eigeninteresse keinen Totalangriff gegen die Moderne führen konnte, vielmehr selbst Elemente der Moderne in sich trug und, indem sie die verlorengegangenen feudalen Stützen durch gesellschaftliche und politische Mobilisierung der Katholiken ersetzte, die Kirche partiell modernisierte.
Darüber hinaus verfocht der ultramontane Katholizismus selbst liberale Prinzipien, wenn und soweit die Erben der Aufklärung diese vergaßen. Das galt insbesondere für ihre Amalgamierung mit der staatskirchlichen Tradition, aber auch für die aus einem holistischen Volksbegriff resultierende Neigung zur Entwicklung moderner Staatsomnipotenz und für die Verengung der liberalen Bewegung auf die Förderung bürgerlicher Klasseninteressen. Die katholische Kritik an diesen Entwicklungen fußte gewiss nicht auf der bewussten Übernahme liberaler Theoreme; sie gründete vielmehr teils in der Überzeugung von der Unveräußerlichkeit vorstaatlicher Rechte und stellte zum Teil auch nur eine opportunistische Ausnützung der Schwächen der liberalen Gegenspieler dar. Erst recht weitete sie sich nicht zu einer Infragestellung der eigenen Weltordnungsansprüche aus, was ihre Glaubwürdigkeit natürlich von vorneherein stark beeinträchtigte. Dennoch wirkte der Katholizismus mit dieser Kritik bisweilen als liberales Korrektiv, das mit dem Kampf für die Befreiung der Kirche von staatlicher Bevormundung zugleich an der Erweiterung der Freiheitsrechte des Einzelnen und der gesellschaftlichen Gruppen in einem pluralistischen Staatswesen mitwirkte.
Drittens aktivierte der Katholizismus mit der Mobilisierung breiter Bevölkerungskreise eine ganze Reihe von Gruppeninteressen, die über das Interesse an der Restaurierung kirchlicher Freiheiten und Machtpositionen weit hinausgingen, der Bewegung aber vielfach überhaupt erst die nötige politische Virulenz verschafften. So artikulierten sich im Widerstand gegen die aufklärerisch-repressive Kirchenpolitik zugleich die Vorbehalte traditioneller Eliten gegen den modernen Nationalstaat; katholische Bürger verbanden die Opposition gegen das Staatskirchentum mit dem Kampf für die eigenen Freiheitsrechte im konstitutionellen Staat; Angehörige der traditionellen Unterschichten ließen sich für die katholische Sache gewinnen, weil sie zugleich der Abwehr liberaler Führungs- und Modernisierungsansprüche zu dienen schien; katholische Arbeiter erlebten den Katholizismus als Fluchtpunkt vor den Zumutungen der industriellen Arbeitswelt und möglichen Bundesgenossen bei der Abwehr der Ausbeutung durch liberale Unternehmer. In Deutschland, wo sich der Katholizismus bekanntlich zu einer besonders schlagkräftigen Partei verdichtete, kam zu diesen durchaus unterschiedlichen sozialen Interessen dann in der Reichsgründungsära auch noch der latente Protest gegen die meist protestantischen Führungsschichten in Bürokratie, Kultur und Wirtschaft, die Abneigung süddeutscher und welfischer Kräfte gegen die preußische Hegemonie und die Opposition von Elsässern, Lothringern und Polen gegen den deutschen Nationalstaat überhaupt. Mit all diesen Momenten entwickelte sich der Katholizismus zu einer politischen Kraft, die zwar in Selbstbindung an den katholischen Glauben, aber in wachsender Unabhängigkeit von Klerus und kirchlicher Hierarchie wirkte und damit selbstverantwortetes politisches Handeln ganz im Sinne der Aufklärung ermöglichte.
Die modernen und modernisierenden Elemente innerhalb des Katholizismus mussten mit der Zeit umso stärker zur Geltung kommen, als die erklärten Hauptziele des Ultramontanismus illusionär waren. Wissenschaftlicher Fortschritt, Säkularisierung und Industrialisierung waren nicht aufzuhalten; und die verschiedenen Emanzipationsbewegungen, die sich daraus ergaben, konnten wohl für eine gewisse Zeit unterdrückt, aber letztlich nicht mehr rückgängig gemacht oder aufgelöst werden. Eine Rückkehr zur christlichen Fundierung der weltlichen Ordnung war darum ebenso wenig zu erreichen wie eine Verwirklichung der ständestaatlichen Theoreme, die man aus einem idealisierten Mittelalter-Bild abgeleitet hatte. Und nach 1870 konnte auch nicht auf Dauer verborgen bleiben, dass in der Welt der Nationalstaaten und des Imperialismus kein Platz mehr für die Wiederherstellung des Kirchenstaates war. Erreichbar waren allenfalls die Sicherung der Freiheit der Kirche als einer Gruppe unter vielen und die Unabhängigkeit ihres geistlichen Oberhaupts; christliches Wirken in diese plurale Welt hinein war nur möglich, wenn und soweit sich die Kirche den nachrevolutionären Realitäten stellte.
Entsprechend ließ der antiultramontane Eifer der Kirche mit der Zeit tatsächlich nach. In gewisser Weise war das schon beim Ersten Vatikanischen Konzil zu spüren: Die Verkündigung des Universalepiskopats und der Unfehlbarkeit des Papstes stellte zwar einen Triumph der Ultramontanen dar und lag auch ganz in der Konsequenz ultramontanen Denkens; indem sie dem Papsttum die volle Kontrolle über den Gebrauch der bürgerlichen Freiheiten durch die Katholiken sicherte, rüstete sie die Kirche aber gleichzeitig für eine Situation, in der die traditionellen Machtmittel feudaler Prägung nicht mehr zur Verfügung standen. Von den materiellen Machtmitteln der alten Kirche, die noch kurz zuvor im Syllabus eingeklagt worden waren, war nicht mehr die Rede; nur noch von der geistlichen Autorität des Papstes. 1885 ließ Leo XIII. dann in der Enzyklika Immortale Dei eine (wenn auch noch sehr vorsichtige) Distanzierung vom monarchischen Legalitätsprinzip erkennen; gleichzeitig hielt er französische Katholiken von der Bildung einer offen gegenrevolutionären Partei ab und drängte sie zur Verständigung, zum »Ralliement« mit der Republik. Sechs Jahre später, 1891, rückte er in der Enzyklika Rerum novarum auch von der Fixierung auf ein ständisches Gesellschaftsverständnis ab. Und nach der Jahrhundertwende folgte, nach vergeblichen Anläufen schon in den 1880er Jahren, die schrittweise Aufhebung des »Non expedit«, das die italienischen Katholiken bis dahin von einer Beteiligung an den allgemeinen politischen Wahlen der Republik abgehalten hatte.
Die Abkehr der Kirche von den ultramontanen Weltordnungsvorstellungen ging allerdings nur sehr zögernd vonstatten. Ihre Amtsträger blieben noch lange von der Sehnsucht nach Wiederherstellung vorrevolutionärer Zustände geprägt, beobachteten die moderne Welt mit Misstrauen und zogen sich eher auf den innerkirchlichen Bereich zurück als neue Ordnungsvorstellungen zu entwickeln, die den Realitäten der Zeit angemessen waren. Auf den Diplomaten Leo XIII., der in seinen Anfangsjahren gehofft hatte, die äußere Machtstellung der Kirche durch eine Verständigung mit den konservativen Regierungen stärken zu können, folgte 1903 der Seelsorger Pius X., der sich unter Vernachlässigung der politischen Ambitionen auf innere Reformen der Kirche konzentrierte. Getragen wurde er dabei von einer breiten religiösen Erneuerungsbewegung, die der religiösen Praxis mit Herz-Jesu-Verehrung, marianischer Frömmigkeit und Eucharistie-Kundgebungen ein zugleich individualisierendes und weltabgewandtes Gepräge gab. Ansätze zur Rehistorisierung theologischen Denkens, wie sie von einer breiten und vielfältigen Strömung »reformkatholischer« Theologen seit Mitte der 1890er Jahre entwickelt wurden, zerbrachen an der Intoleranz der Masse der Gläubigen und der Kirchenleitung, die im traditionellen Selbstverständnis verunsichert waren, aber gerade darum fundamentalistisch am Buchstaben der Dogmen festhielten. Immer rigidere Maßnahmen gegen eine »modernistische« Irrlehre, die es in der vermuteten Geschlossenheit gar nicht gab, wirkten als Barrieren gegen eine aktive Auseinandersetzung des Katholizismus mit den Problemen der modernen Welt.
Für den Katholizismus ergab sich daraus, dass er bei seinen Versuchen, die Welt zu gestalten, von der Kirche entweder allein gelassen oder aber, wenn er sich dabei allzu weit von den traditionellen Vorstellungen entfernte, behindert wurde. Nachdem der ultramontane Traum im Wesentlichen nur noch identitätsstiftend wirken konnte und praktikable Neuorientierungen von kirchlicher Seite ausblieben, konnten die außerkirchlichen Impulse, die durch die Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten in den Katholizismus hineinwirkten, eine starke Prägekraft entfalten. Entsprechend entfremdeten sich Kirche und Katholizismus; und wenn katholische Formationen dann allzu moderne Züge annahmen, intervenierte das Papsttum.
Das bekamen etwa die italienischen und französischen Christdemokraten zu spüren, denen politische Aktivitäten im Sinne einer Verwirklichung der Demokratie verboten wurden, aber auch die bürgerlichen Führer des Zentrums im wilhelminischen Deutschland, deren Pochen auf politischer Selbständigkeit in Rom mit unverhohlenem Misstrauen beobachtet wurde, und die katholischen Arbeiter, die im sogenannten Gewerkschaftsstreit nur knapp an einem Verbot der interkonfessionellen Gewerkschaftsbewegung vorbei kamen. Allerdings waren diese Interventionen nur halbherzig; die Sehnsucht nach vorrevolutionären Zuständen verdichtete sich nicht mehr zu einem offensiv gegenrevolutionären Kurs. Der Rückzug der Kirche von den politischen Ambitionen bedeutete daher im Übrigen, dass sich der Katholizismus je nach den politischen und sozialen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern und Regionen ganz unterschiedlich entwickelte und katholische Formationen oft scharfe innere Spannungen aufwiesen – besonders dann, wenn der äußere Druck nachließ, der aus dem Doppelangriff aufklärerischer und obrigkeitsstaatlicher Kräfte auf traditionale Freiheiten und Machtpositionen der Kirche resultierte.
III. Der deutsche Katholizismus
In Deutschland lassen sich nach dem Abklingen des Kulturkampfs drei sozial unterschiedlich fundierte Bewegungen innerhalb des Katholizismus unterscheiden, die jeweils eigenständig auf die Politik des Zentrums einwirkten und so den Kurs des Katholizismus bestimmten: eine bürgerliche Emanzipationsbewegung, eine populistisch gefärbte Protestbewegung ländlicher und kleinbürgerlicher Unterschichten und eine Arbeiterbewegung, die insbesondere dort reüssierte, wo Mischformen traditioneller und industrieller Lebensweisen erhalten blieben.5
Die bürgerliche Bewegung im deutschen Katholizismus geht in Ansätzen bis in die 1840er Jahre zurück. Ursprünglich stützte sie sich auf einen vergleichsweise kleinen Zirkel katholischer Akademiker, höherer Beamter und Unternehmer; ihr politisches Gewicht bezog sie zunächst aus der Reputation, die die bürgerlichen Honoratioren, meist durch die Vermittlung des örtlichen Klerus, bei den unterbürgerlichen Wählermassen besaßen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung, insbesondere im Zuge der 1896 einsetzenden neuen Hochkonjunkturperiode, weitete sich dieser Zirkel quantitativ beträchtlich aus: Katholiken drangen vermehrt in die Bereiche der Großindustrie, des Handels und des Bankwesens ein und entfalteten dort beträchtliche Aktivitäten; ebenso profitierten sie von der Ausweitung der öffentlichen Verwaltung, der Wohlfahrtspflege und des Bildungswesens und stellten sie einen erheblichen Anteil an der neuen Schicht der technischen Intelligenz. Gleichzeitig rückten sie gesellschaftlich immer deutlicher zu einer Gruppe zusammen, entwickelten sie ein stärkeres und stärker an den Werten des modernen Industriestaates orientiertes Selbstbewusstsein als bisher und traten sie auch politisch deutlicher als bisher als Gruppe in Erscheinung.
Aus der eher vorsichtigen Distanz, die die bürgerlichen Führer der Gründungsära gegenüber ständestaatlichen Utopien hatten erkennen lassen, entwickelte sich jetzt eine offensive Kritik an der Rückwärtsgewandtheit des bisherigen Katholizismus und ein lautstarkes Bekenntnis zu den Errungenschaften des modernen Industriestaates. Die Wirtschafts- und Sozialordnung des modernen Kapitalismus wurde nicht mehr, wie bislang vielfach in katholischen Kreisen üblich, prinzipiell in Frage gestellt oder gar verurteilt, sondern ganz im bürgerlichen Sinne als Grundlage allgemeinen materiellen Fortschritts begrüßt; Wissenschaft und Technik wurden nicht länger als bedrohlich für die traditionellen Lebensverhältnisse empfunden, sondern als Grundlagen moderner Existenzbehauptung begierig aufgegriffen; Vereine, Parteien und Parlamente galten nicht mehr als Hindernisse auf dem Weg zu einem organischen Staatsaufbau, sondern als selbstverständliche Mittel, um die »Rechte des Volkes« zur Geltung zu bringen; die Auseinandersetzung mit der geistigen Entwicklung der Zeit erschöpfte sich nicht länger in trotziger Apologetik, sondern ging auf weite Strecken in eine unbefangene Lernbereitschaft über und mündete vielfach in unkritische Überanpassung.
Die neue Hochschätzung für die Werte einer bürgerlich dominierten Industriekultur ließ die – vielfach historisch bedingte – »Rückständigkeit« des katholischen Volksteils in der Mitwirkung am wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt und in der Besetzung der Führungspositionen in Staat, Wirtschaft und Kultur umso schmerzlicher ins Bewusstsein treten: Sie nagte am Selbstwertgefühl der katholischen Bürger, behinderte sie in ihren Entfaltungsmöglichkeiten und ließ langfristig die Zukunft des politischen Katholizismus überhaupt fragwürdig erscheinen. Entsprechend erscholl nun allenthalben der Ruf nach mehr katholischen Akademikern, mehr katholischen Gelehrten, mehr katholischen Kommerzienräten und stärkerer Vertretung der Katholiken in den oberen Rängen der Bürokratie. In zahlreichen Artikeln und Versammlungen wurde über die Ursachen der Rückständigkeit räsoniert und an den Bildungseifer der Katholiken appelliert; zugleich wurde auf allen Ebenen von den staatlichen Stellen eine »paritätische« Berücksichtigung der Katholiken bei der Besetzung öffentlicher Ämter gefordert und allgemein nach Beweisen für die Gleichwertigkeit der katholischen Bürger im Deutschen Reich gesucht.
Für diesen bürgerlichen Aufbruch hatte zu großen Teilen Ludwig Windthorst den Boden bereitet, indem er konservativen Utopien immer wieder Absagen erteilt und konsequent für die Verwirklichung rechtsstaatlicher Prinzipien gestritten hatte. Auf dieser Grundlage gründeten Julius Bachem, Hermann Cardauns, Georg von Hertling und andere die »Görres-Gemeinschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland«; und Julius Bachem war es auch, der im Frühjahr 1906 in seinem vieldiskutierten Artikel »Wir müssen aus dem Turm heraus!« in den Historisch-Politischen Blättern das Programm dieses bürgerlichen Aufbruchs noch einmal prägnant zusammenfasste. Ebenso spielten Franz Hitze und August Pieper an der Spitze des Volksvereins eine wichtige Rolle, indem sie die Bewältigung sozialer Probleme vom Boden der kapitalistischen Wirklichkeit aus propagierten und betrieben. Eher am Rande, aber gleichwohl symptomatisch wirkten die »reformkatholischen« Theologen, so Franz Xaver Kraus, der in seinen 1896–1900 anonym erschienenen Spectator-Briefen heftige Attacken gegen den Ultramontanismus ritt, und Hermann Schell, der 1897 mit der Forderung nach der Verbindung der Kirche mit moderner Wissenschaft und nationaler Kultur Aufsehen erregte; »Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts« hieß der provozierende Titel seiner Programmschrift. Ergänzt wurden ihre Bestrebungen von Männern wie Carl Muth, der 1898 mit einer Kampfansage an die moralische Bevormundung des katholischen Literaturbetriebs antrat, und Martin Spahn, der als historischer Publizist für eine Versöhnung der Katholiken mit dem preußisch-kleindeutschen Geschichtsbild wirkte. Muths 1903 gegründetes Organ Hochland, in dem auch Spahn regelmäßig publizierte, entwickelte sich rasch zum wichtigsten geistigen Forum der Bewegung.
Natürlich agierte die bürgerliche Aufbruchsbewegung nicht in jeder Hinsicht einheitlich. So hielten sich die politischen Führer in der Regel von den theologischen Erneuerungsbemühungen bewusst fern, um ihr ohnehin schwieriges Verhältnis zu den kirchlichen Autoritäten nicht noch zusätzlich zu belasten. Die Identifikation mit dem neudeutschen Nationalismus ging unterschiedlich weit, ebenso die Bereitschaft zur Übernahme liberaler Ordnungsvorstellungen; antiliberale Momente der ideologischen Tradition und Imperative der aktuellen bürgerlichen Situation vermengten sich in den unterschiedlichsten Kombinationen. Ein Teil war gewiss bereit, sich um der individuellen Karriere willen den Vorstellungen des Regierungslagers anzupassen, während andere – und hier insbesondere die politisch erfahrenen Führungskräfte der Zentrumspartei – sehr wohl wussten, dass der Aufstieg der katholischen Bürger im Reich auf Dauer nur gesichert werden konnte, wenn sich das Zentrum als eigenständiger Machtfaktor behauptete. Aber alle trafen sich in dem Bestreben, sich in der bestehenden bürgerlichen Ordnung, beziehungsweise in dem, was von einer solchen Ordnung vorhanden war, einzurichten; zeitweilig wurde es zum wichtigsten Kennzeichen der Zentrumspolitik, wichtiger jedenfalls als das Bemühen um Stärkung der kirchlichen Machtpositionen und Sicherung der kirchlichen Freiheiten über den Status quo hinaus.
Die ländlichen Unterschichten stellten lange Zeit nur den passiven Resonanzboden des Ultramontanismus dar: ein Wählerreservoir, das ihm politische Kraft verlieh, weil er es in seinen angestammten Traditionen bestärkte. Ende der 1880er/zu Beginn der 1890er Jahre entwickelte sich aber auch aus diesem Reservoir eine eigenständige politische Bewegung. Zur wachsenden Erbitterung der ländlichen Bevölkerungsgruppen über wirtschaftliche Belastungen und soziale Deklassierung kam jetzt das Vordringen der Techniken und Inhalte bürgerlicher Politik in eben diese Bevölkerungsgruppen im Zuge der »Zweiten Aufklärung«. Das führte insbesondere die mittelständischen Bauern im Einflussbereich des Katholizismus, daneben aber auch Kleinbauern, Handwerker und Kleinhändler dazu, den Honoratioren, denen sie bislang die Vertretung ihrer Interessen anvertraut hatten, die Gefolgschaft aufzukündigen und sich unter Vermittlung eines neuen Typs politischer Volkstribunen zu einer Bewegung zu konstituieren, die sich in ihrer Mischung aus rückwärtsgewandten und modernen, antiliberalen und elementar-demokratischen Elementen am besten als populistisch charakterisieren lässt.
Im Mittelpunkt dieser Bewegung, für die etwa der Trierer »Presskaplan« Georg Friedrich Dasbach, der oberfränkische »Bauerndoktor« Georg Heim und auch der junge Matthias Erzberger als Wortführer auftraten, stand zunächst einmal der Protest gegen eine Entwicklung, die die mittelständischen Gruppen vielfach um ihre wirtschaftliche Existenz zu bringen drohte, sie auf jeden Fall zu schmerzhaften Umstellungen zwang, ihren tradierten Status radikal in Frage stellte und allgemein in Richtung auf ihre Deklassierung und Marginalisierung wirkte. Begleitet wurde dieser Protest von heftigen Emotionen gegen alles, was für diese Entwicklung verantwortlich schien oder ihr zumindest nicht deutlich genug entgegentrat: gegen das »freie Spiel der Kräfte« des Liberalismus, das sie unter Druck setzte; gegen moderne Wissenschaft und Technik, die ihre Kenntnisse entwerteten; gegen Industrieherren, Börsenjobber und Bankiers, die von der Entwicklung profitierten, unter der sie zu leiden hatten; gegen die Juden, die unter den Nutznießern des kapitalistischen Systems eine prominente Rolle spielten; gegen Bürokratie und Aristokratie, die sich offensichtlich mit dem modernen Industriekapitalismus verbündet hatten; gegen die Honoratioren in Verbänden, Parteien und Parlamenten, die sich als unfähig erwiesen hatten, sie vor dem wirtschaftlichen und sozialen Abstieg zu schützen.
Die Konkretisierung dieser Grundemotionen, die politisch in sehr verschiedener Weise genutzt werden konnten, erfolgte im wilhelminischen Deutschland eher in sozialstaatlicher und partizipatorischer Richtung. So teilten die Populisten den Ruf der adligen Großgrundbesitzer nach Konservierung der traditionellen Produktionssphären durch staatliche Protektion, kämpften aber zugleich (und oft noch entschiedener) für eine Umverteilung zugunsten der »kleinen Leute«, die die Interessen des Großgrundbesitzes empfindlich treffen musste. Die Bauern forderten die Erhöhung der Getreidezölle, ebenso den Übergang zur Doppelwährung zur Erhöhung der Getreidepreise, Maßnahmen gegen die Spekulation mit Agrarprodukten, Vieh- und Fleischeinfuhr-Kontrollen, Margarine-Diskrimination und obligatorische Landwirtschaftskammern mit weitreichenden Vollmachten. Kleinhändler verlangten Maßnahmen gegen die unkontrollierte Ausbreitung von Warenhäusern und Konsumgenossenschaften, Handwerker die lückenlose Regelung handwerklicher Tätigkeit durch obligatorische Handwerkskammern. Alle Fraktionen des mittelständischen Populismus kämpften aber auch für eine strenge Antikartell- und Antimonopolgesetzgebung, für eine progressive Einkommensteuer und für staatliche Daseinsvorsorge, die Bauern darüber hinaus gegen Staffeltarife zugunsten der ostelbischen Getreideproduzenten, gegen Latifundienbildung und in Bayern auch für die Aufhebung des Bodenzinses. Die Kammern wollten sie nach allgemeinem und gleichem Wahlrecht zusammengesetzt sehen, also ganz in der Hand der kleinen Produzenten wissen.
Auch hinsichtlich der Regierungsform schwebte den Populisten bei aller Beschwörung traditioneller Formen ein größeres Maß an Egalisierung und Partizipation vor. Von einer Infragestellung der monarchischen Ordnung wollten sie zwar nichts wissen; doch hatten die Monarchen nach ihren Vorstellungen die Rechte des »Volkes« zu wahren und für sein Wohl zu sorgen, und mussten die regierenden Bürokratien durch starke Volksvertreter daraufhin kontrolliert werden, ob sie diesen Pflichten nachkamen. Die Parlamente sollten ebenso nach dem gleichen Wahlrecht beschickt werden wie die Kammern, und die parlamentarischen Vertreter sollten in enger Fühlungnahme mit ihren Wählern stehen. Versuche, die Populisten durch die Aktivierung von Sozialistenfurcht und Nationalismus von solchen systemsprengenden Vorstellungen wieder abzubringen, scheiterten an ihrem Realitätssinn; sie zeigten sich im Gegenteil, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, durchaus bereit, im Interesse der »kleinen Leute« auch mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten; und sie forderten mit Rücksicht auf die Steuerlast »höchste Sparsamkeit im Aufwande für Militär und Marine.«6
Trotz dieser Vorstellungen und Forderungen wird man die Populisten nicht einfach als »dynamisch-demokratisches Element« im politischen Katholizismus deuten können,7 jedenfalls nicht im modernen Sinn des Begriffes. Über die Verbesserung der eigenen Situation hinaus Verantwortung für das Staatsganze zu übernehmen, blieb außerhalb ihres Gesichtskreises. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich als das »Volk« schlechthin betrachteten, und die Unbedingtheit ihrer Forderungen ließen für Kompromisse, praktische Toleranz und Minderheitenschutz wenig Raum. Und die antiliberalen, antisemitischen und antimodernistischen Affekte wurden, auch wenn sie sich vorerst kaum in der politischen Praxis niederschlugen, doch auch nicht aufgearbeitet. Darum blieb die Bewegung insgesamt für autoritäre Versuchungen anfällig; und in der Schlussphase des Ersten Weltkrieges und danach hat sie ihr auch nachgegeben, besonders in Bayern: Die heftige Opposition gegen die Politik der Friedensresolution von 1917 und gegen die republikanische Ordnung von Weimar haben hier ihre Wurzeln.
Schließlich die katholische Arbeiterbewegung: Sie entstand, nach vereinzelten regionalen Ansätzen in den 1870er Jahren parallel zu dem bürgerlichen Aufbruch; politisches Gewicht erlangte sie allerdings erst nach der Jahrhundertwende, über den Aufstieg der Christlichen Gewerkschaften und die Ausweitung des Volksvereins zu einem Mitgliederverein katholischer Arbeiter. Was sie zusammenhielt, war über das Festhalten an bestimmten identitätsstiftenden religiösen Traditionen hinaus ein elementares Verlangen nach Emanzipation: nach Befreiung von wirtschaftlicher Not, von kultureller »Rückständigkeit« und vor allem von politischer Bevormundung. Dieses Verlangen war zwar, den Residuen christlichen Universalismus entsprechend, in vage Visionen von einem »Ausgleich der Interessen von Kapital und Arbeit, Handel und Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft« eingebunden und artikulierte sich darum nicht etwa in einer klassenkämpferischen Terminologie, sondern in Forderungen nach »Standesbewusstsein«, »Anerkennung«, »Mitbestimmung«, »Gleichberechtigung«, nach einem „gerechten Anteil an den Erfolgen der wirtschaftlichen und geistigen Kultur.8 Dennoch stellten die katholischen Arbeiter die bestehende gesellschaftliche und politische Machtverteilung ebenso in Frage wie ihre sozialdemokratisch orientierten Kollegen: Indem sie sich zur Verwirklichung dieser Forderungen in beträchtlichem Umfang organisierten und die Vertretung ihrer Interessen nicht länger den traditionellen Honoratioren überließen.
Bei der Entwicklung ihrer Strategie ließ sich diese Arbeiterbewegung kaum von theoretischen Einsichten leiten. Sie war zwar von einer ständestaatlich orientierten rückwärtsgewandten Kapitalismus-Kritik ausgegangen; ihre Eigendynamik entwickelte sie aber gerade in der Auseinandersetzung mit dem Ungenügen dieser Kritik. Sie zeichnete sich darum durch einen fundamentalen Empirismus und Pragmatismus aus; bisweilen neigte sie sogar zu ausgesprochener Theoriefeindlichkeit. Auf eine kirchlich orientierte katholische Soziallehre, die über die Betonung sittlicher Grundsätze hinaus die Realitäten der kapitalistischen Produktionsweise in ihre Überlegungen einbezog, hoffte sie vergebens; liberale Vorstellungen empfand sie als ungenügend; und am Marxismus schreckte sie die zugrundeliegende materialistische Geschichtsphilosophie. Die meisten Anregungen empfing sie von den bekanntlich sehr pragmatischen Trade Unions in Großbritannien; im Übrigen erwarben ihre führenden Vertreter durch Studium der bürgerlichen Nationalökonomie und Lektüre der Schriften von Marx und Engels so viel an Kenntnissen über die Mechanismen des kapitalistischen Marktes, dass sie in weiten Teilen zu ganz ähnlichen unmittelbaren Zielsetzungen gelangten wie die reformistischen Kräfte in der Sozialdemokratie: Ausbau der staatlichen Sozialpolitik und Arbeiterschutz-Gesetzgebung, genossenschaftliche Selbsthilfe, Sicherung und Ausbau des Koalitions- und Vereinsrechts, Tarifautonomie, Abschluss von kollektiven Tarifverträgen, Reallohnsteigerungen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung durch öffentlich-rechtliche Arbeitskammern aus Unternehmer- und Arbeitervertretern und ein »konstitutionelles Betriebssystem«, im allgemein-politischen Bereich gleiches Wahlrecht und Repräsentanz gemäß der Stärke und Bedeutung des eigenen »Standes«.
Zu welchem Wirtschaftssystem die Verwirklichung dieser Ziele führen sollte und welche politische Ordnung mit ihm korrespondieren sollte, darüber wurde in der katholischen Arbeiterbewegung nicht systematisch nachgedacht. Privatkapitalistische Produktionsweise und konstitutionelle Monarchie wurden nicht grundsätzlich in Frage gestellt, aber ebenso wenig wurde der ordnungspolitische Status quo einfach akzeptiert. Am ehesten konkretisierten sich die Forderungen nach Mitwirkung und Gleichberechtigung noch in der Vision eines »sozialen Kaisertums«: eines konstitutionellen Regimes, in dem sich ein unabhängiger Monarch und ein starkes Parlament wechselseitig ergänzten, beide darauf bedacht, einseitige Bevorzugungen, Bevormundung und Ausbeutung zu verhindern, und von einem breiten Konsens von Kräften getragen, die sich im Streben nach nationalem Produktivitäts- und Machtzuwachs in allseitigem Interesse verbunden wussten. Diese Vision war durchaus geeignet, Kräfte freizusetzen, die die Entwicklung zu einer parlamentarischen Demokratie und mehr noch zu einem Sozialstaat vorantrieben. Auf der anderen Seite unterschätzte sie aber auch die Dynamik sozialer und politischer Konflikte ganz erheblich; folglich schenkte sie der institutionellen Sicherung der angestrebten »demokratischen« Rechte zu wenig Beachtung.
Ambivalenzen im Hinblick auf die Stellung zur Moderne und im Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie gab es also auch hier. Dennoch muss festgehalten werden, dass die katholische Arbeiterbewegung zu den wichtigsten Motoren der Demokratisierungsbewegung im späten Kaiserreich gehörte. Von der anfänglich verkündeten Zurückhaltung in der Anwendung des Streikmittels war in der Praxis bald nichts mehr zu spüren; statt dessen häuften sich zunehmend erbitterte Klagen über die »Herrenmoral der deutschen Großindustriemagnaten« und über Verständnislosigkeit in den Reihen der Zentrumshonoratioren. Die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie wurde defensiv geführt und blieb im Wesentlichen vom Zwang zur Legitimation gegenüber den Arbeitern bestimmt; dem Ansinnen, sich durch eine Verteufelung der Sozialisten zu profilieren, setzte sich die große Mehrheit der katholischen Arbeiterführer mit Bestimmtheit entgegen. Als mittelfristiges Ziel propagierten sie sogar die Schaffung einer parteipolitisch neutralen Einheitsgewerkschaft nach dem Vorbild der britischen Trade Unions. In dieser impliziten Verständigung mit dem pragmatischen Teil der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung wurden die sozialstaatlichen Elemente der Weimarer Ordnung grundgelegt, und dann wurde sie auch noch einmal für die Formierung der sozialen Ordnung der Bundesrepublik wichtig.
IV. Erfolg und Niedergang
Wie diese drei Bewegungen ineinanderwirkten und wie sie sich mit den angestammten konservativen Kräften im Katholizismus auseinandersetzten, kann hier nicht behandelt werden.9 Festzuhalten ist zunächst, dass der historische Katholizismus ein äußerst vielschichtiges Phänomen gewesen ist. Bismarck sprach einmal davon, dass das Zentrum in seiner Brust »nicht zwei Seelen« habe, sondern gleich »sieben Geistesrichtungen, die in allen Farben des politischen Regenbogens schillern: von den äußersten Rechten bis zur radikalen Linken.«10 Und Franz Mehring fand im politischen Katholizismus alles vertreten, »von den Auffassungen kleinbäuerlicher und kleinbürgerlicher Demokratie bis zu den Auffassungen feudaler Romantik und zünftlerischer Krähwinkelei.«11 Die Frage nach dem Verhältnis von Katholizismus und Moderne wird man darüber hinaus dahingehend beantworten können, dass der Katholizismus eine Reaktion auf die Moderne darstellte, die sich zunächst intentional gegen die Moderne richtete, dabei aber der katholischen Kirche eine Machtstellung unter den Bedingungen der Moderne sicherte und eine breite Skala unterschiedlicher politischer Aktivitäten in der modernen Welt freisetzte. Er trug damit selbst zur gesellschaftlichen Durchsetzung der Moderne bei; und soweit er sich dabei von der ultramontanen Verengung zu lösen vermochte, wurde er auch selbst zu einem Bestandteil der Moderne. Langfristig, wenn auch über mancherlei Umwege und gegen anhaltende Widerstände, hat er sogar die katholische Kirche modernisiert – jedenfalls soweit, dass sie sich als Machtfaktor in den modernen Industriegesellschaften behaupten konnte.12 Indem er sich so an der Ausgestaltung der Moderne beteiligte, hat der Katholizismus allerdings notwendigerweise mit der Zeit an Kohärenz und Substanz verloren. In Deutschland wurde das schon in den internen Auseinandersetzungen im späten Kaiserreich spürbar, ehe es durch die rasche Auflösung seiner Organisationen bei der nationalsozialistischen Machtergreifung auch nach außen hin offenkundig wurde. Eine erneute Konsolidierung des katholischen Milieus im geistigen und moralischen Vakuum nach 1945, begünstigt durch die strukturelle »Westverschiebung« Deutschlands, konnte nicht verhindern, dass es sich auf dem Höhepunkt der Wirtschaftswunder-Jahre mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit aufzulösen begann. Generell erweist sich der Katholizismus damit als ein Übergangsphänomen, das die Durchsetzung der Moderne begleitete, mit ihrem Erfolg aber auch seine Aufgaben verlor.
2.Bismarcks Kulturkampf – Modernisierungskrise, Machtkämpfe und Diplomatie
Der Kulturkampf in Preußen-Deutschland war Teil eines säkularen Konflikts, in dem die Emanzipation von kirchlichem Integralismus und die Abwehr der modernen Staatsomnipotenz unauflöslich miteinander vermischt waren. Die Kirche, zumal die katholische, wurde sowohl von den Kräften der Aufklärung bedrängt als auch vom Ausbau des modernen Staates; dabei gerieten traditionale Machtpositionen der Kirche ebenso in die Defensive wie traditionale Freiheiten im mixtum compositum vorstaatlicher Herrschaftsgefüge.13 Staat und Aufklärung kämpften an einer gemeinsamen Front, die zugleich als Brücke im latenten Konflikt zwischen traditionaler Herrschaft und bürgerlicher Gesellschaft dienen konnte.
Im Deutschland der Reichsgründungsära konkretisierte sich dieses Bündnis in der Zusammenarbeit Bismarcks mit den Nationalliberalen. Ihr gemeinsamer Kampf gegen Machtansprüche und Machtmittel der katholischen Kirche lag in der Schnittmenge der Interessen des Reichsgründers und der liberalen Bewegung, war Teil des Modernisierungsprogramms, das sie mit der Reichsgründung ins Werk setzten, und fungierte zugleich als Kitt, der ihr Bündnis über den latenten Gegensatz in der Verfassungsfrage hinweg zusammenhielt.14
I. Die Formierung der Zentrumspartei
Für die Liberalen war dieser »Kulturkampf« zunächst ein integrativer Bestandteil ihres Engagements für einen modernen nationalen Staat: Es ging darum, die Kirche wie alle anderen Institutionen in den modernen Staat einzuordnen, ihr quasi-staatliche Funktionen zu nehmen, die sie in der traditionalen Ordnung innehatte, sie rechtsstaatlichen Prinzipien zu unterwerfen. Konkret bedeutete dies vor allem die Übertragung der Schulaufsicht über die Volksschule von der Kirche auf den Staat, die Säkularisierung der bürgerlichen Eheschließung und der sonstigen »Standesamts«-Geschäfte, die Abschaffung von Sonderrechten der Kirche gegenüber ihren Mitgliedern und an ihrem Vermögen.15 Bismarck teilte diese Ziele in dem Maße, wie er auch sonst mit den Kräften der Zeit gehen wollte: So sehr er die Kirchen, auch die ihm als pietistisch geprägten Protestanten fremde katholische Kirche, grundsätzlich als Ordnungsmächte schätzte, so wenig wollte er es dulden, dass die staatliche Autorität und die neue Einheit des Reiches durch überkommene Mächte infrage gestellt wurden.
Natürlich musste dieser Teil des Modernisierungsprogramms der Reichsgründungs-Koalition ebenso auf Widerstände und Gegenkräfte stoßen wie die staatliche Einigung und die Schaffung einer rechtlichen Rahmenordnung für die Industriegesellschaft. Das galt umso mehr, als die Frontstellung der katholischen Kirche gegen die Moderne unter Papst Pius IX. ihren Höhepunkt erreichte. In der Enzyklika Quanta cura von 1864, der ein förmlicher Syllabus errorum beigelegt wurde, wandte sich die Papstkirche ausdrücklich gegen die Vorstellung, die Gesellschaft könne ohne Rücksicht auf die Religion organisiert werden, und verurteilte dann Volkssouveränität, Glaubens- und Kultusfreiheit, Pressefreiheit, Säkularisierung der gesellschaftlichen Institutionen und Trennung von Kirche und Staat als Ausdruck dieses Irrglaubens, ebenso wie Rationalismus, Ökonomismus und Sozialismus.16 Als die Regierungen in Baden und in Bayern in den 1860er Jahren versuchten, die Vorrechte der Kirche auf das konstitutionelle Maß zurückzuschneiden, bekamen sie zu spüren, dass der Klerus zur Behauptung seiner Positionen auch die katholischen Volksmassen mobilisieren konnte.
Dennoch musste der Konflikt zwischen modernem Verfassungsstaat und katholischer Kirche nicht die Zuspitzung erfahren, wie sie den Kulturkampf kennzeichnete. Der deutsche Episkopat interpretierte die päpstliche Absage an die Moderne in der Regel nicht offensiv. Eine besondere katholische Fraktion gab es im preußischen Abgeordnetenhaus seit 1866 nicht mehr; die Gemeinsamkeit katholischer Abgeordneter in kirchenpolitischen Fragen war vor den allgemeinpolitischen Gegensätzen verblasst. 1867 veröffentlichte der Bischof von Mainz, Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler eine vielbeachtete Schrift Deutschland nach dem Krieg von 1866, in der er die bislang vorwiegend großdeutsch orientierten Katholiken aufforderte, nunmehr ohne Vorbehalte an der kleindeutschen Lösung mitzuwirken. Das entsprach einer verbreiteten Stimmung. Grundsätzlichen Widerstand gegen die Reichsgründung gab es unter den deutschen Katholiken nur selten, auch wenn, wie im Westen und Süden des Reiches häufig, Vorbehalte gegenüber Zumutungen des preußischen Militärstaats blieben.17
Dass das Ringen um die Einordnung der katholischen Kirche in den modernen Staat im Kaiserreich, anders als etwa im zisleithanischen Österreich, gleichwohl die Dimension eines erbitterten Machtkampfs mit grundlegenden Folgen für das politische System annahm, ist im Wesentlichen auf zwei spezifische Faktoren zurückzuführen: Zum einen erreichte hier die Offensive der »Ultramontanen« (wie man die papsttreuen Eiferer nannte, die sich »jenseits der Berge«, das heißt: an Rom orientierten) eine besondere Spitze. Im Juli 1870, als die Neuregelung des Kirche-Staat-Verhältnisses im Habsburgerreich schon abgeschlossen war, verkündete das Erste Vatikanische Konzil gegen erhebliche Bedenken der deutschen Bischöfe das Dogma von der »Unfehlbarkeit« des Papstes, sofern sich dieser in Glaubensfragen »ex cathedra« äußere.18 Gleichzeitig begannen ehemalige Mitglieder der katholischen Fraktion, insbesondere der konservative Westfale Hermann von Mallinckrodt und der altliberale Rheinländer Peter Reichensperger, für die Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus im November 1870 Kandidaten aufzustellen, die ein Eintreten für die uneingeschränkte Wahrung der Rechte der Kirche verbürgten. Schließlich gelang es dem ultrakonservativen preußischen Diplomaten Karl Friedrich von Savigny, die allgemeinpolitisch sehr heterogene Fraktion, die auf diese Weise entstand (und die sich dann am 14. Dezember 1870 aus Verlegenheit die nichtssagende Bezeichnung »Fraktion des Zentrums« gab), und, was wichtiger war, viele Bischöfe und einen Teil des Klerus für den Kampf um die Rückgabe des Kirchenstaates an den Papst zu mobilisieren. Im Wahlkampf zu den Reichstagswahlen vom März 1871 formierte sich daraufhin zum ersten Mal so etwas wie eine »katholische Bewegung« im politischen Raum.19
Der Erfolg der »katholischen Phalanx« (so eine zeitgenössische Selbstcharakterisierung20) fiel geringer aus, als ihre Initiatoren erhofft hatten: Von 131 Wahlkreisen, die eine katholische Bevölkerungsmehrheit aufwiesen, fielen 59 an Abgeordnete, die sich der Zentrumsfraktion des Reichstags anschlossen; 60 katholische Abgeordnete traten anderen Fraktionen bei. Dennoch fühlten sich die Liberalen außerordentlich herausgefordert: Das Zentrum bildete die zweitgrößte Fraktion; es war ihm vielerorts gelungen, die Unterschichten für sich zu mobilisieren, sowohl die »rückständigen« als auch die Industriearbeiter; und es schien ein Programm zu verfolgen, das mit der unbedingten Bindung an den Papst in Rom nicht nur die Individuen unterdrückte, sondern auch die Einheit der Nation gefährdete. Umso entschlossener mussten sie fortfahren, die katholischen Gläubigen dem Einfluss der finsteren Mächte der Vergangenheit zu entziehen. Rudolf Virchow prägte dafür als Sprecher der Fortschrittsliberalen im preußischen Abgeordnetenhaus den Begriff »Kulturkampf«.21
Bismarck lagen die Vollendung der Aufklärung und die Durchsetzung der Prinzipien moderner Wissenschaft verständlicherweise weniger am Herzen. Umso schärfer sah er die machtpolitische Dimension des Vorgangs: Hier entwickelte sich eine Partei, die den populistischen Appell an die Massen noch besser beherrschte als er, und die ihn, völlig unabhängig von seinem Einfluss, gegen die Regierung richtete. Das schien ihm den prekären Herrschaftskompromiss, auf dem das Reich beruhte, in jeder Hinsicht zu gefährden: Es unterminierte seine eigene Herrschaftstechnik ebenso wie die Wählerbasis der Nationalliberalen; es drohte die Unterschichten gegen die Honoratioren aufzuwiegeln und, insofern die neue Partei auch den partikularistischen Stimmungen im Süden und anderswo Rechnung trug, vielleicht sogar die Einheit des Reiches in Frage zu stellen; es drohte mit dem Einfluss der römischen Kurie ständig Irritationen in die innere wie die äußere Politik des Reiches hineinzutragen. Dem konnte nur begegnet werden, darin stimmte er mit den Liberalen überein, wenn man den Einfluss der »Ultramontanen« auf die katholische Bevölkerung unterband.
Bismarck begriff die Auseinandersetzung um das Staat-Kirche-Verhältnis also seit dem Frühjahr 1871 als Kampf um die Macht im Staat und um die Sicherung der staatlichen Ordnung, die er geschaffen hatte. Und er führte sie entsprechend – mit den Mitteln staatlicher Macht und polarisierender Ausgrenzung, die ihm zu Gebote standen. In einem Schreiben an Delbrück Anfang Juni 1872 sprach der von der »mir seit Jahr und Tag zu meinem Bedauern klaren Tatsache, daß wir uns mit der Rom jetzt beherrschenden Partei im Kriege befinden«; und er fügte hinzu: »Passivität gilt für Schwäche und ist Schwäche. Wir sind gezwungen zu fechten oder uns zu unterwerfen.«22 Natürlich gedachte er zu »fechten« – das war der zweite Faktor, der den Kulturkampf in Preußen-Deutschland zu einem umfassenden Machtkampf werden ließ.
Das positive Ziel dieses Kampfes stand Bismarck nicht gerade sonderlich deutlich vor Augen. »Seine Ziele seien Kampf gegen die ultramontane Partei, insbesondere in den polnischen Gebieten, Westpreußen, Posen, Oberschlesien – Trennung von Kirche und Staat, von Kirche und Schule überhaupt