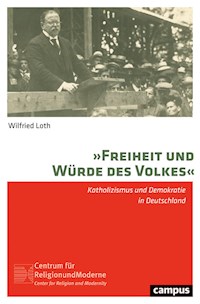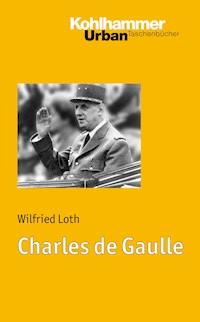Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Kalten Krieg standen sich sowjetkommunistische Parteidiktaturen und westliche Demokratien unversöhnlich gegenüber. Zugleich mussten die Verantwortlichen beider Seiten darauf bedacht sein, einen Krieg zu verhindern - denn er wäre mit Atomwaffen geführt worden und hätte mit der Vernichtung der Menschheit zu enden gedroht. Bemühungen zum Abbau der Konfrontation, zur Sicherung einer friedlichen Austragung des Systemgegensatzes und zur Stärkung der Kooperation zwischen Ost und West gab es daher seit Beginn des Ost-West- Konflikts, immer wieder unterbrochen von Spannungsschüben, von Abkapselung und Verhärtung. Auf der Grundlage neuer Quellen verdeutlicht Wilfried Loth, wie die Entspannungspolitik zur Überwindung des Kalten Kriegs und zum Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums führte. Er zeigt die Mechanismen auf, die den Abbau des Eisernen Vorhangs ermöglichten, und analysiert das Handeln der wesentlichen Akteure dieses weltgeschichtlichen Konflikts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried Loth
Die Rettung der Welt
Entspannungspolitik im Kalten Krieg 1950–1991
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Im Kalten Krieg standen sich sowjetkommunistische Parteidiktaturen und westliche Demokratien unversöhnlich gegenüber. Zugleich mussten die Verantwortlichen beider Seiten darauf bedacht sein, einen Krieg zu verhindern - denn er wäre mit Atomwaffen geführt worden und hätte mit der Vernichtung der Menschheit zu enden gedroht. Bemühungen zum Abbau der Konfrontation, zur Sicherung einer friedlichen Austragung des Systemgegensatzes und zur Stärkung der Kooperation zwischen Ost und West gab es daher seit Beginn des Ost-West- Konflikts, immer wieder unterbrochen von Spannungsschüben, von Abkapselung und Verhärtung. Auf der Grundlage neuer Quellen verdeutlicht Wilfried Loth, wie die Entspannungspolitik zur Überwindung des Kalten Kriegs und zum Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums führte. Er zeigt die Mechanismen auf, die den Abbau des Eisernen Vorhangs ermöglichten, und analysiert das Handeln der wesentlichen Akteure dieses weltgeschichtlichen Konflikts.
Vita
Wilfried Loth ist emeritierter Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Duisburg-Essen.
Inhalt
Prolog: Helsinki, 1. August 1975
1.Koreakrieg und Stalin-Noten
Aufrüstung in West und Ost
Die Note vom 10. März 1952
Die Reaktion des Westens
Stalins Wende
2.Tauwetter und Blockbildung
Berijas Pläne
Churchills Initiative
Ulbrichts Rettung
Das Ende der Provisorien
3.Entspannung im Kalten Krieg
Der »Geist von Genf«
Abrüstung und Wiedervereinigung
Das Berlin-Ultimatum
Von Camp David nach Paris
4.Chruschtschow und Kennedy
Der Weg zum 13. August
Fragmentarischer Dialog
Das Kuba-Abenteuer
Heißer Draht und Teststoppabkommen
5.Visionen auf dem Weg
Von Chruschtschow zu Breschnew
Vietnam-Krieg und Wettrüsten
De Gaulle und die deutsche Frage
Prager Frühling und Breschnew-Doktrin
6.Die Zeit der Verträge
Brandts Weg nach Moskau
Berlin-Regelung und SALT-Vertrag
Entspannung in Aktion
Erste Rückschläge
7.Der Niedergang der Entspannung
Jackson, Helsinki und Angola
Von Ford zu Carter
Der Gipfel von Wien
Entspannung in Europa
Der Entschluss zur »Nachrüstung«
8.Dunkle Zeiten
Einmarsch in Afghanistan
Carters Kurswechsel
Reagan und die Friedensbewegung
Deutsch-deutscher Dialog und Polen-Krise
Das Ende der Verhandlungen
9.Das Ende des Kalten Krieges
Das neue Denken
Schwieriger Start
Gorbatschows Offensive
Durchbruch in Washington
Kooperation und Perestroika
10.Revolutionen und Friedensschlüsse
Die Auflösung der sowjetischen Parteidiktatur
Die Demokratisierung der »Volksdemokratien«
Die deutsche Wiedervereinigung
Friedensregelungen
Der Zerfall der Sowjetunion
Bilanz: Die Angst und die Wege der Freiheit
Nachwort
Anmerkungen
Prolog: Helsinki, 1. August 1975 (S. 9–20)
1.Koreakrieg und Stalin-Noten (S. 21–41)
2.Tauwetter und Blockbildung (S. 43–68)
3.Entspannung im Kalten Krieg (S. 69–95)
4.Chruschtschow und Kennedy (S. 97–125)
5.Visionen auf dem Weg (S. 127–150)
6.Die Zeit der Verträge (S. 151–179)
7.Der Niedergang der Entspannung (S. 181–212)
8.Dunkle Zeiten (S. 213–244)
9.Das Ende des Kalten Krieges (S. 245–273)
10.Revolutionen und Friedensschlüsse (S. 275–307)
Bilanz: Die Angst und die Wege der Freiheit (S. 309–314)
Nachwort (S. 315–316)
Abkürzungen
Quellen und Literatur
1.Memoiren und zeitgenössische Schriften
2.Quelleneditionen
3.Darstellungen
Personenregister
Sachregister
Prolog: Helsinki, 1. August 1975
Die Zeremonie dauerte 17 Minuten. Am 1. August 1975, nachmittags kurz nach 17 Uhr Ortszeit, unterzeichneten 35 Staats- und Regierungschefs aus Europa, den USA und Kanada in der Finlandia-Halle im Zentrum von Helsinki die Schlussakte der »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«, in einer Kurzformel KSZE genannt. Da das Protokoll die Delegationsleiter in alphabetischer Reihenfolge nach der französischen Bezeichnung der Teilnehmerländer platziert hatte, an einem langen, leicht gerundeten Tisch gegenüber dem Auditorium, leisteten die Repräsentanten der beiden deutschen Staaten (»Allemagne«) als erste ihre Unterschrift, zunächst Bundeskanzler Helmut Schmidt und dann der Erste Sekretär der SED, Erich Honecker. Weiter ging es mit US-Präsident Gerald Ford (»Amérique«) und dem österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky (»Autriche«). Während ein Regierungschef nach dem anderen das in grünes Leder gebundene, 100 Seiten umfassende Dokument unterschrieb, jeder auf einer neuen Seite, herrschte im Saal gespannte Stille, unterlegt vom Blitzlichtgewitter der Fotografen. Nachdem als letzter der jugoslawische Präsident Josip Broz Tito (»Yougoslavie«) seinen Namen unter das Dokument gesetzt hatte, erklärte der gastgebende finnische Staatspräsident Urho Kekkonen den Unterzeichnungsakt für beendet. Die Delegierten erhoben sich von ihren Sitzen, lang anhaltender Beifall setzte ein, dann schloss Kekkonen die Konferenz mit einem Appell an die Teilnehmerstaaten, die in der Schlussakte festgehaltenen Absichtserklärungen auch in die Tat umzusetzen.
Damit fand ein Unternehmen seinen vorläufigen Abschluss, auf das die Sowjetunion lange Jahre vergeblich hingearbeitet hatte. Im Januar 1954 hatte der damalige sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow zum ersten Mal eine Europäische Sicherheitskonferenz vorgeschlagen, die eine Lösung der Streitfragen europäischer Sicherheit auf der Grundlage des Status quo der Nachkriegsordnung bringen sollte. 1965 hatte der Warschauer Pakt dazu aufgefordert, in einer gemeinsamen Konferenz »Maßnahmen zu erörtern, die die kollektive Sicherheit in Europa gewährleisten«.1 1966 hatte er seinen Vorschlag mit Anregungen zum Rückzug der Militärbündnisse sowie zur wissenschaftlichen, technologischen und kulturellen Zusammenarbeit verbunden. 1969, im »Budapester Appell« des Politisch-Beratenden Ausschusses der Warschauer Pakt-Staaten, war betont worden, dass diese Zusammenarbeit der europäischen Staaten »unabhängig von ihrer Gesellschaftsordnung« und »auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der Achtung der Unabhängigkeit und der Souveränität der Staaten«2 erfolgen solle.
Der Westen hatte sich zu einer solchen Konferenz aber erst bereitgefunden, nachdem die Bundesrepublik Deutschland in den Verträgen von Moskau und Warschau 1970 den Verzicht auf Gewaltanwendung und die Anerkennung der Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen in Europa mit der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen bilateral geregelt hatte und 1971 auch eine Berlin-Regelung gefunden worden war, die den Status quo der westlichen Enklave inmitten der DDR sicherte. Außerdem hatten die Westmächte durchgesetzt, dass über einen zentralen Aspekt der europäischen Sicherheit separat verhandelt wurde: die Reduzierung der Truppenbestände in Mitteleuropa, über die die betroffenen Staaten der NATO und des Warschauer Pakts seit 1973 auf der Konferenz über »Mutual Balanced Force Reduction« (MBFR) in Wien verhandelten.
Als die Tagesordnung der KSZE im Winter 1972/73 festgelegt wurde, hatten die Westmächte darüber hinaus erreicht, dass nicht nur Fragen der Sicherheit und der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Bereich behandelt wurden, sondern auch Fragen der Freizügigkeit, der Erleichterung der Kontaktmöglichkeiten zwischen Ost und West, humanitäre Probleme und eine Verbesserung des Informationsflusses. In dem Schlussdokument, das den Staats- und Regierungschefs im Sommer 1975 zur Unterzeichnung vorlag,3 wurden die hier zu treffenden Maßnahmen dann ziemlich konkret beschrieben: »wohlwollende Prüfung« von Anträgen auf Verwandtenbesuche und Familienzusammenführung, allgemeine Erleichterung von Reisen und Gruppenbegegnungen, verbesserter Austausch von Printmedien, Rundfunk-, Fernseh- und Filmproduktionen, bessere Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten, breiter Austausch in allen Bereichen der Kultur.
Für die kommunistischen Regime war die Zustimmung zu diesen Grundsätzen äußerst heikel. Sie konnte nur erreicht werden, weil der sowjetische Parteichef Leonid Breschnew unbedingt einen positiven Abschluss der Konferenz zustande bringen wollte – ein Dokument, mit dem er den Westen auf das Prinzip der Entspannung und der wirtschaftlichen Kooperation verpflichtete und das er auch zu Hause als Erfolg präsentieren konnte, möglichst noch vor dem 22. Parteitag der KPdSU, der für den Februar 1976 vorgesehen war. Die sowjetische Seite akzeptierte daher auch, dass in den einleitenden zehn Grundsätzen zur Regelung der Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten ausdrücklich die »Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt« untereinander genannt wurde – eine Barriere gegen jede militärische Intervention nach Art der Niederschlagung des »Prager Frühlings« im August 1968, auf deren Errichtung insbesondere Rumänien gedrängt hatte. Ebenso nahm sie nach langem Widerstreben schließlich hin, dass ein Recht auf Veränderung der Grenzen »durch friedliche Mittel und durch Vereinbarung« festgehalten wurde – eine Bestimmung, ohne die die Bundesrepublik die Vereinbarung nicht unterzeichnen wollte, weil sonst die Zustimmung zur Unverletzlichkeit der Grenzen und die Bestätigung der territorialen Integrität der Staaten als eine definitive Besiegelung der deutschen Teilung gedeutet werden konnte.
Hinsichtlich der Sicherheit vor einem bewaffneten Konflikt wurden über die Festlegung von Grundsätzen hinaus nur die vorherige Ankündigung von größeren militärischen Manövern und die Möglichkeit eines Austauschs von Manöver-Beobachtern vereinbart. Weitere vertrauensbildende Maßnahmen blieben Folgeverhandlungen vorbehalten. Im Übrigen hielten die Teilnehmerstaaten ausdrücklich fest, dass die Schlussakte von Helsinki bestehende Abkommen nicht berührte. Die Verpflichtungen im Warschauer Pakt, in der NATO und in der Europäischen Gemeinschaft galten also unverändert weiter. Die Schlussakte von Helsinki war völkerrechtlich nicht bindend, und es wurde auch keine Institution geschaffen, die die Einhaltung der Vereinbarung überwachen sollte. Moskau hatte ursprünglich auf die Einrichtung eines »Europäischen Sicherheitsrates« gedrängt. Als aber deutlich geworden war, dass eine solche Einrichtung auch zur ständigen Überprüfung des Verhaltens hinsichtlich der Menschenrechte und der Freizügigkeit führen musste, hatte die sowjetische Delegation den Vorschlag selbst wieder fallen gelassen.
So enthielt die Schlussakte hinsichtlich des weiteren Verfahrens nur die Verpflichtung, weitere gesamteuropäische Konferenzen einzuberufen. Eine erste Folgekonferenz wurde für 1977 vereinbart; sie sollte in Belgrad stattfinden. Gegen langes Sträuben der sowjetischen Seite verpflichteten sich die Teilnehmer außerdem, die Schlussakte in jedem Teilnehmerstaat ungekürzt zu veröffentlichen und sie »so umfassend wie möglich« zu verbreiten. Die Bürger der Staaten des Sowjetblocks bekamen damit ein Dokument mit Grundsätzen in die Hand, auf die sie sich gegenüber ihren Regierungen jederzeit berufen konnten. Die Regime des Ostblocks stimmten implizit zu, sich unabhängig vom Parteistandpunkt an den Grundsätzen von Helsinki messen zu lassen.
Die Verhandlungen über die KSZE-Schlussakte hatten fast zwei Jahre gedauert. 375 Diplomaten aus allen europäischen Staaten mit der Ausnahme von Albanien, dazu die Vertreter der USA und Kanadas als NATO-Mächte hatten in 2.341 Sitzungen in Genf über Inhalt und Form des Dokuments gestritten. Zum Schluss war unter großem Zeitdruck gearbeitet worden, mit einer Sitzungsdauer von 18 Stunden pro Tag. Um das festgesetzte Schlussdatum des 18. Juli 1975 einzuhalten, hatte man die Uhren anhalten müssen; erst um 2.42 Uhr des nächsten Tages war über die letzten strittigen Formulierungen Einvernehmen erzielt worden.
Bevor die 35 Staats- und Regierungschefs dann im sommerlichen Helsinki das Verhandlungsergebnis besiegelten, gaben sie Erklärungen ab. Bei Außentemperaturen von 28 Grad Celsius (von denen in der klimatisierten Halle allerdings wenig zu spüren war) hatten sie dazu jeweils 20 Minuten Zeit, wobei die Reihenfolge der Erklärungen per Los festgelegt wurde. Tatsächlich brauchte Ford 28 Minuten, während der britische Premierminister Harold Wilson, der nach den Eingangsstatements von Gastgeber Kekkonen und UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim als erster sprach, es in 15 Minuten schaffte. Insgesamt dauerte das Treffen zweieinhalb Tage, vom Mittag des 30. Juli, einem Mittwoch, bis zum Spätnachmittag des 1. August. Die finnische Polizei traf strenge Sicherheitsvorkehrungen, die die Arbeit der Journalisten zur Tortur werden ließ. Viermal am Tag, jeweils zu Beginn und am Ende der Sitzungen, wurde die gesamte Innenstadt hermetisch abgeriegelt, ebenso die Ausfallstraßen. Entsprechend groß war das Verkehrschaos.
Kekkonen, der im Mai 1969 als erster Vertreter eines Staates außerhalb des Warschauer Vertrags positiv auf den Vorschlag der Sicherheitskonferenz reagiert und damals Helsinki als Verhandlungsort vorgeschlagen hatte, stellte die Unterzeichnung der Schlussakte in seiner Eröffnungsansprache als einen Wendepunkt in der Geschichte Europas dar: »Wir haben allen Grund zu glauben, dass eine neue Ära in unseren gegenseitigen Beziehungen anbricht und dass wir zu einer Reise durch Entspannung zu Stabilität und dauerhaftem Frieden aufgebrochen sind.«4 Ähnlich zuversichtlich äußerte sich Tito, der am zweiten Konferenztag sprach: »Wenn künftige Historiker auf diese Konferenz zurückblicken, werden sie diese mit Sicherheit als einen Wendepunkt, als die Hinwendung Europas zur Koexistenz und zum Frieden bewerten.«
Waldheim war wesentlich zurückhaltender. Er betonte, »dass der erfolgreiche Abschluss dieser Konferenz eher einen Anfang als ein Ende darstellt«. Ford mahnte: »Die Geschichte wird diese Konferenz nicht aufgrund dessen beurteilen, was wir heute hier sagen, sondern aufgrund dessen, was wir morgen tun werden, nicht aufgrund der Versprechen, die wir eingehen, sondern aufgrund der Versprechen, die wir auch einhalten.« Wilson zitierte Clement Attlees Diktum: »Die einzige Alternative zur Ko-Existenz ist der Ko-Tod«, um dann die Forderung anzuschließen, die Zusagen hinsichtlich der Freizügigkeit auch einzulösen: »Entspannung bedeutet wenig, wenn sie sich nicht im täglichen Leben unserer Völker widerspiegelt. Ich sehe keinen Grund, weshalb im Jahre 1975 die Europäer nicht die Möglichkeit haben sollten, zu heiraten, wen sie wollen, zu hören und zu lesen, wen sie wollen, und hinzureisen, wohin sie wollen. Wenn man das streitig machen würde, wäre das nicht ein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche.«
Demgegenüber betonte Honecker, der als erster Vertreter eines »sozialistischen« Staates sprach, »das Entscheidende« sei »die Anerkennung des Prinzips der Unverletzlichkeit der Grenzen«. Freizügigkeit und Menschenrechte erwähnte er mit keinem Wort; stattdessen definierte er die Fortsetzung der Entspannung als »weitere Arbeit an einem stabilen Fundament der kollektiven Sicherheit in Europa«. Breschnew warnte, niemand dürfe versuchen, »auf Grund der einen oder anderen außenpolitischen Erwägung anderen Völkern vorzuschreiben, wie sie ihre inneren Angelegenheiten zu ordnen haben. Das Volk eines jeden Staates – und nur das Volk – hat das souveräne Recht, seine inneren Angelegenheiten selbst zu regeln, seine innerstaatlichen Gesetze selbst zu verabschieden.« Auch für ihn war das die »wichtigste Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der Arbeit der Konferenz«.
Immerhin sprach er dabei, deutlich aufgeschlossener als Honecker, von der Souveränität des Volkes, nicht einfach nur von der staatlichen Souveränität. Man konnte das auch als eine Absage an die »Breschnew-Doktrin« verstehen, wie die westliche Seite die Inanspruchnahme eines angeblichen Rechts auf Interventionen zur Rettung des Sozialismus bezeichnet hatte. Breschnew sprach auch davon, dass man Kompromisse habe schließen müssen, und begrüßte den vereinbarten »breiteren Austausch von Informationen im Interesse des Friedens und der Freundschaft zwischen den Völkern«. Den »Vereinbarungen ihre volle Wirksamkeit zu verleihen«, bezeichnete er uneingeschränkt als »unsere gemeinsame und wichtigste Aufgabe«. Darüber hinaus versprach er, sich für »wirkliche Ergebnisse bei der Abrüstung« einzusetzen. Insbesondere galt es, »Wege zur Verminderung der Streitkräfte und der Rüstungen in Mitteleuropa zu finden, ohne dass dabei irgendjemandes Sicherheit beeinträchtigt wird«.
Die gegensätzlichsten Auffassungen waren in der letzten Arbeitssitzung am Freitagnachmittag zu hören. Rumäniens Partei- und Staatschef Nicolae Ceauşescu erinnerte daran, dass es »Demokratie und Demokratie gibt – in dieser oder in jener Weise.« Dann machte er unmissverständlich deutlich, dass er die kommunistische Form von »Demokratie« für die höhere hielt, die darum von den westlichen Demokratien nichts anzunehmen brauche: »Die Demokratie, die wir in Rumänien realisieren, ist viel hochwertiger als die Demokratie, von der einige Sprecher gesprochen haben.« Demgegenüber verwies der Vertreter des Vatikans, Erzbischof Agostino Casaroli, der als letzter sprach, auf den unauflöslichen Zusammenhang von Frieden und Menschenrechten: »Wenn der Friede Wahrheit ist – selbstverständlich nicht der Friede der Gräber, der Versklavung oder des Zwanges –, dann setzt er eine gerechte, richtige und weise Ordnung der Rechte und der legitimen Interessen der einzelnen Parteien voraus, seien sie auch unterschiedlich oder stünden sie zueinander im Gegensatz. Dies ist das Ergebnis des Sieges der Vernunft und des guten Willens über die alleinige Konfrontation der Kräfte.«
Die Reden der 34 Kollegen anzuhören, war für die Staats- und Regierungschefs natürlich eine mehr oder minder lästige Pflichtübung. Viel wichtiger waren ihnen die bi- und multilateralen Gespräche untereinander am Rande der Konferenz. Bis tief in die Nacht hinein fanden solche Begegnungen statt, vom Vorabend der Konferenzeröffnung bis zum Abend nach Abschluss der Konferenz. Manche waren reine Routinetreffen, so zahlreiche Gespräche zwischen den osteuropäischen Führern. Es gab aber auch erstmalige Begegnungen und intensive Verhandlungen.
So bemühte sich Ford in zwei langen Gesprächen mit Breschnew, Schwierigkeiten bei den laufenden Verhandlungen über ein zweites Abkommen zur Begrenzung der strategischen Atomrüstung (SALT II) und die Truppenreduzierung in Mitteleuropa zu überwinden. Dabei gelang ihnen eine Reihe von Fortschritten. Breschnew stimmte zu, dass Raketen mit Mehrfachsprengköpfen pauschal gezählt wurden, und Ford akzeptierte Begrenzungen der Reichweite von Marschflugkörpern. Als es darum ging, die Einhaltung dieser Begrenzungen sicherzustellen, wussten sie jedoch nicht weiter. Ebenso wenig konnten sich die Führer der beiden Weltmächte über die Einordnung der sowjetischen »Backfire«-Bomber verständigen: Die Verteidigungsminister hatten ihnen dazu unterschiedliche technische Daten mitgegeben, die nicht in Einklang zu bringen waren. So blieb zum Schluss nur die Feststellung, dass es nicht einfach war, in den Fragen der Rüstungsbegrenzung zu einer Verständigung zu gelangen. Sowohl Ford als auch Breschnew fügten aber hinzu, dass sie sich weiterhin intensiv um einen baldigen Durchbruch bemühen wollten.5
Schmidt hatte unter anderen zwei lange Besprechungen mit Honecker – die erste Begegnung der beiden deutschen Staatsmänner. Dabei wurde weiterentwickelt, was sich seit dem Spätherbst 1974 als tragfähige Grundlage einer Verbesserung der deutsch-deutschen Beziehungen abzeichnete: finanzielle Zugeständnisse der Bundesrepublik, die Honecker zur Absicherung seiner Herrschaft brauchte, gegen eine größere Durchlässigkeit der innerdeutschen Grenze und eine Verbesserung der Verbindungen zwischen Westdeutschland und West-Berlin. Diskutiert wurde über die Erhöhung der Pauschale, die die Bundesrepublik für das Benutzen der Transitstrecken zahlte, die Sanierung der Autobahn Helmstedt–Berlin, die Wiederingangsetzung des Teltow-Kanals, über den die kürzeste Schifffahrtsstraße zwischen West-Berlin und dem Bundesgebiet führte, und andere Maßnahmen zur Verbesserung des Reiseverkehrs. Schmidt signalisierte seine Bereitschaft, die Transitpauschale zu erhöhen, soweit dies plausibel gemacht werden konnte. Honeckers Vorschlag, die Kosten für die Autobahn-Erneuerung im Verhältnis 70 zu 30 zu teilen (70 Prozent für die Bundesrepublik, 30 für die DDR), wollte er von den Experten prüfen lassen. Zugleich machte er deutlich, dass er dafür Gegenleistungen erwartete – vor allem eine Senkung des Mindestalters bei der Genehmigung von West-Reisen von DDR-Bürgern und die Vereinbarung von Folgeabkommen zum Grundlagenvertrag über die innerdeutschen Beziehungen. Honecker wollte sich darauf nicht festlegen lassen, wie auch Schmidt keine verbindlichen Zusagen gab. Beiden wurde aber in Helsinki klar, dass man auf diese Weise ins Geschäft kommen würde.6
Verhandlungsfortschritte dieser Art wurden freilich nicht sogleich sichtbar. Die Unterzeichnung der Helsinki-Akte stieß darum auch nicht überall auf Gegenliebe. In den USA sorgten sich Bürger baltischer Abstammung, mit dem Bekenntnis zur Unverletzlichkeit der Grenzen werde die Annexion Estlands, Lettlands und Litauens durch die Sowjetunion endgültig sanktioniert. Alexander Solschenyzin, der 1974 aus der Sowjetunion ausgebürgert worden war, warf Ford vor, mit seiner Unterschrift unter die KSZE-Schlussakte »die Völker Osteuropas zu verraten« und ihre »Versklavung auf immer offiziell zu besiegeln«.7 Und Ronald Reagan, schon in den Startlöchern, um Ford die Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 1976 streitig zu machen, stellte die Vereinbarung mit den kommunistischen Regimen als etwas völlig Unamerikanisches dar: »Ich bin dagegen, und ich denke, dass alle Amerikaner dagegen sein sollten.«8 Innenpolitisch zahlte sich die Reise nach Europa für Ford nicht aus.
Auch unter den Europäern gab es Kritik. Raymond Aron in Paris nannte die KSZE eine »Komödie«: Nie sei ein so ungeheurer Aufwand betrieben worden, »um solch lächerliche Ergebnisse zu erzielen«. Bislang hätten es die westlichen Nationen immer vermieden, die Teilung Europas moralisch zu ratifizieren. »In Helsinki haben sie offensichtlich nachgegeben.« Robert Conquest, britischer Sowjetexperte, beklagte, die Unterzeichnung der Schlussakte befördere das trügerische Bild von einer friedliebenden und liberalen Sowjetunion und unterminiere so den Verteidigungswillen des Westens: »Die Atmosphäre, die so geschaffen wird, ist schlecht.«9 Ähnlich sah es die CDU/CSU-Opposition im Deutschen Bundestag: »Maßgebliche Inhalte des Schlussdokuments der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«, hieß es in einem Entschließungsantrag, mit dem die Oppositionsfraktion die Bundesregierung aufforderte, die Akte nicht zu unterzeichnen, »dienen einer weltweiten Täuschung über die wahre Sicherheitslage in der Welt.« Entspannungspolitik sei »nach östlicher Auffassung ein offensives, ein expansives, ein aggressives Konzept«, führte Fraktionsvorsitzender Karl Carstens zur Begründung aus, »und dem stellt der Westen nichts entgegen, nichts, was damit vergleichbar wäre«.10
In Moskau wurden hinter verschlossenen Türen die entgegengesetzten Befürchtungen laut. Viele Mitglieder des Politbüros, berichtet der langjährige Botschafter der Sowjetunion in Washington, Anatolij Dobrynin, »hatten schwere Bedenken, internationale Verpflichtungen einzugehen, die den Weg zu auswärtiger Einmischung in unser politisches Leben öffnen konnten. Viele Sowjetbotschafter äußerten Zweifel, weil sie richtig voraussahen, dass die Vereinbarungen schwierige internationale Dispute nach sich ziehen würden. Moskau hatte wegen des Liberalisierungsprozesses, der mit Helsinki verbunden war, eine grundlegende Entscheidung mit weitreichenden innenpolitischen Folgen zu treffen.«11
Tatsächlich war die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki weniger ein Wendepunkt in der Geschichte der Ost-West-Beziehungen als ein Anlass, über die Möglichkeiten der Entspannungspolitik nachzudenken, und ein Moment ihrer Bekräftigung. Entspannungspolitik gab es, seit es den Kalten Krieg gab, das heißt: seit den ersten Jahren nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs im Sommer 1945. Immer wieder machten sich Zweifel bemerkbar, ob die Sowjetunion wirklich so aggressiv und so mächtig war, wie es die These vom sowjetischen Expansionismus behauptete. Immer wieder gab es Zweifel, ob der Westen so kriegslüstern war, wie die These vom westlichen Imperialismus unterstellte. Immer wieder waren Stimmen zu hören, die auf die Kosten der Konfrontation zwischen dem Ostblock unter sowjetischer Führung und dem Westblock unter amerikanischer Führung hinwiesen: die Notwendigkeit, erhebliche Ressourcen in die militärische Rüstung zu stecken, ohne je ganz sicher sein zu können, dass die Abschreckung des Gegners wirklich funktionierte; die Tendenzen zu autoritärer Verhärtung der eigenen Gesellschaft; das wachsende Risiko einer atomaren Katastrophe. Immer wieder setzten sich diejenigen zur Wehr, die unter der Blockkonfrontation besonders zu leiden hatten – die Deutschen, die die Teilung ihrer Nation erdulden mussten; die kleineren Staaten, die sich durch die Abhängigkeit von den neuen Weltmächten eingeengt fühlten; die innenpolitischen Verlierer der Konfrontation.
Chancen zu einem Abbau der Konfrontation gab es insofern, als sich Ost und West, anders als es die Metapher vom Kalten Krieg nahelegt, nicht wirklich existentiell bedrohten. Die Machthaber des Ostblocks hatten zwar andere Zukunftsvorstellungen als die Bürger des Westens – die einen erwarteten, dass sich der »Sozialismus«, wie sie ihn verstanden, früher oder später auch im Westen durchsetzen würde; die anderen wünschten, dass die Diktaturen des Ostens eines Tages freiheitlichen Regimen wichen. Doch weder die einen noch die anderen waren bereit, für die Durchsetzung dieser Vorstellungen einen Krieg zu riskieren. Dazu waren diese Ziele nicht existentiell genug, und der Preis, der dafür zu zahlen gewesen wäre, war viel zu hoch. Mit dem Aufbau der atomaren Waffenarsenale war er in keinem Fall mehr zu verantworten. Dass diese Arsenale nicht zum Einsatz kommen würden und so die Welt vernichteten, wurde zum wichtigsten aller politischen Ziele, im Westen wie im Osten. Die sowjetischen Führer betrachteten es auch nicht als ein vordringliches Ziel, ihren Machtbereich mit politischem Druck auf das westliche Europa auszudehnen; und der Westen verfügte hinsichtlich der Befreiung des östlichen Europas nur über sehr begrenzte Mittel.
Hinderlich war nur, dass man das nicht so genau wissen konnte. Die Brutalitäten kommunistischer Regime und die aggressive Propagandasprache ihrer Führer riefen im Westen Zweifel und Ängste hervor; die ständigen Schwierigkeiten, sich zu behaupten, und das klassenkämpferische Weltbild, in dem sie sich immer wieder bestärkt fühlten, zeitigten die gleichen Effekte bei den Kommunisten des Ostens. Dieses Misstrauen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg dazu geführt, dass die Bemühungen um eine gemeinsame Nachkriegsordnung, die die USA und die Sowjetunion als die beiden Hauptsiegermächte zu verantworten hatten, weitgehend gescheitert und zwei gegensätzliche Machtblöcke entstanden waren, die sich wechselseitig bedrohten.12
Im Westen hatte man die Durchsetzung moskautreuer kommunistischer Regime in Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und schließlich auch der Tschechoslowakei als Auftakt zu einer immer weiteren Expansion des Sowjetkommunismus wahrgenommen, der bald das gesamte westliche Europa bis zum Atlantik zum Opfer zu fallen drohte. Darauf hatte man seit 1947 mit einer Politik der »Eindämmung« reagiert, die zur Bildung eines westlichen Blocks führte: Stabilisierung der westlichen Demokratien durch die Finanzhilfen des Marshall-Plans, Ausschluss der Kommunisten aus den Regierungen der westeuropäischen Länder, Zusammenschluss der drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands zu einem westdeutschen Staat, der ökonomisch wie politisch fester Bestandteil des Westens werden sollte; schließlich auf Bitten der verängstigten Westeuropäer im April 1949 der Abschluss des Atlantikpakts, mit dem die USA und Kanada Großbritannien, Frankreich, den Beneluxländern, Italien, Norwegen, Dänemark, Island und Portugal militärische Unterstützung im Falle eines Angriffs durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten verbindlich zusagten.
Stalin hatte den Aufbau eines westlichen Bündnisses als Bruch der Anti-Hitler-Koalition verstanden und mehr und mehr befürchtet, er werde der Vorbereitung eines Krieges gegen die Sowjetunion dienen. Die USA hätten die Demokratisierung Deutschlands aufgegeben, hatte Nikolai Nowikow, sein Botschafter in Washington bereits im September 1946 nach Absprache mit Außenminister Wjatscheslaw Molotow geschrieben. Sie seien bestrebt, die osteuropäischen Länder zu durchdringen; sie übten Druck auf die Sowjetunion aus und suchten durch das Entfachen einer Kriegspsychose ein hohes Rüstungsniveau sicherzustellen. »Alle diese Maßnahmen sind kein Selbstzweck. Sie sind allein darauf gerichtet, die Bedingungen dafür zu schaffen, in einem neuen Krieg die Weltherrschaft zu gewinnen.«13 Entsprechend hatte der sowjetische Diktator seinen osteuropäischen Verbündeten die Teilnahme am Marshall-Plan verboten, er hatte den Kurs der kommunistischen Parteien in Ost- wie in Westeuropa strikt auf das Moskauer Vorbild ausgerichtet und zur Wachsamkeit gegenüber dem »Klassenfeind« in den eigenen Reihen aufgerufen. Die jugoslawischen Kommunisten unter der Führung Titos, die sich diesem Kontrollanspruch Moskaus nicht beugen wollten, waren im Juni 1948 aus dem Kominform, dem neuen Lenkungsorgan der kommunistischen Parteien Europas, ausgeschlossen worden. Alle Welt glaubte jetzt, sich in einem »Kalten Krieg« zu befinden, der früher oder später in einen »heißen« Krieg, sprich: eine große militärische Konfrontation der beiden Lager übergehen könnte.
Aus der Bedrohungssituation von zwei Blöcken, die sich mit gegensätzlichen Weltordnungs- und Zukunftsvorstellungen gegenüberstanden, gab es keinen leichten Ausstieg. Jede Seite musste mit präventiven Sicherheitsmaßnahmen der Gegenseite rechnen und sich dagegen wappnen. Um das ständige Kräfteringen einzudämmen, das daraus resultierte, musste man übertriebene Ängste überwinden. Ideologische Scheuklappen waren abzulegen, und man musste sich gegen jene breite Koalition von Kräften durchsetzen, die von der Konfrontation profitierten und damit – bewusst oder unbewusst – zu sekundären Verursachern des Kalten Krieges geworden waren: die Militär- und Rüstungslobbys und die Sieger in den innenpolitischen Auseinandersetzungen, die im Zeichen des Kalten Kriegs geführt wurden.
Weil diese Bedingungen nicht so schnell zusammenkamen und auch nur schwer durchzuhalten waren, wurden die Bemühungen zum Abbau der Konfrontation, zur Sicherung einer friedlichen Austragung des Systemgegensatzes und zur Stärkung der Kooperation zwischen Ost und West immer wieder von neuen Spannungsschüben, von Abkapselung und Verhärtung unterbrochen. Mit der Zeit wuchs allerdings der Realismus; Maßnahmen der Rückversicherung halfen der Vernunft, über die Angst zu siegen. Das bedeutete auch, dass die leninistische Ideologie, die das Weltbild Stalins und seiner Statthalter geprägt hatte, im Laufe der Zeit an Bedeutung verlor, nicht kontinuierlich, aber in der Tendenz – bis sie schließlich in einem Akt der Selbstbefreiung ganz über Bord geworfen wurde.
Ost und West verfolgten in der Entspannungspolitik weitgehend übereinstimmende Ziele: Vermeidung der atomaren Konfrontation, die zum gemeinsamen Untergang zu führen drohte, Minderung der Rüstungslasten, Zusammenarbeit zum wechselseitigen Vorteil. In einem Punkt aber schlossen sich die Erwartungen, die mit der Entspannungspolitik verbunden waren, gegenseitig aus: Während man in Moskau und den anderen Hauptstädten des Ostblocks darauf bedacht war, durch die Vereinbarungen mit dem Westen die eigene Herrschaft abzusichern, zielte die westliche Entspannungspolitik auch darauf, die Freiheitsbeschränkungen im Osten zu überwinden. Insofern war die östliche Entspannungspolitik zumindest nach Stalin in der Anlage defensiv, die westliche dagegen in unterschiedlicher Intensität offensiv. Bei der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wurden beide Momente sehr deutlich spürbar. Es war – im Osten wie im Westen – eine Frage des Selbstvertrauens, welchen man für stärker hielt.
1.Koreakrieg und Stalin-Noten
In den 1950er-Jahren waren Entspannungsbemühungen zunächst mit dem Versuch verbunden, den Prozess der Ost-West-Blockbildung, der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Gang war, im letzten Moment noch einmal zu stoppen. Im westlichen Vorfeld der Sowjetunion hatten sich unter dem Schutz der Roten Armee und der informellen Einflusssphären-Teilung der Siegermächte kommunistische Regime etabliert, das westliche Europa hatte den Wiederaufbau im Zeichen des Marshall-Plans gemeinschaftlich und unter amerikanischer Führung organisiert, und auf deutschem Boden waren, weil die Verständigung der Besatzungsmächte über eine gemeinsame Deutschland-Regelung nicht gelang, zwei separate Staaten entstanden, die in enger Abhängigkeit von der östlichen bzw. westlichen Führungsmacht den gegensätzlichen weltpolitischen Lagern zuzurechnen waren. Aber noch war das Problem eines Verteidigungsbeitrags der westdeutschen Bundesrepublik nicht gelöst und damit die Struktur des westlichen Verteidigungsbündnisses ebenso ungewiss wie die Art der amerikanischen Präsenz in Europa. Ebenso wenig war die DDR in ein östliches Verteidigungsbündnis eingebunden, und es gab auch noch keine Zusage, dass die sowjetische Schutzmacht auf Dauer für die »sozialistische« Ordnung im östlichen Deutschland einstehen würde.
Die Alternative zum Abschluss der Blockbildung durch die militärische Integration der beiden deutschen Staaten in die gegensätzlichen Bündnissysteme des Ostens und des Westens lautete Neutralisierung, genauer gesagt: die Verständigung über einen Friedensvertrag, der einem wieder vereinten Deutschland untersagte, sich einem Militärbündnis anzuschließen, das sich gegen eine der Siegermächte richtete, gefolgt von dem Abzug aller Besatzungstruppen aus Deutschland. Was unter solchen Umständen aus der NATO werden würde, war ziemlich offen; aber mindestens ebenso offen war die Zukunft der »sozialistischen« Revolution, die die SED-Kommunisten unter tatkräftiger Mithilfe ihrer sowjetischen »Freunde« in der östlichen Besatzungszone auf den Weg gebracht hatten. Der Ost-West-Gegensatz musste bei einer solchen Konstruktion in jedem Fall erheblich an Bedeutung verlieren.
Aufrüstung in West und Ost
Die Initiative zur Einbeziehung der jungen Bundesrepublik Deutschland in das westliche Verteidigungsbündnis und damit zur Verstetigung der Provisorien, die 1949 geschaffen worden waren, ging von den USA aus. Die Truman-Administration hatte ursprünglich auf eine lange Fortdauer des amerikanischen Atomwaffenmonopols vertraut und deswegen einen geringen Grad an konventioneller Rüstung für vertretbar gehalten. Strategische Planungen für den Fall eines sowjetischen Angriffs auf das westliche Europa, den man für ganz unwahrscheinlich gehalten hatte, hatten einen Rückzug amerikanischer Truppen an die Atlantikküste vorgesehen, gefolgt von einer massiven Luftoffensive. Nach dem erfolgreichen Test der ersten sowjetischen Atombombe am 29. August 1949 setzte sich nun aber die Überzeugung durch, dass auf die atomare Überlegenheit langfristig kein Verlass mehr war. Ein Memorandum des Nationalen Sicherheitsrats vom 7. April 1950, das im Wesentlichen von Außenminister Dean Acheson und dem Chef des Politischen Planungsstabs Paul Nitze verfasst worden war, forderte darum, den kommunistischen »Drang zur Weltherrschaft« durch die Schaffung von militärischer Überlegenheit zu brechen. Dazu sollte eine effektive Organisation westlicher Verteidigung geschaffen werden, und die Verteidigungsausgaben sollten auf das Vier- bis Fünffache steigen.1
Die Schaffung einer effektiven Verteidigungsorganisation des Westens schloss logischerweise die Aufstellung deutscher Truppen ein. Die Bundesrepublik war das exponierteste Vorfeld westlicher Sicherheit. Man konnte sie daher weder ohne Schutz lassen noch auf ihren Beitrag zur Verteidigung verzichten. Weil die Wiederbewaffnung der Deutschen aber große Sorgen vor einem Wiederaufleben der deutschen Gefahr hervorrief, zögerte man freilich, diesen Teil des Aufrüstungsprogramms in Angriff zu nehmen. Als die Joint Chiefs of Staff entschieden auf die Aufstellung westdeutscher Streitkräfte drängten, wurde ihnen gesagt, dass dies nicht ginge, »solange die wichtigsten Mitglieder des westeuropäischen Verteidigungssystems nicht unter veränderten Umständen, die jetzt nicht voraussehbar sind, zu der Überzeugung gelangen, dass ein gewisses Maß an deutscher Wiederbewaffnung die Sicherheit des Westens im Ganzen eher stärken als schwächen würde«.2
Die Veränderung der Umstände, von niemandem so erwartet, ergab sich aus dem Angriff nordkoreanischer Truppen auf Südkorea am 25. Juni 1950. Stalin hatte dem anhaltenden Drängen des nordkoreanischen Diktators Kim Il-Sung endlich nachgegeben, einen Angriff auf den Süden zu genehmigen – offensichtlich davon überzeugt, dass der Krieg zwischen den beiden Koreas ohnehin bevorstand, das ziemlich korrupte Regime von Syngman Rhee im Süden rasch zusammenbrechen würde und die amerikanischen Truppen, die im Juni 1949 abgezogen waren, nicht zurückkehren würden, um ihn zu retten. Die Truppen Kim Il-Sungs drangen in der Tat rasch nach Süden vor; bis Ende Juli hatten sie die gesamte koreanische Halbinsel bis auf einen knappen südöstlichen Landstrich um die Stadt Pusan erobert.
Truman und seine Berater begriffen den Angriff jedoch, anders als von Stalin erwartet, als Ausdruck einer sowjetischen Strategie militärischer Expansion, der es Widerstand zu leisten galt. Nicht zuletzt unter dem Druck einer öffentlichen Meinung, die sie beschuldigte, China 1949 leichtfertig an den Kommunismus verloren zu haben, beauftragten sie General Douglas MacArthur, den amerikanischen Prokonsul in Japan, dem südkoreanischen Regime mit Luft- und Seestreitkräften zu Hilfe zu eilen. Da die Sowjetregierung den Sicherheitsrat gerade boykottierte (aus Ärger darüber, dass dort der Sitz Chinas immer noch von der Regierung Chiang Kai-sheks gehalten wurde), gelang es ihnen auch, ein Mandat der Vereinten Nationen zur Verteidigung Südkoreas zu erhalten. Insgesamt 16 Nationen beteiligten sich an dem Militäreinsatz unter dem Oberbefehl MacArthurs, darunter Australien, Kanada und Großbritannien. Die Hälfte der Truppen wurde allerdings von den USA gestellt, 40 Prozent von den Südkoreanern. Mit einer Landung in Incheon (dem Hafen in der Nähe der Hauptstadt Seoul) am 15. September begann MacArthurs Gegenoffensive. Innerhalb von zwei Wochen wurde Seoul zurückerobert; dann begannen die Mandatstruppen, über den 38. Breitengrad nach Norden vorzudringen.
Der Angriff der Nordkoreaner auf das südliche Korea verhalf nun dem Szenario eines Angriffs ostdeutscher Kommunisten auf das westliche Deutschland zu einer gewissen Plausibilität. Damit konnten die Anwälte einer Bewaffnung der Bundesrepublik in die Offensive gehen. Am 29. August 1950 bot Bundeskanzler Konrad Adenauer »im Falle der Bildung einer internationalen westeuropäischen Armee einen Beitrag in Form eines deutschen Kontingents« an;3 zwei Wochen später verlangte Acheson von der britischen und französischen Regierung nicht nur eine Erhöhung ihres Rüstungsbudgets, sondern auch die Zustimmung, deutsche Truppen in der Stärke von etwa zehn Divisionen aufzustellen. Nur unter diesen Voraussetzungen erklärte sich die amerikanische Regierung bereit, das militärische Engagement der USA in Europa zu verstärken und den Oberbefehl eines integrierten Generalstabs der NATO zu übernehmen.
Die französische Regierung reagierte auf diese Erpressung mit dem Vorschlag einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Wenn deutsche Truppen schon unvermeidlich waren, dann sollte die Verfügungsgewalt über diese Streitkräfte nicht bei der Bundesregierung liegen, sondern bei der Gemeinschaft der westlichen Europäer. Frankreich wollte darum, wie Ministerpräsident René Pleven am 24. Oktober 1950 erläuterte, eine europäische Armee aufstellen, die einem europäischen Verteidigungsminister unterstellt war und nationale Kontingente »auf der Basis der kleinstmöglichen Einheit« integrierte.4 Einen deutschen Generalstab sollte es folglich nicht geben; dagegen sollten die bestehenden europäischen Armeen nur soweit in die neue Organisation einbezogen werden, wie sie für die Verteidigung Europas benötigt wurden. Die Sicherung europäischer Interessen in den Übersee-Gebieten sollte weiterhin in nationaler Hand bleiben.
Eine solche Diskriminierung der Deutschen innerhalb einer westlichen Verteidigungsgemeinschaft war freilich in der Bundesrepublik nicht durchsetzbar. Adenauer lehnte sie darum rundweg ab. Er wollte den Bedarf an deutschen Truppen im Gegenteil dazu nutzen, die Fesseln des Besatzungsstatuts abzustreifen, die die westlichen Siegermächte dem jungen westdeutschen Staat angelegt hatten. Die Regierungen in Washington und London hielten den französischen Vorschlag ebenfalls für abwegig: politisch nicht durchzusetzen und militärisch völlig unsinnig. Angesichts der Gefahr einer Verlagerung amerikanischer Truppen von Deutschland nach Korea stimmte die französische Regierung der Aufstellung deutscher Kampftruppen im Rahmen der NATO am 6. Dezember im Prinzip zu; über die Form des deutschen Verteidigungsbeitrags war damit aber noch nicht entschieden. Im Gegenzug beschloss der Ministerrat des Atlantikpakts am 18./19. Dezember in Brüssel die Schaffung einer integrierten NATO-Streitmacht. General Dwight D. Eisenhower, der legendäre Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, wurde zu ihrem ersten Oberbefehlshaber bestimmt.
Unterdessen hatte China in den Koreakrieg eingegriffen. Als die Truppen MacArthurs auf breiter Front gegen die chinesische Grenze vorrückten, entschloss sich Mao Zedong am 13. Oktober 1950 gegen den Widerstand seines Ministerpräsidenten Zhou Enlai, Stalins Aufforderung zur Intervention zu folgen. Mao vermutete, dass die Truppen MacArthurs nicht am Yalu Halt machen würden. Vor allem aber sah er in einem Sieg der Amerikaner in Korea ein Signal an die nationalchinesischen Kräfte, den Kampf um die Herrschaft über China wieder aufzunehmen. Am 25. November, nachdem die UNO-Truppen gerade den Yalu erreicht hatten, begann eine groß angelegte Offensive chinesischer Truppen. MacArthurs Truppen wurden nach Süden zurückgedrängt. Am 31. Dezember überschritten die Chinesen und Nordkoreaner den 38. Breitengrad nach Süden, kurz darauf fiel Seoul in ihre Hand.
MacArthur forderte jetzt, die nationalchinesischen Truppen auf dem Festland landen zu lassen und auch Atombomben gegen China einzusetzen. Die drohende Niederlage vor Augen, war Truman nahe daran, diesen Forderungen nachzugeben. Erst als sich die Front wieder stabilisierte, entschied er sich dagegen. Der Krieg blieb auf Korea beschränkt. Nach einer erneuten amerikanischen Offensive, bei der im März 1951 die Rückeroberung Seouls gelang, und einer vergeblichen chinesischen Frühjahrsoffensive mutierte er zum Stellungs- und Abnutzungskrieg. Als MacArthur Anfang April den amerikanischen Kongress für eine Ausweitung des Krieges auf China zu mobilisieren versuchte, wurde er von Truman wegen Insubordination entlassen. Die Truman-Administration fürchtete, die Sowjetunion würde eine Ausweitung des amerikanischen Engagements in Ostasien zur weiteren Expansion in Europa und am Persischen Golf nutzen. Ein Krieg gegen China war für sie »der falsche Krieg am falschen Ort zur falschen Zeit gegen den falschen Feind«.5
Während sich der Krieg in Korea zu einem langwierigen, freilich auch sehr verlustreichen Stellungskrieg entwickelte, kam eine Einigung über die Form des westdeutschen Beitrags zur NATO erst nach zähen Verhandlungen zustande. Um die Jahresmitte 1951 rang sich Acheson zu der Einsicht durch, dass er ohne eine europäische Einbindung in Frankreich nicht durchzusetzen war. Dafür musste der französische Außenminister Robert Schuman allerdings akzeptieren, dass den Deutschen innerhalb der Europa-Armee die gleichen Rechte zugestanden wurden wie den anderen Mitgliedern. Im Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), der am 27. Mai 1952 von den Vertretern Frankreichs, der Bundesrepublik, Italiens, Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs in Paris unterzeichnet wurde, wurden die Entscheidungen von einstimmigen Voten eines Ministerrats abhängig gemacht. Die Truppen sollten auf Divisionsebene integriert werden, und die Bundesrepublik sollte ein eigenes Verteidigungsministerium erhalten. Die Bundesrepublik wurde zumindest vorerst noch nicht in die NATO aufgenommen; die Bundesregierung konnte aber gemeinsame Sitzungen des EVG-Ministerrats und des NATO-Rats verlangen. Ein »Generalvertrag«, den die Bundesregierung am 26. Mai 1952 mit den westlichen Besatzungsmächten schloss, sah zudem die Aufhebung des Besatzungsstatuts vor. Allerdings behielten sich die westlichen Siegermächte alle »Deutschland als Ganzes« betreffenden Rechte vor und verboten den Deutschen weiterhin die Produktion strategisch relevanter Rüstung.
Der Koreakrieg und die Bereitschaft der Europäer, im Interesse an der eigenen Sicherheit Kompromisse zu schließen, verhalfen dem ehrgeizigen Aufrüstungsprogramm NSC-68 über die parlamentarischen Hürden. Der Kongress akzeptierte nicht nur die Ausweitung der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa (von zwei auf sechs Divisionen) und neue Militärhilfen für die europäischen Verbündeten, sondern auch die Entwicklung der Wasserstoffbombe (die dann im November 1952 erstmals erfolgreich getestet wurde) und die Ausweitung der amerikanischen Truppenstärke von 1,5 auf 3,5 Millionen Mann. Von 13 Milliarden Dollar im Jahr 1950 stieg der amerikanische Verteidigungshaushalt bis 1953 auf über 50 Milliarden – der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt kletterte dadurch von fünf auf 13 Prozent. Die USA etablierten sich damit nun auch als die militärische Führungsmacht des westlichen Bündnisses. Im September 1951 gab der NATO-Rat dem Drängen Griechenlands und der Türkei nach, als gleichberechtigte Mitglieder in das westliche Verteidigungsbündnis einbezogen zu werden. Mit dem Inkrafttreten des entsprechenden Vertrags am 18. Februar 1952 stieg die Zahl der NATO-Mitglieder von 12 auf 14.
In Stalins Sicht stieg mit der westlichen Aufrüstung die Gefahr eines Angriffs auf das eigene Lager. Von dem Beschluss zur Bildung einer integrierten NATO-Streitmacht gehe gewiss keine unmittelbare Kriegsgefahr aus, sagte er den Parteichefs und Verteidigungsministern der osteuropäischen »Volksdemokratien«, die er nach der Tagung des Atlantikrats am 18./19. Dezember 1950 eilig nach Moskau gerufen hatte. Die USA hätten sich in Korea »in eine Zwangslage gebracht« und seien dort für »zwei, drei Jahre« gebunden. Danach sei die »Auslösung des Dritten Weltkriegs« aber möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich: »Imperialisten haben ihre eigene Logik: Sie pflegen unbewaffnete oder schwach bewaffnete Länder anzugreifen, um sie zu vernichten; aber sie machen einen Bogen um die gut bewaffneten Länder.«6
Um den befürchteten Angriff des Westens abzuwehren, wurden die Führer der Ostblock-Staaten angewiesen, »die Zeit von zwei, drei Jahren, die wir haben, dazu [zu] nutzen, eine moderne und schlagkräftige Armee aufzubauen«.7 Bis Ende 1952 sollten die Armeen der Volksdemokratien zusammen eine Friedensstärke von 1.140.000 Mann aufbringen, bis Ende 1953 eine Kriegsstärke von 3.000.000 Mann. Den Volksdemokratien wurde einige Unterstützung durch sowjetische Militärtechnik zugesagt. Vor allem aber wurde ihnen auferlegt, die Schwerindustrie auszubauen, um die verstärkten Armeen angemessen ausrüsten zu können. Zur Koordination des Aufrüstungsprogramms wurde in aller Heimlichkeit ein »Koordinierungskomitee« unter dem Vorsitz von Nikolai Bulganin geschaffen.8 Ebenso wurde die Entwicklung einer eigenen Wasserstoffbombe forciert. Sie konnte dann im August 1953 erstmals erfolgreich getestet werden, zehn Monate nach der ersten Zündung der amerikanischen Wasserstoffbombe.
Die Note vom 10. März 1952
Gleichzeitig bemühte sich Stalin verstärkt, Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Deutschland in Gang zu bringen. Nach der Bildung der ersten Bundesregierung unter Konrad Adenauer hatte er im September 1949 notgedrungen der Konstituierung einer »Deutschen Demokratischen Republik« auf dem Boden der sowjetischen Besatzungszone zugestimmt. Aber abgefunden hatte er sich mit der deutschen Teilung deswegen noch nicht: Dazu war das Kriegspotential auf westdeutschem Boden – in erster Linie die Schwerindustrie des Ruhrgebiets –, über das die Westmächte jetzt verfügten, in seiner Sicht viel zu groß; und die Vorstellung einer Allianz amerikanischer und deutscher Imperialisten löste bei ihm geradezu apokalyptische Ängste aus. Den SED-Führern hatte er daher immer wieder eingeschärft, zuerst müsse die Einheit Deutschlands verwirklicht werden, erst danach könne man sich an den »Aufbau des Sozialismus« machen.9 Dass sich die Westmächte nun anschickten, das westdeutsche Potential in ihr Aufrüstungsprogramm einzubeziehen, änderte an dieser Prioritätensetzung nichts. Es ließ im Gegenteil den Abschluss eines Friedensvertrags mit Deutschland nur noch dringlicher erscheinen.
Die DDR wurde darum in das Aufrüstungsprogramm, mit dem Stalin auf den Beschluss zur Schaffung einer integrierten NATO-Militärstreitmacht reagierte, auch gar nicht einbezogen. Sie war weder bei der Besprechung des neuen Programms in der zweiten Januarwoche 1951 vertreten noch wurde sie bei den Arbeiten des Koordinierungskomitees berücksichtigt. Stattdessen verlangte die Sowjetregierung mit einer Note vom 3. November 1950, eine neue Konferenz des Alliierten Außenministerrats einzuberufen, bei der über die »Einhaltung der Potsdamer Vereinbarungen hinsichtlich der Demilitarisierung Deutschlands« diskutiert werden müsse.10 Nachdem die Westmächte daraufhin zumindest Verhandlungen über die Tagesordnung einer Außenministerratstagung zugestanden hatten, empfahl der für die deutschsprachigen Länder zuständige Direktor der Dritten Europäischen Abteilung des sowjetischen Außenministeriums, Michail G. Gribanow, einen verbindlichen Vorschlag für einen Friedensvertrag mit Deutschland auszuarbeiten, den die Sowjetregierung »zur Behandlung in der Außenministerratstagung vorlegen könnte«. Einen Entwurf seiner Abteilung für einen solchen Vertrag legte er gleich bei.11 Bei der Eröffnung der Konferenz über die Tagesordnung, die am 5. März 1951 in Paris begann, trug der stellvertretende Außenminister Andrej A. Gromyko die Forderung nach Verhandlungen über eine »Beschleunigung des Abschlusses des Friedensvertrags mit Deutschland und in Zusammenhang hiermit [über den] Abzug der Besatzungstruppen aus Deutschland« vor.12
Der sowjetischen Verhandlungsinitiative war freilich kein Erfolg beschieden. US-Außenminister Acheson wollte vor der Aufstellung westdeutscher Truppen im Rahmen des westlichen Bündnisses keine Verhandlungen über die Deutschlandfrage zulassen, und er konnte sich damit bei seinem britischen wie bei seinem französischen Kollegen durchsetzen. So bestanden die westlichen Delegationen in Paris darauf, zunächst über die Ursachen für die aktuellen internationalen Spannungen zu sprechen, dann über den Friedensvertrag mit Österreich und erst an dritter Stelle über die deutsche Einheit und den Friedensvertrag mit Deutschland. Zu einer Annäherung der Standpunkte kam es nicht. Am 21. Juni wurden die Verhandlungen abgebrochen, ohne dass irgendein Ergebnis erzielt worden wäre.13
Angesichts dieser Niederlage empfahl Gribanow seinen Vorgesetzten, auf eine Taktik zurückzugreifen, die Stalin schon im Vorfeld der Gründung der Bundesrepublik angewandt hatte: die Mobilisierung der westlichen Öffentlichkeit (besonders in Westdeutschland, aber auch bei den westeuropäischen Verbündeten der USA) gegen die Politik ihrer Regierungen. In einem Memorandum, das er am 9. Juli 1951 an Gromyko schickte, schlug er gleich ein ganzes Bündel »dringlicher Maßnahmen« vor:
Die DDR-Regierung solle der Bundesregierung noch im Juli, spätestens aber Anfang August »Verhandlungen über die Durchführung freier, demokratischer, gesamtdeutscher Wahlen« vorschlagen, ohne weiter auf einer paritätischen Zusammensetzung der Verhandlungskommission zu bestehen. Sollte die Bonner Regierung dies ablehnen (was Gribanow als »höchstwahrscheinlich« bezeichnete), würde die DDR »in den Augen des deutschen Volkes als Bannerträger des Kampfes um die Wiederherstellung des geeinten Deutschlands« erscheinen. Andernfalls würde sich die Adenauer-Equipe spätestens bei einer nachgeschobenen Forderung nach »Einstellung der Wiederaufrüstung Westdeutschlands« als »Gegnerin der Einheit Deutschlands und Mittäterin bei der Vorbereitung eines neuen Krieges« entlarven.
Die DDR-Regierung solle die Vier Mächte erneut »um schnellen Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland ersuchen« – wie schon im Vorfeld der Pariser Vorkonferenz, aber diesmal gestützt auf die Ergebnisse der Volksbefragung gegen die »Remilitarisierung« und für den Abschluss eines Friedensvertrages »noch 1951«, für welche die von der SED gelenkte »Nationale Front« seit Mai auch in Westdeutschland Unterschriften sammelte.14
»Zur Unterstützung der unter anderem in Frankreich und Deutschland ebenfalls gegen die Wiederherstellung des deutschen Militarismus auftretenden Pazifisten« solle der Vorsitzende der Sowjetischen Kontroll-Kommission die Bildung einer »vierseitigen Kommission« zur Kontrolle der Entmilitarisierung in allen vier Besatzungszonen vorschlagen; die Sowjetregierung solle ferner unter Hinweis auf »die Ergebnisse der Befragung des deutschen Volkes offiziell Protest gegen den Bruch des Potsdamer Abkommens« einlegen.
Ebenso solle die Sowjetregierung mit den »Grundlagen des Entwurfs des Friedensvertrages mit Deutschland«, der ursprünglich für die Außenministerratstagung vorbereitet werden sollte, in die Öffentlichkeit gehen, verbunden mit dem Angebot, die Besatzungstruppen schon »innerhalb von sechs Monaten« restlos abzuziehen. Der »Fachkommission« zur Vorbereitung dieses Entwurfs dürfe nicht mehr als ein Monat Zeit gegeben werden.
Weiter solle die Sowjetregierung vorschlagen, noch vor der »Entscheidung über die Frage des Friedensvertrages« über eine »Halbierung der Besatzungstruppen« und die Festsetzung einer »Höchstzahl der Besatzungstruppen der Vier Mächte in Deutschland« zu verhandeln.
Schließlich solle man das Regime der Sowjetischen Kontroll-Kommission optisch lockern, im Wesentlichen durch eine Trennung der »sowjetischen Besatzungskontrollbehörden von den sowjetischen Militärbehörden in Deutschland«.
Gribanow gab sich überzeugt, dass die Westmächte ebenso wenig auf den Vorschlag zur Schaffung einer Kontrollkommission für die Entmilitarisierung eingehen würden wie auf jenen, die Zahl der Besatzungstruppen sofort zu halbieren. Auch bei dem Vorschlag, den Friedensvertrags-Entwurf zu veröffentlichen, spielte der angestrebte propagandistische Effekt eine Rolle. Die Veröffentlichung wäre, schrieb er, »gleichzeitig ein schwerer Schlag gegen das Manöver der drei Mächte mit der von ihnen geplanten Erklärung zur Beendigung des Kriegszustandes mit Deutschland«. Tatsächlich sollte die britische Regierung diese Erklärung noch am gleichen Tag abgeben, an dem das Memorandum fertig gestellt wurde. Frankreich folgte am 13. Juli, die USA am 24. Oktober.
An der Zielsetzung des »Kampf[es] für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands« änderte sich damit aber nach Gribanows Verständnis nichts. Es ging darum, der angeblich »fiktiven Lockerung des Besatzungsregimes« der Westmächte etwas »Wirkliches« entgegenzusetzen, das »den vitalen Interessen des ganzen deutschen Volkes wie auch den Interessen aller anderen friedliebenden Völker entspricht« – das Angebot eines »schnellen Abschluss[es] des Friedensvertrages« und des folgenden Abzugs aller Besatzungstruppen innerhalb von sechs Monaten. Gleichzeitig sollte das Hervorkehren des Gegensatzes zwischen westlicher und sowjetischer Haltung in der Wiederbewaffnungsfrage »die Haltung der französischen Patrioten« stärken, »die gegen den Wiederaufbau des deutschen Militarismus antreten«. Dazu sollte, was ursprünglich den Außenministern zur Verhandlung vorgelegt werden sollte, nun – in gleicher Weise substantiell vorbereitet – zunächst der Öffentlichkeit präsentiert werden. Wenn die Beteiligung der Organe der Bundesrepublik trotz des Verzichts auf paritätische Zusammensetzung des gesamtdeutschen Gremiums nicht zu erreichen wäre, sollte die Berufung auf die Ergebnisse der Volksbefragung in Westdeutschland ersatzweise die Initiative der DDR-Regierung legitimieren und ihr damit ein Gewicht verschaffen, das ihr ohne eine solche Legitimation offensichtlich fehlte. Politischer Druck in Frankreich wie in der Bundesrepublik, so die offensichtlich dahinter stehende Kalkulation, sollte die westlichen Regierungen zwingen, dem Abschluss des Friedensvertrages, gegen den sie sich sperrten, doch noch zuzustimmen.15
Molotow war mit diesen Vorschlägen sogleich einverstanden. Vielleicht, so darf man angesichts der Verfahrensweisen in der sowjetischen Führung vermuten, hatte er sie sogar inspiriert. Der langjährige Außenminister hatte zwar im März 1949 sein Regierungsamt verloren; stattdessen war er aber mit dem Vorsitz des Außenpolitischen Ausschusses des Politbüros betraut worden, womit die operative Leitung der sowjetischen Außenpolitik nach wie vor in seiner Hand lag. Stalin hingegen zeigte sich zunächst skeptisch. Offensichtlich glaubte er nicht mehr so recht an den Erfolg der Unterschriftenkampagne in der Bundesrepublik. Darüber hinaus passte ihm nicht, dass in den Verhandlungen nun nicht mehr, wie noch während der Pariser Vorkonferenz geplant, über die Einhaltung der Potsdamer Entmilitarisierungsvereinbarungen gesprochen werden sollte. Das, so fürchtete er, könnte als ein Nachgeben der Sowjetunion gedeutet werden. »Viele Mitglieder des Politbüros hielten eine derartige Initiative für zu riskant«, berichtet Wladimir S. Semjonow, damals der »Politische Berater« der Sowjetischen Kontroll-Kommission in Deutschland, von der entscheidenden Politbüro-Sitzung am 27. August 1951, zu der er hinzugezogen worden war.16
Die Entscheidung fiel dann doch zugunsten der Veröffentlichung eines »Grundlagenentwurfs des Friedensvertrages mit Deutschland«. Nicht nur Molotow, sondern auch Geheimdienst-Chef Lawrentij P. Berija machte sich für sie stark. Sie sollte, wie es in der nach der Sitzung überarbeiteten Beschlussvorlage hieß, »eine konkrete Plattform des Kampfes für ein vereintes demokratisches Deutschland und gegen die Unterjochung Westdeutschlands durch die anglo-amerikanischen Imperialisten abgeben«.17 Der Empfehlung des sowjetischen Generalstabs, das integrierte Aufrüstungsprogramm des Ostblocks angesichts der Kriegsgefahr auch auf die DDR auszudehnen, wurde nicht stattgegeben. »Stalin gab dem Experiment schließlich seinen Segen«, so Semjonow weiter, »warnte aber, bei einem Misserfolg werde er die Schuldigen zur Verantwortung ziehen«.18
Allerdings wurde die von Gribanow und Molotow konzipierte Strategie dahingehend modifiziert, dass die Veröffentlichung des Friedensvertrags-Entwurfs erst einige Zeit nach einem Appell der DDR-Volkskammer an den Deutschen Bundestag erfolgen sollte, mit dem erneut zur Bildung einer gesamtdeutschen Vertretung zur Vorbereitung gesamtdeutscher Wahlen aufgerufen wurde. Nach der voraussehbaren Zurückweisung dieser Initiative und der damit einhergehenden Diskreditierung der Bonner Regierung sollte sich »die Regierung der DDR offiziell an die Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs mit der Bitte wenden, den Abschluss des Friedensvertrages mit Deutschland mit anschließendem Abzug der Besatzungstruppen zu beschleunigen«. Auf diese Bitte sollte die Sowjetregierung dann mit der Veröffentlichung ihres Entwurfs reagieren.19 Auf diese Weise, so offensichtlich Stalins Kalkül, würde die Sowjetregierung schließlich doch als Anwalt des deutschen Volkes erscheinen und damit die Westmächte in Zugzwang bringen.20
Den Beschlüssen des Moskauer Politbüros entsprechend begann die DDR ihre Kampagne am 15. September mit dem Vorschlag von Ministerpräsident Otto Grotewohl, eine »gemeinsame gesamtdeutsche Beratung der Vertreter Ost- und Westdeutschlands« einzuberufen, die »erstens über die Abhaltung freier gesamtdeutscher Wahlen« und »zweitens über die Beschleunigung des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland […] entscheiden« sollte.21 Gribanow und Molotow bereiteten unterdessen den Text des Friedensvertrags-Entwurfs vor, mit dem die Sowjetregierung in die Öffentlichkeit gehen sollte, sobald die DDR-Kampagne Wirkung gezeigt hatte. Nach Stalins Vorstellungen sollte das »im Laufe von zwei bis drei Monaten« erreicht werden.22
Bei der Vorbereitung des Textes achteten der Leiter der Außenpolitik und sein deutschlandpolitischer Behördenchef einerseits darauf, dass ein völkerrechtlich präziser Entwurf ausgearbeitet wurde, den man auf der angestrebten Außenministerratstagung präsentieren konnte, ohne die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion zu gefährden. Ein vollständiger Vertragsentwurf aus elf Teilen und einer Präambel, den eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Gribanows Stellvertreter Oleg Seljaninow zusammenstellte, ging bis zur Regelung von Einzelheiten wie der Rückführung der »displaced persons« innerhalb von drei Monaten nach Vertragsabschluss und der Öffnung des Nord-Ostsee-Kanals für Handelsschiffe aller Nationen und Kriegsschiffe aus den Ostsee-Anrainern. An einer Stelle wurden die Verhandlungen mit den westlichen Alliierten, für die der Entwurf gedacht war, sogar direkt angesprochen: Eventuelle Ansprüche von Deutschlands Nachbarländern »auf unbedeutende Grenzkorrekturen«, hieß es da, könnten vom Außenministerrat »während der endgültigen Vertragsausarbeitung geprüft werden«.23
Andererseits waren Gribanow und Molotow aber auch sehr darauf bedacht, den Gegnern einer Verständigung über den Friedensvertrag in der Bundesrepublik und in Frankreich nicht unfreiwillig Munition zu liefern. Dies führte schon Mitte September zu dem Vorschlag, nicht den vollständigen Text eines möglichen Friedensvertrags zu veröffentlichen, sondern eine Erklärung, die »Grundlagen« eines Friedensvertrags skizzierte. Gleichzeitig kamen die Autoren den Interessen der Deutschen wie der Westmächte in aufeinander folgenden Versionen des Entwurfs mehr und mehr entgegen. In der Fassung vom 25. Januar 1952 wurde der Text als Entwurf einer gemeinsamen Erklärung der vier Siegermächte präsentiert, die sich über die »grundlegenden Bestimmungen« eines überfälligen Friedensvertrags mit Deutschland äußerten. Die Verpflichtung der Deutschen zur Zahlung von Reparationen wurde gemildert, allen ehemaligen Nazis und Militärpersonen wurde Rehabilitation angeboten, es wurde der Aufbau von Land-, See- und Luftstreitkräften zu »Verteidigungszwecken« erlaubt. Ein Hinweis auf den Erhalt oder Ausbau der »demokratischen Reformen« in der sowjetischen Besatzungszone entfiel, ebenso die Verpflichtung der Ruhrindustrie auf eine Produktion »in friedlicher Absicht« und – mit Blick auf die Interessen Frankreichs – die Erwähnung des Saarlandes als Teil des deutschen Territoriums.24 Nach dem Entwurf der Note, die diesen Entwurf begleiten sollte, sollte die Sowjetregierung ihre Bereitschaft erklären, »auch andere mögliche Vorschläge in dieser Frage zu prüfen«.25
Die Grenze der Zugeständnisse war da erreicht, wo es um die Sicherheit der Sowjetunion ging: Deutschland sollte sich verpflichten, »keinerlei Koalitionen oder Militärbündnissen beizutreten, die gegen eine Macht gerichtet sind, die mit ihren bewaffneten Streitkräften am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat« – also weder einem einseitigen Militärbündnis mit den Westmächten noch einem bilateralen Pakt mit der Sowjetunion nach Art des Rapallo-Vertrages. Entsprechend sollten »alle bewaffneten Streitkräfte der Alliierten […] innerhalb eines Jahres seit dem Tag des Inkrafttretens des Friedensvertrages aus Deutschland abgezogen werden«; »alle ausländischen Militärbasen auf dem Territorium Deutschlands« waren bis dahin zu beseitigen.26
Der Ertrag der DDR-Kampagne zur Organisation gesamtdeutscher Wahlen und Mobilisierung der Westdeutschen für einen Friedensvertrag fiel freilich mager aus. Stalins Skepsis hinsichtlich der Erfolgsaussichten des Unternehmens dürfte folglich noch gewachsen sein. Jedenfalls hielt er es nach dem Ablauf der drei Monate, die nach der Politbüro-Entscheidung vom 27. August 1951 für die Mobilisierungskampagne vorgesehen waren, nicht mehr für geboten, mit der Einbeziehung der DDR in das Aufrüstungsprogramm des Ostblocks noch länger zu warten. Anfang 1952 wurde mit der Umstrukturierung der paramilitärischen »Bereitschaften« der DDR zu Verbänden begonnen, die für einen Einsatz in einem »großen« Krieg zwischen Ost und West geeignet waren. Ebenso wurden erste Maßnahmen zu einer besseren Sicherung der Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik eingeleitet.27
Die beginnende Aufrüstung der DDR hielt Stalin aber nicht davon ab, das »Experiment« der Veröffentlichung von Grundzügen eines Friedensvertrags mit Deutschland zu Ende zu führen. Im Gegenteil: Am 30. Januar 1952 ordnete er noch einmal eine Intensivierung der DDR-Kampagne an. Auf den Appell an die vier Mächte, den die DDR-Regierung weisungsgemäß am 13. Februar veröffentlichte, reagierte er zunächst nur mit einer öffentlichen Antwort, die die Vorzüge eines Friedensvertrags für das deutsche Volk in den höchsten Tönen pries. Den deutschen Genossen wurde aufgetragen, die Kampagne darauf zu richten, »die Bonner Regierung und das Bonner Parlament mit einer solchen Menge von Resolutionen und Forderungen zu attackieren, dass sowohl das Parlament als auch die Regierung starken Druck von Seiten des Volkes erfahren«.28 Sodann nahm er an den Formulierungen der Note höchstpersönlich weitere Veränderungen vor, mit denen er den Deutschen weiter entgegenkam: Das Verbot der Bildung von Monopolen entfiel, ebenso das Verbot der Verbindung des Ruhrgebiets mit »irgendwelchen internationalen Vereinigungen« (gemeint war die Montanunion), die Verpflichtung zu Reparationsleistungen und das Verbot des Dienstes deutscher Staatsbürger »in ausländischen Armeen und Polizeieinheiten«. Statt von einer Begrenzung der deutschen Streitkräfte war jetzt positiv davon die Rede, dass Deutschland die Streitkräfte besitzen sollte, »die für die Verteidigung des Landes notwendig sind«. Schließlich gestand er der Bonner Regierung zu, was diese in Reaktion auf den DDR-Appell gefordert hatte: Es »verstehe« sich, »dass ein solcher Friedensvertrag unter unmittelbarer Beteiligung Deutschlands, vertreten durch eine gesamtdeutsche Regierung, ausgearbeitet werden« müsse.29
Die Veröffentlichung der Note mit dem beigefügten »Entwurf für die Grundlagen eines Friedensvertrages mit Deutschland« zögerte Stalin noch einige Wochen hinaus, immer in der Hoffnung, dass das Trommelfeuer der DDR-Regierung doch noch Wirkungen in Westdeutschland zeitigen würde. Erst nachdem das Außenministerium am 6. März gedrängt hatte, dass die Unterzeichnung des Generalvertrags der Westmächte mit der Bundesrepublik bevorstünde und man dem zuvorkommen sollte, gab er seine Einwilligung, die Note den Botschaftern der drei Westmächte am 10. März zu übergeben und sie gleichzeitig zu veröffentlichen. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei und der DDR wurden erst am Vorabend der Veröffentlichung über ihren Inhalt unterrichtet. Hinsichtlich der Erfolgsaussichten des Unternehmens machte er sich zu diesem Zeitpunkt wohl kaum noch große Illusionen.
Die Reaktion des Westens
In den westlichen Hauptstädten löste die sowjetische Note vom 10. März 1952 vielfach Besorgnis aus: Wenn die Westdeutschen darauf bestanden, dass über das sowjetische Angebot verhandelt wurde, dann war der Weg zur Verwirklichung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft erst einmal gestoppt; und wenn die Verhandlungen dann tatsächlich zur Etablierung eines blockfreien Deutschlands führten, war das gesamte westliche Verteidigungskonzept, wie es sich seit den Anfängen des Korea-Krieges herausgebildet hatte, im Kern getroffen. Manche westlichen Politiker sahen in der sowjetischen Initiative freilich auch eine Chance zu einer Milderung der Ost-West-Konfrontation, die die Aussicht eröffnete, die als problematisch angesehene Bewaffnung der Bundesrepublik im letzten Moment doch noch zu vermeiden. Der Politische Planungsstab des amerikanischen State Department unter der Leitung von Paul M. Nitze warb sogar dafür, eine Neutralisierung Deutschlands als Auftakt zu einer – friedlichen – Zurückdrängung des Kommunismus zu begreifen. Um die Ernsthaftigkeit des sowjetischen Angebots zu testen, empfahlen die Beamten des Planungsstabs, sogleich die Bildung eines gemeinsamen Wahl-Kontrollgremiums durch die vier Alliierten vorzuschlagen und einen Termin für gesamtdeutsche Wahlen – spätestens im November 1952 – vorzugeben.30
In der britischen und in der französischen Regierung überwog hingegen die Furcht vor einem Rückzug der amerikanischen Verbündeten und der darauf folgenden Konfrontation mit einem offensichtlich wieder starken Deutschland. Da die Flexibilität des amerikanischen Planungsstabs nicht sogleich von allen Abteilungen der Truman-Administration geteilt wurde und zudem Adenauer die Vertreter der drei Westmächte sogleich dringend davor warnte, sich auf Vier-Mächte-Verhandlungen einzulassen, konnten die europäischen Verbündeten eine gemeinsame Antwortnote der drei Westmächte durchsetzen, in der eine Neutralisierung Deutschlands als Verhandlungsziel von vorneherein ausgeschlossen wurde. Einer gesamtdeutschen Regierung müsse es »freistehen«, hieß es in der Antwortnote vom 25. März 1952, »Bündnisse einzugehen, die mit den Grundsätzen und Zielen der Vereinten Nationen in Einklang stehen«. Außerdem wurde verlangt, die Sowjetunion müsse zunächst einer Untersuchung der politischen Verhältnisse in der »Sowjetzone« durch eine Kommission der Vereinten Nationen zustimmen; ebenso wurde mit demagogischem Seitenblick auf die Deutschen darauf verwiesen, dass nach westlicher Auffassung in Potsdam noch keine endgültige Entscheidung in der Frage der Grenzen Deutschlands getroffen worden sei.31
Für Adenauer war eine Neutralisierung Deutschlands gleichbedeutend mit dem Auftakt zur Sowjetisierung ganz Deutschlands. Die Amerikaner, so fürchtete er, würden sich dann ganz aus Europa zurückziehen; und unbedarfte Nationalisten würden den Kommunisten helfen, »das freie Deutschland zusammen mit der Ostzone in die Sklaverei [zu] bringen«.32 Wiedervereinigung ohne Fortdauer der Westbindung war für ihn daher kein erstrebenswertes Ziel, sondern eine Gefahr, die unter allen Umständen abgewehrt werden musste. Als die Sowjetregierung in einer Antwort auf die westliche Note am 9. April meinte, »freie gesamtdeutsche Wahlen« könnten »in kürzester Zeit« durchgeführt werden (freilich unter der Kontrolle der Vier Mächte, nicht erst nach einer Prüfung durch die Vereinten Nationen), und der amerikanische Außenminister Dean Acheson daraufhin eine Verhandlung auf der Ebene der vier Hochkommissare für unumgänglich hielt, warnte Adenauer darum abermals vor einem solchen Schritt. Gleichzeitig hielt er die eigene Öffentlichkeit mit dem Versprechen hin, wenn der Westen jetzt nur fest bleibe, werde die Sowjetunion bald (»nicht viele Jahre«) ein noch viel weitergehendes Angebot machen: die Entlassung des »ganzen europäischen Ostens« in die Freiheit.33
Auf diese Weise gelang es dem deutschen Bundeskanzler, die Forderung des gesamtdeutschen Flügels seiner Regierungskoalition und der SPD-Opposition nach einem »Ausloten« der sowjetischen Initiative ins Leere laufen zu lassen. Das ermöglichte es der britischen und französischen Regierung einmal mehr, Verhandlungen, zu denen Acheson immerhin bereit war, zu vertagen und auf dem Recht eines vereinten Deutschlands zu bestehen, »sich mit anderen Nationen zu friedlichen Zwecken zu verbinden« – so die Formulierung in der zweiten westlichen Antwortnote vom 13. Mai.34 Am 26. Mai wurde in Bonn der Generalvertrag unterzeichnet; einen Tag später unterschrieb Adenauer in Paris zusammen mit den Vertretern Frankreichs, Italiens und der Benelux-Staaten den Vertrag über die Bildung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.
Anfang Juni wollte die französische Regierung mit Rücksicht auf die Entwicklung der öffentlichen Meinung in Frankreich wie in der Bundesrepublik doch noch Verhandlungen über den sowjetischen Vorschlag zugestehen – wenn auch nur in taktischer Absicht, um den Gegnern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft die Unmöglichkeit einer Verständigung mit der Sowjetunion vor Augen zu führen. Jedoch bestand Acheson jetzt auf einer vorherigen Anerkennung der westlichen Verfahrensvorschläge für freie Wahlen durch die Sowjetregierung. Ihm war die Ratifizierung der Westverträge unterdessen wichtiger als jedes mögliche »roll back« des Kommunismus. Im Gegensatz zu seinem französischen Kollegen Robert Schuman schien ihm eine neue Verhandlungsrunde mit den Sowjets das Erreichen dieses Ziel nur zu gefährden. Nach langwierigen Verhandlungen, in denen auch Adenauer noch einmal heftig gegen jede Vier-Mächte-Beratung opponierte, einigte man sich auf das Angebot einer Beratung über Zusammensetzung und Funktionen einer Untersuchungskommission, betonte aber gleichzeitig, dass Wahlen erst dann abgehalten werden könnten, wenn man »Übereinstimmung über das Programm zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung« erzielt habe. Mit dieser dritten westlichen Antwortnote, die am 10. Juli veröffentlicht wurde,35 war der Dialog über den Neutralisierungsvorschlag endgültig auf einem toten Gleis angelangt.
Stalins Wende
In der sowjetischen Hauptstadt wurde sorgsam registriert, wie der Westen auf die Veröffentlichung von Grundzügen eines Friedensvertrags reagierte. Ende März 1952 wurden Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht nach Moskau zitiert, um über ihre Eindrücke von der Wirkung der Veröffentlichung zu berichten. Bei ihrer ersten Besprechung mit Stalin am Abend des 1. April versicherte Pieck zunächst pflichtgemäß, »dass die Vorschläge der sowjetischen Regierung für einen Friedensvertrag mit Deutschland eine breite Massenbewegung in Deutschland ausgelöst und die Regierung Adenauer, wie aus der Antwort der Westmächte auf die Note der Sowjetregierung zu ersehen ist, in eine schwierige Lage gebracht haben«. Sodann erkundigte er sich nach Stalins Meinung: »Wie stehen die Perspektiven hinsichtlich des Abschlusses eines Friedensvertrags mit Deutschland; wird es zu einer Konferenz der vier Mächte kommen, welche Ergebnisse sind von dieser Konferenz zu erwarten?«36