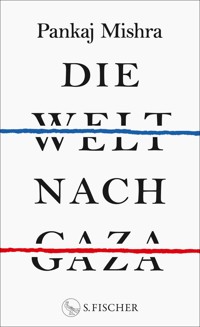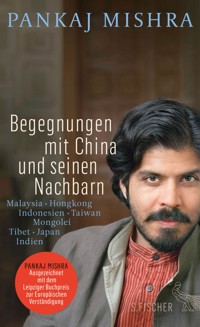19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine erhellende Analyse der politischen Irrwege unserer Zeit – jenseits der eurozentrischen Perspektive: Der bekannte Schriftsteller und Publizist Pankaj Mishra nimmt die selbstzufriedenen Gedankengebäude des Westens in den Blick. Er zeigt, dass der Mythos vom »überlegenen Westen« bis heute nicht hinterfragt wird. Rassismus, Kolonialismus und Imperialismus werden aus der Erzählung vom demokratischen Aufstieg verbannt, einfache, von Ressentiments geprägte Welterklärungen werden zum Mainstream. So entstand der Neoliberalismus aus der Angst der Weißen um ihre Vorherrschaft. Und der westliche Liberalismus ist gar nicht so liberal, denn er definiert die eigene Kultur als die maßgebliche und brandmarkt andere Entwürfe als rückständig oder autoritär. Die wahren Feinde der Demokratie aber sind jene, die angeblich ihre Werte verteidigen: Dies zeigt der in den USA tief verwurzelte Rassismus ebenso wie die Angst vor islamistischen Invasoren. Mit solchen Beispielen hält uns Mishra den Spiegel vor und macht sichtbar, wie brüchig das Fundament ist, auf dem unsere westliche Welt errichtet wurde: Eine freiheitliche Demokratie, in der Gleichheit und Menschenwürde verwirklicht sind, ist noch nicht erreicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Pankaj Mishra
Freundliche Fanatiker
Über das ideologische Nachleben des Imperialismus
Über dieses Buch
Einfache Welterklärungen stehen derzeit hoch im Kurs. Auch der Mythos vom »überlegenen Westen« wird nicht hinterfragt. Rassismus, Kolonialismus und Imperialismus werden aus der Erzählung vom demokratischen Aufstieg verbannt.
Scharfsinnig seziert Pankaj Mishra dieses im Mainstream verankerte Denken und zeigt, wie brüchig das Fundament ist, auf dem unsere westliche Welt angeblich errichtet wurde. Die wahren Feinde der Demokratie sind jene, die vorgeben, ihre Werte verteidigen: Dies zeigen der tief verwurzelte Rassismus in den USA oder die Angst vor islamistischen Invasoren. Eine bestechende Analyse der politischen Irrwege unserer Zeit – jenseits der eurozentrischen Perspektive.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pankaj Mishra, geboren 1969 in Nordindien, ist einer der wichtigsten globalen Intellektuellen. Er ist Journalist, Essayist und Schriftsteller und schreibt für »New Yorker«, »Guardian«, »Lettre International« und »Cicero«. Sein Buch »Das Zeitalter des Zorns« war ein weltweiter Bestseller, für »Aus den Ruinen des Empires« erhielt er den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Er lebt in London und Mashobra, einem Dorf am Rand des Himalaya.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Bland Fanatics. Liberals, Race, and Empire« bei Verso Books, London
© 2020 by Pankaj Mishra
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,
D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt,
nach einer Idee von Eva Gabrielsen
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491371-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
[1] Achtet auf diesen Mann
[2] Die Kultur der Angst
[3] Die Religion des Weißseins
[4] Das Persönliche als das Politische
[5] Der Mann der Vierzehn Punkte
[6] Freundliche Fanatiker
[7] Das Zeitalter der Krise des Menschen
[8] Freie Märkte und Sozialdarwinismus in Mumbai
[9] Die Verlockungen faschistischer Mystik
[10] Was groß an uns ist
[11] Warum mögen Weiße, was ich schreibe?
[12] Die Maske, die sie aufsetzt
[13] Die endgültige Religion
[14] Stümperhafte Kumpel
[15] Der Economist und der Liberalismus
[16] Englands letztes Brüllen
[17] Wankende Staaten
Zur Literatur
Register
Einleitung
Ich möchte, dass alle Amerikaner werden.
THOMAS FRIEDMAN
Irgendwann einmal müsste man die Geschichte unserer eigenen Obskuranz, die Zähigkeit unseres Narzißmus ans Licht bringen.
ROLAND BARTHES
Die Essays in diesem Buch entstanden als Reaktion auf die angloamerikanischen Verirrungen, die im Brexit und der Wahl Donald Trumps gipfelten. Diese Verirrungen umfassten etwa den vom Economist im 19. Jahrhundert lange unterstützten Traum des imperialistisch gesinnten Liberalismus oder Henry Luces Proklamation eines vom »Freihandel« geprägten »amerikanischen Jahrhunderts«. Ebenso gehören dazu die »Modernisierungstheorie« – der Versuch amerikanischer Kalter Krieger, die postkoloniale Welt von einer kommunistischen Revolution abzuhalten und für die auf schrittweise Entwicklung gerichtete Alternative des Konsumkapitalismus und der Demokratie zu gewinnen – wie auch die katastrophalen humanitären Kriege und die demagogischen Eruptionen unserer Zeit.
»Zu den kleineren Bösewichtern der Geschichte«, schrieb Reinhold Niebuhr 1957, »gehören die freundlichen Fanatiker der westlichen Zivilisation, die die doch so sehr bedingten Leistungen unserer Kultur für die endgültige Form und Norm der menschlichen Existenz halten.« Für Niebuhr waren die größeren Bösewichter natürlich Kommunisten und Faschisten. Als überzeugter Antikommunist war der US-amerikanische Theologe anfällig für Ausdrücke wie »die moralische Überlegenheit der westlichen Zivilisation«. Dennoch sah er den seltsamen Weg, den der Liberalismus genommen hatte: »Ein Dogma, das die wirtschaftliche Freiheit des Individuums gewährleisten sollte, wurde in einer späteren Periode des Kapitalismus die ›Ideologie‹ großer, körperschaftlicher Strukturen, die es nutzten und immer noch nutzen, um eine echte Kontrolle ihrer Macht zu verhindern.« Er beobachtete auch aufmerksam das fundamentalistische Credo, das unser Zeitalter prägte – Kapitalismus und liberale Demokratie westlicher Prägung würden sich nach und nach in der ganzen Welt ausbreiten, und alle Gesellschaften sollten sich, kurz zusammengefasst, in derselben Weise entwickeln wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten.
Natürlich konnte Niebuhr nicht voraussehen, dass die freundlichen Fanatiker, die den Kalten Krieg so heimtückisch machten, an dessen Ende die Weltbühne beherrschen würden. In Gestalt liberaler Internationalisten, neokonservativer Verfechter der Demokratie und Apologeten freier globalisierter Märkte sollten sie durch eine inzwischen komplexere und widerspenstigere Welt stolpern und dazu beitragen, dass weite Teile Asiens, Afrikas und Lateinamerikas aus den Fugen gerieten, bevor sie in ihren eigenen Gesellschaften politisches Chaos anrichteten.
Die Weltgeschichte der Ideologien des Liberalismus und der Demokratie nach 1945 wie auch eine umfassende Soziologie der angloamerikanischen und anglophilen oder amerikafreundlichen Intellektuellen wären erst noch zu schreiben, obwohl die Welt, die sie schufen und vernichteten, schon jetzt in ihre tückischste Phase eintritt. Die meisten von uns erwachen gerade erst mit verschlafenen Augen aus den frenetischen Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Kriegs, in denen, wie Don DeLillo schrieb, »der dramatische Anstieg des Dow Jones und die Geschwindigkeit des Internets uns alle aufforderten, permanent in der Zukunft zu leben, im utopischen Glanz des Cyberkapitals«.
Es ist jedoch bereits seit langer Zeit klar, dass die globale Wette auf unregulierte Märkte und auf militärische Interventionen zu deren Gunsten das ehrgeizigste ideologische Experiment der Moderne darstellte. Deren Anhänger, Verbündete und Unterstützer, von Griechenland bis nach Indonesien, waren zudem weitaus einflussreicher als ihre sozialistischen und kommunistischen Rivalen. Homo oeconomicus, das autonome, nach rationalen Grundsätzen handelnde, mit Rechten ausgestattete Subjekt der liberalen Philosophie, überzog alle Gesellschaften mit phantastischen Plänen zur Steigerung der Produktion und des Konsums. Das in London, New York und Washington geprägte Idiom der Moderne bestimmte den Common Sense des öffentlichen intellektuellen Lebens auf sämtlichen Kontinenten und veränderte radikal, wie weite Teile der Weltbevölkerung Gesellschaft, Wirtschaft, Nation, Zeit und individuelle wie kollektive Identität verstanden.
Wer versuchte, hinter die exaltierte Rhetorik der liberalen Politik und Ökonomie zu schauen, fand dort natürlich nur selten entsprechende Realitäten. Mein persönlicher Lernprozess hinsichtlich dieses fehlenden Realitätsgehalts begann mit eigenen Erfahrungen in Kaschmir, wo Indien, angeblich die größte Demokratie der Welt, zu einer Form von Hindu-Suprematismus und rassistischem Imperialismus ebenjener Art herabgesunken war, von dem das Land sich 1947 befreit hatte. Als ich 1999 dorthin ging, hatte ich viele Vorurteile hinsichtlich der befreienden »zivilisatorischen« Rolle Indiens im Gepäck und gehörte zu denen, die stillschweigend annahmen, dass die Muslime in Kaschmir mit dem »säkularen«, »liberalen« und »demokratischen« Indien besser führen als mit dem islamischen Staat Pakistan.
Die brutalen Realitäten der militärischen Besatzung Kaschmirs durch indische Truppen und die eklatanten Lügen und Täuschungen, die damit verbunden waren, zwangen mich, einen Großteil der alten Kritik am westlichen Imperialismus und der daran geknüpften Fortschrittsrhetorik wieder aufzugreifen. Als meine kritischen Artikel über Kaschmir im Jahr 2000 in The Hindu und The New York Review of Books erschienen, wurden sie in meiner Heimat am lautesten nicht von Hindu-Nationalisten, sondern von selbsternannten Wächtern der »liberalen Demokratie« Indiens attackiert. Ich hatte mich mit der einflussreichen Ideologie eines indischen Exzeptionalismus angelegt, der für Indiens einzigartig starke und vielfältige liberale Demokratie moralisches Ansehen wie auch geopolitische Bedeutung einforderte.
Viele dieser selbstgerechten Vorstellungen rochen nach der Scheinheiligkeit der oberen Kasten und nach Klassenprivilegien. Die Fetischisten einer rein formalen und verfahrensorientierten Demokratie beriefen sich frömmlerisch auf »die Idee Indien«, das Experiment eines säkularen und liberalen Staatswesens. Sie schienen sich nicht an der Tatsache zu stören, dass die Menschen in Kaschmir und den Bundesstaaten an der Nordostgrenze Indiens de facto unter einem Kriegsrecht lebten, das den Sicherheitskräften das uneingeschränkte Recht zu Massakern und Vergewaltigungen verlieh – und auch nicht an dem Umstand, dass für einen großen Teil der indischen Bevölkerung das Versprechen der Gleichheit und Würde, gestützt durch Rechtsstaatlichkeit und unparteiische Institutionen, ein fernes, fast schon phantastisches Ideal geblieben war.
Jahrzehntelang zog Indien Vorteile aus einer im Kalten Krieg verbreiteten Vorstellung von »Demokratie«, die diese Staatsform auf ein moralisch glänzendes Etikett für die Wahl der Regierenden reduzierte, statt darauf abzustellen, welche Macht sie in den Händen hielten und wie sie diese Macht ausübten. Als ein nichtkommunistisches Land, das regelmäßig Wahlen abhielt, erfreute Indien sich eines makellosen internationalen Ansehens, obwohl es ihm nicht – und sogar noch weniger als vielen asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern – gelang, seinen Bürgern auch nur die elementaren Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben zu bieten. Der Heiligenschein leuchtete noch heller, als die Regierungen des Landes sich dem freien Markt zuwandten und das kommunistische China plötzlich als Herausforderer des Westens auftrat. Selbst als Indien sich dem Hindu-Nationalismus verschrieb, entwickelte sich in den angloamerikanischen Eliten ein überschwänglicher Konsens: dass die liberale Demokratie tiefe Wurzeln im indischen Boden geschlagen und ihn so für das Wachstum freier Märkte vorbereitet habe.
Für einen Autor mit meinem Hintergrund wurde es zwingende Notwendigkeit, diese Einmütigkeit in Frage zu stellen – zunächst in meiner Heimat und dann immer häufiger im Ausland. Die freundlichen Fanatiker Indiens, die entschlossen schienen, den Herzen und Köpfen der Kaschmiris die »Idee Indien« einzuhämmern, bereiteten mich in vielerlei Hinsicht auf das Spektakel einer liberalen Intelligenzija vor, die den Krieg für »Menschenrechte« im Irak mit jener humanitären Freiheits-, Demokratie- und Fortschrittsrhetorik feierte, die man ursprünglich von europäischen Imperialisten des 19. Jahrhunderts kannte.
Mir war schon lange klar, dass westliche Ideologien den Aufstieg des »demokratischen« Westens während des Kalten Kriegs in geradezu absurder Weise geschönt hatten. Der lange Kampf gegen den Kommunismus, der den Anspruch auf höchste moralische Tugend erhob, hatte mancherlei zweckdienliche Täuschungsmanöver verlangt. Die Jahrhunderte des Bürgerkriegs, der imperialen Eroberung, der brutalen Ausbeutung und des Völkermords wurden schlichtweg ausgelassen in historischen Darstellungen, die zeigten, wie die Menschen des Westens die moderne Welt geschaffen hatten und mit ihren liberalen Demokratien zu den Vorbildern geworden waren, denen alle anderen nachstreben sollten. Was ich allerdings nicht wusste, bevor ich im Wissensökosystem Londons und New Yorks zu leben begann, war die Tatsache, dass die Ausflüchte und Auslassungen mit der Zeit zu gewaltigen Defiziten im Wissen über den Westen wie auch die außerwestliche Welt geführt hatten. Einfältige und irreführende Vorstellungen und Annahmen, die aus dieser bornierten Geschichte stammten, prägten die Reden westlicher Politiker, die Berichte von Denkfabriken sowie die Leitartikel von Zeitungen und lieferten das nötige Futter für zahllose Kolumnisten, TV-Fachleute und Terrorismusexperten.
Es mag heute – vor allem für jüngere Leser – nur noch schwer erinnerlich sein, dass der Mainstream im angelsächsischen Raum in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts Figuren wie Niall Ferguson hofierte. Auch hatten Thesen Konjunktur, laut denen die Besetzung der Territorien fremder Völker und die Unterdrückung ihrer Kultur wirkungsvolle Instrumente der Zivilisierung gewesen seien. Demnach bräuchte es mehr von diesem emanzipatorischen Imperialismus, um hartnäckig rückständige Völker dem fortgeschrittenen Westen anzupassen. Der britische Imperialismus, den westliche Wissenschaftler und führende Antikolonialisten gleichermaßen jahrzehntelang für einen rassistischen, illegitimen und häufig räuberischen Despotismus gehalten hatten, wurde in unserer Zeit erstaunlicherweise zu einer segensreichen Veranstaltung umgedeutet. Sie habe, in Fergusons Worten, »unbezweifelbar dem freien Handel, der freien Bewegung des Kapitals und, durch die Abschaffung der Sklaverei, der Freiheit der Arbeit den Weg« geebnet.
Was interessiert da schon, dass der durch Kanonenboote in Asien eingeführte Freihandel die in den eroberten Ländern aufkeimenden Industrien vernichtete, das »freie« Kapital hauptsächlich in die weißen Siedlerstaaten Australien und Kanada floss und abhängige statt »freier« Arbeit an die Stelle der Sklaverei trat? Die Märchen von der Erschaffung der modernen Welt durch die Briten wurden nicht etwa nur in heimlichen rechtsextremen Versammlungen oder Luxusklausuren für Hedgefonds-Investoren verbreitet. Vielmehr übernahmen Mainstream-Medien aus Fernsehen, Funk und Presse die Aufgabe, ihnen bei einem breiteren Publikum intellektuelle Anerkennung zu verschaffen. Politiker wie auch Vertreter der Fernsehgesellschaften fügten sich der kriegerischen Unlogik dieser Ansichten. Die BBC stellte Niall Fergusons Glauben an die Notwendigkeit, den Imperialismus wiederherzustellen, ihre Hauptsendezeit zur Verfügung. Der Tory-Bildungsminister bat ihn, als Berater für den Lehrplan im Fach Geschichte tätig zu werden. Auf der Suche nach einem noch einflussreicheren Publikum überquerten die Revanchisten den Atlantik und statteten jene US-Amerikaner mit intellektuellem Rüstzeug aus, die versuchten, die moderne Welt durch freie Märkte und militärische Gewalt umzubauen.
Natürlich übergingen die Barden eines neuen weltumspannenden liberalen Imperiums nahezu vollständig alle asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Stimmen. Und die wenigen, die Zugang zur Mainstream-Presse fanden, mussten erkennen, dass ihr einzigartiges Privileg sie verpflichtete, zunächst einmal das Terrain von all den falschen Darstellungen oder schlichten Unwahrheiten zu säubern, die sich über Jahrzehnte dort angesammelt hatten. Dieser oft frustrierende Kampf prägte auch meine eigenen, auf den folgenden Seiten reflektierten Bemühungen.
Diese waren indes unvermeidlich, denn in allen Bereichen des Journalismus waren die Vorurteile längst tief verwurzelt und traten immer wieder hartnäckig zutage, ob man nun über Afghanistan, Indien oder Japan schrieb. Hier nur ein Beispiel: In Chancen, die ich meine, einem äußerst einflussreichen Buch (und einer zehnteiligen Fernsehserie), hatten Milton und Rose Friedman einen verführerisch binären Gegensatz zwischen rationalen Märkten und staatlichen Eingriffen konstruiert (ein Gedanke, der die Analysen, die Politik und die Rezepte der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds für die nächsten zwei Jahrzehnte prägen sollte). Friedman hatte eine Gruppe chilenischer Wirtschaftswissenschaftler, die sogenannten »Chicago Boys«, bei deren Umbau der chilenischen Wirtschaft nach dem von der CIA initiierten Sturz Salvador Allendes 1973 inspiriert und suchte nun nach intellektueller Bestätigung in Ostasien. Er behauptete, Japan, Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur wären deshalb erfolgreich, weil sie sich auf »private Märkte« stützten. In Das Ende der Geschichte schloss Francis Fukuyama sich dieser These an und erklärte, die ostasiatischen Volkswirtschaften hätten »ähnliche Erfahrungen gemacht wie Deutschland und Japan im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Ihre Entwicklung hat bestätigt, dass späte Modernisierer in einer liberalen Wirtschaftsordnung ihre Vorgänger einholen und sogar überholen können.«
Die Fabel vom ostasiatischen »Wunder« wurde in den Mainstream-Medien zu einem zentralen Bestandteil der Berichterstattung über Asien. Sie stimmte allerdings gar nicht mit den historischen Befunden überein, die zeigten, dass staatlich gelenkte Modernisierung und ökonomischer Protektionismus für die Vorkriegswirtschaft Japans und Deutschlands von ebenso zentraler Bedeutung gewesen waren wie für die Nachkriegswirtschaft Ostasiens. In jüngster Zeit erwiesen sich die alten Traditionen technokratischer Herrschaft in Ostasien als äußerst bedeutsam für den relativ erfolgreichen Umgang mit der Covid-19-Pandemie, während angloamerikanische Verfechter des freien Marktes an dieser Aufgabe scheitern – mit tödlichen Folgen. Doch solche Tatsachen, die in der New York Times ebenso ungeniert ignoriert wurden wie im Economist und im Wall Street Journal, scherten kaum jemanden.
Die Mär von den freien Märkten passte natürlich zu den Bemühungen der Weltbank, des IWF und anderer Institutionen des internationalen Wirtschaftsmanagements. Sie hatten zwei Prioritäten, die Armutsbekämpfung und den Ausbau des staatlichen Sektors, doch waren diese schon in den frühen 1980er Jahren der Deregulierung des Handels sowie dem Abbau der Preissubventionierung und der Beschränkungen für ausländische Investitionen gewichen. Als die Sowjetunion implodierte und ein Heer von Amerikanisierern Russland überschwemmte, glaubten die Anhänger des freien Marktes, sie hätten die Macht, »die Welt ganz neu zu gestalten«, wie Reagans von Thomas Paine stammende Lieblingswendung lautete. Die aggressive Werbung für eine neue Form der von Albert Hirschman so genannten »Mono-Ökonomie« wurde begleitet von der atemberaubenden Einbildung, dass mit dem Untergang des Kommunismus ein segensreiches postideologisches Zeitalter begonnen habe. Wie sich herausstellte, wurde die Hoffnung, die Welt durch eine ökonomische Schocktherapie ganz neu zu gestalten, nicht enttäuscht. Der Lebensstandard brach in sich zusammen. Russland erlebte eine schwere Mortalitätskrise, die in den 1990er Jahren zu einer massiven Steigerung der Sterblichkeit bei Männern führte und Millionen von Männern das Leben kostete. Auch die Kriminalitätsrate schoss in die Höhe – eine Serie von Katastrophen, die 1998 in der Zerstörung des Rubels und im Staatsbankrott gipfelte.
Nachdem die Kreuzzügler ihre Fahne über dem Kreml gehisst hatten, sahen sie sich nach neuen Eroberungsmöglichkeiten in aller Welt um. Ende der 1990er Jahre gab es zahlreiche mächtige und reiche Förderer des Washingtoner Konsenses, den man nun auch Lateinamerika, Asien und Afrika aufzwang. In US-amerikanischen Universitäten, Business Schools und philanthropischen Einrichtungen waren neue Zentren intellektueller und politischer Autorität entstanden. Nichtamerikaner erhielten Positionen in US-amerikanisch beherrschten internationalen Institutionen wie der Weltbank und dem IWF. Heute beschäftigen rechtsgerichtete Denkfabriken wie das American Enterprise Institute, das Cato Institute und das Peterson Institute sehr viel mehr Ökonomen und Journalisten, die nichtamerikanischer Herkunft sind.
In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wurde ein Großteil der Arbeit beim Export des eisernen Käfigs der US-amerikanischen Moderne zunehmend von Wissenschaftlern und Denkfabrikmitarbeitern erledigt, die außerhalb der Vereinigten Staaten geboren waren. Sie vermittelten einfallsreich zwischen den Eliten ihrer Herkunftsländer und der USA. Ein prominentes Beispiel für diese geistige Synergie ist Jagdish Bhagwati, nach eigenem Bekunden »der führende Freihändler der Welt« und Pate der auf Märkte umgestellten Wirtschaft Indiens. Von seiner Kanzel an der Columbia University und dem Council for Foreign Relations verbreiteten Bhagwati und seine Jünger unablässig neoliberale Ideen und behaupteten, kein Land könne ohne eine Beschränkung der Gewerkschaften, die Abschaffung von Handelsbarrieren, die Beseitigung von Subventionen und dergleichen mehr vorankommen.
Selbst die Terroranschläge vom 11. September 2001 vermochten solche Überzeugungen nicht zu erschüttern. Der Verdacht, ein »islamischer Faschismus« hätte dem Liberalismus den Krieg erklärt, drängte viele angloamerikanische Intellektuelle zu einem noch kühneren Versuch, die Welt nach dem von ihnen bevorzugten Bild des angloamerikanischen Universums umzugestalten. Modernisierungstheoretiker hatten mit Blick auf die longue durée in der Geschichte die Pflege der Demokratie Mittelschichtnutznießern des Kapitalismus zugewiesen. Doch eine »postideologische« Generation liberaler Internationalisten und viele Neokonservative glaubten nun, die Demokratie ließe sich durch eine Shock-and-Awe-Therapie auch in Gesellschaften ohne einschlägige Traditionen einpflanzen.
In ihrem vorherrschenden Diskurs war der ethnisch und religiös »Andere« entweder ein unverbesserlicher Rohling (und damit das genaue Gegenteil des von aufgeklärtem Eigeninteresse geprägten US-Amerikaners), den es weltweit durch einen unermüdlichen Krieg gegen den Terror auszurotten galt, oder ein homo oeconomicusUS-amerikanischer Prägung, der von seinen unfähigen politischen Führern und Institutionen daran gehindert wurde, sein rationales Eigeninteresse zu verfolgen. Die Phantasien, die bei der Invasion und Besetzung des Iraks eine treibende Rolle spielten, beschworen das Bild einer Freiheit, die auf wundersame Weise erscheinen werde, sobald der despotische Staat entmannt sei und endlich freie Märkte florieren dürften, die automatisch individuelle Interessen und Wünsche harmonisieren würden.
Wichtiger noch war indessen, dass die Anschläge vom 11. September die auf den Zivilisierungsgedanken fixierte Identität und Solidarität stärkten und einen offeneren Ausdruck weißer Überlegenheitsphantasien ermöglichten. Eine kleine Gruppe von Kriminellen und Fanatikern stellte eigentlich keine tödliche Bedrohung für die mächtigsten und reichsten Gesellschaften der Geschichte dar. Dennoch wurden die manischen Allahu-akbar-Rufe mit einem immer lauteren Trommelwirbel aus »westlichen Werten« beantwortet und mit der vertrauensbildenden Berufung auf den angeblichen Wesenskern des Westens, zu dem etwa die Aufklärung gehört. Das kollektive Bekenntnis zu bestimmten westlichen Freiheiten und Privilegien wurde zu einem Reflex. So schrieb Salman Rushdie: »Wir müssen uns einig sein darüber, was alles gut und richtig ist: Küssen in der Öffentlichkeit, Schinkenbrote, Meinungsverschiedenheiten, neueste Mode.« Und viele empfanden es als taktlos, als Susan Sontag von einer »frömmlerischen, realitätsverzerrenden Rhetorik« der »Vertrauensbildung« und des »Managements von Trauer und Leid« sprach, die an die »einstimmig beklatschten und selbstgerechten Plattitüden sowjetischer Parteitage« erinnere. Man griff sie an, weil sie gesagt hatte: »Lasst uns gemeinsam trauern. Aber lasst nicht zu, dass wir uns gemeinsam der Dummheit ergeben.«
Ihre Warnungen blieben ungehört. »Ich bin froh, ein Laptop-General zu sein«, schrieb Paul Berman in Terror und Liberalismus – und tadelte all jene, die nicht bereit waren, sich dem neuen Kreuzzug für den Liberalismus im Nahen und Mittleren Osten anzuschließen. Während des Vietnamkriegs bemerkte Hannah Arendt, dass Mitglieder der von den Demokraten gestellten US-Regierung häufig Ausdrücke wie »monolithischer Kommunismus« und »zweites München« benutzten. Sie schloss daraus, dass diese unfähig seien, »sich der Wirklichkeit als solcher zu stellen, weil sie immer eine Analogie vor Augen hatten, die ihnen ›half‹, die Wirklichkeit zu verstehen«. Berman, der bis dahin nicht als Experte für moderne politische Bewegungen östlich von Europa aufgefallen war, identifizierte den Islamismus ganz ähnlich als eine abgeleitete Version der totalitären Feinde – Faschismus und Kommunismus –, gegen die der Liberalismus während des gesamten 20. Jahrhunderts gekämpft hatte. Nachdem er »durch die islamischen Buchhandlungen Brooklyns gelaufen« war, präsentierte er eine Genealogie des »Islamismus«, die nahezu ausschließlich auf der Lektüre Sayyid Qutbs, eines Ideologen der ägyptischen Muslimbruderschaft, basierte. Nach Berman hatten liberale Intellektuelle die Pflicht, den neuen nihilistischen Faschismus zu bekämpfen, zu dem sowohl säkulare Diktaturen wie im Irak als auch panislamistische Bewegungen gehörten. Durch sein Laptop-Bombardement versammelte er schon bald diverse in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten, von Richard Holbrooke bis Martin Amis, hinter seiner Sache.
Martin Amis publizierte einen mehr als 10000 Wörter umfassenden Aufsatz über Islam und Islamismus, doch die Erfahrungen mit muslimischen Gesellschaften, über die er darin berichtete, reichen nicht tiefer als Christopher Hitchens’ Kauf eines Osama-T-Shirts in Peshawar oder der gescheiterte Versuch der Familie Amis, außerhalb der Öffnungszeiten Zutritt zum Felsendom in Jerusalem zu erhalten. »Beim einfachen muslimischen Mann«, erklärte Amis, »ist der Drang zu rationaler Nachprüfung heute sehr schwach ausgebildet.« Es finden sich zahlreiche weitere befremdliche Behauptungen (beispielsweise dass die Armee im algerischen Bürgerkrieg auf der Seite der Islamisten gestanden habe) in diesem Aufsatz, der mit seiner Pseudogelehrsamkeit und fanatischen Gewissheit von moralischer Überlegenheit an Osama bin Ladens krampfhaft literarische Tiraden erinnert.
Bei den Literaten halfen große Worte wie »salafistischer Totalitarismus« und »islamischer Faschismus«, profundes Wissen vorzutäuschen. Außerdem befriedigten sie den nostalgischen Wunsch mancher eingesessenen Schriftsteller, sich als Avantgarde eines edlen Kreuzzugs gegen einen bösartigen »Ismus« zu verstehen. Die Inbrunst des verhinderten Ideologen ließ keinen Raum für die nüchterne Tatsache, dass es in fast allen Nationalstaaten eine unzufriedene und schwankende Minderheit gibt, deren Größe beständig im umgekehrten Verhältnis zur Aufmerksamkeit, zum Takt und zur Klugheit der Mehrheitsbevölkerung variiert.
Es war ein entmutigendes Schauspiel: Talentierte Autoren kauten auf Klischees herum, die von Zeitungsschreiberlingen bis auf den Knochen abgenagt wurden, und eine gefälschte imperiale Geschichte samt bedrohlichen Visionen sich hektisch fortpflanzender Muslime diente zur Rechtfertigung massiver Gewalt gegen Völker, die bei alledem keine Stimme hatten. Doch wie schon Niebuhr ausführte, neigen die »Kulturmenschen« mit ihrer hochentwickelten Fähigkeit des Argumentierens dazu, »plausiblere Ausreden für Kriegshysterien und die Dummheiten nationaler Politik zu liefern, als gewöhnliche Menschen jemals zu erfinden vermöchten«. Wie sich zeigte, wurde das von Amis vorgeschlagene »öffentliche Gespräch« über den Islam niemals geführt. Die Maßstäbe dafür hatte man allzu niedrig angesetzt, und es wurde schließlich von einer isolierten, eitlen Plaudertruppe geführt. Sie versuchte, sich und uns angesichts der Erschütterung durch eine im Wandel befindliche Welt zu beruhigen, indem sie eine unüberwindliche Maginot-Linie um unser Herz und unseren Verstand baute.
Inzwischen legten neoimperialistische Angriffe auf den Irak und Afghanistan das wirkliche Vermächtnis des britischen Imperialismus bloß: Konflikte zwischen Stämmen, Ethnien oder Religionen, die neue Nationalstaaten schon bei der Geburt erstickten oder zu endlosen Bürgerkriegen, unterbrochen von skrupellosen Despotien, verdammten. Niederlage und Demütigung verbanden sich mit der Erkenntnis, dass jene, die aus dem Westen kamen, um der restlichen Welt angeblich die Zivilisation zu bringen, sich in wahllosem Morden und willkürlicher Folter ergingen.
Begeisterte Sozialtechniker und Wirtschaftspraktiker, die man aus den USA in die Green Zone Bagdads importierte, versuchten, all das zu verwirklichen, worauf die Verfechter des freien Markts in der Heimat hofften – die Zerschlagung des Sozialstaats, die Privatisierung des Militärs und der Gefängnisse sowie eine allgemeine Deregulierung. Dieses äußerst waghalsige Amerikanisierungsexperiment löste nicht nur einen wütenden Aufstand aus, sondern führte auch zum Zusammenbruch des Landes, zum Aufstieg des Islamischen Staats und zur weiteren Destabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens. In Russland hatten Chaos und massenhaftes Elend bereits dafür gesorgt, dass mit Wladimir Putin ein verdrossener ehemaliger KGB-Mann zum unwahrscheinlichen Retter seines Landes wurde, der sich zudem dreist in die US-amerikanischen Wahlen einmischte.
Schließlich erwählten die Enttäuschten und Unzufriedenen im Kernland der liberalen Moderne einen habituellen Grapscher zu ihrem Retter. Wie Donald Trumps Wahlsieg im November 2016 zeigte, hatte der Washingtoner Konsens in Washingtons eigenem Hinterland allzu viele Opfer produziert. Während in der Levante die Schlacht um Demokratie und Kapitalismus tobte, wurde beides westlich des Potomac stetig unterminiert – durch die extreme Konzentration der Vermögen, die unablässige Kriminalisierung der Armen, durch eine dysfunktionale Politik, ein gefährliches Sicherheitsestablishment und durch bedenkenlose Medien.
Mehr als ein Jahrzehnt nach dem 11. September lieferte sich der westliche Liberalismus mit seiner realitätsverkleisternden Rhetorik noch immer ein Rennen bis zum Äußersten mit seinem ideologischen Zwillingsbruder, und das mit einer eskalierenden Dialektik aus Luftangriffen und Gemetzeln am Boden. Je mehr das außerhalb des Westens herrschende Chaos auf den Westen selbst übergriff, umso aggressiver wurde diese Rethorik und umso schneller vermischte sie sich mit dem Hass der weißen Suprematisten auf Immigranten, Flüchtlinge und Muslime (oder oft auf solche, die nur wie Muslime »aussahen«). Noch bedrohlicher ist allerdings die Tatsache, dass dadurch der Zeitpunkt der Selbstprüfung und Kurskorrektur bei den angloamerikanischen Eliten hinausgeschoben wurde.
In einem seiner letzten Interviews klagte Tony Judt über seine »katastrophale« angloamerikanische Generation, zu deren verhätschelten Mitgliedern auch George W. Bush und Tony Blair gehörten. Diese historisch kaum ins Gewicht fallenden Eliten waren nach den prägenden Kriegen und dem Hass des 20. Jahrhunderts im Westen »in einer Welt ohne harte Entscheidungen ökonomischer oder politischer Art« aufgewachsen und glaubten, »ihre Entscheidungen, ganz gleich wie sie ausfallen mochten, könnten keine verheerenden Konsequenzen haben«. Ein Angehöriger der Bush-Administration demonstrierte 2004 nach der damals als Erfolg angesehenen Invasion im Irak nassforsch die Arroganz der Macht. »Wenn wir handeln«, prahlte er, »schaffen wir unsere eigene Realität.«
»Eine ziemlich beschissene Generation, wenn man über sie nachdenkt«, meinte Judt. Letztlich konnte ihr rückwärtsgewandter Größenwahn keinen Bestand haben in einer Welt, in der die kulturelle wie auch wirtschaftliche Macht dem alten angloamerikanischen Establishment unaufhaltsam entglitt. Im letzten Jahrzehnt entstand eine größere globale Öffentlichkeit, in der sich viele Stimmen melden, die andere Meinungen äußern sowie als Korrektiv wirken und das Blendwerk überbewerteter intellektueller Eliten rasch entlarven.
Wir erleben gegenwärtig eine tiefgreifende Korrektur, bei der die triumphalistischen Narrative des britischen und US-amerikanischen Exzeptionalismus ebenso streng auf den Prüfstand gestellt werden wie einst die postkolonialen Tugendansprüche. Das Coronavirus hat die lange durch diese Narrative verdeckte Realität brutal entblößt: hochverschuldete Staaten, Bürgschaften für Unternehmen, verarmte Arbeiterklassen und ausgehöhlte öffentliche Gesundheitssysteme. Die angloamerikanischen Selbsttäuschungen, die fortwährend die hohen Todesraten anderswo berechneten, von der irischen Hungersnot bis zum Irak, haben im eigenen Land massenmörderische Ausmaße angenommen. Eine schwadronierend nachlässige Haltung gegenüber der Pandemie führte zusammengenommen zu mehr als einer Viertelmillion Toten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten.
Die Welt, die wir kannten und die von den Nutznießern des westlichen Imperialismus wie auch des antiimperialistischen Nationalismus geprägt wurde, löst sich auf. Viele unserer hehren Vorstellungen über uns selbst sind zusammengebrochen. Der indische Anspruch auf eine Sonderstellung erscheint ebenso unbegründet wie der US-amerikanische. Am Horizont zeichnen sich neue und breitere Kämpfe für Freiheit, Gleichheit und Würde ab. Doch wie die Essays in diesem Band zeigen, werden die neuen Stimmen im öffentlichen Raum immer noch übertönt von lauten und ständig wiederholten angloamerikanischen Klagen über den Zustand der Welt.
Besonders laut wurden sie, als Boris Johnson sich Donald Trump in der Führung der freien Welt anschloss. Vom Kalten Krieg bis zum Krieg gegen den Terror galt der Cäsarismus, der andere Staaten heimsuchte, als Besonderheit asiatischer oder afrikanischer Völker oder wurde den despotischen Traditionen der Russen oder Chinesen, dem afrikanischen Stammeswesen, dem Islam oder dem »arabischen Denken« zugeschrieben. Doch diese Analyse – die in Tausenden von Büchern und Zeitschriftenartikeln verbreitet wurde und die Feinde der Demokratie unter bedrohlich fremden Menschen und in deren minderwertigen Kulturen verortete – bereitete ihr Publikum nicht auf den Anblick blonder Rüpel an der Spitze der größten Demokratien der Welt vor. Die Barbaren standen niemals vor den Toren. Wie sich zeigte, regieren sie uns seit einiger Zeit.
Nach dem verspäteten Schock über diese Erkenntnis wurde ohnmächtige Verzweiflung zum vorherrschenden Tenor in den Kommentaren des Establishments zu den Ereignissen der letzten Jahre. Diese akute Hilflosigkeit verrät jedoch noch etwas Bedeutsameres. Während die Demokratie im Westen ausgehöhlt wurde, verbargen Politiker und Kolumnisten des Mainstream deren wachsenden Hohlraum hinter Angriffen auf ihre angeblichen ausländischen Feinde – oder hinter Lobgesängen auf ihre angeblichen ausländischen Freunde. Nach Jahrzehnten dieses irreführenden und zutiefst ideologischen Diskurses fühlen sich viele unserer Besten und Klügsten von Trumps und Johnsons Mätzchen veralbert, entsetzt über die verschärfte Kritik einer aufkommenden Linken und zugleich gänzlich unfähig, mit der Vernichtung der Demokratie durch ihre angeblichen Freunde im Ausland abzurechnen.
Die Verwundbarkeit der westlichen Demokratie war für die asiatischen und afrikanischen Untertanen des britischen Empire schon lange erkennbar. Gandhi, der Demokratie ganz wörtlich als Herrschaft des Volkes, des demos, verstand, behauptete, sie habe im Westen lediglich »nominellen« Charakter. Sie könne gar nicht Wirklichkeit werden, solange »die breite Kluft zwischen den Reichen und den Millionen Hungernden besteht« und die Wähler »ihre Informationen aus den Tageszeitungen [beziehen], die oft unehrlich« seien. B.R. Ambedkar, einer der Hauptautoren der indischen Verfassung, warnte zu Beginn des indischen Experiments mit einem Parlament und Wahlsystem britischer Prägung, das allgemeine und gleiche Wahlrecht sorge zwar für politische Gleichheit, lasse jedoch die groteske soziale und ökonomische Ungleichheit unangetastet. »Wir müssen diesen Widerspruch sobald wie möglich auflösen«, drängte er, »sonst werden die Leidtragenden dieser Ungleichheit die Struktur der politischen Demokratie zerstören.« Die gewählten Demagogen unserer Zeit, die von benachteiligten Wählern eben wegen ihrer Fähigkeit zur Zerstörung der Demokratie gewählt wurden, haben die Aufmerksamkeit verspätet auf viele weitere Widersprüche dieser Art gelenkt. Doch die späte Beachtung der von Ambedkar ausgesprochenen Warnung hat sich als tödlich erwiesen.
Seit der Corona-Krise ist deutlicher geworden, dass die modernen Demokratien seit Jahrzehnten auf einen moralischen und ideologischen Bankrott zuschlittern – und ihre eigenen Publizisten haben sie nicht darauf vorbereitet, mit den politischen Gefahren und den Umweltkatastrophen fertigzuwerden, die der unregulierte Kapitalismus unablässig selbst solchen Gewinnern der Geschichte zufügt wie Großbritannien und den USA. Die freundlichen Fanatiker bemühten sich sehr, ihre parfümierte Vorstellung angloamerikanischer Überlegenheit vor der anrüchigen Vergangenheit des Völkermords, der Sklaverei und des Rassismus – wie auch vor dem Gestank der Korruption in den Wirtschaftsunternehmen – zu schützen, aber für die wirklichen Feinde der Demokratie haben sie keine Nase.
Zu Hause wie auch im Ausland unter Belagerung geraten, wird ihre Autorität als Oberaufseher, Polizisten und Erklärer der Welt zunehmend in Frage gestellt. Längst reif für die Pensionierung, aber immer noch fest verwurzelt in den oberen Etagen der Politik und des Journalismus, bringen sie weiter unablässig ihren Zorn und ihre Frustration unter die Leute oder jammern über cancel culture und die »radikale Linke«, denn zu mehr sind sie nicht fähig. Ihre nervtötend simplen Vorstellungen über Demokratie, deren Feinde und Freunde, die freie Welt und dergleichen verdammen sie dazu, die heutige Welt als endlose Folge von Schocks und Katastrophen zu erleben. Wenn Wut, Verwirrung und Fassungslosigkeit ihre Gesichter verzerren, so weil ihr Narzissmus heute am Boden liegt, Selbstgefälligkeit nicht mehr als analytischer Rahmen durchgeht und erbitterter Ethnonationalismus in Indien oder anarchische Missregierung in Großbritannien und den Vereinigten Staaten nur allzu deutlich machen, dass wir nicht in einer liberalen Demokratie leben – zumindest noch nicht.
[1]Achtet auf diesen Mann
Über Niall Ferguson und den Neoimperialismus
»Die Zivilisation geht in die Brüche«, erklärt der Millionär und Yale-Absolvent Tom Buchanan recht unvermittelt seinem Gegenüber Nick Carraway in Der große Gatsby: »Was das anlangt, bin ich ein furchtbarer Pessimist geworden. Hast du ›Der Aufstieg der farbigen Völker‹ gelesen – von diesem Goddard? (…) wenn wir uns nicht vorsehen, wird die weiße Rasse weggefegt.« – »Tom zieht es in letzter Zeit in die Tiefe«, bemerkt seine Frau Daisy. Buchanan fährt fort: »Und dieser Kerl hat die Lösung gefunden. Wir, die herrschende Rasse, müssen auf der Hut sein, sonst übernehmen die anderen Rassen die Herrschaft.« – »Zermalmen müssen wir sie«, flüstert Daisy mit einem Augenzwinkern in Richtung Nick. Doch Buchanan lässt sich nicht aufhalten: »Und wir haben all die Dinge geschaffen, aus denen die Zivilisation besteht – zum Beispiel Wissenschaft und Kunst und all das. Versteht ihr?«
»Es hatte etwas Mitleiderregendes, wie er sich konzentrierte«, bemerkt der Erzähler Carraway, »als würde ihm die eigene Selbstgefälligkeit neuerdings nicht mehr genügen.« Die früh im Roman angesiedelte Szene hilft dem Leser, Buchanan als einen Langweiler zu identifizieren – und als einen ungebildeten Tölpel. Sie verweist auch auf eine wachsende Panik in der anglophilen herrschenden Klasse der Vereinigten Staaten von Amerika. Voller Argwohn gegenüber Jay Gatz, dem Selfmademan mit gefälschtem Oxbridge-Stammbaum, schaut Buchanan nervös auf andere Emporkömmlinge, die aus dem Nichts auftauchen und die Herrenrasse herausfordern.
Scott Fitzgeralds Goddard basiert zumindest teilweise auf Theodore Lothrop Stoddard, dem Autor des Bestsellers The Rising Tide of Color Against White World Supremacy (1920). Stoddards Ruhm war ein Zeichen seiner Zeit, des überhitzten rassistischen Klimas des frühen 20. Jahrhunderts, als die »Gelbe Gefahr« real erschien, der Ku-Klux-Klan auf die Bühne zurückkehrte und Theodore Roosevelt sich öffentlich Sorgen wegen eines möglichen »Rassenselbstmords« machte. Zur Begründung seines Widerwillens gegen eine Verwicklung der USA in den Krieg in Europa erklärte Woodrow Wilson 1917 gegenüber seinem Außenminister, »die weiße Zivilisation und ihre Herrschaft über die Welt beruhe weitgehend auf unserer Fähigkeit, unser Land intakt zu halten«.
Hysterische Ängste hinsichtlich der »weißen Zivilisation« ergriffen die USA, als die Selbstverstümmelung Europas im Ersten Weltkrieg unterdrückte Völker von Ägypten bis nach China zu politischer Selbstbehauptung ermutigte. Anders als andere bekannte Rassisten, die den Unterschied zwischen nordischen und lateinischen Völkern in den Vordergrund stellten, schlug Stoddard eine klare Teilung der Welt in weiße und farbige Rassen vor. Er setzte schon früh auf Islamophobie und behauptete in The New World of Islam, die Muslime stellten eine finstere Gefahr für einen hoffnungslos zersplitterten und verwirrten Westen dar. Wie zahlreiche angesehene Eugeniker seiner Zeit fand Stoddard später an den Nazis vieles, das ihm gut gefiel, weshalb er denn auch zu denen gehörte, die nach der Aufdeckung der Naziverbrechen 1945 rasch in der Versenkung verschwanden.
Das Banner der weißen Vorherrschaft wird seither im postimperialen Europa nur noch mit Vorsicht geschwenkt und nur sehr selten von Politikern und Autoren des Mainstreams. In den Vereinigten Staaten wurden Rassenängste entweder in pseudowissenschaftlichen Traktaten über die Minderwertigkeit bestimmter Rassen wie The Bell Curve oder in unheilverkündenden Großtheorien wie Samuel Huntingtons »Kampf der Kulturen« geschürt. Es kann daher kaum überraschen, dass Huntington sich in seinem letzten Buch Sorgen macht, die Einwanderung aus Lateinamerika werde die nationale Identität der USA zerstören, die offensichtlich eine Hervorbringung der »angloprotestantischen Kultur« sei. Da die Macht sich erkennbar Richtung Osten verschiebt, sucht man nach einem Gegenmittel gegen die Bestürzung über den Verlust an Macht und Einfluss und rührt in regelmäßigen Abständen die Werbetrommel für die »transatlantische Allianz« – wie etwa in Philip Bobbitts Terror and Consent. In einer begeisterten Besprechung schrieb Niall Ferguson, das Buch werde gewiss »mit Vergnügen von Männern eines bestimmten Alters, einer bestimmten Schicht und einer bestimmten Bildung von der Upper East Side Manhattans bis hin zum Londoner West End gelesen werden«.
Ferguson ist selbst eine Neuauflage des homo atlanticus. In einem Vorwort zur britischen Ausgabe von Civilisation: The West and the Rest schreibt er, er habe sich in den frühen 2000er Jahren weg von einer langweiligen Oxbridge-Karriere in die Vereinigten Staaten locken lassen, »wo wirklich die Macht und das Geld waren«. Der Autor zweier früherer Bücher über das Bankwesen des 19. Jahrhunderts wurde einem breiteren Publikum bekannt durch Der falsche Krieg, eine Streitschrift mit zahllosen wissenschaftlichen Referenzen, die den Briten die Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs gibt. Nach Ferguson war Preußen nicht die Bedrohung, die das von den Liberalen geführte Kabinett in London in ihm sah. Diese Fehleinschätzung habe nicht nur nach 1919 einen weiteren Krieg unvermeidlich werden lassen und die Schaffung einer unausweichlich von Deutschland dominierten Europäischen Union in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts verschoben, sondern auch auf tragische und fatale Weise den Zugriff Großbritanniens auf seine Überseebesitzungen geschwächt.
Diese wehmütige Vision eines Empire, über dem die Sonne niemals hätte untergehen müssen, besaß einen leicht erkennbaren Mangel. Sie unterschätzte grob – und ignorierte tatsächlich sogar vollkommen – die wachsende Stärke der antikolonialen Bewegungen in ganz Asien, die ihrerseits, vollkommen unabhängig vom sonstigen Geschehen in Europa, die ohnehin schwindende Fähigkeit Großbritanniens, seine riesigen Überseegebiete zu verwalten, unterminiert hätten. Damals jedoch wirkte Der falsche Krieg jungenhaft und gewinnend revisionistisch und begründete Fergusons Ruf. Man hielt ihn für »provokativ« und amüsant – beides Dinge, die sich in der intellektuellen Kultur Großbritanniens höherer Wertschätzung zu erfreuen scheinen als in irgendeiner anderen.
Im Rückblick betrachtet kündigten die in Der falsche Krieg zu lesenden, an Stoddard erinnernden Klagen über die unnötige Entmannung der angelsächsischen Macht ein Thema an, das immer deutlicher hervortrat, als Ferguson seine Expertise als Wirtschaftshistoriker beiseitelegte und zu einem Prediger des Empire wurde, der nebenher auch Historiker war. Schon in Politik ohne Macht, das wenige Monate vor den Anschlägen vom 11. September 2001 erschien, hatte er gefordert, die USA sollten »einen größeren Teil ihrer gewaltigen Ressourcen dafür einsetzen, die Welt für Kapitalismus und Demokratie sicher zu machen« – wenn nötig mit militärischer Gewalt. Im April 2003, wenige Wochen nach dem Beginn des Shock-and-Awe-Feldzugs im Irak, schrieb er im New York Times Magazine: »Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Ich bin ein Vollmitglied der neoimperialistischen Bande.«
Fergusons nächstes Buch – Empire: How Britain Made the Modern World – erschien in den USA mit einem etwas didaktischeren Untertitel: »Aufstieg und Niedergang der britischen Weltordnung und die Lehren für die Weltmacht«. Der Ausdruck »Empire« löste in den USA immer noch ein gewisses Unbehagen aus, da deren eigene nationale Mythen in einem frühen, kurzlebigen und selektiven Antiimperialismus gründeten. Ein verärgerter Ferguson – »die Vereinigten Staaten«, rief er aus, »sind, kurz gesagt, ein Imperium, das seinen Namen nicht auszusprechen wagt« – machte sich daran, das Wort von dem Misskredit zu befreien, in das es durch political correctness offenbar geraten war. Das britische Empire des 19. Jahrhunderts »war unzweifelhaft ein Pionier des Freihandels, der freien Bewegung des Kapitals und mit der Abschaffung der Sklaverei auch der freien Arbeitskraft. Es investierte gewaltige Summen in die Entwicklung eines modernen weltweiten Kommunikationsnetzes. Es sorgte in riesigen Gebieten für die Verbreitung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit (…). Ohne die Ausbreitung britischer Herrschaft in aller Welt«, so fuhr er mit einem typischen kontrafaktischen Manöver fort, besäßen kolonisierte Völker wie die Inder nicht das, was inzwischen zu ihren wertvollsten Ideen und Institutionen gehöre: parlamentarische Demokratie, individuelle Freiheit und die englische Sprache.
Die Vereinigten Staaten, argumentierte Ferguson, sollten nun dem Beispiel Großbritanniens folgen, wobei er allerdings zu fragen vergaß, warum denn die USA die moderne Welt erst noch erschaffen mussten, wenn doch Großbritannien bereits so gute Arbeit geleistet hatte. Er pflichtete dem Neokonservativen Max Boot bei, dass die USA in ganz Asien »die aufgeklärte ausländische Verwaltung« wiederherstellen sollten, »die einst selbstbewusste Engländer in Reithosen und Tropenhelm bereitgestellt« hätten. Es gelte, »rasch damit zu beginnen, amerikanische Studenten an den führenden Universitäten zu bewegen, ernsthafter über berufliche Karrieren im Ausland nachzudenken«.
Die von Ferguson vorgeschlagene »Anglobalisierung« der Welt war kaum mehr als eine aufgefrischte Version der US-amerikanischen »Modernisierungstheorie«, die ursprünglich während des Kalten Kriegs als Alternative zum Kommunismus vorgeschlagen worden war und nun eine Verbindung mit einer revolutionären Gewalt einging, für die man einst die kommunistischen Regime gescholten hatte. Ihre Lektüre im Jahr 2011 lässt allenfalls melancholische Gefühle aufkommen. Im ersten aufgeregten Jahr des weltweiten »Kriegs gegen den Terror« lösten jedoch leichte Siege über die bunt zusammengewürfelte Truppe der Taliban in einem breiten ideologischen Spektrum des angloamerikanischen Raumes megalomane Phantasien über »den Rest der Welt« aus. Dieses Spektrum reichte von Ann Coulter, die forderte, wir sollten »ihre Länder erobern, ihre Anführer töten und sie zum Christentum bekehren«, bis hin zu Michael Ignatieffs salbungsvollem »Empire-Lite« und dem von Robert Cooper, einem der windigen Gurus Tony Blairs, propagierten »liberalen Imperialismus«. Der »islamische Faschismus« sei ebenso böse wie der Nationalsozialismus und Saddam Hussein ein zweiter Hitler, ein über Generationen währender Kampf drohte, und die Anrufung Winston Churchills – nach Ferguson der »größte aller Angloamerikaner«, an dessen entschlossene Verteidigung der englischsprachigen Völker in Bushs Weißem Haus eine Büste erinnerte – schien allenthalben an der Ostküste für eine straffere Haltung zu sorgen.
Wenn die Rezeption eines Autors in einen günstigen politischen Kontext fällt, kann das für ihn den Durchbruch bedeuten. Das gilt in besonderem Maße für Ferguson, dessen Bücher weniger wegen ihrer originellen wissenschaftlichen Beiträge als wegen einiger ihrer provokanten kontrafaktischen Behauptungen bekannt sind. In Großbritannien wurde sein Getöse um die Bürde des weißen Mannes von akademischen Historikern zwar weitgehend ignoriert. Er profitierte jedoch von einem allgemeinen Rechtsruck im politischen und kulturellen Diskurs, der Apostel der öffentlichen Meinung wie Andrew Marr veranlasste, Ferguson mit Hochachtung zu behandeln. Seine Apotheose erlebte er jedoch in den USA, wo er – gestützt von seinem Oxbridge-Prestige und, wichtiger noch, von einer erfolgreichen TV-Serie – für viele aufstrebende Römer ein weiser griechischer Berater wurde. Er brauchte keine lange Zeit vertretenen Prinzipien zu widerrufen, um zum Harvard-Professor, zum Prime-Time-Experten bei CNN und Fox und zum Gast auf hochkarätigen Selbstdarstellungsveranstaltungen in Davos und Aspen aufzusteigen. Er wurde schnell und reibungslos zum auffälligsten Flüchtling aus dem postimperialen Großbritannien, der dem Washingtoner (und New Yorker) Konsens seinen Beifall zollte.
Für einen Leser aus jener Welt, welche die Briten angeblich erschaffen hatten, gehörte Empire unverkennbar in die Tradition dessen, was der chinesische Denker Tang Tiaoding 1903 unverblümt als »von Weißen verfasste Geschichte« beschrieb. Swami Vivekananda, der berühmteste indische Denker des 19. Jahrhunderts, brachte die weitverbreitete moralische Missbilligung der von Ferguson gefeierten tropenbehelmten Missionare der westlichen Zivilisation zum Ausdruck:
Vergiftet vom berauschenden Wein neugewonnener Macht, furchterregend wie wilde Tiere, die den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht kennen, Sklaven der Frauen, von ihren Begierden übermannt, von Kopf bis Fuß in Alkohol getränkt, ohne jegliche rituellen Verhaltensnormen, unrein (…), von materiellen Dingen abhängig, mit allen Mitteln nach Grund und Vermögen anderer Menschen greifend (…), der Körper ihr alleiniges Ich, nur auf die Befriedigung ihrer Begierden bedacht – das ist das Bild des westlichen Dämons in indischen Augen.
Schon 1877, Jahrzehnte bevor antikolonialistische Führer und Intellektuelle in ganz Asien und Afrika eine systematische politische Kritik am Kolonialismus entwickelten, attackierte der reisende Muslimaktivist Dschamal al-Din al-Afghani den »Fallstrick der Doppelzüngigkeit« in britischen Darstellungen Indiens. Die Briten hätten nur deshalb gewaltige Summen in den Aufbau eines weltweiten Kommunikationsnetzes gesteckt, so schrieb al-Afghani, »um unsere Reichtümer abziehen zu können sowie den Handel für die Bewohner der Britischen Inseln zu erleichtern und die Sphäre ihres Reichtums zu erweitern«. Zwei Generationen westlicher Historiker bestätigten im Kern die frühen asiatischen und afrikanischen Thesen, wonach der »Freihandel«, ob nun wie in China durch Kanonenboote oder wie in Indien durch schlichte Besetzung erzwungen, verheerende Auswirkungen hatte. Die indische Unabhängigkeitserklärung von 1930 fasste die vielgestaltigen Schäden zusammen, die einem breiten Streifen unterjochter Länder, von der osmanischen Türkei und Ägypten bis hin nach Java, zugefügt worden waren:
Dörfliche Wirtschaftszweige wie das Handspinnen sind zerstört worden (…), und anders als in anderen Ländern ist nichts an die Stelle dieser vernichteten Handwerkszweige getreten. Zölle und Währung werden in der Weise manipuliert, dass sie den Bauern nur noch größere Lasten aufbürden. Britische Industrieerzeugnisse bilden den größten Teil unserer Importe. Die Zollbestimmungen sind auf den Nutzen britischer Erzeuger ausgerichtet, und die Einnahmen daraus werden nicht dazu verwendet, die Last der Massen zu erleichtern, sondern eine äußerst verschwendungssüchtige Verwaltung zu finanzieren. Noch ungerechter ist die Manipulation des Wechselkurses, die dazu führt, dass viele Millionen aus dem Land abfließen (…). Jegliches administrative Talent wird erstickt, und die Massen müssen sich mit niederen Stellungen als Dorfbeamte und Schreiber begnügen (…). Das Bildungssystem hat uns aus unserer Verankerung gerissen.
Ferguson ignorierte die noch schlimmeren Verbrechen des Imperialismus nicht völlig: den Sklavenhandel, die Behandlung der australischen Aborigines oder die Hungersnöte, die mehrere zehn Millionen Menschen in ganz Asien dahinrafften. Er bot jedoch eine robuste Verteidigung der britischen Motive, die offensichtlich gleichermaßen humanitärer und ökonomischer Natur gewesen seien. Millionen asiatischer Vertragsarbeiter in ferne Kolonien zu transportieren (Inder auf die Malaiische Halbinsel, Chinesen nach Trinidad) sei schrecklich gewesen, doch »wir können nicht so tun, als hätte diese Mobilisierung billiger und wahrscheinlich sonst beschäftigungsloser Arbeitskräfte für Gummiplantagen und Goldminen keine wirtschaftliche Bedeutung besessen«. Und er stellte die »modische« Behauptung in Frage, die Briten hätten »nichts zur Linderung der durch Dürre verursachten Hungersnöte dieser Zeit getan«. Jedenfalls, »wann immer die Briten sich despotisch verhielten, kam fast jedes Mal aus der britischen Gesellschaft heraus eine liberale Kritik an diesem Verhalten«. Er klingt wie die Europäer, die V.S. Naipaul – Enkel solch eines Vertragsarbeiters – in seinem Buch An der Biegung des großen Flusses beschreibt und von denen es dort heißt: Sie »wollten Gold und Sklaven, wie alle anderen auch; aber zugleich wollten sie sich als Wohltäter der Sklaven ein Denkmal setzen«.
Fergusons nächstes Buch, Das verleugnete Imperium. Chancen und Risiken amerikanischer Macht, eine selektive Geschichte imperialistischer US-amerikanischer Interventionen, zeigt den Autor zunehmend besorgt über die Fähigkeiten des US-amerikanischen Imperiums statt über dessen Legitimität. Er war überzeugt, dass man in den USA soziale Sicherungssysteme wie Medicare und Medicaid drastisch kürzen müsse, um im Ausland weitere Außenposten für Amerikaner in Reithosen bauen zu können. Doch wie sich zeigte, strömten die Amerikaner nicht eilends zu Abercrombie & Fitch, um sich mit tropentauglicher Kleidung einzudecken. Zwar bemühten sich einige eifrige junge Republikaner in der Bagdader Green Zone nach Kräften, den irakischen Staat zu zerlegen, doch das machte auf Ferguson keinen Eindruck: »Die besten und klügsten Köpfe Amerikas wollen nicht Mesopotamien regieren, sondern MTV managen; sie wollen nicht über Hedschas herrschen, sondern Hedgefonds verwalten.«
»Illegale Einwanderer, Arbeitslose und verurteilte Straftäter«, so meinte Ferguson, »sollten ein ausreichendes Reservoir für größere amerikanische Streitkräfte darstellen.« Doch 2006, im schlimmsten Jahr des antiamerikanischen Aufstands, war Ferguson überzeugt, dass die USA der »arbeitsintensiven« Aufgabe, den Irak besetzt zu halten und zu regieren, nicht gewachsen waren. Mit Worten, die an Gibbon erinnerten, nannte er den Lesern von Vanity Fair diverse Vorzeichen für den Verfall und Untergang der westlichen Zivilisation. Dazu zählten die Abhängigkeit der USA von »asiatischen Zentralbanken und Finanzministerien im Nahen und Mittleren Osten«; der Feminismus, der schuld am demographischen Niedergang Europas sei; und die Tatsache, dass »Mädchen nicht mehr mit Puppen spielen; sie sind nun selbst die Puppen, gekleidet nach dem Diktat der Modebranche«. Die Amerikaner seien übergewichtig, während die Europäer, die dem Christentum und dem Kriegswesen den Rücken gekehrt hätten und den Sozialstaat ausnutzten, degenerierte Faulenzer seien: »Endloses Gaming, Chatten und Chillen mit ihren iPods – die nächste Generation hat schon jetzt ein dürftigeres Verhältnis zur ›westlichen Zivilisation‹, als es den meisten Eltern lieb ist.«
So wirkte es denn auch nicht allzu abrupt, als Ferguson Ende 2006 seine transatlantischen Überzeugungen aufgab und seinen intellektuellen Glauben wie auch seine Energie stattdessen auf »Chimerika« richtete, eine in seinen Augen notwendige und sinnvolle Allianz zwischen China und den USA, eine veritable G2. Bei all seinen Vorstößen in eine »provokante« Geschichte des Empire hatte sich Ferguson doch seinen guten Ruf als Wirtschaftshistoriker bewahrt. »Die drohende Finanzkrise Amerikas ist so gewaltig«, hatte er schon 2004 geschrieben, »dass man versucht ist, von einer finanzwirtschaftlichen Entsprechung des perfekten Sturms – oder eines perfekten Erdbebens – zu sprechen.« Nun jedoch, überwältigt vom »Aufstieg Chinas«, schienen ihm »die beiden Hälften Chimerikas« auf wunderbare Weise »komplementär« zu sein: