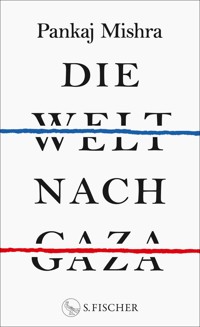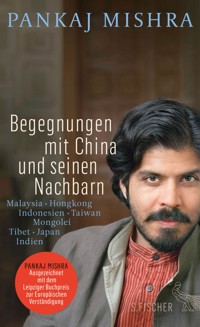19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von den feuchten Hütten in Mumbai bis in toskanische Landvillen – »Goldschakal« ist ein schonungsloser Roman über die Ungleichheit der modernen Welt und wie sie auf die intimsten Beziehungen durchschlägt. »Pankaj Mishra verwandelt die intime Geschichte der bescheidenen Herkunft eines Mannes in das Kaleidoskop einer Gesellschaft, die von Macht und Reichtum geblendet ist – und ihre menschlichen Kosten. Ein spektakulärer, erhellender Roman.« Jennifer Egan Während Arun in einer kleinen Hütte neben den Eisenbahnschienen aufwächst, träumt er davon, den ärmlichen Verhältnissen seiner Familie zu entfliehen. Als er trotz seiner niedrigen Kaste am Indian Institute of Technology angenommen wird, scheint er endlich aus dem ewigen Kreislauf der Armut ausbrechen zu können. Auf dem Campus trifft er auf zwei Studenten aus ähnlichen Verhältnissen. Im Gegensatz zu dem verunsicherten Arun verfügen sie über den schieren Willen und das Selbstvertrauen, die gnadenlosen sozialen Schranken zu durchbrechen. Die Absolventen des IIT werden schließlich zu den Finanzgenies ihrer Generation, die von East Hampton bis in die Toskana ebenso hart arbeiten wie sie ausgelassen leben. Während seine Freunde einer nie dagewesenen finanziellen und sexuellen Freiheit hinterherjagen, beschließt Arun, ein Leben als Schriftsteller zu führen, und zieht sich mit seiner alternden Mutter in ein kleines Dorf im Himalaya zurück. Die bescheidene Idylle der Zurückgezogenheit wird gestört, als Alia auftaucht, eine junge Frau, die über Aruns Klassenkameraden schreibt. Sie ist schön, gebildet und belesen – und zieht Arun zurück in die glitzernde Welt der Luxusapartments in London, New York und Mumbai. Kurz darauf wird er in eine schreckliche Gewalttat verwickelt, die von seinem engsten Freund begangen wurde, und Arun muss mit der Person abrechnen, die er geworden ist. »Goldschakal« ist ein eindringlicher Roman über die moralischen und emotionalen Kosten materiellen Fortschritts. Es ist die Geschichte eines Landes und einer globalen Ordnung im Umbruch und den Ungleichheiten von Klasse und Geschlecht, die auf unsere intimsten Beziehungen durchschlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Pankaj Mishra
Goldschakal
Roman
Über dieses Buch
Für Arun, Aseem und Virendra ist die Aufnahme an das Indian Institute of Technology die Chance, dem Leben der niedrigen Kasten zu entfliehen. Mit einem Willen, der ebenso rücksichtslos ist wie ihr Selbstvertrauen grenzenlos, werden Aseem und Virendra zu den Aufsteigern ihrer Generation, arbeiten hart und leben ausgelassen. Während seine Freunde einer nie dagewesenen finanziellen und sexuellen Freiheit hinterherjagen, zieht Arun sich mit seiner alternden Mutter in ein kleines Dorf im Himalaya zurück. Doch auch die bescheidene Idylle der Zurückgezogenheit wird gestört, als Arun in die schreckliche Gewalttat eines Freundes verwickelt wird – und mit der Person abrechnen muss, zu der er geworden ist.
Ein schonungsloser Roman über die Ungleichheit der modernen Welt und wie sie auf die intimsten Beziehungen durchschlägt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pankaj Mishra, geboren 1969 in Nordindien, schreibt seit über zehn Jahren regelmäßig für die »New York Review of Books«, den »New Yorker« und den »Guardian« über den indischen Subkontinent, über Afghanistan und China. Er gehört zu den großen Intellektuellen des modernen Asien und hat zahlreiche Essays in »Lettre International« und »Cicero« veröffentlicht; auf Deutsch sind darüber hinaus der Roman »Benares oder Eine Erziehung des Herzens« und der Essayband »Lockruf des Westens. Modernes Indien« erschienen. Pankaj Mishra war u. a. Gastprofessor am Wellesley College und am University College London. Für sein Buch »Aus den Ruinen des Empires«, das 2013 bei S. Fischer erschien, erhielt er 2014 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Bei S. Fischer sind von ihm außerdem »Begegnungen mit China und seinen Nachbarn« und »Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart« erschienen. Er lebt abwechselnd in London und in Mashobra, einem Dorf am Rande des Himalaya.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Run and Hide« bei Hutchinson Heinemann, London.
Copyright © 2022 by Pankaj Mishra
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Philipp Starke, Hamburg www.starke-gestaltung.de
Coverabbildung: pitinan/Can Stock Photo
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491609-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
[Widmung]
Erster Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Zweiter Teil
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Teil Drei
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Vierter Teil
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Zitierte Übersetzungen
Dieses Werk ist ein Roman. Die Namen, Figuren und Geschehnisse darin sind fiktiv und basieren nicht auf wahren Personen oder Erlebnissen.
Für J.H.B.
Erster Teil
Eins
Während der ersten Tage, die Aseem im Gefängnis ver bringt, wiege ich mich jede Nacht mit Hilfe einer Vision in den Schlaf: Ich gleite über die klare, unbewegte Oberfläche des Wassers, bis ich mich weit vom Ufer entfernt auf den Rücken drehe und auf dem Wasser treibe, das Gesicht zum Himmel gerichtet, und dann lasse ich mich sinken.
Während die Sprudelspur der Atemblasen verblasst, dringt Wasser in die Nasenlöcher und den Mund ein und füllt allmählich meinen Körper, bis ich schwer bin und lautlos in die Tiefe des endlosen Blaus sinke.
Immer schlafe ich ein, bevor mein Körper auf dem verwüsteten Grund des Meeres zur Ruhe kommt.
So habe ich mich als Kind stets in den Schlaf gewiegt; und wenn ich mich genötigt fühle, mit dir über diese Zeiten zu sprechen und aus der Vergangenheit jene Fetzen, die du in deinem eigenen Buch übersehen hast, herauszupicken und Erinnerungen auszugraben, die ich lange verdrängt habe, dann tue ich das nur aus dem Grund, dass darin alles vorweggenommen ist, was zwischen uns geschah.
Ich bin mir sicher, ich werde den falschen Ton anschlagen und deine Abscheu und deinen Zorn riskieren; und doch muss ich auch von Aseem sprechen. Als mein erster Freund und früher Beschützer hat er mich nicht nur mit dir bekanntgemacht, sondern mich auch dazu ermutigt, dir zu folgen, bevor er unser aller Schicksal so gewaltsam und unentwirrbar miteinander verwoben hat.
Aseem, der sich selbst als Maskottchen einer siegreichen Selbsterfindung sah, liebte es, seine Freunde in seinen Traum von Macht und Herrlichkeit einzuweihen. Er stellte ihn sogar als existenzielle Notwendigkeit dar, indem er unablässig V.S. Naipaul zitierte: »So ist die Welt; wer nichts ist, wer es geschehen lässt, dass aus ihm nichts wird, hat keinen Platz darin.«
Es wird nicht leicht sein, sagte er immer, für Selfmademen aus unseren unteren sozialen Schichten. Er zitierte Tschechow – wie der Sohn eines Sklaven Tropfen um Tropfen das Sklavenblut aus sich herauspressen muss, bis er eines Tages erwacht und begreift, dass das Blut eines echten Menschen durch seine Adern fließt. Er wurde immer sehr emotional, wenn er davon sprach, welch ein Kampf es sei, bis wir uns selbst ernst nehmen könnten – dieser Kampf, sagte er, ginge dem Ringen voraus, andere davon zu überzeugen, uns ernst zu nehmen, und deshalb sei der Kampf mit uns selbst weit anspruchsvoller.
Er wirkte immer so gewandt und so selbstsicher, dass ich ihm nicht zu widersprechen wagte. Erst rückblickend wird mir die Gefahr bewusst, die für Aseem ausdenklich war: dass bei unseren Versuchen, uns selbst neu zu erschaffen – zu »echten Menschen« zu werden, indem wir schlicht unseren starken Wünschen und Impulsen folgten, ohne Anleitung durch Familie, Religion oder Philosophie –, wie durch diese Versuche unsere Selbsterkenntnis eingeengt wurde, dass die Verzerrungen in unserem Charakter unbemerkt blieben, bis wir eines Tages mit Schrecken als jene neuen Menschen erwachten, zu denen wir geworden waren.
Die Warnzeichen waren schon erkennbar, als ich Aseem zum ersten Mal begegnete. Ich habe dir in all den Gesprächen, die wir über ihn, über Virendra und über die anderen führten, während du für dein Buch recherchiertest, nie davon erzählt: Wie wir in unserer ersten Nacht am IIT von johlenden Männern weit nach Mitternacht aus dem Tiefschlaf gerissen wurden, der auf nervöse Erschöpfung folgt, und in ein überfülltes Oberstufenzimmer getrieben wurden, wo der Zigarettenrauch so dicht war, dass er einen erschlagen konnte, und wo ein Student, der einen Lungi trug, unter dem seine dicken haarigen Beine hervorlugten, mit tamilischem Akzent »Behenchod« blökte und uns aufforderte, uns nackt auf Händen und Knien auf den Boden niederzulassen.
Das war Siva. Er war stämmig, und sein großer, runder, rasierter Kopf schien halslos auf seinen Schultern zu sitzen. Er war wütend oder gaukelte eine große Wut vor, weil wir drei in dieser Nacht irgendwie ein größeres Zusammenkommen von Erstsemestern verpasst hatten.
»Ihr Schwesternficker«, rief er von seinem Bett aus, wo sich mehrere seiner Freunde herumlümmelten und uns aus ihren bebrillten Augen mit feindseliger Neugier beobachteten. »Ihr denkt, ihr müsst nicht bei uns vorstellig werden! Sagt mir, wer zum Teufel seid ihr? Und ich will, dass ihr bellt wie die braven kleinen Köter, die ihr seid!«
Aus unserer Hundeposition heraus stimmten wir gleichzeitig ein:
»Ich bin Arun Dwivedi, Maschinenbau, All-India-Studentenrang 62.«
»Ich bin Virendra Das, Informatik, All-India-Studentenrang 487.«
»Ich bin Aseem Thakur, Maschinenbau, All-India-Studentenrang 187.«
Wir bellten, während Sivas Kumpane sich in Gelächter auflösten, und Siva selbst stieß jenes volldröhnende Lachen aus, das du viele Jahre später, als du Material für dein Buch sammeltest, in den Gesprächen hören solltest, die vom FBI aufgezeichnet und von seinen Anwälten an die Presse geleakt wurden.
Virendra, Aseem und ich hatten uns an diesem Tag in dem uns zugewiesenen Wohnheim kennengelernt. So vieles verband uns da längst. Irgendwann in unseren frühen Teenagerjahren, als unsere Schulnoten langsam vielversprechend wurden, hatten unsere Eltern beschlossen, sich zu verschulden, bei Kleidung und Essen zu sparen und unseren Geschwistern eine Ausbildung zu verweigern, um ihre Söhne aufs Indian Institute of Technology zu schicken und sie auf den Weg zur Erlösung von Mangel und Unwürdigkeit zu bringen.
Jahrelang erzählten sie uns später noch, dass sie von morgens bis abends geackert hatten, um uns die Chancen im Leben zu geben, die ihnen verwehrt worden waren. Unser besonderes Gedächtnis und unser Talent zur Konzentration erwiesen sich als Fluch; die ungeheure Anstrengung, um in die renommierteste technische Hochschule des Landes aufgenommen zu werden, hat unsere Kindheit zerstört und sie vollgefüllt mit freudlosen Aufgaben, Verpflichtungen sowie Versagensangst.
Nun war unser langes Warten nach dem Bestehen der härtesten und anspruchsvollsten Prüfung der Welt endlich vorüber. Bei unserer ersten Begegnung wechselten wir jedoch kaum ein Wort miteinander. Waren wir zunächst auch überwältigt, dass wir es geschafft hatten, die Hoffnungen unserer Eltern zu bestätigen, so waren wir sehr schnell entmutigt zum Schweigen gebracht, als wir unseren Traum dann im harschen Licht des Tages betrachteten.
Abblätternde Farbe, karge Glühbirnen, krächzende Deckenventilatoren und das vor Mückenlarven zitternde Regenwasser in den Pfützen schienen darauf hinzudeuten, dass wir es kaum aus dem Sumpf unserer verzagten unteren Mittelklasse herausgeschafft hatten (in jenen Tagen ohne Google-Bildersuche hatte ich nicht gewusst, was ich von der Pforte zum Reichtum der Welt erwarten sollte). Die Wände unseres Zimmers waren mit Temperafarbe blassgelblich gestrichen, mit Abdrücken beschmiert, wo sich eingeölte Köpfe angelehnt hatten, und mit Flecken übersät, wo Moskitos zerquetscht worden waren; der Betonboden war von einer kieseligen Rauheit, mit ewigem Schmutz verkrustet, und in der Dunkelheit unter unseren Feldbetten wirkten die Staubschichten wie samtene Lumpen.
Der Speisesaal mit seinen bedrohlich schaukelnden Deckenventilatoren war an jenem ersten Tag ein einziger Wirbel aus Vätern in Breitkragenblazern mit Messingknöpfen und dicken Schulterpolstern, die ihre Hände unbehaglich neben den Hüften baumeln ließen, und von Müttern, die unsicher auf den Beinen waren, in Kanjivaram- und Benares-Seidensaris gehüllt und mit wuchtigem Goldschmuck behangen, wie Frauen, die verschmierten Lippenstift trugen, als wäre es das erste Mal – Menschen, die sich endlich in Selbstzufriedenheit versuchten, nachdem sie sich und ihre Kinder jahrelang nackter Angst und Furcht ausgesetzt hatten.
In der Luft lag der künstliche Geruch von Old Spice Aftershave und der blumige Duft von Pond’s Talkumpuder, worin sich, in Verbindung mit den herausgeputzten Männern und Frauen, zaghaft etwas Feierliches andeutete.
Doch die Halle, mit ihren abgewetzten Formica-Tischen und den rußigen blauen Wänden, an denen die vor den Ventilatoren geflüchteten Fliegen ihre Zeit totschlugen, hatte etwas Muffiges.
Virendra, Aseem und ich gehörten zu den ganz wenigen Neuankömmlingen, die an jenem Abend nicht von ihren Eltern begleitet wurden. Unseren Vätern und Müttern war klar gewesen, dass sie bei diesem entscheidenden ersten Schritt des Aufstiegs ihrer Söhne in die Ehrbarkeit unsere Herkunft durch ihre Anwesenheit verraten hätten. Am Prüfungstag hatte meine Mutter zu Hause ein ganztägiges Satyanarayan-Puja-Ritual veranstaltet, und mein Vater hatte mir das Geld gegeben, um ihm ein Telegramm aus Delhi zu schicken, sobald die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen bekanntgegeben wurden.
Als er das Telegramm erhielt, so erzählte mir meine Mutter, sei er auf dem Bahnhof, wo er arbeitete, auf- und abgelaufen und habe Besan-Laddus aus einer offenen Schachtel verteilt – an Leute, die über seine flammende Ausgelassenheit vermutlich genauso verwundert waren wie ich, als ich von seiner Verwandlung vom mürrischen Grobian zum rasend stolzen Papa erfuhr.
Bei der Abfahrt des Zuges, der mich zu meinem ersten Semester am IIT Delhi brachte, winkte er. Seine Lippen bewegten sich, vielleicht um etwas zu sagen, etwas, das nicht leicht in Worte zu fassen war, weder damals noch jetzt: dass ich nun Teil einer Welt war, die für ihn bloß Verachtung übrighatte. Er würde es niemals wagen, während meines Studiums nach Delhi zu kommen; meine Mutter konnte sich dies nicht einmal im Traum vorstellen, und ich war jedes Mal dankbar für ihre mentalen Fesseln, wenn ich mir ausmalte, dass sie an den Toren des IIT stand und in ihrem Dehati-Hindi nach mir fragte.
Viele Studenten waren in dieser Hinsicht rücksichtslos. Ich erinnere mich an den hellhäutigen Bengali, der sich mit seiner Verwandtschaft zu Rabindranath Tagore und einer langen familiären Verbindung nach Oxford rühmte. Das plötzliche Auftauchen seiner Mutter verriet seine Gewöhnlichkeit, und als die pummelige, dunkelhäutige kleine Gestalt vor seinem Zimmer auf dem Boden hockte, versuchte er, sie als sein Hausmädchen auszugeben.
Aseem hielt seine eigenen Eltern auf Distanz, um die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass sein Vater ein sehr einflussreicher Bahnbeamter sei, obwohl er bloß ein junger Ingenieur war, und vielleicht auch, um die Tatsache zu verschleiern, dass seine Eltern, für die er eine glühende Verachtung hegte, bigotte Menschen waren, fest entschlossen, Dalits und Muslime niemals in ihr Haus zu lassen.
Ich war an diesem ersten Tag aus einem Grund nervös, den ich niemandem anvertrauen konnte. Ich hatte Virendras Nachnamen neben meinem eigenen am schwarzen Brett entdeckt, was auf seine Abstammung von den Parias hinwies, die Kuhkadaver häuteten und für Hindus der oberen Kaste strikt unberührbar, ja unnahbar waren.
Wenige Minuten später stolperte er in mein Zimmer, beschwert durch einen olivgrünen Schlafsack und eine Blechkiste, auf die in weißer Farbe sein Name in Hindi gepinselt worden war mit einer Verschnörkelung, die einen 3D-Effekt erzielen sollte.
Er war dünn und schmächtig, trug eine Polyester-Schlaghose und ein blaues Nylon-Buschhemd. Seine Schuhe waren glänzend schwarz geputzt, und auf der Schnalle seines sehr breiten, ebenfalls schwarzen Gürtels waren zwei ineinander verschlungene Messingschlangen zu sehen. In seinen kleinen Augen über der Stupsnase und dem ordentlich gestutzten dünnen Schnurrbart aus Raaj-Kumar-Filmen der 1950er Jahre lag eine alarmierte Leere, und er füllte den winzigen, traurigen Raum mit dem Geruch von Kokosnussöl, während er seine Bücher und Zeitschriften – Bücher über Allgemeinbildung und alte Ausgaben der Competition Success Review – auf seinem Schreibtisch stapelte und eine Bürste sowie eine Dose mit schwarzer Cherry-Blossom-Schuhcreme sorgfältig unter seinem Bett verstaute.
Als er auspackte, klirrte leise die kleine goldene Uhr an seinem schmalen Handgelenk, und er enthüllte einige vertraute Embleme einer unteren Kaste, eines halbbäuerlichen Daseins: einen rautenförmigen Handspiegel; eine grobmaschige Decke; ein gerahmtes Porträt von Hanuman, der, auf ein Knie gestützt, seine Brust aufreißt, um darin Ram und Sita auf einem Thron zu offenbaren; Pakete mit Maggi-Nudeln und eine Dose Desi-Ghee, um die Thalis in der Kantine zu verfeinern.
Dass ich es ans IIT geschafft hatte, war, wie man so schön sagt, mein eigenes ›Verdienst‹. Dank der Bemühungen meines Vaters hatte ich einen unverwechselbar brahmanischen Nachnamen und eine viel hellere Haut, die von einer Geburt unter den Wohlgeborenen zeugte, und bei jeder Gelegenheit, zu der ich meinen Oberkörper entblößen musste, konnte ich sogar die Heilige Opferschnur tragen. Doch mit Virendra in der Nähe begann die hart erkämpfte Sicherheit meiner Brahmanen-Abstammung zu bröckeln.
Als ich in dieser Nacht nackt in Sivas Zimmer war, inmit ten einer Verwahrlosung aus Zigarettenrauch, weggeworfenen Hühnerknochen und leeren Old-Monk-Rumflaschen, umgeben von höhnischen Männern in weißen Schmuddelwesten und mit dicken Brillengläsern, fühlte ich mich vollends entblößt.
Es hatte einen Stromausfall gegeben, und mehrere Schweißschwalle flossen mir den nackten Rücken hinunter, bevor der Schweiß auf den Boden tropfte; auch meine Stirn war klatschnass, und von Zeit zu Zeit musste ich die Tropfen abschütteln.
Ich wurde mir eines fremden Auges bewusst, das zu mir aufblickte; Virendra hatte die Uhr abgenommen, die wie ein loses Armband um sein Handgelenk gehangen hatte – eine Frauenuhr von HMT, wie mir auffiel, an einem dünnen, unechten Goldband –, und er hatte sie ganz oben auf seinem Stapel von Kleidern, Schuhen und Gürtel abgelegt. Von dort, aus der Mitte einer zusammengekringelten Schlange, starrte mich der tickende Reif an, als wäre er am Leben.
Auf dem Bett liegend, unter einem Pin-up-Foto von Cindy Crawford, die ihre Brüste umarmte, massierte Siva seine Waden (Jahre später würde er bei einer Wohltätigkeitsgala in New York hunderttausend Dollar ausgeben, um einmal neben dem Supermodel zu sitzen), während er rief: »Sieh dir deine Schuhe an. So schwarz und blank wie dein Gesicht.«
Es entstand eine Pause, in der ich mich fragte, warum Virendra mitten in der Nacht in Sivas Zimmer seine besten Schuhe trug.
Siva brüllte wieder: »Woher kommst du, kaalu haramzada, schwarzer Bastard?«
Die Frage war nur an einen von uns gerichtet.
»Mirpur, Sir«, sagte Virendra mit dünner Stimme, die Siva und seine Freunde in Gelächter ausbrechen ließ.
»Wo ist Mirpur, saala chamar?«
»In einem Basti im Distrikt Gorakhpur, Sir.«
»Wo ist Gorakhpur, kaalu …«
Ich sah den Rastplatz auf dem Weg nach Nirgendwo vor mir, Blechhütten und Lumpen rund um eine Bushaltestelle, eine Zuckerrohrfabrik, die nahebei ihren faulig riechenden Rauch ausstieß, und ein künstliches Becken mit grellgrünem, unter Schwimm-Hyazinthen ersticktem Wasser, in dem vollkommen reglos abgemagerte schwarzgraue Büffel standen.
»Okay, okay, es reicht mit der Geographie«, sagte Siva. »Gaana gao, saala chamar.«
Nach der kürzesten Pause begann Virendra jubelnd zu singen: »Waqt ne kiya kya haseen sitam …«
Es gab eine Explosion von Gelächter, gefolgt von kleineren Ausbrüchen der Heiterkeit, als ein furchtloser Virendra weitermachte.
Ich hörte, wie Siva sagte: »Panditji, englische Übersetzung, ja?«
Er konnte nicht ahnen, welche Erleichterung mir der Ehrentitel für Brahmanen bereitete.
»Sir«, sagte ich mit gesenktem Blick. »Es bedeutet: ›Welch wundervolle Rache hat die Zeit genommen, ich bin nicht mehr der, der ich einst war, und auch du bist es nicht.‹«
Meine Stimme war viel zu laut. Ein paar Männer gackerten.
»Was für ein beschissen deprimierendes Lied«, sagte Siva und kitzelte damit weiteres Gelächter hervor. »Okay, okay, genug gesungen, kaalu chamar. Ab chalo, Panditji ki gaand saaf karo.«
In seinem Akzent klang sein boshafter Befehl so, als würde er bei einem Kellner um ein paar weitere Chilis für sein Thali bitten.
Seine Freunde krümmten sich vor Lachen, und mir kam der Gedanke, dass sie vielleicht sogar über sein Hindi spotteten, denn er klang wie die ulkigen Südinder in Bollywoodfilmen.
Während einer Pause holte Siva ein gefaltetes weißes Tuch aus seiner Tasche hervor, tupfte sich das rundliche Gesicht ab, bis er ganz zum Schluss seine Nasenspitze polierte.
Ich wunderte mich über diese Geste, als er sagte, Virendra könne sein Karma nur verbessern und eine Wiedergeburt als Dalit vermeiden, wenn er den Anus eines Brahmanen sauberlecke, während Aseem eine Beförderung vom Kshatriya zum Brahmanen anstreben könne, wenn er sich bei dem ganzen Spektakel einen runterhole.
Du hättest aus dieser Szene in deinem Buch weit mehr gemacht als Aseem, der sie in seinen letzten Roman verarbeitete. Ich bemerkte, dass das spiralgebundene Manuskript ungelesen im Bücherstapel auf deiner Seite unseres Bettes in London steckte. Ich schlug es eines Tages auf und versteckte es dann schnell ganz unten im Stapel. Die Figur, die im Roman die Geliebte darstellt – eine junge Journalistin aus der muslimischen Oberschicht, die an einer Eliteuni studiert hat, kein Wasser trinkt, das nicht abgekocht oder gefiltert worden ist, und raucht, wenn sie nervös ist –, basierte zumindest teilweise auf dir.
Bei seiner männlichen Hauptfigur, einem Dalit-Studenten, der Virendra nachempfunden ist, war Aseem einfallsreicher. In einem düsteren sozialrealistischen Stil wollte er die Erniedrigung von Hindus der unteren Kasten zeichnen. Dementsprechend machte er in seiner Version unseres ersten Tages am IIT jeden Einzelnen von uns zu Dalits und verlegte die Szene vom IIT Delhi an eine medizinische Hochschule in Ranchi.
Der Dalit-Student Virendra wurde zum Opfer einer Vergewaltigung; seine Peiniger, die sich hinter wabernden Schleiern von Beedi-Tabakrauch verbargen, waren einheitlich der oberen Kaste angehörende grinsende, gemeine Kleinstädtler aus Bihar. Aus Rücksicht auf einen linksgerichteten Geist verwandelte Aseem Virendra in einen maoistischen Ideologen, einen charismatischen Sprecher einer Guerillagruppe, die in den zentralindischen Wäldern Bergbaukonzerne und deren Söldnerarmeen bekämpft.
Wie du weißt, schlug Virendra nach dem IIT einen ganz anderen Weg ein. Doch Aseems übertriebene Beschreibung der Grausamkeit, die ihm angetan wurde, war kein Verrat an der Wahrhaftigkeit.
Du warst damals zu jung und wusstest wahrscheinlich nicht, dass Lynchmorde, das Ausbrennen von Augen sowie Vergewaltigungen von Dalits in der Dunkelheit der Dörfer und Kleinstädte, aus denen wir gekommen waren, weit mehr als heute an der Tagesordnung waren.
Politiker, die den Hindus der unteren Kasten Selbstachtung und mehr Maßnahmen gegen Diskriminierung versprachen, fanden erst später Gehör.
Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die wohlgeborenen Hindus ihre aufstrebenden Konkurrenten ohne Angst vor Repressalien oder Widerstand quälen. Und Siva konnte im unwahrscheinlichen Fall einer Untersuchung durch die Verwaltung des IIT stets behaupten, dass er lediglich einem Initiationsritus frönte, dem sich alle neuen Studenten unterzogen.
»Gehen wir, gehen wir, kaalu chamar, aage bhado, Panditji wartet!«, rief er.
»Hey, sai baba«, wandte er sich an Aseem, »worauf wartest du? Hol’ bitte dein bestes Stück raus.«
Er drehte sich abrupt zu mir um: »Ach, Panditji, lass doch bitte diesen jämmerlichen Ausdruck sein. Ich will, dass du bei der Reinigung eines wichtigen Organs glücklich aussiehst.«
Seine Freunde lachten noch ein wenig mehr darüber, und Siva nahm wieder sein weißes Taschentuch, wischte sich das Gesicht ab und polierte seine Nase.
Virendra ließ keine aufsässige Pause entstehen. Ich spürte, wie er sich im Krebsgang hinter mir in Position brachte, und dann drückte sich sein dünner, borstiger Schnurrbart gegen meine Pobacken, seine verstohlene Zunge hinterließ feuchte Spuren auf der weichen Haut, und ich versuchte, dem Befehl von Siva zu folgen und Begeisterung vorzutäuschen, und wusste nicht, wohin ich schauen sollte: hinunter auf den grobkörnigen Boden, wo mich das gnadenlose Gesicht von Virendras Uhr anstarrte, oder hinauf zu Cindy Crawfords Brüsten, unter denen vergnügte Gesichter grinsten, von denen zwei hektisch Kaugummi kauten, während Siva rief: »Schneller, schneller, behenchod, du kaalu Bastard.«
Nach vier Stunden dieses Spektakels, das zerrissen war von ohrenbetäubenden und gruseligen Schreien aus anderen Teilen des Wohnheims, wo weitere Erstsemester rituell gedemütigt wurden, kehrten wir in unser Zimmer zurück.
Es stellte sich heraus, dass Siva übermäßigen Gefallen an dem von ihm ersonnenen Ritual fand, und so ging unsere Tortur noch einige Nächte lang auf seinem Zimmer weiter. Das Poster von Cindy Crawford wurde mir gut bekannt: wie die Reißzwecken, mit denen es befestigt war, Rost angesetzt hatten, und wie sich die Ränder des Posters verdrießlich nach innen wölbten und den abgeschliffenen Putz der Wand bloßlegten. Auch erkannte ich jedes von Sivas Taschentüchern wieder; sie waren allesamt mit zierlichen Spitzen besetzt. Bis heute erinnere ich mich an den Geruch von billigem Rum, an den Anblick einer rostigen Elektrokochplatte mit freiliegenden Drähten und an ein Teesieb aus Plastik, das in einer verbeulten Kasserolle in einer Ecke vor sich hinvegetierte; und lange Zeit konnte ich die Ameise nicht vergessen, die einst um meine Knie herumhuschte, bevor Virendra, der auf eine heimliche Art hektisch hinter mir war, das Insekt zerdrückte und den toten Körper von seinen Fingern schnippte.
Mein Knie und meine Ellbogen schürften auf, meine Augen brannten von Zigarettenrauch und Schlafmangel, und noch wochenlang danach verkrampften sich wieder und wieder meine Pobacken bei der bloßen Erinnerung an Virendras Zunge. Aseem beklagte sich, dass sein Penis noch Wochen später wund war und seine Vorhaut blutete.
Weit mehr Schaden wurde Virendras zerbrechlichem Körper zugefügt.
Manchmal hörte ich unterdrückte Schluchzer von der anderen Seite des Raumes. Und einmal hörte ich Aseem in Bezug auf Siva sagen: »Was für ein rakshas.« Jedes Wort des Mitgefühls oder der Sympathie wäre überflüssig gewesen, und nichts dergleichen wurde jemals zwischen uns gewechselt.
Das schockiert dich wahrscheinlich, doch nichts in unserem Leben hätte uns auf die Freundlichkeit von Fremden hoffen lassen können. In Aseems Roman ist es die Grausamkeit, die den Dalit-Studenten angetan wird, die ihr radikales politisches Bewusstsein in Gang bringt. In Wirklichkeit wollte oder konnte niemand von uns aus der uns zugewiesenen Position in der Hackordnung ausbrechen.
Schließlich hatten die Angehörigen von Virendras Kaste ihre eigenen Unberührbaren – Menschen, die sie terrorisieren und unterdrücken konnten. Innerhalb eines Jahres würden wir die Gelegenheit bekommen, dort zu sitzen, wo Siva und seine Freunde gesessen hatten, und die Demütigung einer neuen Gruppe von Erstsemestern zu überwachen.
Und dann wussten wir, dass uns in Zukunft, wenn wir unbeirrt weiter Grausamkeiten erleiden und anrichten würden, die Mitgliedschaft in der höchsten Kaste erwartete: die jener Menschen, die sich niemals um Geld sorgen müssen.
Unsere Gewohnheiten zur Selbsterhaltung waren bereits in unserer Kindheit geprägt worden, kurz nachdem wir mit der langen Vorbereitung für das IIT begonnen hatten. Wir wussten, wir hatten keine andere Wahl, als in unseren Leistungen niemals nachzulassen und gleichgültig allem persönlichen Leid und jeder Schande zu begegnen, bis zumindest der Gipfel der Sicherheit in Reichweite schien; und wir wussten auch, dass der zermürbendste Teil dieses Aufstiegs die vier Jahre am IIT wären.
Und dennoch: Auch Monate nach dieser ersten Nacht – und lange, nachdem Siva aufgehört hatte, uns in sein Zimmer zu rufen, und anfing, weniger ein Dämon als ein genialer Informatikstudent und eine außerordentlich großzügige Gestalt zu werden, die allen und jedem seine Notizen überließ und deren stumpfe Züge auf ihrem großen runden Kopf zu einem Eindruck von Gediegenheit und Wärme zusammenschmolzen –, auch Monate danach öffnete ich die Tür zu meinem Zimmer und rechnete halb mit dem Anblick von Virendras dünnem Körper, der schlaff vom Deckenventilator baumelte.
Selbstmorde waren an den IITs etwas Alltägliches. Wie sich herausstellte, gehörte Virendra zu denen, für die Demütigung ein teurer Luxus war. Wenn ich die Tür zu seinem vermeintlichen Leichnam öffnete, fand ich ihn stattdessen meist an seinem Schreibtisch, gebeugt über seine Hausarbeit zu Produktionsverfahren, über GRE-Übungstests oder ein Exemplar der Competition Success Review, unter dem girlandengeschmückten Wandporträt von Hanuman mit der aufgerissenen Brust.
Sein Gesicht wirkte strenger, sogar starrsinnig, als hätte sich das Gewicht seines unpersönlichen Willens zum Erfolg noch heftiger darin abgesetzt.
Viel länger als wir anderen hatte er Nachhilfeunterricht für die Aufnahmeprüfungen am IIT genommen. Er hatte nur knapp bestanden und bemühte sich hartnäckig jedes Semester, seinen Notendurchschnitt zu verbessern; er hielt seinen Stift in der geballten Faust und bohrte ihn ins Papier, als wäre er eine Waffe in einem Krieg, in dem es für den Verlierer kein Erbarmen gab und in dem ein Versagen der Verbannung nach Hause gleichkam: das Zimmer im Basti, wo junge Schweine und räudige Hunde an Müllbergen kauen und sich knochendürre schwarze Schafe gegen eine rostige Wasserpumpe reiben.
Mit dieser entschlossenen Haltung saß er im Schneidersitz auf dem Boden und ließ eine Bürste über seine Schuhe sausen, massierte seine Kopfhaut mit Kokosnussöl, wobei er in einer Hand seinen rautenförmigen Spiegel hielt (der nach ein paar Monaten zerbrach und seinen Kopf in ungleiche Hälften teilte), oder er schrubbte sich in der Dusche den Oberkörper mit Lifebuoy-Seife ab; derartig entschlossen machte er sich in einem Seminar nach dem anderen Notizen und las, auf der Seite liegend, das Manorama Yearbook, während er sich in dem feuchten Raum ab und an seine Frostbeulen rieb.
Die kleinen Freuden der meisten Studenten – Rockbands, Carrom- und Pingpongturniere, Debattier- und Quizwettbewerbe, Mädchenbeobachten bei SPIC-MACAY-Konzerten und im Priya-Kino – interessierten ihn nicht das Geringste. Abgelenkt war er einzig und allein durch die alte Playboy-Ausgabe mit Kim Basinger auf dem Cover, die er eines Abends, von Bettwanzen belästigt, unter seiner Matratze fand, wo Aseem sie versteckt hatte.
Zwei
Ein Jahr verging. Das Wohnheim füllte sich im neuen Semester zunächst mit Studienanfängern, die durch die anfänglichen Früchte ihrer Plackerei beunruhigt aussahen, und anschließend mit den Geräuschen ihrer Initiation: übertriebene Schreie der Beleidigung, Chöre von Selbstspott sowie Gekreische von Ausgelassenheit und Schmerz.
Virendra und Aseem hatten verschiedene Zimmer zugeteilt bekommen, doch wir waren alle im selben Flügel untergebracht, und als ich eines Tages an Virendras Zimmer und dem vertrauten Duft von Kokosnussöl vorbeikam, sah ich eine schwankende Pyramide nackter junger Männer. Virendra trug sein Sandoz-Unterhemd und lag auf seinem Bett, der Druck von Hanuman über ihm, die Hände im Nacken verschränkt und mit den Zehen wackelnd.
In all den Monaten hatte ich Virendra nie lächeln sehen, und jetzt war ich erstaunt darüber, wie unbekümmert er seinen Frohsinn zum Ausdruck brachte. Er warf den Kopf zurück, während die Spitzen seiner glänzenden schwarzen Schuhe unter seinem Bett hervorlugten, und er kicherte und kicherte bei jedem Schwanken der nackten Körper.
Als der schwerfällige Stapel von Akrobaten in einem Gewühl aus Armen und Beinen zusammenbrach, schien ihm eine Welle der Schadenfreude die Kehle zuzuschnüren; er hielt sich den Hals, als müsste er würgen.
Später an diesem Nachmittag sah ich Virendra den Korridor entlanggehen, seine Augen noch glasig von der Anstrengung des Lernens, mit dem Playboy in der Hand und der aufgerollten Kim Basinger darinnen. Ich war auf dem Rückweg von der Toilette und wusste, dass er sich zum Höhepunkt bringen musste, bevor er von dem Geruch von Phenol und dem Anblick von Exkrementen überwältigt werden würde – Kackhaufen, die von anderen Studenten, die an heimische Hocklatrinen gewöhnt waren, beim falschen Zielen versehentlich auf den Toilettensitzen hinterlassen worden waren.
Ich hatte mich von Virendra fernhalten wollen, als er zum Opfer wurde; ich empfand Abneigung gegen ihn, als er den Willen zur Macht entdeckte. Um dies zu vermeiden, musste ich lernen, sein Lachen zu ignorieren, das, wenn man ihm ganz nah war, verriet, dass einige seiner Backenzähne gezogen worden waren; ich musste lernen, mir seinen Retro-Schnurrbart und sein geöltes Haar anzusehen.
Es war nicht leicht. Ich versuchte ja gerade, die Selbsterkenntnis, die er hervorrief, zu unterdrücken.
Letztes Jahr sagtest du in London: »Ich bin so gerührt von Virendra. Trotz allem. Er ist der sympathischste aller IIT-Leute, über die ich in meinem Buch schreibe.« Ich erinnere mich, dass du trotz deiner Bemühungen etwas Entscheidendes über unser Leben übersehen hattest: wie sich die uns zugefügten Erniedrigungen unsichtbar in unseren Charakteren abgezeichnet und unterschiedliche Leidenschaften gesät haben: den Traum von weltlichem Ruhm ebenso wie den Wunsch, sich vor der Welt zu verstecken.
Du warst gerade von einem Gespräch mit Virendra in seiner Justizvollzugsanstalt in Massachusetts zurückgekehrt. »Er erzählte mir«, so sagtest du, »wie furchtbar er von seinen Gefängniswärtern behandelt wurde. Trotzdem war er so freundlich, so geduldig, so großzügig mit seiner Zeit. Er schenkte mir all diese kleinen Details, die mir helfen, eine Geschichte zu erzählen.«
Du erwähntest einige dieser Details, die du in deinem Buch, deiner »geheimen Geschichte der Globalisierung«, verwenden würdest, und ich hörte nach vielen Jahren wieder den Namen (Brillant!) des besten Korrespondenz-Tutoriums, das es fürs IIT-JEE in den 1980er Jahren gab. Nach so vielen Jahren erinnerte ich mich wieder an den winzigen Schreibwarenladen mit den zerbrochenen Glasvitrinen in Delhi, in dem die meisten Studienmaterialien von einem stämmigen Mann in einem schmutzigen Baniyan mit schlaffen Armen illegal fotokopiert wurden, und an das Nachhilfeinstitut Agrawal Study Circle, an das junge Männer im Teenageralter aus ganz Bihar und Uttar Pradesh von ihren ängstlichen Eltern geschickt wurden.
»Virendra hat mir sogar all diese Abkürzungen erklärt, mit denen er aufgewachsen ist, und er hat mir geduldig all jene buchstabiert, die ich nicht kannte«, sagtest du.
Ich erschauderte innerlich, als ich wieder die Abkürzungen hörte, die unsere Jugend tyrannisiert hatten: IIT-JEE, CGPA, DR, IIM, CAT, IMS, GRE, GMAT. Und wie seltsam war es, als S. L. Loneys Plane Trigonometry und The Elements of Coordinate Geometry sowie Igor Irodovs Problems in General Physics – die Bibel und Bhagavad Gita aller IIT-Aspiranten – eines Morgens in London in einer Amazon-Kiste auftauchten.
Du lachtest, als ich, während du andere Bücher auspacktest, sagte: »Wirst du dir ernsthaft Resnick, Halliday und Walker, Sears und Zemansky antun?«
Wie sich herausstellte, hast du das nicht getan, doch du hast alles gelesen, was du über unseren Gott in die Finger bekommen konntest: Rajat Gupta, Absolvent des IIT Delhi, erster im Ausland geborener Geschäftsführer von McKinsey & Company und Vorbild vieler Studierender in den USA. Du hast unsere Lehrkräfte am IIT interviewt – diese wunderbaren Männer und Frauen, die uns erstaunlicherweise mit Respekt begegneten und uns nach diesen ersten Nächten das Gefühl gaben, zu den Auserwählten des Landes zu gehören. Du hast die langen Abschriften der Gespräche zwischen Siva, Virendra und anderen Finanzgenies unserer Generation am IIT gelesen; du bist zu ihren Arbeitsplätzen und Spielplätzen gereist, von New York bis in die Toskana und nach Kalimantan. Du hast jene interviewt, denen sie während ihres Strebens nach Reichtum und Sex begegnet sind, und du hast Evernote-Dateien und Dropbox-Ordner sowie mehrere Pappordner mit Gesprächsnotizen, Zeitungsberichten, eingescannten Kontoauszügen und heruntergeladenen Videos gefüllt.
Selbst Aseem, der immer mit äußerster, selbstkritischer Strenge andere Schreibende beurteilte, meinte einmal: »Ich habe keine Ahnung, ob Alia schreiben kann, aber sie ist eine großartige Forscherin.«
Durch einen Twitter-Feed, der täglich mit raffinierten Drohungen überschäumte, wusstest du darüber hinaus von einem noch größeren Zusammenbruch. »Es gibt eine ganze Generation, vielleicht sogar zwei, von abgefuckten Männern in Indien«, sagtest du. »Menschen ohne moralischen Kompass.«
Ich denke mittlerweile, dass dies unbestreitbar ist – die Freiheit bedeutete für zu viele Männer wie uns eine Entwürdigung der Werte und Ideale, die das Leben der meisten Menschen bestimmen. Seit ich dich kennengelernt habe, habe ich so viel über die Grausamkeiten und die Unterdrückungen in einer Welt gelernt, die noch immer und heimtückischer als jemals zuvor eine Männerwelt ist.
Doch so wie meine unreflektierte Männlichkeit das Erkennen einiger lebenswichtiger Wahrheiten verhinderte, so machten es dir deine nebenbei ererbten Vorteile von Abstammung, Klasse und Reichtum unmöglich, die eigentümliche Panik und Inkohärenz von Selfmademännern zu erkennen; wie sie ihr Leben in permanenter Angst vor Zusammenbruch und Bloßstellung verbringen.
Die Geschichte, die du in deinem Buch erzählen wolltest, hätte vervollständigt werden können durch eine Betrachtung der Umstände, die uns geprägt hatten. Du warst dir nicht sicher, ob unsere Erfahrungen vor dem IIT irgendetwas erklären würden. »Es ist so amerikanisch«, sagtest du einmal, »diese Obsession mit der persönlichen Geschichte, diese Vorstellung, dass sie tatsächlich erklären kann, wer man ist und was man getan hat, als ob wir nicht die Möglichkeit hätten, uns davon zu befreien.«
Nach allem, was geschehen ist, nach all den Entscheidungen, die ich getroffen habe, kann ich deine Ambivalenz nur teilen, deinen Unwillen, das Prinzip des freien Willens aufzugeben. Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht geradeso schuldig wie Aseem und Virendra.
Ich muss dennoch über die Umstände und die Muster unseres heutigen Lebens schreiben – ich muss es auf Umwegen tun, denn Umwege sind die einzigen Pfade zur Wahrheit. In gewissem Sinne ist dies das Memoir, zu dem du mich einst gedrängt hattest, eine Fortsetzung deines eigenen Kampfes, Männer wie Virendra zu verstehen. Viele der Enthüllungen verdanke ich dir: All das, was ich nicht sehen konnte, bis ich dich traf, und obwohl es zu spät kommt und du es vielleicht nicht lesen willst, werde ich womöglich – wie damals, als ich mit dir zusammen war – etwas erfahren über die Teile meines Selbst, die ich ignoriert oder verdrängt habe, über all das, was tief in mir verschüttet liegt, was ich nicht verstehe, wovor ich mich aber immer gefürchtet habe.
Du kamst in unser Leben, lange nachdem wir es geschafft hatten, uns zu verkleiden. »Schau niemals zurück«, sagte Aseem häufig, »schau immer nach vorn und nimm dein Leben selbst in die Hand, lass' nicht zu, dass es von der Vergangenheit bestimmt wird.«
Dann zitierte er aus dem Roman An der Biegung des großen Flusses über die Notwendigkeit, »auf der Vergangenheit herumzutrampeln«, und die relative Leichtigkeit, mit der diese kreative Zerstörung erreicht werden kann: »Am Anfang«, so zitierte er Naipauls Zeilen aus dem Gedächtnis, »ist es, als würdest du einen Garten zertrampeln. Zuletzt ist es einfach nur noch der Boden, auf dem du gehst.«
Schon sehr früh gingen wir uns selbst verloren, und wir vermieden es, uns vollständig unserer Erfahrung zu stellen, ja, wir versteckten uns sogar vor ihr. Virendra sprach nie über seine frühen Jahre, und über eine lange Zeit wich Aseem mehr oder minder aus demselben Grund vor dem Thema zurück: Die Brandwunden, die ihm damals zugefügt worden waren, waren nie richtig verheilt, und nur ein Masochist hätte sie freiwillig wieder aufgerissen.
Erst vor kurzem begann er, offen über seine niedere Herkunft zu sprechen, nachdem Narendra Modi 2014 triumphierend seine grausamen Beschränkungen und Entbehrungen – und die von Hunderten Millionen verletzter und beleidigter indischer Menschen – gegen die übermäßigen Ansprüche der englischsprachigen Elite aufrechnete. Von Modi lernte Aseem, dass die Schande, schwach und unkultiviert geboren und in Scham aufgewachsen zu sein, ab sofort der Vergangenheit angehörte und dass man in der in Indien entstehenden Leistungsgesellschaft seine halb ländlichen und von niederer Kaste oder niederer Klasse geprägten Anfänge ebenso gewinnbringend publikmachen konnte, wie es die Selfmademen der USA taten, wenn es um ihre Herkunft aus Blockhütten, Erdnussfarmen und osteuropäischen Schtetls ging.
Wenn ich jetzt auf unsere Verunstaltungen zurückblicke, kann ich jedoch zumindest eine ihrer Ursachen erkennen: den verzweifelten Wunsch, einer schmachvollen Vergangenheit zu entfliehen, die immer bedrohlich zu Hause darauf zu warten schien, uns zurückzuerlangen.
Zwei Jahre lang, bevor ich am IIT angenommen wurde und mein Elternhaus für immer verließ, besuchte ich Tutorien in Delhi. Wie Aseem und Virendra fuhr ich immer mit einer wachsenden Furcht vor dem, was mich zu Hause erwarten würde, zurück.
Wie quälend lebendig sind doch diese Szenen aus den 1980er Jahren, in denen ich einige Indizien für unser späteres Verhalten ausmachen kann. Der Zug vom Bahnhof in Old Delhi, der starrsinnig durch die Ebenen von Punjab und Haryana raucht und schleift, erreicht Deoli gegen fünf Uhr morgens. Enge, dachlose Bahnsteige rauschen die ganze Nacht an den Fenstern meines nicht reservierten Sitzplatzes in der dritten Klasse vorüber, während der Wind durch die Gitterstäbe Kohlenstaub in mein Haar bläst. Wenn der Zug anhält, sehe ich einen schwach beleuchteten Bahnsteig, auf dem sich Kulis herumtreiben, immer zu zweit, immer bereit, den seltenen Aussteiger zu bedrängen, immer bereit, ihre Schals zu einem schneckenförmigen Polster auf ihrem Kopf zusammenzurollen und auf diesem improvisierten Kissen einen metallenen Koffer entgegenzunehmen, bevor sie in die Nacht davontrippeln.
Von irgendwoher kommt das Klappern eines eisernen Wagens, das Klirrkirren und Dong-dong eines Hammers, mit dessen Schlägen Räder geprüft werden. Menschen ziehen wie Schatten am Fenster vorbei und verschwinden für immer. Einer von ihnen dreht sich leicht um, aber nur, um einen gewaltigen Schwall Paansaft auf den Boden zu spucken.
Dann schlingert der Wagen mit zahlreichen Zischlauten los, vorbei am Bahnwärter, der eine Laterne in die Höhe streckt und dessen Gesicht in dem zitternden grünen Schein etwas Teuflisches besitzt, und vorbei an einem kleinen Flachbau, in dem sich eine Reihe von Hebeln befinden. Beim Gleiswechsel schaukelt es sanft unter mir, die wenigen Lichter erlöschen, und die ausgedehnte Nacht vor meinem Fenster nimmt wieder ihren Lauf – wenn auch nicht lange.
Ich sitze auf einer Holzbank mit gerader Rückenlehne, eingekeilt zwischen mehreren Leuten, und gegenüber sitzt eine ähnlich angespannte Reihe von Menschen mit gesenkten Köpfen, die sich ruckartig erheben, nur um wieder langsam zu sinken. In der Schlafkoje über mir entblößt das fahlgelbliche Licht der Lampen ein Gewimmel halb schlummernder Körper mit aufgerissenen Mündern wie Fische.
Manchmal nicke ich weg, doch der Zug pfeift mit durchdringender Melancholie, stottert über einen Bahnübergang, röhrt in einen lauten Tunnel, während die Metallfensterläden in ihrem Rahmen klappern oder der zusammengekauerte Mann neben mir mit seiner großen, kräftigen Nase, der leise schnarcht und einen strengen Schweißgeruch verströmt, plötzlich auf meinen Schoß sackt.
Mein ganzer Körper verkrampft sich. Ich möchte so gerne meine Beine ausstrecken und meine Füße irgendwo hochlegen; und in diesem Zustand der Unbeweglichkeit bin ich mir ganz sicher, dass das Glück für mich immer ein unerreichbares Ziel bleiben wird.
Deoli hat keinen nennenswerten Rangierbahnhof, nur ein paar sich selbst überlassene Waggons und Lokomotiven aus verbeultem Eisen auf ein paar Abstellgleisen. Es gibt einen einzigen Bahnsteig mit einem kleinen Dach, unter dem ein steinernes Gebäude steht, das mit weißen und braunen Streifen angestrichen ist; es beherbergt das Büro des Stationsvorstehers sowie einen Verkaufsstand, an dem mein Vater Tee, Samosas, geschnittenes Weißbrot, Kekse, hartgekochte Eier, Paan und Zigaretten verkauft.
Bei Tagesanbruch schlafen überall Männer und Frauen auf dem paanfleckigen Boden, von Kopf bis Fuß sind sie in Weiß gehüllt, der weiße Stoff ist immer schockierend, die Farbe des Todes und der Trauer, und sie liegen unter eilig drehenden, niedrigen Deckenventilatoren.
Stell dir vor, wie ich an diesem Zufluchtsort der Mittellosen aussteige, zwischen den anonymen weißen Bündeln hindurchgehe, vorbei an den Hunden, die zu wachen und zu stöhnen beginnen, durch einen schlammigen Vorplatz mit zweirädrigen Tongas, Fahrradrikschas und Ochsenkarren, einem offenen Abfallberg, den streunende Kühe zaghaft plündern, während sie ab und zu einen Huf bewegen und mit ihrem Fell zucken, bevor ich über einen schmalen Sandweg verschwinde.
Hier stehen die Baracken der Eisenbahner, ihre Wände sind mit getrockneten Kuhfladen übersät, und in den schmalen Vorhöfen vor jedem Zimmer liegen zerbrochene Möbelstücke verstreut. Unter den beladenen Wäscheleinen – gekreuzigte Hemden mit durchnässten Ärmeln, Pythonschlangen aus zerknitterten, ausgewrungenen Saris – scharren hagere Hühner in der Erde; und nur die gelegentliche Reihe von indischem Basilikum in alten Dalda-Blechdosen zeugt von einem Gefühl der Ordnung und der Eitelkeit des Besitzes.
Um diese Zeit erheben sich die Kochfeuer der Angithi-Öfen in schmalen Säulen in den blauen Himmel. In unserem eigenen kleinen Hof steht eine kauende Kuh unter einem groben, strohgedeckten Verschlag und über einem frischen Fladen, der von granatgrünen Fliegen umschwirrt ist. Sie ist fest an einen Eisenpfahl angeleint, so dass sie weder das kleine Kohl- und Tomatenbeet erreichen kann, das meine Mutter pflegt, noch den schwarzen Topf über dem Kohlebecken, in dem sie jeden Morgen und Nachmittag das Essen zubereitet, während sie auf der winzigen Veranda hockt, die durch den Dachüberstand gebildet wird, wobei das lose Ende ihres Sari auf dem Boden hängt.
Unser Haus ist ein kleines Kothri mit beigefarbenen Wänden und zwei hohen, schmalen Fenstern, die unbarmherzig auf den Hof blicken. Es gibt keine Möbel außer einer Eisentruhe in einer Ecke und einem Stapel Matratzen aus groben Kokosfasern auf dem roten Betonboden. In eine Wand sind grün gestrichene Regale eingelassen, auf denen Emaillebecher, Stahlteller und vier Porzellantassen stehen.
Auf dem weißen Geschirr ist ein Monogramm mit einer Dampflokomotive abgebildet, das Indiens nationales Motto Satyamev Jayate (Allein die Wahrheit siegt) verkündet; es ist der einzige Luxusgegenstand im Raum und wird sorgfältig aufbewahrt, da es zu Beginn der Karriere meines Vaters von der indischen Eisenbahngesellschaft Indian Railways gestohlen wurde.
Neben den Regalen hängt ein gewebter Sack an einem Nagel an der Wand. In einer Ecke steht ein kupfernes Waschbecken, darunter ein kurzstieliger Besen. Staub haftet an allen Türleisten; die Flügel des Ventilators, der an einem Haken im nackten verzinkten Dach hängt, sind staubergraut, das Dach selbst ist rußflauschig schwarz. Die Wände werden nach jeder Monsunzeit grüner und schimmliger, und im Winter ist der Raum geradeso kühl und feucht, wie er im Sommer warm und feucht ist.
In diesem Kothri, in dem ich scheinbar eine Ewigkeit gelebt habe, ist es unmöglich, sich eine andere Zukunft für mich vorzustellen. Jeden Tag nach dem Abendessen werden drei Matratzen auf dem Boden ausgebreitet, auf denen wir zu viert schlafen, und in der Nacht ist es unmöglich, sich im Raum zu bewegen, ohne auf eine liegende Figur zu treten oder über ihren Körper zu stolpern. Man muss sorgfältig nach einem freien Platz suchen, und wenn man einen Fuß in die Lücke gesetzt hat, muss man einen Platz für den anderen finden.
Die Topographie meines Viertels fühlt sich ebenso beengend an. Am Ende der Gasse befindet sich ein weißer Shiva-Tempel vor einem verstaubten Niembaum, ein kleiner Schrein mit einem Lingam in der Mitte eines Lotos aus Beton, in gelbe Seide gehüllt, die immer feucht ist und schwarz mit Fliegen und Ameisen. Hier lebt eine zwiespältige Figur aus meiner Kindheit, ein Pujari mit grauem, stoppeligem Gesicht, der von Kopf bis Fuß in Safran gekleidet ist und auf dem Kopf eine Art Narrenkappe mit Klappen über den Ohren trägt.
Als ich zwölf war, lud mich dieser Priester einmal in den Schrein ein, um mir eine zuckrige Opferspeise mit Batashas zu geben, und ich stellte fest, dass er mit unbedecktem Kopf noch bedrohlicher aussah. Er hatte seine Mütze abgenommen, als er sich vor mich kniete und begann, meinen Penis zu reiben, und mit der Sandelholzpaste von seiner Stirn in der Nase, betrachtete ich sein pompöses Kastenabzeichen, das brahmanische chutki, ein langes, ungeschnittenes, ölfeuchtes Haarbüschel auf der Rückseite seiner glänzenden Glatze.
Nebenbei arbeitet er als Transporteur von schwerem Gepäck, und er besitzt einen Esel, den er erbarmungslos mit einer Latte züchtigt, wenn das Tier sich weigert, ihm zu folgen. Die Schläge auf die nackten Rippen und Schienbeine klingen hart und trocken, die Latte prallt an den Knochen des Esels ab, und das Tier krümmt sich oft heftig unter den Hieben. Der Priester hechelt laut zwischen einzelnen Schlägen, die er rhythmisch mit zusammengebissenen Zähnen austeilt, und am Ende, wenn sich der Esel mit einem gleichgültigen Schnauben wieder aufrichtet, wirkt der Priester von der einfachen Sturheit und Widerstandsfähigkeit seines Tieres nahezu überfordert.
Es sei seine Pflicht, sagt er mir häufig, während er sich an seinem Bart kratzt, mein Lingam so groß wie den von Shiva werden zu lassen. Gewöhnlich fliehe ich nach dem verwirrend ekstatischen und vage beschmutzenden Akt im feuchten Schatten des Lingams zu einem Nullah; und ich lerne den schmalen, zerfurchten Pfad zum Graben auswendig, der entlang schwarzer Schienen verläuft, durch Flecken verbrannten hohen Grases und sich lautlos wiegender Farne, ordentlicher kleiner Pyramiden aus spurlosem weißen Stein und Telegraphenmasten, deren Holz in gräulichen Streifen abblättert.
Ich kann mich noch gut an das flaue Gefühl in meiner Brust erinnern, als ich vorsichtig zum Wasser hinunterstieg und über verblichene Kotklumpen sprang, bis ich unten am kiesigen, schmalen Ufer angelangt war, wo die Strudel dunkle Tiefen andeuteten.
Die einzige befestigte Straße in der Gegend, ein dünner Asphaltstreifen zwischen zwei Erdpfaden, die von den Rädern der Ochsenkarren zu feinem, dickem Staub zermahlen wurden, führt zu meiner alten Grundschule. In diesem kleinen Dreizimmergebäude aus unverputztem Backstein untersuchen zwei Lehrkräfte in makellosem Khadi jeden Morgen die Haare der Schüler auf Läuse, wobei sie bei den beiden Dalits unter uns Lineale statt ihrer Finger verwenden, bevor sie sie mit ihren schwarzen Schiefertafeln und der Kreide auf dem roten Lehmboden sitzen lassen.
Ein paar hundert Meter weiter diesen unebenen schwarzen Weg durch den Staub entlang, vorbei an Holzkarren mit frisch geschnittenem Zuckerrohr und einer Maschine, die den Saft in dicke, grauschlierige Gläser abfüllt, liegt eine weiße bis ockerfarbene Stadt mit engen Gassen, schwarzen, offenen Abflussrohren und noch viel mehr Pariahunden, die so oft getreten und gesteinigt werden, dass sie mit eingezogenen Schwänzen selbst vor den wenigen Menschen davonlaufen, die etwas zu fressen für sie haben.
In der Stadt gibt es Geschäfte, ein Kino, mehrere Tempel und sogar eine Moschee, deren Marmorintarsien von Plünderern aus den Wänden gebrochen wurden und deren rosafarbene Sandsteinkuppel vom Taubendreck befleckt ist. Aus diesem unförmigen Sammelsurium ertönen gelegentlich die nasalen Rufe des Mawlawi sowie blecherne, spöttische Trompetenstöße bei Hochzeitsfeiern und der Klang eines Lautsprechers: ein Tongawallah, der die Attraktionen des einzigen Kinos der Stadt ankündigt.
Das Getrappel der Hufe nähert sich, ich höre das Schlagen einer Peitsche auf Fell, und ich gehe hinaus, um die protzbunt bemalten Plakate zu sehen, die über die Tonga drapiert sind: Bilder von Männern mit langen Koteletten und gebleckten Zähnen, die einander mit überdimensionalen Gewehren bedrohen, im Hintergrund explodierende Wolkenkratzer, und Frauen in ärmellosen Kleidern und geschlitzten Röcken oder den knappsten weißen Saris, die unter Wasserfällen ihre Schultern und Arme und – manchmal noch gewagter – ihre Beine entblößen.
Wir, die wir nur eine Generation von den langen Jahrhunderten der Landwirtschaft entfernt sind, leben von der Erde und sind wegen des kargen Einkommens gezwungen, auf eine Art und Weise zu existieren, die man heute als ökologisch sinnvoll bezeichnen würde. Gemüse, das nicht im Hof angebaut wird, kauft man im örtlichen Mandi, in Tüten, die aus Hindi-Zeitungen gefaltet wurden und deren Knitter ich immer glätte, um sie zu lesen, wobei ich sie umständlich umdrehen muss, um die Worte des verschmierten Drucks zu entziffern. Die Kühe im Hof liefern Milch, Käse, Butter, Ghee, Quark und Dung; sie verzehren Gemüseschalen und Essensreste.
Die Mahlzeiten sind immer biologisch, da Düngemittel unerschwinglich sind, und sie sind frisch gekocht, denn es gibt keinen Kühlschrank. In Delhi bin ich auf Vicco Vajradanti umgestiegen, doch zu Hause sind die Zahnbürsten immer noch aus Zweigen des Niembaums oder des Hibiskus gemacht, man bricht sie ab, zerdrückt eines der Enden und reibt sich damit über die Zähne; schließlich spaltet man den Zweig und schabt sich mit den Hälften die Zunge ab. Der Angeethi-Ofen ist mit Holzkohle gefüllt, die vom Bahnhof gestohlen wurde; Geschirr und Besteck werden nach Benutzung mit Asche abgeschrubbt. Das Wasser, das in Kupfereimern von einer nahegelegenen Handpumpe geholt wird, ist streng rationiert; dennoch verwandeln die Eimerbäder und der Abwasch unter freiem Himmel den Hof in eine matschige, grauschwarze Sauerei.
Ich muss mich baden, um mir den feinen Kohlenstaub und den Geruch von verbrannter Kohle aus dem Haar und von der Haut zu schrubben. Doch ich bin froh, dass ich die Toilette im Zug benutzt habe, mich durch den überfüllten Waggon gezwängt habe, um mich über ein dreckiges, brüllendes Loch im Boden zu hocken. Denn die Gemeinschaftslatrine in dem Wachhäuschen hinter den Eisenbahnhäusern ist ein viel zu grausamer und umfassender Angriff auf die Sinne, so dass wir uns immer unter freiem Himmel am Ufer des Nullahs erleichtern müssen, in der Nähe der kleinen Strudel, in denen das schwarze Wasser, wenn man ganz genau hinsieht, plötzlich zum Leben erwacht und vor Schwärmen kleiner Fische brodelt.
Frühmorgens nehmen wir den kürzesten Weg zum Nullah, gehen mit gestohlenen Thums-Up-Cola-Flaschen in der Hand zwischen den Gleisen entlang, durch einen Wust aus Exkrementen, weggeworfenen Einwegtellern aus Blättern und zerbrochenen Tonbechern, und wir erschrecken die Ratten, rosafarbene enthaarte Kreaturen, die sich um den Abfall gestritten haben und beim ersten Geräusch unserer Füße die Holzschwellen hinunterhumpeln, dorthin, wo sich die schwarzen Streifen der Schiene in Richtung einer fernen Brücke verengen.
Direkt unter dieser Brücke über den Nullah befindet sich ein unbefestigter Weg und die Stelle, an der wir zwischen fünf Uhr dreißig und sechs Uhr morgens, wenn keine Züge fahren, pflichtbewusst in die Hocke gehen. Es sei denn, sie haben Verspätung. In diesem Fall halten wir uns fest, wenn der Zug mit einem hohlen Klappern und einem starken Windstoß über uns hinwegrauscht, und ziehen die Köpfe ein, während die vorbeifahrenden Waggons sanft Staub gegen unsere entblößten Genitalien blasen.
Früh am Morgen riecht es bei mir zu Hause nach Agarbatti – noch Jahrzehnte später reichte der entfernteste Hauch von Sandelholz aus, um mich stillschweigend in die Tiefen meiner Vergangenheit zurückzutragen. Meine Mutter ist wie immer seit vier Uhr morgens auf den Beinen und verbeugt sich vor den bunten, gerahmten Postkartenabzügen von Rama, Krishna und Hanuman in einer Ecke des Zimmers, ihr vorzeitig ergrautes Haar ist mit dem Ende ihres Saris bedeckt; sie ist eine Figur, die eher von trauriger Unterwerfung zeugt als von Frömmigkeit.
Später am Morgen, nachdem sie den Angeethi angezündet hat, liest sie laut aus Ram Charit Manas vor, ein in dunkelbraunes Khadi eingewickeltes Buch der Gita Press, und obwohl sie vieles darin nicht versteht, rührt Tulsis Lobpreisung von Ramas Tugend, Sitas Treue und Hanumans Hingabe sie zu Tränen, und ihr halb verborgenes Gesicht erstrahlt vor Zärtlichkeit.
Meena, meine kleine Schwester, sitzt bei ihr und wiegt sich hin und her. Sie trägt eine rote Schleife in ihrem langen Haar und einen verblichenen Salwar Kamiz. Meena ist zehn Jahre alt, für ihr Alter aber sehr klein und schmächtig: Sie sieht aus, als wäre sie höchstens sieben, und mit zwölf würde sie nicht mehr weiterwachsen. Wie ihre Mutter ist auch sie selten unbeschäftigt.
Bald wird sie zur Handpumpe am Bahnhof hinuntergehen, in jeder Hand schwingt dann gemächlich ein Eimer, um sich dort zwischen unflätigen Männern und Frauen durchzudrängeln; sie wird zurückkommen, das Wasser plätschert in den Eimern, die dünnen Arme hängen lang und steif an ihrer Seite herunter. Sie schrubbt und scheuert die Kochtöpfe mit Asche und schlägt sie gegen den Boden; sie melkt die Kuh und zerrt dabei mit überraschender Heftigkeit an ihren Eutern; sie fragt mich, ob ich schmutzige Wäsche für sie habe, und schrubbt energisch den nicht zu entfernenden Schmutzring im Innern meines Hemdkragens (ein Kampf, von dem ich weiß, dass er nur zum Ausfransen führen wird), und erhebt sie sich aus ihrer Hocke, klebt ihr jedes Mal eine Haarsträhne an der Stirn.
In ihrer Freizeit näht sie Leinensäcke für den Laden meines Vaters, ihre Hände sausen dabei flink über ihrem Schoß auf und ab, doch ihr gebeugter Hals, ihre Augen, Augenbrauen und Lippen sind dabei völlig beruhigt durch die eintönige Tätigkeit. Sehr selten hebt sie den Kopf, um ihren Nacken auszuruhen, dann blickt sie ausdruckslos ins Leere, blinzelt und beugt sich erneut über den Sack.
Sie wird meiner Mutter ähnlicher. Vom ständigen Waschen und Putzen hat sie dieselben weißen und abgehärmten Finger. Sie fürchtet sich vor allem und hat den plötzlichen und unstillbaren Drang, sich zu verstecken und zu weinen.
Du sagtest einmal: »Der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Männer und Frauen die Welt erleben, ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht«, und diese Worte schienen mir sofort eine unumstößliche Wahrheit auszudrücken. Wie sich jedoch herausstellte, meintest du etwas anderes, als ich angenommen hatte.
Du sprachst von der Art und Weise, wie Frauen im öffentlichen Raum mit der Furcht vor Männern leben, mit der Sorge, dass ihre bloße Anwesenheit auf der Straße, in Geschäften und Büros ein lüsternes Interesse wecken könnte. Daran hatte ich noch nie gedacht, und meine Unwissenheit über eine alltägliche Erfahrung von Frauen verdeutlichte nur noch deinen Standpunkt.
Doch ich hatte die Frauen im Sinn, die zu Hause blieben und den Tag buchstäblich im Dunkeln verbrachten, in lichtlosen Küchen, während ihre Männer das Haus verließen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich hatte im Sinn gehabt, wie unveränderlich unsere Großmütter und Mütter im Schatten anderer Menschenleben existierten und starben; wie ungebrochen die Trance der Knechtschaft war, in der sie ihr eigenes Gefühl von Bescheidenheit in einer großen, gleichgültigen Welt an ihre Töchter weitergaben.
Der Absturz meiner Mutter begann schon mit neun Jahren, als ihr Vater bei einem Unfall ums Leben kam; mit der Heirat meines Vaters im Alter von 16 Jahren wurde sie von neuen Schrecken umschnürt. Die Elendskarriere meiner Schwester begann sogar noch früher, nämlich mit dem Bewusstsein, dass sie überhaupt einen Vater hatte; nach ihrer frühen Heirat mit einem Mann, der ihr schnell hintereinander vier Kinder aufzwingt, wird es unmöglich, alledem zu entkommen, während er zu einem hoffnungslosen Trinker verkommt, zu einem nikamma und muft khor, einem Verschwender und Schmarotzer, um es mit Babas Lieblingsworten zu sagen.
Als ich ankomme, putzt sich Baba gerade die Zähne. Der Zweig steckt noch in seinem Mund, und er nickt beiläufig. Was gibt es zu sagen? Meine Mutter und meine Schwester blicken kaum von ihrem Tablett mit nackten Kartoffeln und Schalenspiralen auf. Tatsächlich sprechen wir nicht viel miteinander, und zwischen meinem Vater und meiner Mutter vergehen Wochen ohne größere Unterhaltungen.
In diesem stillen Haus stammen die Geräusche von anderswo: das bedächtige Wiehern der Kühe, das gleichmäßige Plopp-Plopp, wenn sie ihren Mist fallen lassen, laute, schimpfende Männerstimmen, Schreien und Schluchzen, wenn Kinder ausgepeitscht und Ehefrauen geschlagen werden, Türen aus Wellblech, die auf Betonschwellen schrappen, bevor sie zugestoßen werden, das dumpfe Donnern vorbeifahrender Güterzüge, das Schnäuzen von Nasen oder das Dudeln von Transistorradios, das drosselnde Quieken und Knarren, bis sie eingestellt sind, und zwar alle auf denselben Sender: All India Radio am Morgen, Vividh Bharati am Nachmittag und am Abend Radio Ceylon, das von einer düsteren Baritonstimme zu fröhlichem Gesang wechselt.
Die Stimmen von nebenan klingen immer bedrohlich. Die Nachbarin ist eine alte Frau, die Mutter eines Arbeiters, der oft unterwegs ist, um die Wagen der Permanent Way Inspectors zu schieben, seine nackten Füße bewegen sich flink über die glühend heißen schwarzen Schienen. Die Frau murmelt die ganze Zeit vor sich hin und malt sich Szenarien aus, in denen sie betrogen oder ausgeraubt wird.
Am häufigsten ist unsere Kuh in diese Szenarien verwickelt, die sich in ihr Gemüsebeet verirrt, woraufhin die Frau mit einem langen Stock hinausgestürmt kommt, dann knochig und zahnlos herumsteht, während ihr kurzes graues Haar im Wind flattert, und eine halbe Stunde lang obszön vor sich hinflucht, laut genug, um die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen.
Einmal kam Baba aus unserem Zimmer und schrie zurück: »Kya bol rahi hai, beizzat aurat, yeh kaisi bhasha hai? Was sagst du da, du schamloses Weib? Was sollen diese Ausdrücke?«
Plötzlich wirkte sie verwirrt, als verstünde sie nicht, was an ihrer Wortwahl anstößig gewesen war. Ihr Anblick schien meinem Vater die Luft zu rauben, obwohl er bereit gewesen war, sie noch weiter zu schelten. Er blieb eine Weile lang stehen, bevor er verzweifelt abwinkte und sich zurückzog.
»Was soll man mit solch barbarischen Menschen machen?«, fragte er. »Deshalb musst du hart für dein Studium arbeiten und von hier abhauen.«
Mein Vater – gutaussehend, mit leuchtenden braunen Augen, absurd langen Wimpern, die ich von ihm geerbt habe, und einem perfekt gestutzten und gekämmten Bart, seiner einzigen körperlichen Eitelkeit, die er jeden Morgen vor einem rostigen Handspiegel auslebt –, mein Vater ist der Meinung, dass er uns bereits einen guten Start ins Leben beschert hat.
Auf der Flucht vor seiner Herkunft aus Rajasthan, wo er ein einfacher Kurmi war, hat er mich mit einem einzigen Federstrich des Schulleiters in einen Hindu der oberen Kaste verwandelt: ein Brahmanen-Nachname auf meinem Schulzeugnis, ein gewöhnliches Täuschungsmanöver, das mich weniger anfällig für die Herablassung der Hochgeborenen macht, mich aber gleichzeitig mit der lebenslangen Angst besetzt, entlarvt zu werden.
Er schickte mich auf eine örtliche Grundschule und sparte Geld für meine Ausbildung, indem er meine Schwester aus der Schule nahm. Anschließend meldete er mich an einer christlich geführten Sekundarschule fünf Meilen außerhalb der Stadt an, wo ich mich den Hindu-Jungen anschließe, die jeden Morgen meuterisch das Vaterunser murmeln, sich über die verwöhnten englischstämmigen Inder lustig machen und deren Röcke tragenden Müttern nachstellen, mit Zirkeln und Rasierklingen zotiges Zeug in die hölzernen Schreibtische ritzen, von Kricket-Ruhm schwärmen und die kleine Bibliothek voller Enid-Blyton-Bücher über englische Schulkinder plündern, deren Sommerferien auf Inseln und in Dörfern mit erstaunlicherweise gutmütigen Polizisten sie verzaubert.
Als Krönung seiner Bemühungen lieh Baba sich Geld, um mich zu den Tutorien nach Delhi zu schicken. Die Konditionen des örtlichen Geldverleihers sind haarsträubend. Doch Baba ist zuversichtlich, dass mein Erfolg mich garantiert in die Riege derer aufsteigen lässt, die sich um Geld keine Sorgen machen müssen.
Während er den Aufstieg seines Sohnes ausheckt, befindet sich sein eigener Ruf im freien Fall. Früher arbeitete er einmal in der Kantine im Bahnhof eines großen Eisenbahnknotenpunkts, er trug einen Turban und eine gestärkte weiße Jacke mit Messingknöpfen und einer diagonalen roten Schärpe darüber. Doch ein Kommissar erwischte ihn dabei, wie er Mehl und Kerosin aus Bahnvorräten an einen örtlichen Händler verkaufte. Er wurde auf einen kleineren Bahnhof versetzt, wo keine warmen Mahlzeiten serviert wurden, was die Möglichkeiten des Nebenverdiensts einschränkte.
Aufgrund der Entdeckung, dass er noch immer staatliche Mittel veruntreute, wurde er ein weiteres Mal degradiert und landete ohne Uniform in Deoli, einem Bahnhof an einer schmalspurigen Nebenstrecke in einer unterbevölkerten Gegend. Hier verkauft er nur noch Samosas, die in trübem Erdnussöl frittiert werden (das für den Darm schädlich und uns verboten ist), und seine einzige andere Einnahmequelle ist eine kleine Provision von Kartenspielern, meist Feuerwehrmännern, die nach Feierabend an seinem Stand zocken und verbotenen Tharra trinken.
Er kommt spät abends nach Hause zurück, nachdem er seine Samosas an die letzten Züge verkauft hat, und notiert sorgfältig die Tageseinnahmen in einem linierten Notizbuch. Der Bahnhof, der die meiste Zeit des Tages trostlos ist, wird verwandelt durch kleine Entladungen von Energie, wenn die Züge atemlos röhrend und hustend um die Kurve an einem Bahnübergang auftauchen, die schwarzen Lokomotiven mit Kuhfängern, deren gefletschte Metallzähne etwas Dämonisches haben, sich aber als zahme Holzwaggons entpuppen, die mit einem kurzen, verzweifelten Schrei und knirschenden Bremsen zum Stillstand kommen.