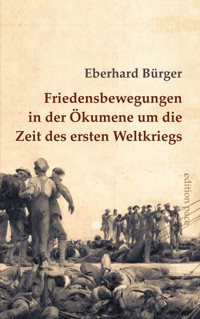
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: edition pace
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der vorliegenden Band im "Regal zur Geschichte des Pazifismus" enthält eine Darstellung des evangelischen Theologen Dr. Eberhard Bürger zu "Friedensbewegungen in der Ökumene um die Zeit des ersten Weltkriegs". Beim Rückblick auf die Jahre 1914-1918 gibt es neben der großen Last der Geschichte und der Schuld, die zu bekennen ist, noch eine andere Seite, die hier ergänzt wird: "Kirche des Friedens" werden heißt auch, die Erfahrungen, Zeugnisse und Modelle der Geschichte wahrzunehmen und sich heute von ihnen für morgen inspirieren zu lassen. Die Überschrift "Befreit zum Widerstehen" trifft den Nerv dessen, was es zu überliefern und bedenken gilt: Vom Evangelium befreit zu werden aus der vermeintlichen Übermacht der zerstörerischen "Mächte und Gewalten" zu einem lebens- und friedensbejahenden Leben, auch zur Entlarvung der "Mächte und Gewalten" und zum Widerstand gegen sie. Dies kann sich freilich nur in kirchlichen Räumen ereignen, die unabhängig sind von staatlichen bzw. nationalen Komplexen. Der Begriff "Friedens-Bewegungen" zeigt an, dass es hier nicht nur um eine einheitliche Bewegung im soziologischen Sinne geht, sondern um eine Vielzahl von Strömungen, Gruppen, Einzelnen, um deren "Nein zum Krieg" und deren "Ja zum Frieden". Die Friedens-Bewegungen sind von Anfang an weltweit, also ökumenisch gewesen. Ökumenisch meint hier: international, konfessions- und religionsübergreifend, auch die oft mehrheitlich nichtreligiösen Bewegungen einbeziehend, in den Zielstellungen sich berührend. Dabei liegt der Schwerpunkt des Überblicks geografisch auf dem deutschsprachigen Raum - auf Deutschland, auf Österreich und der Schweiz. edition pace Regal zur Geschichte des Pazifismus 4 Herausgegeben von Peter Bürger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
edition pace Band 17
Regal zur Geschichte des Pazifismus 4
Herausgegeben von Peter Bürger
Inhalt
Vorab
Regal zur Geschichte des Pazifismus
Bibliographie
(
Auswahl
)
„B
EFREIT ZUM
W
IDERSTEHEN
“ Friedens-Bewegungen in der Ökumeneum die Zeit des Ersten Weltkrieges
Eberhard Bürger
1. Die Anfänge des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen
2. Die Anfänge des Internationalen Versöhnungsbundes
3. Exkurs zu einigen Entwicklungen im Versöhnungsbund bis heute
4. Der Beginn der internationalen Friedens-Bewegung
5. Das Aufblühen der Friedens-Bewegung im deutschsprachigen Raum
6. Anmerkungen zur sogenannten „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“
7. Veränderungen in der Friedens-Bewegung durch den Kriegsverlauf
8. Erinnerungen und Reflexionen – „Nacharbeiten“ zum Ersten Weltkrieg
Zeittafel
John Singer (1856-1925):
„Gassed“, 1919 bearbeiteter Ausschnitt
commons.wikimedia.org
VorabRegal zur Geschichte des Pazifismus
Von „gefallenen Engeln aus der Hölle“ ist die Rede. Die öffentliche Hetzjagd auf Pazifisten und Antimilitaristen hat gegenwärtig wieder Hochkonjunktur, was jedem klardenkenden Menschen Anlass zur Sorge geben sollte. In zwei Weltkriegen standen allein die Pazifisten in deutschen Landen auf der richtigen Seite, was später – nach insgesamt über 70 Millionen Toten – rasch verdrängt wurde. Historische Aufklärung tut not. Zu erinnern ist an das Zeugnis von Frauen und Männern, die sich als Minderheit dem Mehrheitsstrom jener militärischen Heilslehre entgegengestellt haben, die am Ende stets in den Abgrund hineinführt.
Der vorliegende Überblick „Friedensbewegungen in der Ökumene um die Zeit des ersten Weltkriegs“1 des evangelischen Theologen Dr. Eberhard Bürger (Magdeburg) erscheint als vierter Band des neuen, von der edition pace bereitgestellten „Regals“ zur Geschichte der Friedensbewegung. In Kooperation mit dem Alois Stoff Bildungswerk der DFG-VK NRW haben bislang schon vorgelegt:
Alfred Hermann F
RIED
: Geschichte der Friedensbewegung. Eine Darstellung zum Pazifismus bis 1912.
Ludwig QUIDDE: Über Militarismus und Pazifismus. Vier friedensbewegte Texte aus den Jahren 1893-1926.
Richard B
ARKELEY
: Die deutsche Friedensbewegung 1870-1933. Unveränderter Text der Darstellung von 1947.
Alle Teile des „Regals“ edieren wir zunächst als kostenfrei abrufbare Internet-Publikationen. Nachträglich erscheinen außerdem auch Verlagsausgaben mit ISBN-Nummer.
pb
1 Hier mit freundlicher Genehmigung des Verfassers und des Editionsprojektes „Kirche & Weltkrieg“ entnommen dem Sammelband: „Frieden im Niemandsland“. Die Minderheit der christlichen Botschafter im Ersten Weltkrieg. Herausgegeben von Peter Bürger. 2021 (Online-Version; auch als Paperback erschienen).
1.
Die Anfänge des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen
Am 1. August 1914 wurde in Deutschland die Mobilmachung ausgerufen: Alle Züge waren für den Transport von Truppen und Kriegsgerät beschlagnahmt worden. Endlich begann das lange vorbereitete,5 von vielen freudig ersehnte Kriegsgeschehen und – was nur wenige geahnt haben – die sogenannte „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“! (Eine gemachte Katastrophe.) Mitten im Chaos dieses Tages reisten dennoch Teilnehmer einer Konferenz ins Inselhotel in Konstanz. 153 aus dreizehn Ländern hatten sich angemeldet, darunter 22 aus Deutschland.6 Nur 93 von ihnen erreichten die Tagung7, darunter drei aus Deutschland: der evangelische Pfarrer Friedrich Siegmund-Schultze8 als Organisator und Schriftführer, Pfarrer Ernst Böhme aus Kunitz bei Jena9 und der Konstanzer Stadtpfarrer Zandt. Friedrich Siegmund-Schultze hatte viele Einladungsschreiben an Einzelpersonen verschickt und vor allem von kirchenleitenden Amtsträgern entschiedene Absagen bekommen.10 Das Thema derTagung sowie die Tagesordnung fanden sich auf der großformatigen Einladung:
„Die Kirchen und Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen“ – Konferenz in Konstanz vom 3. bis 4. August 1914. Das Ziel der Konferenz: ‚Durch Freundschaft der Kirchen müssen Gefühle von Misstrauen und Hass sowie Antipathie zwischen Völkern und Nationen überwunden werden‘.“11
Die Tagung hatte eine lange Vorgeschichte, die 1907 mit der 2. Haager Friedenskonferenz begonnen hatte: Ein „Aufruf der Kirchen für den Frieden“, verbunden mit der Einrichtung eines „Kirchlichen Komitees zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland“ führte in den Jahren danach zu „Friedensreisen“ von Geistlichen nach Deutschland und England. Bereits damals hatte Friedrich Siegmund-Schultze die federführenden Aufgaben übernommen. Die Freundschaftsarbeit wuchs in beiden Ländern. Sie wurde begleitet von den beiden Zeitschriften „The Peacemaker“ und „Die Eiche“.
Die Zeitschrift „Die Eiche“ gehört zu den Zeitschriften, die mich wirklich ins Staunen versetzt haben. Als Vierteljahresschrift 1913 begründet, knüpft ihr Name an die deutschen und englischen Traditionen an und verbindet nationales Selbstbewusstsein („Wir pflanzen einen deutschen Baum in deutscher Erde.“ „…auch in England ist die Eiche der Nationalbaum!“) mit dem Brauch der Friedenseiche, die zur Hoffnung auf Frieden immer wieder gepflanzt wurde: „Pflanzt Friedenseichen in allen deutschen Kirchen! Als 1908 die deutschen Kirchenmänner ihre Friedensfahrt nach England unternahmen, fanden sich Vertreter aller deutschen Kirchen und Richtungen zusammen. Im Jahre 1909 kamen im Zeichen der Eiche, die auf allen Programmen und Begrüßungen das Sinnbild war, die Vertreter der britischen Kirchen zu uns herüber… Pflanzt Friedenseichen für die Kirche Christi in aller Welt! Nehmt die Schlagbäume weg und legt Straßen an! Am Zoll sitzen und Einlaß verwehren ist leicht; Steinquader zum Straßenbau herbeizuschaffen ist schwer. Hört auf, Gräben zu ziehen, und baut Brücken! Dann werdet ihr euer Eisen nützlich anwenden. Wie lange noch wird das tatsächliche Verhalten der Kirchen ein Hohn sein auf das Bekenntnis zur Gemeinschaft der Heiligen! Die religionsfeindlichen Mächte haben sich längst international organisiert; die Kirchen Christi kommen in ihrer Zwietracht zu keinem Zusammenschluss … Pflanzt Friedenseichen! – Und wo läge die Friedensarbeit näher als zwischen den deutschen und den angelsächsischen Christen!“ Die Aufgaben der „Eiche“ beschreibt Friedrich Siegmund-Schultze so: „1. In dem Streit der Völker durch Weckung des christlichen Gewissens zum Frieden wirken. 2. Gegen Missverständnisse angehen, 3. Friedensarbeit bekannt machen, 4. Verständnis für die Eigenart des anderen wecken, informieren und das christliche Gemeinschaftsgefühl stärken, 5. Persönliche Kontakte anregen und vertiefen, 6. Verständnis für andere wecken und Zusammenarbeit der Christenheit in unserer Zeit.“ In Großbritannien wurde der „Peacemaker“ als Schwesterzeitschrift der „Eiche“ gegründet. Dort findet sich Weihnachten 1913 eine Botschaft an das deutsche Volk: „Die Weihnachtszeit 1913 findet uns näher beieinander als früher. Die Herzen unseres Volkes schlagen mit den Euren zusammen. Nicht mit Neid, sondern mit Freude sehen wir auf das, was Ihr mit Gottes Hilfe erreicht habt. Wir beten, die heilige Weihnachtszeit möge Eure Herzen mit der Freude des Friedefürsten erfüllen; das neue Jahr möge Euch Wachstum und Gedeihen in persönlichen, häuslichen, sozialen nationalen und internationalen Fragen bringen; und jedes folgende Jahr möge Zeugnis geben von einer wachsenden Geistesgemeinschaft und brüderlichen Zusammenarbeit unserer Völker, zur Ehre Gottes und zum Segen der Menschheit.“ – Über die Jahre hin erschienen in der Zeitschrift „Eiche“ Artikel zu England, den USA, Frankreich, Russland (also den Hauptfeinden Deutschlands), der Schweiz, den Niederlanden, zu den nordischen Ländern, Artikel zu Ereignissen wie Friedensaufrufe, der Praxis des Friedenssonntags seit 1912, zu Telegrammen vor und bei Kriegsbeginn, kirchlichen Stimmen zum Krieg (so auch Benedikt XV.), zur Lage der Gefangenen in Deutschland, zum Gebet füreinander zwischen den verfeindeten Völkern, zu Veröffentlichungen des englischen Versöhnungsbundes und der Tätigkeit der Quäker … Oft finden sich freie Absätze in den Artikeln, weil dort die Zensur zugeschlagen hatte. Doch manchmal sind die vollständigen Artikel dann noch gesondert an die betreffende Nummer der „Eiche“ angefügt worden. –Ab dem 5. Jahrgang ändert sich der Untertitel der „Eiche“: „Ein Organ für soziale und internationale Ethik“ und ab 1921 „Vierteljahresschrift für soziale und internationale Arbeitsgemeinschaft“. – Mit welcher Qualität, mit welchem Mut selbst durch die Zeit des Krieges 1914 – 1918 Freundschafts- und Versöhnungsarbeit geleistet worden ist, das bleibt ein wundervolles Zeugnis bis heute! Außerdem hat die „Eiche“ „die Entwicklung der drei Zweige der Ökumene auf dem Weg zur Einigung begleitet, den Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen von Konstanz 1914 bis Prag 1928, die Bewegung für Praktisches Christentum (Stockholm 1925) und die Bewegung für Glaube und Kirchenverfassung (Lausanne 1927)“. Die „Eiche“ hat darüber hinaus die Entwicklung der christlichen Friedensbewegung von 1913-1933 dokumentiert.
Die Konstanzer Konferenz 1914 wurde möglich durch zwei besondere Umstände:
Der Kaiser hatte alle internationalen Konferenzen untersagt, mit Ausnahme dieser einen.12 Daran hatte wohl auch Großherzogin Luise von Baden ihren Anteil. Und: Die Finanzierung der Tagung war möglich, weil der US-Friedensaktivist Andrew Carnegie einen Fonds zur Förderung internationaler Friedensarbeit eingerichtet hatte und Geld zur Verfügung stellte.13
Nach den Vorgesprächen am 8./9. Mai 1914 in London und der Entscheidung für Konstanz als Tagungsort erfolgte ab Mitte Mai der Versand der Einladungen. Am 1. August 1914 um 22.30 Uhr tagte das provisorische internationale Komitee, um zu entscheiden, dass die Tagung nicht sofort nach London verlegt, sondern so weit wie möglich in Konstanz abgehalten wird.
Friedrich Siegmund-Schultze schreibt zur Tagung selbst: „Da die Delegierten zu sehr verschiedenen Zeiten eintrafen, war es schwierig, das Programm, wie es eigentlich beabsichtigt war, durchzuführen. Nachdem bis zum Abend des 2. August verschiedentlich hin und her beraten worden war, was sich aus den schwierigen Verhältnissen, vor allem infolge des Ausbleibens der wichtigsten ausländischen Delegierten ergab, wurde durch die Ankunft von Mr. Baker, Mr. Dickinson und Mr. Lynch am Abend des zweiten Tages der Mobilmachung die Frage dahin entschieden, daß die Konferenz gemäss dem geplanten Programm durchgeführt werden sollte.“14 Am 2. August 10.30 Uhr wurde die Konferenz mit einer Gebetsversammlung eröffnet. Doch bereits am Abend des 2. August verfügten die Konstanzer Behörden das Ende der Konferenz, weil die ausländischen Teilnehmer sonst interniert werden würden. Da wurde allen klar: Der Krieg beginnt wirklich. Wir kommen zu spät, um ihn zu verhindern. Wir sind zu wenige. Wir haben keine Macht. – Was haben sie angesichts dieser tiefen Ohnmachtserfahrung getan?
Sie haben gebetet. Sie haben sich mit kurzen Betrachtungen besonnen. Ein Referat hat ihnen neu in den Blick gebracht, worin sie vom Friedenswirken Jesu Christi den Kern ihres Anliegens sahen.15 Mehr noch: Sie fassten Beschlüsse.
„Zweck des Weltbundes war laut Satzung die Versöhnungs- und Freundschaftsarbeit unter den Völkern zu fördern. Dazu sollten die Kirchen auf die Regierungen und Volksvertretungen einwirken, um sie zu einer Politik zu veranlassen, die das friedliche Zusammenleben der Völker zum Ziel hat. Zur Bewältigung dieser Aufgabe sollten die Kirchen untereinander in ständigem Kontakt ihre Absichten und Bemühungen koordinieren.“16 Außerdem wurde ein Telegramm an die europäischen Staatsmänner gesandt, um sie zur Besinnung auf ihre christlichen Grundlagen zu rufen und Alternativen für die militärische Austragung der Konflikte zu suchen.
Frederick Lynch aus den USA schrieb über diese Stunden in Konstanz: „Draußen waren Deutsche, Franzosen und Engländer im Begriff, gegeneinander zu kämpfen; hier knieten Deutsche, Franzosen und Engländer im Gebet. Draußen riefen die Leute nach Blut; hier beteten Repräsentanten aus zwölf Völkern um wachsende Liebe füreinander.“17
Am Morgen des 3. August 1914 fuhr der Sonderzug des Kaisers – wiederum durch die Großherzogin Luise von Baden vermittelt – über Köln Richtung Niederlande und brachte die internationalen Teilnehmer an die deutsche Grenze. Die Konferenz fand ihre Fortsetzung am 5. August in London.
Friedrich Siegmund-Schultze schreibt rückblickend in einem Brief:
„Das Wichtigste…scheint mir der innere Charakter der Verhandlung zu sein. Fast die ganze Konferenz war eine Gebetsversammlung, an der die Vertreter der verschiedenen Nationen sich trotz des zwischen ihnen ausbrechenden Krieges in engster Gemeinschaft zusammenfanden. Besonders die Versammlung am Sonntagvormittag, an der etwa 100 Delegierte aus aller Welt teilnahmen …, hat bei allen Beteiligten einen tiefen Eindruck hinterlassen. Wohl alle, die an diesen Versammlungen teilgenommen haben, sind zur Überzeugung gekommen, dass das Zusammentreffen, der ersten Kirchenkonferenz für Freundschaftsarbeit mit dem Ausbruch des großen Krieges zwischen den christlichen Völkern providentiell [= von der Vorsehung bestimmt – E.B.] war. Die großen Versäumnisse der Kirche sind uns noch schwerer auf die Seele gefallen.“18
„Dass sich auch die römisch-katholische Kirche am Einsatz für den Frieden zwischen den Völkern beteiligen sollte, war den Einberufern der Konferenz bei ihren ökumenischen Bemühungen von Anfang an wichtig. Diese machten sich deshalb im April und Mai 1914 auf eine Reise nach Frankreich und Belgien auf, um Abklärungen zu tätigen. Zwar schien eine Konferenz zusammen mit römisch-katholischen Vertretern nicht möglich, aber immerhin konnte erreicht werden, dass fast parallel zur Konstanzer Konferenz eine römisch-katholische Friedenskonferenz geplant wurde. Diese sollte am 10. August in Lüttich beginnen, ‚…um die katholische Priesterschaft langsam für den Gedanken gemeinsamer Aktion im Blick auf den Frieden zu gewinnen.‘“19
Die Gründung des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen unter diesen dramatischen Umständen hatte weitreichende Folgen:
(1) In dieser ersten Phase des Weltbundes wurde Frieden zu einem wichtigen Thema einzelner Christen in ihren Ländern. Die Hauptakteure dieser Friedensarbeit waren Quäker (Baker), Anglikaner (Dickinson), liberaler Theologe (Siegmund-Schultze) und Social Gospel (Lynch), die sich zu einem Christentum der Tat trafen. „Nachfolge Jesu wurde nicht nur persönlich interpretiert, sondern als auf die ganze Gesellschaft anwendbar erachtet. Im ungebrochenen Fortschritts-glauben des 19. Jahrhunderts, vergleichbar dem Sozialdarwinismus, hielten sie eine ‚Verchristlichung‘ der Kultur für möglich. Durch die Anwendung der ethischen Prinzipien Jesu könne man an der Verwirklichung des Reiches Gottes in der gegenwärtigen Zeit und in dieser Welt arbeiten.“20
Politisch bedeutete das u. a.: Schiedsvermittlungen bei internationalen Konflikten wurden gefordert. Ein Netzwerk von Menschen und Organisationen sollte Freundschaft fördern und Feindschaft verhindern.
Neu in dieser Zeit: Damit Kirchen friedensfähig werden, müssen sie aus ihren nationalen Bindungen befreit werden. Kirchen sollen auch als Institutionen für die Friedensarbeit gewonnen werden und diese theologisch bedenken. Die Form eines Bundes als loser Verband galt dabei als Einladung, sich locker anzuschließen. Kriegsdienstverweigerung, Anti-Militarismus und Gewaltfreiheit spielten von dieser bürgerlich-kirchlichen Seite damals noch keine Rolle. Wichtig war den Initiatoren die Abstimmung mit der katholischen Kirche.
(2) In der zweiten Phase des Weltbundes von 1914 – 1919 musste der Name geändert werden: Da die Staatskirchen sich nicht zum Mittun bewegen ließen, wurde aus dem „Weltbund der Kirchen für Freundschaftsarbeit“ der „Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen“.
Auf die Konferenz folgte ein „Papierkrieg der Theologen“, dessen Tiefpunkt die Unterzeichnung des „Aufrufs der 93 an die Kulturwelt“ im November 1914 bildete. Für August 1915 wurde in Bern eine internationale Konferenz des Weltbundes vorbereitet – sie kam als einzige ökumenische Konferenz während des 1. Weltkrieges zustande. In der Folge bildete sich ein Netzwerk von regionalen Gruppen, die trotz Kriegsbedingungen miteinander in Verbindung zu bleiben versuchten.
(3) Nur in Deutschland kam die praktische Ausgestaltung der Freundschaftsarbeit wegen inhaltlicher Differenzen der Beteiligten zum Erliegen.21 Daher einigte man sich auf diakonische und seelsorgerliche Arbeit an den etwa zwei Millionen Internierten in deutschen Gefangenenlagern. Friedrich Siegmund Schultze rief die „Caritas inter Arma“ ins Leben, eine Gruppe von etwa 60 Pfarrern, die die Lager regelmäßig bereisten und vor allem bei den englischen Internierten Gottesdienste hielten, Gespräche führten. Außerdem knüpfte eine Hilfsstelle Kontakte zu den Angehörigen der Internierten und half Deutschen in Internierungslagern im Ausland. Das Büro der Zentralstelle für Deutsche im Ausland und Ausländern in Deutschland wurde geleitet von der Schweizer Reformpädagogin Elisabeth Rotten.22 Von vielen nationalistisch gesinnten Deutschen wurde diese Tätigkeit als Verrat angesehen. Doch der Mitarbeiterkreis hielten unbeirrt an den Aufgaben fest, denn: „Wir glauben an eine Macht, die stärker ist als der Hass“; er musste sich jedoch vor Nachstellungen schützen.23 So blieb eine menschliche Ebene zu den zu Feinden deklarierten Menschen aus anderen Ländern erhalten, die nach dem Krieg als Basis der Versöhnung diente.24





























