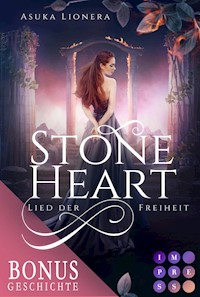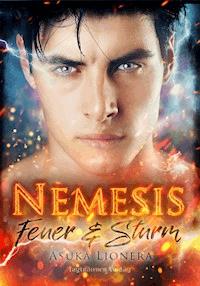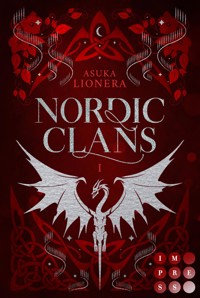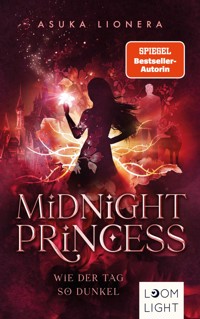4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wenn ein Kuss dein eisiges Herz zum Schmelzen bringt – mitreißende Romantasy um eine verbotene Liebe
Als das Königspaar des Eisreiches Fryske beschließt, seine einzige Tochter mit dem jungen König der Feuerlande zu vermählen, bleibt Davina, der Kammerzofe der Prinzessin, nichts anderes übrig, als ihrer Herrin in das fremde Reich zu folgen. Doch auf dem Weg in die neue Zukunft wird ihre Eskorte von Kriegern des Erdreiches überfallen.
Davina überlebt nur dank der Hilfe eines mutigen Kämpfers, der niemand Geringeres ist als Leander, der Erste Ritter der Feuerlande. Die beiden raufen sich zusammen, um die verschwundene Prinzessin zu finden, und kommen sich auf ihrer Suche immer näher. So nah, dass ein Kuss uralte, eisige Kräfte in Davina erweckt.
Aber Leander ist nicht derjenige, der diese Magie hätte entfesseln dürfen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Wenn ein Kuss dein eisiges Herz zum Schmelzen bringt – mitreißende Romantasy um eine verbotene Liebe
Als das Königspaar des Eisreiches Fryske beschließt, seine einzige Tochter mit dem jungen König der Feuerlande zu vermählen, bleibt Davina, der Kammerzofe der Prinzessin, nichts anderes übrig, als ihrer Herrin in das fremde Reich zu folgen. Doch auf dem Weg in die neue Zukunft wird ihre Eskorte von Kriegern des Erdreiches überfallen. Davina überlebt nur dank der Hilfe eines mutigen Kämpfers, der niemand Geringeres ist als Leander, der Erste Ritter der Feuerlande. Die beiden raufen sich zusammen, um die verschwundene Prinzessin zu finden, und kommen sich auf ihrer Suche immer näher. So nah, dass ein Kuss uralte, eisige Kräfte in Davina weckt. Aber Leander ist nicht derjenige, der diese Magie hätte entfesseln dürfen …
Band 2 erscheint im August 2020
Die Autorin
© privat
Hinter dem Pseudonym Asuka Lionera verbirgt sich eine im Jahr 1987 geborene Träumerin, die schon als Kind fasziniert von Geschichten und Comics war. Bereits als Jugendliche begann sie, Fan-Fictions zu ihren Lieblingsserien zu schreiben und kleine RPG-Spiele für den PC zu entwickeln, wodurch sie ihre Fantasie ausleben konnte. Ihre Leidenschaft machte sie nach einigen Umwegen und Einbahnstraßen zu ihrem Beruf und ist heute eine erfolgreiche Autorin, die mit ihrem Mann und ihren vierbeinigen Kindern in einem kleinen Dorf in Hessen wohnt, das mehr Kühe als Einwohner hat.
Mehr über Asuka Lionera: https://asuka-lionera.de/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf: www.loomlight-books.de
Loomlight auf Instagram: www.instagram.com/loomlight_books/
Viel Spaß beim Lesen!
Asuka Lionera
Frozen CrownsEin Kuss aus Eis und Schnee
Prolog
Eine Faust landet krachend in meinem Gesicht und für einen Moment sehe ich Sterne.
»Konzentrier dich!«, donnert die Stimme unseres Ausbilders. »In einem echten Kampf wärst du jetzt tot.«
Ich schüttele den Kopf und reibe mir mit dem Handrücken über den Mund. Kein Blut. Zum Glück! Meine Mutter würde mich ausschimpfen, wenn ich einen Zahn verliere. Dann konzentriere ich mich wieder auf mein Gegenüber.
Ich habe das Pech, gegen den Prinzen kämpfen zu müssen. Jeder aus unserer Truppe fürchtet sich davor, dieses Los zu ziehen, doch einen trifft es immer. Heute bin ich der Unglücksrabe.
Dass es noch dazu schüttet wie aus Eimern und sich der Trainingsplatz in eine Schlammgrube verwandelt, trägt nicht dazu bei, meine Laune zu heben.
Dennoch gehe ich wieder in Position, ignoriere den kalten Wind, der über mein klatschnasses Hemd streicht und sich mir bis auf die Knochen zu fressen scheint.
Der Prinz ist fast einen Kopf größer als ich. Bis letztes Jahr zählte er zu den Kleinsten unserer Truppe, doch dann schoss er in die Höhe. Wir konnten praktisch dabei zusehen, wie er wuchs. Aber er legte nur an Größe zu, nicht an Muskeln. Mein Kreuz ist um einiges breiter als seines, und meine Arme sind kräftiger. Wenn ich es darauf anlegen würde, könnte ich ihm mit einem Hieb die Lichter auspusten.
Dummerweise darf ich das nicht.
Niemand kämpft ernsthaft gegen den Kronprinzen, wenn er an seinem Leben hängt.
Also stehe ich hier, halb erfroren im Regen, und lasse mich verprügeln.
Ich habe schon mehrmals versucht, unserem Ausbilder klarzumachen, dass ich ein Reiter in Ausbildung bin und kein Faustheld. Leider vertritt er die Meinung, dass wir uns auch ohne Waffe verteidigen müssen, wenn es hart auf hart kommt.
Schon als der Prinz ausholt, weiß ich genau, dass er diesmal auf meinen Bauch zielt. Ich hätte alle Zeit der Welt, ihm auszuweichen, doch ich spanne nur die Muskeln an.
Prinz Esmond verzieht den Mund und holt erneut aus. Ich hoffe, dass er nun wieder auf mein Gesicht zielt, damit ich so tun kann, als sei ich ohnmächtig, um diese verdammte Farce zu beenden.
Stattdessen legt er mir die Hand auf die Schulter, zieht mich näher und rammt mir das Knie zwischen die Beine.
Helle Punkte tanzen vor meinen Augen, als ich mit einem Keuchen zusammensacke. Meine Kameraden am Rande des Trainingsrings geben ein mitfühlendes Zischen von sich.
Mit Mühe hebe ich den Blick und starre in Esmonds siegessicheres Grinsen. Das lässt bei mir das Fass überlaufen. Ich springe ungeachtet der Schmerzen in meinem Unterleib auf die Füße, vergesse, wer da vor mir steht, und gehe auf ihn los. Verdattert reagiert Esmond zu spät. Ich durchbreche seine hastig gehobene Verteidigung und lande einen Treffer nach dem anderen.
Bereits nach dem vierten geht er zu Boden. Der Länge nach liegt er im Schlamm. Von oben schaue ich auf ihn herab.
»Du weißt genau, dass ich mich nicht gewehrt habe«, grolle ich. »Warum greifst du auf schmutzige Tricks zurück? Du hättest mich auch so besiegt.«
»Leander«, knurrt der Ausbilder warnend. »Du sprichst mit dem zukünftigen König.«
Ich verziehe den Mund. »Gnade den Feuerlanden, wenn der da König wird.«
Meine Kameraden schnappen nach Luft, doch niemand wagt es, mich zurechtzuweisen. Wir alle denken dasselbe. Esmond ist zu weich und zu gutgläubig, um ein guter König zu werden. Besonders in Zeiten wie diesen, in denen die Erdländer ständig über die Orte in den Grenzgebieten herfallen, plündern und morden und immer weiter vordringen. Wir brauchen einen starken König, einen Krieger. Einen Mann, dem die Soldaten in einen Kampf folgen, ohne an die Konsequenzen zu denken.
Doch der Junge vor mir wird niemals zu einem solchen Mann heranreifen, wenn er weiterhin mit Samthandschuhen angefasst wird.
Unser Ausbilder fasst sich als Erster, eilt mit großen Schritten zu mir und packt mich am Kragen. »Bist du von Sinnen, Junge?«
Ich befreie mich mit einem Ruck. »Es ist die Wahrheit. Ihr wisst es ebenso wie wir anderen. Aus ihm wird nie ein König werden, wenn wir uns Tag für Tag von ihm verprügeln lassen, ohne uns zu wehren.«
»Wenn der König davon erfährt …«
»Nein«, murmelt Esmond und kommt ungelenk auf die Füße. Schlamm klebt ihm an Hose und Hemd. »Mein Vater wird nichts davon erfahren.«
»Aber …«, setzt unser Ausbilder an.
Esmond schneidet ihm mit einer knappen Kopfbewegung das Wort ab und macht einen Schritt auf mich zu. Verblüfft starre ich auf die Hand, die er mir hinhält.
»Du bist Leander, oder?«, fragt er, als ich zögernd seine Hand ergreife. Jede Sekunde rechne ich mit einer weiteren fiesen Finte. »Ich danke dir.«
»Wofür?«, frage ich.
»Dafür, dass du mich behandelst wie einen von euch.«
»Ich … verstehe nicht.«
»Ich bin hier, um zu lernen«, sagt Esmond. »Am Feuerhof bin ich umgeben von Ja-Sagern und Günstlingen, die mir jeden Wunsch erfüllen. Keiner verweigert mir etwas. Aber umgeben von solchen Menschen kann ich mich nicht entwickeln. Deshalb wollte ich am Training der Knappen teilnehmen. Doch bisher …« Er zuckt hilflos mit den Schultern. »… gehörte ich nicht dazu.«
Ich gebe mir Mühe, seine Erklärung zu verstehen. Ich selbst bin der Sohn eines Lords, der ein eher unbedeutendes, aber wunderschönes Fleckchen Land sein Eigen nennt. Von klein auf spielte ich mit den Kindern aus dem Dorf. Nie habe ich mich ausgegrenzt gefühlt. Deshalb fällt es mir schwer, mir Esmonds Leben vorzustellen. Ein Leben ohne Grenzen, in dem mir jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird.
»Wenn du einer von uns sein willst, solltest du heute Abend mit nach Brannwin kommen«, sage ich, während ich seine Hand umklammert halte. »Nach einem feuchten Training wie heute brauchen wir etwas Warmes zu essen.«
Ein vorsichtiges Lächeln zeichnet sich auf Esmonds Lippen ab. »Ich würde euch gern begleiten. Tut mir leid, dass ich dich getreten habe.«
Ich winke ab. »Ich vergesse es, wenn du heute Abend mehr Bier trinken kannst als ich.«
»Die Wette gilt.«
Unser Ausbilder seufzt. »Ihr Burschen seid zu jung für Trinkspiele …«
* * *
Seitdem gehört Esmond zu uns. Wir hörten auf, in ihm den Prinzen zu sehen. Er war ein dreizehn-, fast vierzehnjähriger Bursche wie der Rest von uns, der die Ausbildung zum Knappen durchlief, um später ein Ritter zu werden.
Mit jedem Tag wurde unsere Freundschaft tiefer. Wir wussten, was der andere dachte, wenn wir uns ansahen, und wurden zu einem unaufhaltsamen Gespann im Trainingskampf. Ich hielt mich nie mit der Wahrheit zurück und Esmond dankte es mir.
Als sein Vater überraschend starb und er in jungen Jahren bereits die Krone erbte, ernannte er mich und die anderen Knappen zu seinen engsten Beratern.
Als die Jahre vergingen, zogen sich die meisten meiner Freunde zurück, um zu heiraten und sich um ihr Gut zu kümmern. Wir sahen uns nur noch zu besonderen Anlässen, zu denen ich ihren gut gemeinten Spott über mich ergehen lassen musste.
»Leander!«, begrüßt mich Baldwin, als sich unsere Truppe anlässlich des fünfjährigen Krönungsjubiläums am Feuerhof trifft. Wie üblich haut er mir so kräftig auf den Rücken, dass ich unweigerlich einen Schritt nach vorn mache. »Treibst du dich immer noch hier am Hof herum?«
Ich spüre, wie mein aufgesetztes Lächeln ins Wanken gerät. Schnell greife ich nach meinem Krug und bleibe ihm eine Antwort schuldig. Die Gerüchte müssen sich bis zu ihm verbreitet haben.
»Du kennst doch Leander«, sagt Anselm, der sich zu uns gesellt. »Ein Pferdenarr durch und durch. Eine Frau, die seine Aufmerksamkeit erregen soll, muss auf einem weißen Gaul daherkommen.«
»Hmm«, brummt Baldwin. »Da könnte was dran sein.«
Ich stürze das Bier hinunter. »Sucht euch jemand anderen, den ihr piesacken könnt«, murre ich. »Der Saal ist voll. Warum bin jedes Mal ich euer Opfer?«
»Weil du uns die beste Vorlage lieferst«, sagt Anselm grinsend.
Er hat über die Jahre ein paar Kilo zugelegt. Ich habe gehört, dass seine Frau eine hervorragende Köchin sein soll. Nicht, dass ich ihn je besucht hätte. Trotzdem ruft mir sein schelmisches Grinsen immer wieder die Probleme in Erinnerung, die wir seinetwegen hatten. Die Mädchen, die ihm in Scharen hinterhergelaufen waren und vor denen wir ihn verstecken mussten. Es war eine unbeschwerte Zeit, als wir noch alle zusammen waren.
Nun haben sie alle ein eigenes Leben - bis auf mich.
»Irgendjemand muss auf den König aufpassen«, murre ich in meinen Krug. »Und da ihr nicht mehr da seid, ist diese Aufgabe mir zugefallen.«
Indem ich an ihr schlechtes Gewissen appelliere, entgehe ich weiterem Spott auf meine Kosten und kann den restlichen Abend irgendwie überstehen.
»Hast du es schon gesehen?«, fragt Anselm in verschwörerischem Tonfall. Auf meinen zweifelsohne fragenden Blick hin fügt er hinzu: »Das Gemälde seiner Verlobten.«
Ich schüttele den Kopf. »Esmond hat es niemandem gezeigt, nicht einmal mir.«
»Finde nur ich das seltsam?«, will Baldwin wissen.
Insgeheim stimme ich ihm zu, halte mich jedoch mit meiner Meinung zurück. Ich bin Esmonds letzter Freund hier bei Hofe. Dank ihm habe ich eine Aufgabe. Dieses Privileg werde ich nicht leichtfertig aufgeben wie meine einstigen Kameraden.
Kapitel 1
Leander
Etwa drei Jahre später …
Der Boden ist glitschig, aufgeweicht von all dem Blut. Ein falscher Schritt und ich versinke in dem tückischen Schlamm und den Tiefen des Erdreichs, aus denen es kein Entkommen gibt. Ein langsamer Tod ohne Ehre.
Ich habe aufgehört zu zählen, in wie vielen Schlachten ich bereits gekämpft habe. Manchmal reihte sich eine an die andere, manchmal lagen mehrere Monate dazwischen, in denen ich jedoch keine Ruhe fand und die Tage konturlos ineinander übergingen.
Die Menschen sagen mir, ich solle froh sein, wenn ich nicht in den Krieg muss, und das Leben genießen. Doch wie soll das gehen, wenn sich jeder meiner Atemzüge wie ein großer Fehler anfühlt? Wenn ich mich für jeden einzelnen schuldig fühle?
Vielleicht finde ich dieses Mal den Frieden, nach dem ich seit Jahren suche. Ein ruhmreicher Tod im Kampf - das ist es, wonach ich mich sehne.
Das Schwert in meiner Hand bildet eine Einheit mit dem Rest meines Körpers. Ich gebiete über die tödliche Waffe, als sei sie ein Teil von mir. Hinter mir höre ich das Donnern unzähliger Hufe, doch ich reite an der Spitze - wie immer. Meine treue Stute Elora gehorcht meinen Anweisungen blind und prescht ohne zu zögern voran. Nicht wenige Erdländer finden sich unter ihren Hufen wieder. Die restlichen machen mit meinem Schwert Bekanntschaft.
Seit vielen Jahrzehnten kämpfen wir Feuerländer gegen das Erdreich. Nicht einmal die Ältesten können sich an den Grund für die Feindseligkeiten erinnern. Es geht immer weiter. Keine Verhandlungen, keine Übereinkünfte, keine Friedensangebote. Keine Seite gibt klein bei. Ganz gleich, wie herausragend unsere Siege sind, die Erdländer rappeln sich jedes Mal wieder auf. Auch jetzt ist der Tross, den sie uns entgegenschicken, lachhaft klein.
»Kommandant!«, brüllt einer meiner Männer über den Kampflärm hinweg.
Ich ziehe mein Schwert aus dem letzten Gegner, der so dumm war, sich mir zu stellen, und drehe mich in die Richtung, aus der die Stimme kam. Wild gestikulierend zeigt der Soldat auf den Hügelkamm in unserem Rücken. Für einen Moment gefriert mir das Blut in den Adern. Dieser mickrige Trupp war nur eine Ablenkung! Hinter uns erwartet uns die richtige Streitkraft.
»Sammeln!«, brülle ich, so laut ich kann.
Die Reiter in meiner Nähe geben den Befehl in Windeseile weiter. Meine Männer sind gut geschult und reagieren sofort. Wir bilden mit unseren Schlachtrössern eine neue Angriffslinie und nehmen die Fußsoldaten schützend hinter uns. Elora scharrt aufgeregt mit den Hufen, während der Hengst neben mir auf der Stelle tänzelt.
Die feindlichen Männer am Hügelkamm stoßen ihre harten Kriegsschreie aus, wagen sich jedoch nicht in unsere Nähe. Ich weiß genau, was sie vorhaben.
»Sobald sie den Kamm herunterkommen«, knurre ich, »treiben wir diese Bastarde dorthin zurück, wo sie hingehören.«
Die Soldaten zu meiner Seite nicken grimmig. Wir alle wissen, dass das Erdreich böse Überraschungen bereithalten kann. Mehrmals musste ich dabei zusehen, wie gute Männer und ihre Pferde im weichen Treibsand oder Felsspalten verschwanden und nie wieder auftauchten.
»Bogenschützen!«, befehle ich. »Feuer!«
Zielsicher treffen unsere Pfeile ins Schwarze. Einige Erdländer rollen in Panik den Hügelkamm hinab - und werden prompt von der weichen Erde verschluckt.
»Idioten«, grollt der Reiter neben mir. »Dachten sie, dass wir auf diesen uralten Trick hereinfallen?«
Die Unebenheiten und versteckten Fallen des Erdreichs sind die einzigen Gründe, warum wir dieses verdammte Land nicht einfach überrennen und unterwerfen. Wir haben es in der Vergangenheit oft genug versucht und teuer dafür bezahlt. Seitdem haben wir keine andere Wahl als uns den Kämpfen zu stellen, wo wir festen Boden unter den Füßen haben.
Mehr und mehr Erdländer kommen nun den Hügelkamm herunter, während sie gewisse Zonen umgehen.
»Angriff!«, brülle ich, nachdem unser Gegner am Fuße des Kamms angelangt ist.
In einer Linie preschen die Reiter meiner Kavallerie-Einheit nach vorn, doch ich muss neidlos anerkennen, dass sich die Erdländer wacker gegen uns behaupten. Anstatt ihr Heil in der Flucht zu suchen, stellen sie sich uns entgegen, attackieren unsere Pferde und bringen so einige meiner Männer zu Fall. Andere zerren sie aus dem Sattel.
Ich weiß nicht, wie viele von ihnen ich niedermache. Zehn? Zwanzig? Fünfzig? Zu viele, als dass ich mir ihre Gesichter merken könnte. Sie verschwimmen ineinander und ich reagiere nur noch. Ohne Unterlass stoße und schwinge ich mein Schwert in feindliche Leiber und lenke Elora über gestrauchelte Erdländer.
Die Sonne geht bereits unter, als ich mein Schwert aus dem Körper des letzten Feindes herausziehe. Meine Kleidung starrt vor Schlamm und Blut und auch Elora ist bis zum Bauch dreckbesudelt. Ich schaffe es kaum, die Waffe in die Scheide zu stecken. Meine Bewegungen sind fahrig, mein Arm schlaff, und ich kann mich kaum noch im Sattel halten.
In das Siegesgeschrei meiner Männer falle ich nicht ein.
Ich schaue nur der Sonne zu, wie sie hinter dem Hügelkamm verschwindet.
Ein weiterer Tag, den ich überlebt habe.
Eine weitere Nacht, die ich irgendwie überstehen werde.
Ich lebe und atme, weil der Tod mich erneut verschont hat.
Doch im Gegensatz zu meinen Männern bin ich nicht froh darüber.
Ich lasse sie feiern und ziehe mich zurück, um mich und mein Pferd zu waschen.
»Wie viele Schlachten müssen wir noch schlagen, bevor es vorbei ist?«, murmele ich Elora zu.
Wir haben gewonnen. Ich kann meinem König und besten Freund die Nachricht eines weiteren, herausragenden Sieges überbringen, doch ich verspüre keine Freude, sondern nur Leere. Kein Sieg, kein guter Kampf vermochte diese Leere bisher zu füllen. Egal, wie viele Erdländer ich töte, mein Rachedurst verlangt nach immer weiteren.
Vielleicht habe ich Glück und treffe in der nächsten Schlacht auf einen ebenbürtigen Gegner, der mich von meinem Elend erlöst.
»Kommandant Leander«, sagt jemand hinter mir.
In einer fließenden Bewegung ziehe ich mein Schwert und halte es dem Ankömmling an die Kehle. Der Soldat - ein junger Mann, der nicht älter als sechzehn sein kann - starrt mich aus schreckgeweiteten Augen an.
»B-Bitte vergebt mir«, stammelt er. »Ich w-wollte nicht …«
Ich stoße den Atem aus und stecke das Schwert weg. »Was ist?«
Er beäugt mich aus sicherer Entfernung. »Wir … haben Spuren gefunden.«
»Spuren?«
Er nickt. »Erdländer zu Pferd. Sie … haben die Grenze passiert.«
Ich stoße einen Fluch aus und wende mich ab. Mit einer Hand tätschele ich Eloras Hals, während ich murmele: »Tut mir leid, mein Mädchen, aber wir werden heute Nacht keinen Schlaf finden.«
Kapitel 2
Davina
Lauf! Lauf weiter!
Mit jedem Schlag hämmert mir das Herz schmerzhafter gegen die Rippen, sodass ich mich vor dem nächsten fürchte. Doch noch mehr fürchte ich mich vor dem, was mich erwartet, wenn sie mich kriegen …
Das Schnauben ihrer Pferde kommt immer näher und die rauen Befehle der Reiter klingeln mir in den Ohren.
Ich zwinge mich vorwärts, ignoriere die Schreie meines Körpers nach einer Pause und renne weiter. Tiefer und tiefer dringe ich in den unbekannten, dicht bewachsenen Wald vor in der Hoffnung, meine Verfolger im Unterholz abschütteln zu können.
Zweige zersplittern unter den donnernden Hufschlägen eines Pferdes ganz in meiner Nähe. Mein Herz setzt für einen Schlag aus, nur um anschließend in halsbrecherischer Geschwindigkeit weiterzuhasten. Beinahe meine ich, den heißen Atem des Gauls bereits im Nacken zu spüren.
Ich wage nicht, mich umzudrehen und nachzuschauen, wie nah mir meine Verfolger tatsächlich bereits gekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele es sind, doch ich höre ihre Befehle, die sie sich in regelmäßigen Abständen zubellen. Die Sprache des Erdvolkes klingt hart und stumpf und passt perfekt zu diesen niederen Geschöpfen.
Etwas packt mich an den Haaren. Im ersten Moment hoffe ich, dass ich mich nur in einem Zweig verfangen habe, doch dann werde ich zurückgerissen. Panisch schreie ich auf - vor Schmerzen und Angst gleichermaßen. Mit dem Rücken krache ich gegen einen Baumstamm, so fest, dass ich befürchte, mir das Rückgrat zu brechen. Sofort wird mir sämtliche, dringend benötigte Luft aus den Lungen gepresst.
Dunkle Punkte blitzen vor meinen Augen auf und ich sacke zusammen. Aber ich darf nicht aufgeben … Wenn ich nicht weiterrenne, werden sie mich kriegen … Benommen versuche ich, wieder auf die Füße zu kommen, scheitere jedoch kläglich. Die Erde unter meinen Füßen ist ungewohnt weich und meine Muskeln protestieren bei jeder noch so kleinen Bewegung.
»Du dachtest wohl, du könntest uns entkommen«, tönt eine tiefe Männerstimme direkt vor mir. Ich höre den schweren Akzent des Erdvolkes, doch ich habe Mühe, den Blick auf ihn zu fokussieren. Alles ist verschwommen und unklar, als würde ich versuchen, durch eine dicke Eisschicht auf den Grund eines Sees zu schauen. »Niemand entkommt uns. Sag uns, wo sie ist! Und vielleicht verschonen wir dein Leben, Mädchen.«
Ich hebe den Kopf. Selbst diese Bewegung jagt unzählige Schmerzwellen durch mich hindurch, doch ich beiße die Zähne zusammen, damit mir kein Laut entweicht.
Mein Gegenüber sitzt auf einem riesigen, kohlschwarzen Kriegsstreitross, das nervös mit den klobigen Hufen scharrt. Der Mann selbst wirkt indes nicht halb so beeindruckend wie sein Pferd. Wie üblich für das Erdvolk, ist auch er von gedrungener Statur. Seine Füße erreichen kaum die Steigbügel, und es würde mich nicht wundern, wenn er eine Leiter braucht, um überhaupt in den Sattel zu gelangen.
Mein Blick huscht zur Seite. Nur noch ein weiterer Krieger, ebenfalls zu Pferd. Wo sind die anderen? Es waren doch fünf, wenn mich nicht alles täuscht.
Fünf Krieger haben ausgereicht, um einen nach dem anderen abzuschlachten.
Wir fühlten uns sicher, schließlich hatten wir die Hauptstadt nach über zwei Wochen unserer Reise so gut wie erreicht. Es sollte ein freudiger Tag werden, sobald wir dort ankämen. Nicht für mich, aber für andere. Und ich hätte mich für sie gefreut und ihnen zuliebe gelächelt.
Doch nun ist keiner mehr übrig, für den ich lächeln muss.
Der Krieger drückt die Fersen in die Flanken seines Pferdes, sodass es einen stampfenden Schritt nach vorn macht. Hastig ziehe ich die Beine ein und schlinge die Arme darum, um nicht unter die zermalmenden Hufe zu geraten.
»Ich frage dich noch ein einziges Mal«, knurrt er, wobei sein Akzent nur noch deutlicher zum Vorschein kommt. »Wo ist die Prinzessin?«
Ich stoße ein höhnisches Schnauben aus. »Ihr wollt die Prinzessin und vergeudet eure Zeit mit mir? Woher soll ich wissen, wo sie ist? Ich habe sie zuletzt gesehen, als ihr uns überfallen habt.«
Ein winziger Funken Erleichterung mischt sich unter die Panik, die in mir tobt. Sie muss entkommen sein. Hoffentlich sind die übrigen Angreifer ihr nicht auf den Fersen …
Als der Angreifer das Pferd noch näher an mich herantreten lässt, rappele ich mich auf die Füße und presse den Rücken gegen den Stamm. Der Blick, mit dem er mich bedenkt und von oben bis unten mustert, verursacht mir Übelkeit. Ich schlucke hektisch, um die aufsteigende Magensäure wieder dorthin zu befördern, wo sie hingehört.
»Unser König wird nicht erfreut sein, wenn wir ihm nicht wie befohlen die Prinzessin bringen«, murmelt der Krieger scheinbar in Gedanken, während sein Blick zu lange auf meinem Gesicht verweilt.
Ich recke das Kinn. »Ihr habt keinen König! Nur einen Emporkömmling, der Herrscher spielt.«
Er zieht eine buschige Augenbraue nach oben. »Gefährliche Worte für solch ein hübsches Ding wie dich.«
»Ich habe keine Angst vor dir.« Ich lege so viel Kraft wie möglich in diese Lüge.
»Ach nein?« Sein Lächeln verursacht mir eine Gänsehaut. »Das solltest du aber. Unser König wird nicht erfreut sein, aber … ich denke, ich kann ihn besänftigen, wenn ich ihm stattdessen eine schöne Dienerin aus dem Reich der Kälte bringe. Nur deine Zunge werden wir dir vorher rausschneiden müssen, da du sie offensichtlich nicht im Zaum halten kannst.«
Äußerlich gebe ich vor, dass mir seine unverhohlenen Drohungen nichts anhaben können. Innerlich winde ich mich jedoch vor Angst. Ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, was mit mir geschehen wird, sobald ich als Sklavin des Erdvolkes ende.
Ich werfe dem Krieger direkt vor mir und dem zweiten im Hintergrund einen durchdringenden Blick zu. »Wagt es nicht, mich anzurühren, sonst …«
»Sonst was?«, höhnt der Krieger. »Wenn du eine der Magierinnen wärst, hättest du uns schon längst zu Eis erstarren lassen. Nein, du bist nichts weiter als eine gewöhnliche Dienerin. Und ab heute wirst du uns dienen.«
Bevor ich ein gezischtes »Niemals!« ausstoßen kann, vernehme ich erneut das Donnern von Pferdehufen. Mir gefriert augenblicklich das Blut in den Adern. Sie müssen sie gefunden haben … Und nun schließen sie zu ihren Kameraden auf. Einem von ihnen hätte ich entkommen können. Zwei vielleicht mit dem Beistand der Göttin auch. Aber drei oder noch mehr? Ausgeschlossen!
Hektisch schaue ich nach links und rechts auf der Suche nach einem Ausweg. Aber wohin ich auch sehe, ich bin umgeben von Wald in einem fremden Land.
Pferd und Reiter nähern sich. Nur einer, schießt es mir durch den Kopf. Und ich erkenne keine Frau bei ihm. Haben sie sie also doch nicht gefunden? Oder ist sie vielleicht …?
Der Reiter wird nicht langsamer, auch nicht, nachdem er uns gesehen haben muss. Stattdessen zieht er in einer fließenden Bewegung sein Schwert. Ich halte die Luft an. Diese Reaktion verleitet den Angreifer direkt vor mir, sich ebenfalls zu dem Neuankömmling umzudrehen. Er erstarrt einen Augenblick, dann brüllt er seinem Kumpanen etwas zu, was ich nicht verstehe.
Für den zweiten Krieger des Erdvolkes kommt die Warnung jedoch zu spät. Mit einem sauberen Hieb trennt er dem Angreifer den Kopf von den Schultern. Ich kneife die Augen zusammen. Ein Teil von mir ist dankbar, dass der Krieger nicht mehr schreien kann. Ich habe heute bereits zu viele Todesschreie gehört …
Als ich grob am Arm gepackt werde, reiße ich die Augen wieder auf. Der andere Angreifer ist aus dem Sattel geglitten und hält mir nun eine Klinge an den Hals, während er einen Arm so um mich geschlungen hat, dass er die Hand über meinen Mund legen kann. Seine Nähe und der Geruch nach feuchter, modriger Erde und Schweiß, den er verströmt, lassen mich fast würgen.
»Keinen Schritt näher!«, schreit er dem Ankömmling zu. »Oder die Kleine atmet gleich durch ein Loch im Hals!«
Am liebsten hätte ich laut gelacht. Als ob das den anderen Mann von irgendetwas abhalten würde! Schließlich habe ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Er wird sich nicht dafür interessieren, ob ich …
Zu meiner Verwunderung gleitet der Mann galant aus dem Sattel und legt das blutverschmierte Schwert auf den Boden, um sich anschließend mit erhobenen Händen zwei Schritte zu entfernen.
»Wie du siehst, bin ich unbewaffnet«, sagt er. Seine Stimme klingt gleichzeitig weich und rau. »Lass die Kleine gehen.«
Der Krieger stößt einen Grunzlaut aus. »Vergiss es! Sie wird mich begleiten. Jetzt geh wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist!«
Der andere Mann seufzt. »Ich befürchte, das wird nicht möglich sein.«
Ich winde mich in der Umklammerung, halte jedoch sofort still, als er die Klinge fester gegen meinen Hals presst und die dünne Haut anritzt.
»Hör auf, dich zu zieren, Mädchen!«, raunt er mir ins Ohr. Ein eisiger Schauer rauscht durch mich hindurch. »Es wird dir bei uns gefallen, versprochen.«
Ganz bestimmt nicht!, denke ich und rucke abrupt den Kopf nach hinten. Dadurch rutscht seine Hand ein Stück nach unten und ich versenke die Zähne in seiner Haut. Ein widerlicher Geschmack nach Dreck und Schweiß flutet meinen Mund, doch ich beiße noch fester zu, bis er aufjault und die Umklammerung löst.
Ich spüre einen Luftzug an der Stirn, gefolgt von einem erstickten Laut. Einen Herzschlag später sackt der Krieger des Erdvolkes in sich zusammen.
Als ich mich zu ihm umwenden will, ist der andere Mann bereits bei mir und breitet seinen dunkelroten Umhang um mich aus.
»Nicht hinsehen«, murmelt er, als er mich vorsichtig an sich zieht.
Ich zittere am ganzen Körper und lehne mich dankbar an ihn, auch wenn eine nervige Stimme mich dafür eine Närrin schimpft. Immerhin weiß ich nicht, ob er nicht auch einer von denen ist … Er könnte mich auch …
Als er sanft einen Arm um meinen Rücken legt, schließe ich die Augen und gebe mich der lockenden Wärme hin, die sein Körper verströmt. Nur für einen Moment, sage ich mir. Nur um wieder neue Kraft schöpfen zu können.
Erst jetzt, wo ich für einen Augenblick zur Ruhe komme, spüre ich, wie erledigt ich bin. Meine Muskeln schmerzen von der Flucht. Die Schnitte an den Armen und Beinen, die ich mir im dichten Unterholz eingefangen habe, pochen. Mein Rücken schmerzt so sehr, dass ich nicht aufrecht stehen kann.
Ich sinke etwas mehr gegen meinen Retter. Das ist er doch, oder? Er hat mich gerettet. Aber … warum?
»Alles in Ordnung?«, fragt er nach einer Weile besorgt.
Langsam hebe ich den Kopf und zwinge meine Augen dazu, sich wieder zu öffnen. Er ist groß. Das ist das Erste, was mir nun, da die Anspannung aus mir weicht, auffällt. Ich reiche ihm gerade mal bis zum Kinn. Mein Blick gleitet über den markanten Kiefer hinweg weiter nach oben. Er hat den Mund leicht zusammengepresst, als ärgere er sich über etwas. Eine gerade Nase, eine Spur zu breit vielleicht. Schließlich bleibe ich an seinen Augen hängen.
Eine solche Farbe habe ich noch nie gesehen.
In Fryske, dem Land, aus dem ich stamme, haben alle Bewohner eine helle Augenfarbe. Blau, so wie ich, aber auch ein helles Grün oder ein kräftiges Türkis. Eine Farbe - klar, begrenzt und genauso kühl wie unsere Heimat.
Die Augen des Mannes vor mir sind eine Vielzahl aus Farben und Schattierungen, dass ich sie unmöglich alle benennen kann. Ein warmes Braun herrscht vor, wird jedoch von Sprenkeln aus Gold und Grün unterbrochen. Zur Pupille hin wird die Iris heller, bis sie beinahe golden wirkt.
Er zieht die Brauen zusammen, während ich ihn unverhohlen anstarre. Widerstrebend reiße ich mich vom Anblick seiner Augen los. Sein Haar ist dunkel. Ich bin nicht sicher, ob es ein dunkles Braun oder doch schwarz ist. An den Seiten ist es kürzer und einzelne Strähnen hängen ihm in die Stirn.
»Bist du in Ordnung?«, wiederholt er seine Frage von vorhin.
»Ich … denke schon«, krächze ich. Meine Zunge kommt nur zögerlich meinen Befehlen nach. »Hast du … vielleicht etwas zu trinken?«
Sichtlich verwundert über meine Frage, lässt er mich los und geht hinüber zu seinem Pferd. Während er in der Satteltasche nach etwas zu trinken sucht, werfe ich einen Blick über die Schulter. Hinter mir liegt der Mann aus dem Erdreich. Mit einem Dolch mitten zwischen den Augen. Seltsamerweise berührt mich sein Tod nicht im Mindesten.
Eine Feldflasche erscheint in meinem Blickfeld. »Du solltest nicht hinsehen«, tadelt mich mein Retter.
Ich zucke mit den Schultern und öffne die Flasche. »Er ist nicht der erste Tote, den ich heute sehe«, murmele ich. Nachdem ich einen Schluck getrunken habe, verziehe ich den Mund. »Hast du auch etwas … Stärkeres als Wasser?«
Der Fremde reißt überrascht die Augen auf.
»Ich … nun, weißt du … Der Geschmack seiner Hand verschwindet ansonsten nicht«, beeile ich mich zu erklären.
Tatsächlich klebt mir der widerliche Geschmack von Dreck noch immer am Gaumen, vermischt mit dem metallischen von Blut.
Aus der Tasche an seinem Gürtel zaubert der Fremde eine kleinere, flache Flasche hervor und reicht sie mir nach kurzem Zögern. »Aber nur einen Schluck«, mahnt er. »Ist ziemlich stark.«
Ich nicke und stürze das bittere Gebräu hinunter. Keine Ahnung, was es ist. Es brennt im Hals und entzündet ein Feuer in meinem Bauch. Außerdem vertreibt es den widerlichen Geschmack aus meinem Mund. Ich verziehe nur ein wenig das Gesicht, als ich dem Fremden die Flasche zurückreiche.
Unschlüssig mustern wir uns eine Weile. Wenn er mir etwas hätte antun wollen, hätte er mittlerweile genügend Gelegenheiten dazu gehabt. Dennoch bin ich auf der Hut. Eine Frage lastet trotzdem auf mir - nun, da ich nicht mehr verfolgt werde. Ich wünschte, ich könnte die Gedanken daran verdrängen, aber ich muss es wissen.
»Bist du … noch anderen begegnet, bevor du hierher kamst?«, frage ich.
»Anderen aus Fryske?«, hakt er nach. Ich nicke. »Nein. Ich habe den Trupp des Erdvolkes verfolgt und bin zufällig auf dich getroffen.« Er sieht sich um. Sein Blick huscht von dem Mann hinter mir zu dem anderen ein Stück entfernt. Die Pferde sind mittlerweile verschwunden, ohne dass ich es bemerkt habe.
»Es waren fünf«, werfe ich ein.
»Sieben«, präzisiert er. »Zwei habe ich schon erwischt, als sie gerade über die Grenze kamen. Aber die restlichen sind mir entkommen.«
Sein Blick kehrt zu mir zurück und mustert mich von Kopf bis Fuß. Im Gegensatz zu dem Krieger aus dem Erdreich ist mir sein Blick nicht unangenehm. Es liegt kein begehrliches Glimmen darin, sondern er scheint nur aus meinem Aufzug schlau werden zu wollen. Ich weiß, auch ohne dass er es aussprechen muss, dass es ungewöhnlich ist, eine junge Frau in Reithosen und einem in den Hosenbund gesteckten Hemd anzutreffen. Und noch dazu ohne Schuhe.
»Was machst du hier draußen?«, fragt er schließlich. »Der nächste Ort ist mehrere Tage und die Hauptstadt sogar fast eine Woche entfernt. Zu Fuß …« Sein Blick huscht wieder zu meinen verschmutzten und bloßen Füßen. »… könnten es auch zwei Wochen werden.«
Innerlich winde ich mich vor Scham. Die Stiefel, die ich mitgenommen hatte, haben mir nicht gepasst. Sie waren viel zu groß, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, lieber barfuß zu reisen. Da ich die meiste Zeit eh auf einem Pferd saß, machte mir das nichts aus.
»Ich war … mit einer Eskorte unterwegs«, erkläre ich. »Wir wurden überfallen.«
Wieder zieht er die Brauen zusammen, sodass eine steile Falte dazwischen erscheint. »Eine Eskorte? Aus Fryske?« Er verzieht den Mund. »Sag mir bitte nicht, dass …«
Ich nicke. »Ich gehöre zum Gefolge der Prinzessin.«
Stöhnend reibt er sich mit beiden Händen übers Gesicht. »Prinzessin Eira sollte erst nächsten Monat kommen und einen völlig anderen Weg nehmen! Was, um alles in der Welt, hat euch dazu bewogen, so nah an der Grenze zum Erdreich zu reisen?«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich … weiß nicht … Ich bin nur …«
Er unterbricht mich mit einer abrupten Handbewegung. »Kannst du mir sagen, wo ihr überfallen wurdet?«
Ich schlucke angestrengt, als ich an ihm vorbei den Wald um uns herum mustere. Ich bin von dort gekommen. Oder … war es doch von dort drüben? Alles sieht für mich gleich aus. Braun und grün, ganz anders als zu Hause. Während der Flucht habe ich so oft die Richtung gewechselt, dass ich unmöglich sagen kann, aus welcher ich kam.
Der Fremde deutet mein Zögern richtig. »Also nein.« Er bleckt die Zähne, als er nachdenkt. »Vielleicht kann ich ihre Spuren zurückverfolgen.«
Noch während er redet, eilt er hinüber zu seinem Pferd, das friedlich einige Grashalme zwischen den am Boden liegenden Blättern hervorzupft. Trotz seiner Hast, sind seine Bewegungen kraftvoll und gleichzeitig geschmeidig. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so bewegt wie er: wie ein Raubtier auf der Jagd, das ganz genau weiß, dass es an der unangefochtenen Spitze der Nahrungskette steht. Dass er ein Krieger ist, habe ich schon aufgrund des präzisen Dolchwurfs vermutet, aber die Kraft, die er ausstrahlt, und die Sicherheit, mit der er sich bewegt, lassen keinen anderen Schluss zu: er muss in vielen Schlachten gekämpft haben. Dabei schätze ich ihn höchstens auf Anfang zwanzig und …
Als er die Hände an den Sattel legt und einen Fuß in den Steigbügel stellt, kommen meine Gedanken jäh zum Stillstand.
»He!«, rufe ich. »Was … was ist mit mir?«
Über die Schulter hinweg wirft er mir einen spöttischen Blick zu. »Was soll denn mit dir sein? Ich habe dir das Leben gerettet.«
»Ja, aber ich …« Ich schaue zu Boden und knete den Saum des Hemdes. »Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll.«
Ich sollte ihm nicht vertrauen - schließlich kenne ich ihn nicht -, doch ich habe keine andere Wahl. Wenn er recht hat und der nächste Ort selbst zu Pferd mehrere Tage entfernt ist … Wer weiß, wie viele Krieger des Erdvolkes noch hier durch den Wald streifen! Allein werde ich mich nicht gegen sie behaupten können. Und in einem fremden Land ohne etwas von Wert werde ich nicht weit kommen. Ich besitze nichts als das, was ich am Leib trage.
Als er sich wieder zu seinem Pferd umwendet, werde ich panisch. »Du hast mich gerettet, nur um mich danach meinem Schicksal zu überlassen?«
»Hör zu, Kleine«, grummelt er, als er zu mir herumwirbelt. »Ich bin nur hier, weil ich den Erdländern gefolgt bin. Dass ich dabei auf dich getroffen bin, war reiner Zufall und nicht geplant. Ich muss denen nach, die mir entkommen sind, damit sie nicht weiter ins Landesinnere vordringen. Und ich muss die Prinzessin finden.«
Ich schlucke sämtliche Selbstachtung hinunter und spiele die letzte Karte aus, die ich auf der Hand habe. »Ich werde hier draußen sterben. Und es wäre deine Schuld.«
Ich starre ihn mit zusammengebissenen Zähnen an und bete zur Göttin, dass meine Schlussfolgerungen von vorhin richtig sind. Dass er ein Soldat des Feuerkönigs ist und somit einem Ehrenkodex unterliegt, der ihm verbietet, eine wehrlose Maid sich selbst zu überlassen.
Nachdem er sich die größte Mühe gegeben hat, mich mit bloßen Blicken zu töten, stößt er so geräuschvoll den Atem aus, dass ich es selbst aus mehreren Metern Entfernung noch hören kann. Auch das blitzende Farbenspiel seiner Augen, die vor Wut zu funkeln scheinen, bleibt mir nicht verborgen.
»Sei froh, dass ich einen Eid geschworen habe«, knurrt er. »Ich führe dich aus dem Wald heraus. Aber wenn du mich aufhältst, lasse ich dich zurück! Ich habe nämlich keine Zeit, um sie mit dir zu vertrödeln. Also beeil dich!«
Seine Worte treffen mich härter, als sie es sollten, aber ich verkneife mir einen Kommentar. Mit gesenktem Kopf und fest aufeinandergepressten Lippen eile ich zu ihm, ignoriere aber seine dargebotene Hand. Stattdessen schwinge ich mich ohne seine Hilfe in den Sattel, ein Bein auf jeder Seite. Das Pferd hebt verwundert den Kopf, kommt aber offenbar zu dem Schluss, dass es von mir nichts zu befürchten hat, und grast weiter. Ich tätschele ihm den Hals.
»Kommst du nun oder nicht?«, murre ich, als ich zu ihm hinabsehe und seinem verwunderten Blick begegne. Ein erhebendes Siegesgefühl durchrauscht mich, verschwindet jedoch schnell wieder, als sich seine Miene verdüstert.
»Rutsch ein Stück weiter nach vorn«, brummt der Fremde barsch, ehe er sich hinter mich in den Sattel setzt.
Ich versteife mich trotz der Proteste meiner erschöpften Muskeln. Als ich ihn bat, mich nicht zurückzulassen, habe ich keine Sekunde daran gedacht, dass wir nur ein Pferd haben. Oder dass er hinter mir sitzen würde. Sehr nah hinter mir. Näher als mir ein Mann meines Alters jemals war.
Ich habe davon in den zahlreichen Büchern gelesen, die es im Schloss von Fryske gibt. Von seltsamen Gefühlen, die kurze Berührungen auslösen können. Von einem ungewohnten Flattern im Bauch. Von Gedanken, die einem zuvor nie durch den Kopf gegangen sind.
Ich mochte diese Bücher und habe fast alle gelesen, wenn es meine Zeit zuließ. Aber selbst habe ich das, was darin beschrieben war, noch nie empfunden. Nicht einmal ansatzweise.
Nun wirbeln so viele Gedanken und Empfindungen durch mich hindurch, dass ich keine einzige zu fassen kriege. Einerseits will ich sofort absteigen und wieder Abstand zwischen uns bringen. Andererseits bin ich dermaßen erschöpft, dass ich mich am liebsten nach hinten lehnen und schlafen würde.
Stattdessen klammere ich mich am Sattelknauf fest und rufe mich stumm zur Ordnung.
Das funktioniert auch für ein paar Augenblicke, bis der Fremde einen Arm um meinen Bauch legt und mit der anderen Hand nach den Zügeln angelt. Ich spüre jede noch so kleine Bewegung, jede Verlagerung seines Körpers. Zusätzlich streicht mir sein warmer Atem die ganze Zeit über meinen Nacken.
Mit einem Schnalzen lässt er das Pferd antraben. »Zum Glück haben sich diese Idioten keinerlei Mühe gegeben, ihre Spuren zu verwischen«, murmelt er mehr zu sich selbst, während wir der Schneise der Verwüstung folgen, die die Angreifer hinterlassen haben.
Die klobigen Hufe ihrer Pferde haben sich tief in den Waldboden gegraben und einige Zweige abgeknickt, sodass wir schneller als gedacht zurück zur Straße gelangen. Ein wenig schäme ich mich, dass mir das nicht zuvor aufgefallen ist. Selbst jemand wie ich, der keinerlei Erfahrung im Spurenlesen hat, hätte dieser Verwüstung folgen können und ich wäre nicht auf seine Hilfe angewiesen gewesen. Aber dann wäre ich immer noch allein in einem fremden Land.
Ich bin froh, dass unser Pferd nun auf halbwegs ebenem Boden läuft und ich nicht mehr bei jeder Unebenheit gegen den Körper hinter mir gedrückt werde. Doch auch jetzt spüre ich ihn überdeutlich. Jeden Atemzug, jedes Ziehen an den Zügeln, jede Bewegung seiner Beine, mit denen er sein Pferd größtenteils lenkt. Er muss viel mit ihm trainiert haben; ich bin fast ein wenig neidisch, wie gut sich die beiden verstehen.
Wieder verlagert er das Gewicht, um sich ein Stück zu den Spuren nach unten zu beugen. Ich schnappe nach Luft, als er dabei beiläufig eine Hand an meine Taille legt, um das Gleichgewicht halten zu können.
»Ist nicht lange her, seit sie hier durchgekommen sind«, murmelt er, wieder zu sich selbst.
Ich bin es anscheinend nicht wert, dass er sich mit mir unterhält. Normalerweise würde ich mich darüber ärgern, aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich nicht den Mund öffnen muss. Viel zu schnell hämmert mein Herz in der Brust; so sehr, dass ich es bis zum Hals spüren kann.
Der Fremde richtet sich wieder auf und zieht den Arm, den er bis eben um meinen Bauch gelegt hatte, zurück. Ehe ich mir im Klaren bin, ob ich deswegen aufatmen oder enttäuscht sein soll, hüllt mich ein warmer, blutroter Umhang ein. Verwirrt blinzele ich auf das fremde Kleidungsstück hinab.
»Du zitterst«, erklärt er.
Ich schlucke angestrengt und öffne erst den Mund, als ich meiner Stimme traue. »Ich stamme aus Fryske«, werfe ich möglichst gleichgültig ein. »Was ihr Feuerländler als kalt bezeichnet, ist für uns der wärmste Sommertag seit Jahrhunderten.«
Dennoch ziehe ich den Umhang fester um mich in der Hoffnung, dadurch mein Zittern vor ihm verbergen zu können. Ein Zittern, das nicht von der Kälte herrührt. Tiefer als nötig atme ich ein und rieche Leder, Pferd und frisches Heu und Wald - eine wilde Mischung aus Gerüchen, die dem Umhang anhaften und die das Kribbeln in meinem Bauch nur verstärken.
Was ist nur los mit mir?
Kapitel 3
Davina
Nicht weit von der Stelle, an der wir aus dem Wald kamen, stoßen wir auf die Eskorte aus Fryske.
Oder zumindest das, was davon übrig ist.
Obwohl die Sonne langsam untergeht und die Umgebung in Dämmerlicht taucht, kann ich deutlich das Ausmaß der Zerstörung erkennen. Die Kutsche, neben der ich vor wenigen Stunden noch hergeritten bin, ist völlig zerstört, als hätten die Angreifer mit Äxten darauf eingeschlagen, um auch wirklich jede goldene Verzierung stehlen zu können. Die Truhen sind aufgerissen, Kleidungsstücke wurden kreuz und quer verteilt.
Dazwischen liegen die vier reglosen Körper unserer Soldaten. Ich kannte keinen von ihnen näher. Der König stellte sie uns zur Seite, als wir aufbrachen. Trotzdem murmele ich ein kurzes Gebet zur Göttin für ihre Seelen, wie es sich gehört.
»Macht dir das nichts aus?«
Ich wende mich so gut es geht im Sattel und begegne dem neugierigen Blick meines Retters. Das ist das erste Mal, dass seine bemerkenswerten Augen nicht vor Wut, sondern vor echtem Interesse funkeln.
»Was meinst du?«, frage ich.
Er deutet mit dem Kinn auf einen der gefallenen Soldaten. »Tote. Die Frauen, die ich kenne, würden bei diesem Anblick in Ohnmacht fallen.«
Ich folge seinem Blick. Er hat recht, ein schöner Anblick ist es nicht. All das Blut … Ich kenne tatsächlich viele Frauen in meinem Alter, die nicht hinsehen könnten, aber zu denen zähle ich nicht.
»Sie waren Fremde für mich«, sage ich, ohne den Blick von den Gefallenen zu nehmen. »Sie starben, als sie mich und die anderen verteidigen wollten. Ich sehe keinen Sinn darin, deswegen ohnmächtig zu werden. Das wäre eine Beleidigung für sie und ihre Taten.«
Da er mir eine Antwort schuldig bleibt, beende ich in Gedanken das Gebet an die Göttin und schaue dann wieder zu meinem Retter. Ich meine, den Anflug eines Lächelns in seinen Mundwinkeln erkennen zu können, doch das Zucken ist genauso schnell wieder verschwunden, wie es gekommen ist. Aber ich habe es gesehen, da bin ich mir sicher. Offenbar kann er doch lächeln. Bis eben war ich mir da nicht so sicher.
»Wie es aussieht, können die Frauen der Feuerlande noch einiges von euch Eisländern lernen«, sagt er mit gewohnt grummeliger Miene und schaut dabei demonstrativ an mir vorbei. »Oder vielleicht stimmen auch nur die Erzählungen.«
»Welche Erzählungen?«, hake ich nach.
»Dass die Frauen aus dem Eisland gefühlskalte Wesen sind, ohne jegliche Wärme in ihren Herzen. Weder für die Lebenden noch die Toten.«
Ich schweige, weil ich nicht weiß, was ich darauf erwidern soll. Er spricht die Wahrheit, trotzdem treffen mich seine Worte hart. So sieht er mich also? Aber es stimmt: Im Gegensatz zu den offenherzigen Frauen aus dem Feuerland, wirken wir geradezu zugeknöpft. Das bedeutet aber nicht, dass wir gefühlskalt sind.
Doch auf ihn muss ich so wirken. Er war zwar bisher nicht sonderlich freundlich zu mir, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Habe ich ihm überhaupt für seine Rettung gedankt? Ohne ihn wäre ich verschleppt und versklavt worden - oder Schlimmeres. Ich bin nur hier, weil er mir geholfen und mich nicht einfach mir selbst überlassen hat.
Vielleicht sollte ich den ersten Schritt machen und mich ihm gegenüber etwas freundlicher verhalten.
»Wie ist dein Name?«, frage ich.
Er zieht eine Augenbraue nach oben und ist sogleich auf der Hut. »Wieso?«
Ich zucke mit den Schultern. »Wenn ich für dich ein Gebet an die Göttin sprechen muss, will ich wissen, wie ich dich nennen soll.«
Er schüttelt den Kopf. »Es wird nicht so weit kommen, dass du meinetwegen beten musst. Wir werden sowieso nicht mehr viel Zeit miteinander verbringen.«
Sofort versteife ich mich. »Was meinst du damit?«
Sein Blick gleitet über die zerstörte Kutsche. »Die Prinzessin ist nicht unter den Toten, nicht wahr? Ich muss herausfinden, ob sie entkommen konnte oder verschleppt wurde. Wie dem auch sei, ich muss sie finden.«
»Warum?«
Er sieht mich an, als würde er ernsthaft an meinem Verstand zweifeln. »Weil sie die zukünftige Königin dieses Landes ist«, sagt er. »Es wäre meine Aufgabe gewesen, sie an der Grenze abzuholen und sicher in die Hauptstadt Brannwin zu geleiten.« Er ballt die Hände zu Fäusten. »Wieso ist sie nur früher aufgebrochen? Ich verstehe es einfach nicht …«
Seine Aufgabe. Das bedeutet, dass er einer der engsten Vertrauten des Feuerkönigs sein muss! Vielleicht sogar einer seiner Ritter, denn einem anderen würde der Feuerkönig diese wichtige Aufgabe nicht übertragen. Selbst in Fryske hören wir hin und wieder Geschichten über sie. Vier tapfere Ritter, einer stärker und wagemutiger als der andere. Hochrangige Befehlshaber in der Armee des Feuerkönigs. Jeder von ihnen könnte es spielend mit unseren Ritari aufnehmen. Doch mittlerweile sollen nur noch ein paar von ihnen im Dienst sein.
Aus den Augenwinkeln beobachte ich meinen Retter dabei, wie er die Spuren analysiert, während er sein Pferd mit uns beiden darauf um die zerstörte Kutsche herumtraben lässt.
Er ist jung; schätzungsweise Anfang oder Mitte zwanzig. Etwa drei oder vier Jahre älter als ich. Wenn im großen Saal über die glorreichen Ritter des Feuerkönigs erzählt wurde, stellte ich mir ältere Männer mit mehr Erfahrung vor, die die Soldaten in die Schlacht führten und einen vernichtenden Sieg nach dem anderen gegen die Erdländer errungen haben.
»Wie dem auch sei«, murmelt er und schaut in den Wald, in den einige der Spuren führen. »Ich muss sie finden. Und du musst jetzt absteigen, Kleine.«
Panisch drehe ich mich so weit zu ihm um, wie es mir möglich ist. »Was? Du kannst mich nicht einfach zurücklassen!«
Er mustert mich, ohne dass ich in seiner Miene auch nur die kleinste Regung ausmachen kann. Wenn er mich als gefühlskalt bezeichnet hat - was ist dann er?
»Warum nicht?«, will er wissen. »Ich habe versprochen, dich aus dem Wald zu führen. Das habe ich getan. Ich habe dich sogar zu der Stelle gebracht, an der du verloren gegangen bist.« Er sieht sich um und nickt schließlich zufrieden. »Wir sind auf einer der Hauptstraßen. Früher oder später wird jemand vorbeikommen, der dich mitnimmt. Hier kommen immer mal Leute vorbei. Händler. Reisende.«
Erdländer, die mich versklaven wollen, vervollständige ich in Gedanken seine Aufzählung, beiße mir aber auf die Zunge, um es nicht laut auszusprechen. Wenn ich ihn gegen mich aufbringe, wird er mich erst recht zurücklassen.
Nackte Angst packt mit eisigen Klauen nach meinem Herzen. Ich schlucke angestrengt. »Aber ich … ich weiß nicht … wo ich bin und wohin ich gehen soll.«
Er seufzt tief, offenbar genervt von mir. »Mitnehmen kann ich dich auch nicht. Wenn ich die Erdländer verfolge, muss ich mich vielleicht anschleichen.« Für einen Moment verschwindet die Härte aus seinem Blick, als er mich ansieht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass ein weiches Funkeln in seinen Augen liegt, während er mein Gesicht betrachtet. Sofort beginnt mein Herz unstet vor sich hinzustolpern. »Das kann ich mit dir nicht. Du leuchtest im Wald heraus wie ein Signalfeuer.«
Ich weiß, dass er mein weißblondes Haar und die spitz zulaufenden Ohren meint. Und ich weiß auch, dass ich damit inmitten der braunen und grünen Waldumgebung auffallen werde. Abgesehen davon habe ich keinerlei Erfahrung im Spurenlesen oder Anschleichen. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass er sich einfach umdrehen und mich meinem Schicksal überlassen kann! Hier in der Fremde ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder einem feindlichen Krieger in die Arme laufe oder verhungere. Oder … Schnell schüttele ich den Kopf, als immer neue Schreckensszenarien in meinen Gedanken auftauchen.
»Nimm mich mit«, bitte ich. »Ich verspreche, ich werde dir nicht zur Last fallen.«
»Elora«, er lehnt sich vor, ist mir nun wieder ganz nah und tätschelt dem Pferd den Hals, »ist zwar ein sehr ausdauerndes Mädchen, aber auch sie wird mit zwei Reitern langsamer sein. Ich habe dich schon einmal gerettet. Sei dankbar dafür! Ich habe dich sogar aus dem Wald geleitet und meine Schuldigkeit einer hilflosen Maid gegenüber und damit meinen Eid mehr als erfüllt. Ab jetzt bist du nicht mehr mein Problem.«
Ich knirsche mit den Zähnen. Eingebildeter Mistkerl! Ausgeschlossen, dass er einer dieser sagenumwobenen Ritter der Feuerlande ist!
»Du sprichst von einem Eid«, entgegne ich und übergehe die Tatsache, dass er mich als Problem bezeichnet hat. »Erlaubt dir dieser Eid, eine junge Frau in Nöten einfach ihrem Schicksal zu überlassen?«
Er verengt die beeindruckend funkelnden Augen zu Schlitzen. »Wenn es um ein höheres Ziel geht, vielleicht. Solche Sonderfälle kommen in meinem Eid nicht vor. Aber ich nehme an, dass es wichtiger ist, die Prinzessin zu retten, deren Hochzeit mit meinem König eine Allianz gegen das Erdreich bilden soll, als einer Dienerin den Weg ins nächste Dorf zu weisen.«
Ich halte seinem durchdringenden Blick stand. »Wenn du sie findest, wirst du mich brauchen«, wende ich ein. »Die Prinzessin, meine ich. Sie wird dir nicht einfach folgen. Es sei denn, ich begleite dich. Ich bin ihre engste Vertraute. Und dann kannst du sie unversehrt zu deinem König bringen.«
Er schnaubt verächtlich. »Das könnte ich auch ohne deine Hilfe. Zur Not knebele ich sie und werfe sie über Eloras Rücken.«
Ich blinzele mehrmals. »Wie bitte?«
Er zuckt mit den Schultern. »Du hast mich schon verstanden. Und jetzt runter mit dir. Elora und ich müssen weiter.«
Am liebsten würde ich mir die Haare raufen oder ihm gleich an die Gurgel gehen. Vermutlich würde es auf Letzteres hinauslaufen. Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert: Wie er mit der Prinzessin verfahren will oder dass er tatsächlich plant, mich zurückzulassen.
Ich knirsche mit den Zähnen. Mein verdammter Stolz hält mich davon ab, ihn auf Knien anzuflehen, mich weiter mitzunehmen. Doch als ich aus dem Sattel gleite und meine Füße den harten Boden berühren, verkümmert mein Stolz zu einem leisen Stimmchen. Trotzdem schlucke ich jedes Betteln hinunter, das mir bereits auf der Zunge liegt.
»Dann sag mir wenigstens, wohin ich mich wenden muss, um in den nächsten Ort zu kommen.«
Mein Retter verzieht den Mund und schließt mit einem Seufzen die Augen. »Im Grunde musst du nur immer weiter der Straße folgen, aber wie gesagt, es wird eine Weile dauern, bis du zur nächsten Siedlung gelangst. Um die nächste zu erreichen, wirst du zu Fuß … etwa vier Tage unterwegs sein. Du solltest lieber warten und hoffen, dass ein Händler vorbeikommt. Um ins Dorf Brasania zu gelangen, müssen sie hier lang.«
Vier Tage. Ich kann mich jetzt schon kaum noch auf den Beinen halten und mein Magen knurrt so laut, dass mich Raubtiere im Umkreis von mehreren Hundert Metern hören müssen. Ohne Verpflegung oder eine Waffe, mit der ich mich im Notfall verteidigen kann, werde ich nicht weit kommen.
Flüchtig schaue ich zu den gefallenen Soldaten. Wie ich vermutet habe, haben die Erdländer ihnen die Waffen abgenommen. Nicht, dass ich damit etwas hätte ausrichten können! Aber ich würde mich … besser fühlen.
Ich wende mich um. Mir ist egal, dass der Fremde meint, hier würden des Öfteren Händler entlangkommen. Ich kann nicht einfach hier warten und hoffen, dass die Erdländer nicht doch schneller sind. Aber in welche Richtung soll ich gehen? Welche führt mich noch näher ans Erdreich, wohin ich auf keinen Fall will?
Ich muss einen solch bemitleidenswerten Anblick abgeben, dass sich mein Retter seufzend mit einer Hand durchs dunkle Haar fährt, bis es nach allen Seiten absteht. Die Abendsonne zaubert hellbraune Strähnen hinein, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind, nun aber meine volle Aufmerksamkeit fesseln und für einen Moment meine Wut auf ihn vertreiben. Mit dem zerzausten Haar sieht er jünger, beinahe spitzbübisch aus und wirkt gar nicht mehr wie der Ritter, der vor knapp einer Stunde im Alleingang die Erdländer besiegt hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch seine stoische Miene, aus der ich rein gar nichts herauslesen konnte, ist verschwunden. Nun wirkt er … zwar immer noch genervt, aber auch ein wenig … verletzlich? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, um ihn zu beschreiben. Vielleicht eher … hilflos?
Mit einem weiteren resignierten Seufzen reißt er mich aus meinen wirren Gedanken. »Schau, ob du hier wenigstens Schuhe für dich findest.«
Völlig verdattert starre ich ihn an. »Heißt das, ich darf …?«
»Ja«, brummt er unwirsch und weicht meinem Blick aus. »Aber beeil dich!«
Ich unterdrücke ein Jauchzen und mache mich daran, die durchwühlten Truhen nach Schuhen zu durchsuchen. Immer wieder schaue ich über die Schulter, um sicherzugehen, dass er mich nicht doch mutterseelenallein hier zurücklässt. Doch er bleibt auf seinem Pferd sitzen und observiert unsere Umgebung, als gehe er davon aus, dass wir jeden Moment überfallen werden.
Tatsächlich finde ich in einer Truhe das Paar Stiefel aus weichem Leder, das ich eingepackt hatte. Heilfroh darüber, dass sie die Erdländer nicht interessiert haben, schlüpfe ich hinein. Ein herrliches Gefühl, endlich wieder Schuhe zu tragen! Diese sind zwar alt und ausgetreten, aber gerade deswegen sehr bequem.
Während ich zu meinem Retter zurückeile, flechte ich mir das durch die Flucht in Unordnung geratene Haar neu, das mir offen bis zur Hüfte reicht. Wenn die Abendsonne darauf scheint, schimmern goldene Strähnen darin; normalerweise wirkt es aber beinahe weiß wie der Schnee in Fryske.
»Fertig!«, verkünde ich, als ich direkt vor ihm stehe.
Er beäugt mich von oben bis unten, bis ich kurz davor bin, mich unter seinem Blick zu winden. Wieder schlägt mein Herz schneller, als ein Funkeln durch seine Augen huscht. Eilig fixiere ich einen Punkt hinter ihm, um so das seltsame Gefühl in seine Schranken zu weisen. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass er mehrmals blinzelt, ehe er mir wortlos erneut seinen Umhang reicht.
»Ich sagte doch schon, dass das, was ihr hier als kalt bezeichnet, mir nicht …«
Mit einer knappen Geste schneidet er mir das Wort ab und murmelt etwas von »Eid«, während er mir weiterhin den Umhang hinhält und demonstrativ an mir vorbeischaut. Ich gebe mich geschlagen; wahrscheinlich ist es besser, nicht mit ihm zu diskutieren und mein Glück nicht weiter überzustrapazieren. Also werfe ich mir den Umhang über, der mir so lang ist, dass er fast auf dem Boden schleift. Aber er ist warm und riecht nach ihm.
»Komm.« Er streckt mir die Hand entgegen. »Solange wir noch ein bisschen Licht haben, will ich die Verfolgung aufnehmen und die Spur nicht verlieren.«
Ich lege die Hand in seine und bin überrascht, wie schwielig sie sich anfühlt. Sein Griff ist fest und sicher, als er mir aufs Pferd hilft. Wieder sitze ich vor ihm.
Und wieder bin ich mir seiner Nähe und Wärme mehr als bewusst.
Nach einem Schnalzen setzt sich Elora in Bewegung. Die braune Stute bewegt sich trittsicher durch das Unterholz des Waldes, in den die Spuren der Erdländer führen, aber trotz ihres sicheren Schritts bleibt ein gelegentliches Schaukeln nicht aus. Jedes Mal komme ich meinem Retter dabei so nah, wie ich es unter normalen Umständen nie zulassen würde. Und jedes Mal kribbeln die Stellen, die ihn berühren, auf merkwürdige Weise.
»M-Meinst du, wir können sie durch den Wald verfolgen?«, frage ich ihn, um mich von meinen wirren Empfindungen abzulenken. Ich möchte mich dafür ohrfeigen, dass ich stottere. Das ist doch sonst nicht meine Art …
Ihm muss es auch aufgefallen sein, denn er zögert mit einer Antwort. »Erdländer sind von kleinem Wuchs. Zu Fuß kommen sie nicht schnell genug voran, also sind sie meistens zu Pferd unterwegs. Und Pferde hinterlassen Spuren, denen wir folgen können. Aber … wir müssen uns dennoch beeilen.«
Ich drehe mich im Sattel halb zu ihm um. »Wieso?«
Seine Miene wirkt konzentriert. Oder verkniffen, ich bin mir nicht sicher. »Weil ich befürchte, dass es bald regnen könnte. Regen wird die Spuren verwaschen und wir hätten keinen Anhaltspunkt, wohin wir uns wenden sollen. Es wäre die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, vor allem, wenn sie bereits über die Grenze sind. Auch wenn sie die Prinzessin entführt haben, kann ich nicht einfach mir nichts, dir nichts ins Erdreich spazieren, wann immer es mir passt.«
Ich nicke. Zwar habe ich noch nie Regen gesehen, aber wenn er die Spuren verwischt, haben wir ein Problem.
Ich betrachte die Vielzahl an Spuren, die im Wald verlaufen. Die meisten stammen nicht von den Erdländern, einige überlagern sich, sodass ich nicht mehr sagen könnte, von welchem Tier sie stammen. Oder ob sie überhaupt von einem Tier sind.
»Diese Spuren«, murmele ich. »Bist du sicher, dass eine davon von der Prinzessin stammt?«
Er zieht hinter mir scharf die Luft ein und ich rechne bereits damit, erneut von ihm zurechtgewiesen zu werden.
»Warum fragst du?«, will er stattdessen wissen. Seine Stimme klingt dabei schneidend kalt.
»Nun ja«, druckse ich herum. »Ich … weiß nicht, ob sie sich einfach so hat gefangen nehmen lassen. Was ist, wenn die Erdländer ohne sie unterwegs sind? Wenn sie doch fliehen konnte, ohne dass uns ihre Spuren aufgefallen sind?«
»Das bezweifele ich.«
Ich knirsche mit den Zähnen. War ja klar, dass er nicht meiner Meinung ist.
»Aber«, setze ich erneut an, »haben wir denn einen klaren Hinweis, dass die Prinzessin tatsächlich bei den Erdländern ist?«
Eine Weile ist es still und ich befürchte schon, dass er mir gar nicht antworten wird. Doch dann murmelt er: »Nein.«
Ich halte die Luft an, wage es aber nicht, mich wieder zu ihm umzudrehen. Hat er … tatsächlich zugegeben, dass er sich unsicher ist?
»Doch das bedeutet nicht«, fährt er fort, »dass ich einfach irgendwo warte und hoffe, dass die Prinzessin allein zurückfindet. Ich will dich nicht anlügen. Als ihre Dienerin stehst du der Prinzessin sicher nah. Aber mit jeder verstreichenden Minute sinken unsere Chancen, sie zu finden. Vor allem, wenn die Erdländer sie doch in die Finger bekommen haben. Ihr Reich ist uneinnehmbar.«
Ich runzele die Stirn. »Kein Land und keine Burg ist uneinnehmbar.«
»Das Erdreich schon«, widerspricht er. »Schließlich haben wir es oft genug versucht. Unwegsames Gelände, kaum Vegetation. Nirgends kannst du eine Stellung bauen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie dir im zu weichen Boden versinkt. Ich habe Pferde und Reiter gesehen, die im Schlick untergegangen und nie wieder aufgetaucht sind.« Er stößt ein Schnauben aus und pustet einige meiner Haarsträhnen nach vorn. »Aber warum berede ich das überhaupt mit dir? Du bist eine Frau und hast von solchen Dingen keine Ahnung.«
Ich rolle mit den Augen. Diese und ähnliche Aussagen bin ich gewohnt. Das bedeutet aber nicht, dass sie mich nicht jedes Mal kränken.
»Habt ihr schon daran gedacht, einen Einheimischen nach dem Weg zu fragen?«, will ich wissen.
Mehrere Herzschläge lang ist es still hinter mir, ehe ein schroffes »Was?« ertönt.
Ich seufze übertrieben laut und bin froh, dass er mein Grinsen nicht sehen kann. »Wie in jedem Land, wird es auch im Erdreich Untertanen geben, die mit ihrem Dasein und dem Mann, den sie König nennen, unzufrieden sind. Für die richtige Summe sind sie vielleicht bereit, euch den Weg durch das unwegsame Gelände zu zeigen. Denn schließlich muss es einen Weg geben, wenn die Erdländer nicht selbst Gefahr laufen wollen, im Schlamm zu versinken.«
Erneut herrscht Stille. Ich habe kein Problem damit, mir seinen verdatterten Gesichtsausdruck vorzustellen. Wie gern würde ich ihn sehen!
»Das … das könnte ich niemals tun«, begehrt er schließlich auf. »Das ist …«