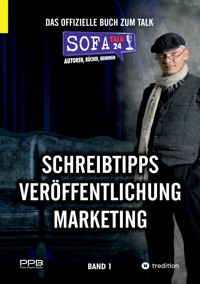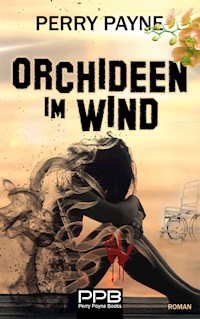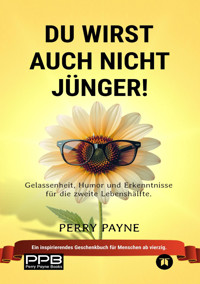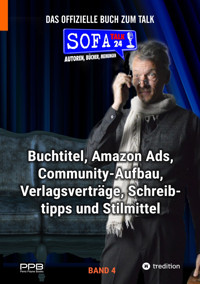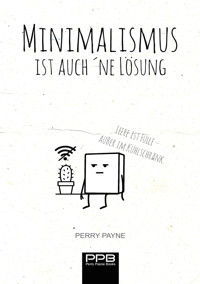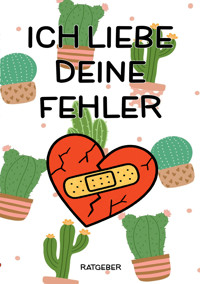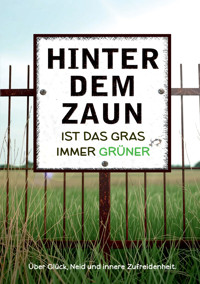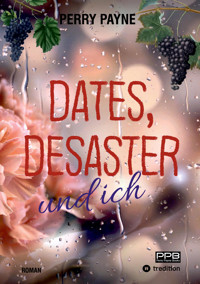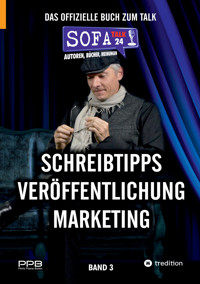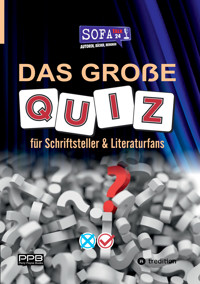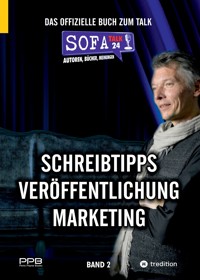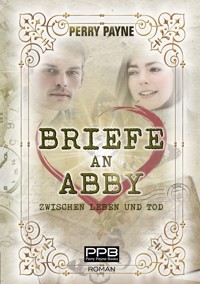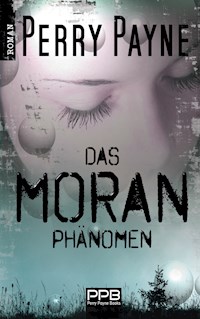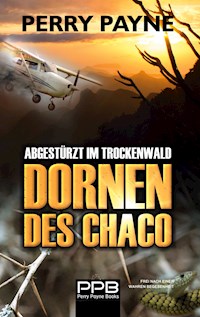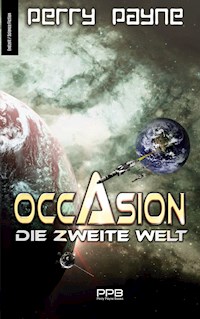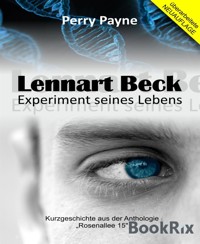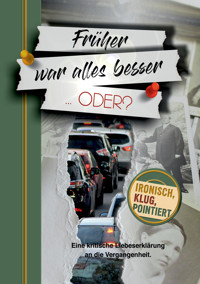
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Kindheit ohne WLAN aber mit Ahoi-Brause, Mofa und Fernseher mit drei Programmen. Dieses Buch lädt zu einer unterhaltsamen Reise in die Vergangenheit ein, als es noch Videokassetten, Sendeschluss, Aschenbecher in Autos, Willy Brandt und Honecker, Walkmans und zwei Mark Taschengeld gab. Es erzählt mit Augenzwinkern vom echten Leben mit warmen Händen, schrägen Erinnerungen und Einmachgläsern im Keller. Mit liebevollem Blick auf die Vergangenheit zeigt dieses Buch, was von gestern auch heute noch zählt und beschreibt den Wandel zum Heute. Ohne Verklärung oder Verteufelung, dafür mit Ironie, Herz und Verstand. Ein pointierter Rückblick auf die „guten alten Zeiten“, der nostalgisch ist und zum Nachdenken anregt – für alle, die das Gestern noch lebendig vor Augen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Perry Payne
Früher war alles besser
… oder?
Eine kritische Liebeserklärung an die Vergangenheit
IMPRESSUM
Ein Buch von PerryPayneBooks (PPB)
Cover und Satz: Perry Payne
Korrektorat/Lektorat: Perry Payne
Bilder: www.freepik.com, David Krüger von Pixabay
Druck und Vertrieb durch Tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg
1. Auflage / ISBN: Softcover 978-3-384-64279-0
• E-Book 978-3-384-64280-6
Alle Rechte liegen bei PerryPayneBooks
E-Mail: [email protected]
Verantwortlich im Sinne des § 55 Abs. 2 RStV: Stefan Maruhn, Würzburger Straße 32, 98527 Suhl
Copyright © 2025 Perry Payne & PPB Paraguay / Internet: https://perry-payne.de/
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung von PPB unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten, Meinungen und Ratschläge.
Perry Payne
FRÜHER
war alles besser ... ODER?
Eine kritische Liebeserklärung
an die Vergangenheit.
Dieses Buch ist ein Dank an das Gestern,
ein Lächeln für das Heute
und eine Einladung, das Morgen mutig mitzugestalten.
Vorwort
Die verklärte Erinnerung
Früher war alles besser. Die Sommer waren länger, die Sonne wärmer, die Kinder höflicher und die Milch gab es inklusive Laktose in Glasflaschen mit Aludeckel. Natürlich waren die Winter schneebedeckt, und zwar jedes Jahr, zuverlässig wie das Sandmännchen um 18:50 Uhr. Das waren keine grauen Pfützen mit Alibi-Schneeresten. Damals fiel der Schnee in Postkartenqualität.
Und die Brötchen! Ah, die Brötchen! Außen hart wie das Berufsleben und innen fluffig wie Omas Federbett. Nicht diese heutigen, aufgewärmten Kompromisse aus der SB-Bäckerei mit Namen wie „Ofenliebe“ oder „Krustenglück“, wo man beim Reinbeißen nie weiß, ob’s bröselt oder quietscht. Nein, früher waren Brötchen noch ehrliche Dinger.
Damals, als Opa morgens um halb fünf bei minus zwölf Grad zur Arbeit lief, weil er weder das Geld für Benzin hatte, noch ein Bus fuhr, hatte er Bewegung ohne Fitnessstudio.
Die Kinder waren jedenfalls artig. Zumindest behauptet das jede Generation. Man grüßte Erwachsene zuerst, auch wenn sie den Raum betraten, sagte brav „Guten Tag“ mit aufgesetztem Lächeln und schrieb Diktate mit Füller, nicht mit dem iPad. Tablets waren Tabletten, und die gab’s nur, wenn’s wirklich schlimm war. Apropos schlimm: Frechheiten galten nicht als Persönlichkeitsausdruck, sondern als: „Willste gleich ´ne Backpfeife?“- Material.
Die Auswahl der TV-Sender war übersichtlich, und das Highlight des Tages ein gutgemeinter Krimi oder die Hitparade. Kein endloses Scrollen durch 14 Streamingdienste, nur um dann doch wieder bei „Friends“ zu landen. Stattdessen gab es Sendeschluss und ein Testbild. Feierabend. Das Fernsehen wusste noch, wann Schluss ist. Das war ein Konzept, das Netflix bis heute nicht verstanden hat.
Und all das ist – man höre und staune – wunderbar falsch erinnert.
Denn natürlich war nicht alles besser. Es war anders. Der Schnee war vielleicht weißer, ja, aber er wurde auch mit bleihaltigem Benzin vollgequalmt. Die Brötchen waren frisch, weil sie niemand tiefgefroren importieren musste, aber eben auch alle gleich. Und die Kinder? Vielleicht waren sie artiger, weil sie Angst hatten. Vor den Eltern, vor Lehrern oder der Polizei. Vielleicht war das auch nur Respekt oder die Angst vor Bestrafung? Jedenfalls anders – aber besser?
Was bleibt, ist die liebevoll verklärte Halbwahrheit: ein Gefühl von Orientierung, Sicherheit und Klarheit. Das Gute an früher ist: Es widerspricht uns nicht. Es ruft nicht dazwischen. Es ist still und lässt sich so hervorragend mit Bedeutung aufladen.
Heute dagegen? Alles ist zu schnell, zu laut, zu kompliziert. Und überhaupt hat früher der Nachbar noch gegrüßt!
Aber Moment – war das wirklich so? Oder sitzen wir kollektiv auf einem nostalgisch gepolsterten Sofa und schauen durch eine rosarote Brille auf eine Vergangenheit, die es so vielleicht nie gegeben hat?
Psychologen nennen das positiven Erinnerungseffekt, Soziologen sprechen von Kollektivnostalgie. Und die Wissenschaft hat einen klaren Verdacht: Unsere Erinnerungen sind keine sachlichen Chronisten der Wahrheit, sie sind poetisch, faul und ziemlich wählerisch.
Dieses Buch geht der Frage nach, warum uns das Gestern oft goldener erscheint als das Heute und welche psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen uns dabei ganz unauffällig in die Falle tappen lassen. Mit freundlicher Unterstützung vom selektiven Gedächtnis, dem medialen Dauerrauschen und einer Prise Verdrängung im Detail.
Die Frage bleibt jedoch, ob uns bei der Erinnerung das Gedächtnis einen Streich spielt oder die gesellschaftlichen Zeiten sich tatsächlich zum durchschnittlich oder teils Schlechteren verändert haben. Wir gehen also ins Detail und verschaffen uns einen objektiven Rückblick im Vergleich.
Die Macht der Erinnerung
Warum Erinnerungen uns trügen
Erinnerungen sind wie alte Super-8-Filme. Sie sind unscharf, flackernd und erstaunlich gut darin peinliche Szenen zu überspringen, weil das Band geknickt ist. Wir erinnern uns selten an den Gestank im Schulbus, aber immer an den ersten Kuss (sofern er nicht ausgerechnet im Schulbus war).
Unser Gehirn ist dabei kein zuverlässiger Archivar, sondern eher ein kreativer Drehbuchautor mit Hang zum Dramatischen oder zum Kuscheligen. Es kürzt, glättet, vertuscht und dichtet dazu. Was bleibt, ist ein Best-of unserer persönlichen Vergangenheit mit sorgfältig ausgewählten Highlights, ein paar Retro-Filter drüber und allem, was wir an früher lieben. Der Rest ist elegant rausgeschnitten.
Neurowissenschaftlich lässt sich das ziemlich gut erklären. Erinnerungen sind keine Dateien, die wir abspielen, sondern Prozesse, die wir jedes Mal beim Abrufen neu konstruieren. Und dabei gilt, je öfter wir eine Erinnerung wiederholen, desto stärker verändert sie sich wie ein altes Foto, das bei jedem Angucken ein bisschen mehr verblasst, bis irgendwann auch Tante Erna aussieht wie ein freundlicher Nebel.
Also erinnern wir uns nicht nur falsch, wir erinnern uns auch selektiv. Was nicht ins aktuelle Selbstbild passt, wird freundlich aussortiert. Was dem Ego schmeichelt, bleibt. Was uns heute Angst macht, verklären wir zur „besseren Zeit“, also der Vergangenheit allgemein, in der es diese Angstauslöser einfach nicht gab.
Das ist nicht nur menschlich, sondern auch praktisch. Denn wenn die Gegenwart überfordert, flieht man eben kurz in frühere Zeiten. Dorthin, wo die Welt noch heil war, der Strompreis niedrig und das Kinderzimmer so aufgeräumt, wie Omas Geschirrschrank nach dem Frühjahrsputz. Allerdings nur im Rückblick und mit selektiver Erinnerung.
Die eigentliche Frage ist also nicht: Trügt uns unsere Erinnerung? Sondern: Warum gefällt uns das so gut?
Vergessen? Nie gehört.
Was Psychologie und Neurowissenschaften über selektives Vergessen und emotionale Färbung sagen:
Es ist schon seltsam: Wir vergessen, wo wir den Haustürschlüssel hingelegt haben, aber erinnern uns glasklar an das Pausenbrot von 1987, ein Graubrot mit Leberwurst, liebevoll in Alufolie oder Butterbrotpapier gepackt. Doch warum ist das so? Ganz einfach: Weil das Gehirn kein Aktenschrank ist, sondern eine Mischung aus Dramaturg und Schönfärber mit gelegentlichem Gedächtnisverlust.
Unsere Erinnerungen sind nämlich wählerisch. Sie behalten nicht, was wichtig ist, sondern was emotional knallt. Der peinliche Sturz auf der Abi-Feier? Bleibt. Der Name des netten Kollegen aus dem Zoom-Call? Weg. Psychologen nennen das „emotionale Färbung“. Je stärker ein Gefühl beim Erleben, also Scham, Glück oder Wut, desto langlebiger die Erinnerung. Der Rest? Wird aussortiert wie altes Gemüse im Kühlschrank.
Man könnte fast meinen, unser Gehirn hat einen schlechten Sinn für Prioritäten. Es merkt sich den Song, der beim ersten Liebeskummer lief, aber nicht den PIN der EC-Karte. Es erinnert sich detailreich an die Tapete im Kinderzimmer, aber nicht an den gestrigen Einkauf.
Erinnerungen sind nun mal keine neutralen Daten, sondern Erzählungen – und unser Hirn liebt Geschichten mit Gefühl, keine Excel-Tabellen.
Vergessen ist übrigens kein Bug, sondern ein Feature. Selektives Vergessen schützt uns vor Überforderung. Würden wir uns an alles erinnern – inklusive jeder E-Mail, jeder schlechten Laune und aller Mathetests der sechsten Klasse – würden wir uns morgens nicht mal mehr trauen aufzustehen. Also löscht das Gehirn. Heimlich. Und oft auch ganz gezielt.
Und genau deshalb ist es okay, wenn wir Omas Kartoffelpuffer zu Goldbarren verklären oder den ersten Kuss zur Liebesgeschichte des Jahrzehnts. Es ist ein menschlicher Schutzmechanismus, also ein innerer Filter für die Seele. Manche Dinge müssen nicht realistisch sein, um echt zu wirken. Manchmal reicht ein Geruch, ein Lied oder ein blasser Gedanke – und plötzlich steht man wieder im Flur von 1989 und riecht Apfelkompott. Verklärung ist kein Fehler. Es ist ein Stück Identität. Wir füllen Lücken, runden Ecken ab und romantisieren, was früher eigentlich nervig war. So wie Tante Inges Sonntagsbraten, der nur deshalb in Erinnerung besser schmeckt, weil er heute nicht mehr aufgetischt wird.
Was folgt daraus? Dass wir uns nicht immer auf unser Gedächtnis verlassen sollten, und dass die „gute alte Zeit“ vielleicht nur deshalb so gut war, weil unser Gehirn ein exzellenter Innenarchitekt ist. Einer, der die Vergangenheit renoviert, bis sie wohnlich wirkt.
Und weil unsere Gedanken und Erinnerungen niemand bewertet oder auf TikTok liked. Sie sind von keinem Algorithmus beeinflusst, nicht inszeniert, sondern roh, unvollkommen und dadurch wertvoll. Erinnerungen sind wie alte Videokassetten. Das Bild flimmert, die Farben sind seltsam und die Auflösung ist gering. Aber genau das macht den Charme aus. Denn sie gehören uns.
Aber hey, solange wir nicht vergessen, dass wir vergessen, ist ja alles in Ordnung. Oder?
Medien – oder wie es früher war
Wie Popkultur, Werbung, Film und Social Media unser Bild von „früher“ formen
Werbung hat uns schon vieles verkauft. Cola als Lebensgefühl, Waschmittel als Beziehungskitt und die Vergangenheit als Paradies. In Werbespots aus den 90ern war die Welt in warmes Licht getaucht, Kinder spielten barfuß im Garten und Familien frühstückten harmonisch, ganz ohne Handy oder ADHS. Damals war das Idealbild die „heile Welt“. Heute ist es: „Damals war die Welt noch heil“.
Auch die Popkultur hat kräftig an diesem Bild mitgemischt. Serien wie Stranger Things oder Dark funktionieren nicht nur durch spannende Plots, sondern durch Retro-Requisiten: BMX-Räder, Kassettenrekorder und bunte Tapeten. Selbst die Monster wirken irgendwie vertraut. Das ist kein Zufall, sondern Strategie: Nostalgie verkauft sich gut, besonders, wenn sie hübsch aussieht.
Dann gibt es noch Social Media. Die wiederum haben den Turbo gezündet. Auf Instagram sehen wir sorgfältig inszenierte Bilder von Retro-Kaffeemaschinen, handgeknotete Makramees, Springseile und Schallplattencover. Der Hashtag #throwbackthursday zeigt uns Woche für Woche eine aufpolierte Vergangenheit – und manchmal ein schlechtes Outfit von 2007, das wir heute als „vintage“ feiern.
Dabei geht Folgendes leicht unter: Die Vergangenheit ist oft eine Collage aus Erinnerungsfetzen, Werbung und Filmkulissen. Unsere Vorstellung vom „Früher“ wurde durch Medien gestaltet, von Bonanza bis Bionade. Und wir selbst machen fleißig mit. Jeder Filter, der ein Handyfoto wie eine Polaroidaufnahme aussehen lässt, ist ein kleiner digitaler Zeitsprung.
Kritisch wird es, wenn wir Medienbilder mit der Realität verwechseln. Wenn wir glauben, die 50er seien eine romantische Ära gewesen, statt eine Zeit voller gesellschaftlicher Enge, Hausfrauenideale und antiautoritären Frisuren. Oder wenn „früher“ automatisch mit „besser“ gleichgesetzt wird, nur weil es heute komplizierter aussieht.
Medien gestalten Erinnerung. Sie produzieren keine Wahrheit, sondern Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre sieht alles ein bisschen hübscher aus, solange man den Schwarz-Weiß-Filter nicht allzu wörtlich nimmt.
Wer heute zurückblickt, sieht selten auf die Wahrheit zurück. Stattdessen zappen wir uns durch eine Wunscherinnerung nach der anderen, die weichgezeichnet, leicht überbelichtet und mit einem sanften Retro-Filter daherkommen.
Die Werbung hat das längst durchschaut und ausgenutzt. Schon in den 80ern wurde nicht mehr nur verkauft, sondern verklärt. Alles war „wie früher“, „mit dem Geschmack der guten alten Zeit“ oder gleich „von Oma“. Die Tatsache, dass Oma bei 38 Grad in der Küche stand und den Schweinebraten zubereitete, während Opa im Unterhemd das Sonntagsbier öffnete, wurde dabei elegant verschwiegen.
Nehmen wir zum Beispiel den Caro-Kaffee. Der Werbeslogan „Der schmeckt sogar dem Mann!“ ist heute ein Paradebeispiel für fragwürdigen Humor und für Werbestrategien, die mit Rollenklischees hausieren gingen wie Marktschreier mit Spargel. Dass ein „Mann“ in den 80ern überhaupt einen koffeinfreien Kaffee probierte, war anscheinend schon ein Marketingwunder.
Langnese war da subtiler. „So schmeckt der Sommer“. Das war mehr ein Gefühl als Geschmack, mehr Erinnerung als Eis. Es war das Versprechen, das ein Capri oder Nogger nicht einfach nur gefrorenes Zuckerwasser war, sondern ein Ticket zur schönsten Kindheitserinnerung aller Zeiten. Keine Wespen, keine matschigen Tennisplätze, nur Sonne, Freundschaft und endloser Juli. Und vielleicht, dass der Nogger Choc regelmäßig die Zähne herausforderte. Egal. Damals hatte man ja noch Milchzähne. Oder die fetten Zahnspangen und kaum Wartezeiten für einen Termin beim Zahnarzt.
Dabei fällt mir Afri-Cola ein. Die ging gleich in die Vollen. Der Slogan „Sexy-mini-super-flower-pop-op-cola – alles ist in Afri-Cola!“ war eine nahezu künstlerische Explosion, begleitet von barbusigen Models, bewusstseinsverändernder Kamerafahrten und dem leisen Gefühl, man hätte versehentlich was geraucht. Der Spot wurde vom legendären Fotografen Charles Wilp inszeniert. Ein Mann, der Werbung offenbar als psychedelisches Gesamtkunstwerk verstand. Und siehe da: Es funktionierte. Bis heute haftet Afri-Cola dieser anarchisch-coole Hauch von „anders“ an. Quasi die Nostalgie mit Kohlensäure.
Meister Proper wiederum war der erste muskulöse Haushaltsgott. Ein blank rasierter Glatzkopf mit Ohrring, Waschbrettbauch und Allzweckreiniger. Heute würde er vermutlich mit Vanish Oxi arbeiten und 3 Millionen Follower auf TikTok haben. Damals war er ein Symbol für Kraft und Leute die beim Putzen aussehen wollten wie Superhelden. Es war eine progressive Botschaft mit starker Abgrenzung.
Und natürlich Persil, der Klassiker: „Da weiß man, was man hat.“ Ein Satz, der auch als Lebensmotto vieler Boomer gelten könnte. Persil versprach Beständigkeit, Sauberkeit und Kontrolle. Der Dreck ging raus, das Leben blieb weiß. Irgendwie war das Werbung wie ein Waschgang für die Seele.
Dann gab es noch die Popkultur. Auch die hat ganze Arbeit geleistet. Mit der Kult-Serie Stranger Things (seit 2016 auf Netflix), wurden die 80er aufpoliert wie eine alte Levi’s-Jeans. Doch was fehlt hier? Ganz einfach: Zahnspangen mit Drahtbügeln, Nikotingeruch in allen Textilien oder das elendige Spulen der Kassetten mit Kugelschreibern. Die echte Realität bleibt auch in dieser Aufbereitung der Vergangenheit draußen, wie beim Türsteher des Clubs der Nostalgie.
Gleiches gilt für Dirty Dancing. Wer nicht wenigstens einmal auf einer Party so getan hat, als würde er die „Hebefigur“ wagen, nur um am Ende beide Knie zu verlieren, der hat das kollektive Gedächtnis der 80er nicht betreten. Die Geschichte war einfach: Sommerliebe, Tanz, Klassenkampf light, Johnny als Heilsbringer. Und niemand fragte, ob die 17-jährige Frances mit dem 25-jährigen Tanzlehrer heute noch durch eine Drehbuchabnahme kämen.
Bleiben wir noch ein wenig bei den Filmen, denn hier gibt es eine Menge kultiger, ikonischer und prägender Highlights aus den 70ern, 80ern und 90ern. Wer kennt nicht E.T. – Der Außerirdische (1982), mit dem schrumpeligen Alien, das mit seinem Leuchtfinger Herzen berührte und Fahrräder fliegen ließ? Oder