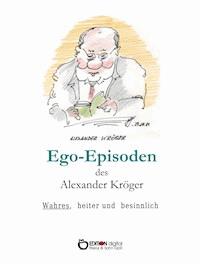8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In „Fundsache Venus“ entdeckt Wally 327 Esch als Überlebende einer Rettungsexpedition das geborstene Raumschiff, und sie findet Dirk, ihren Lebensgefährten, aus dessen toter Hand sie ein Souvenir entnimmt, das, so glaubt sie, für sie bestimmt ist. 18 Jahre hütet sie das Geheimnis dieses Geschenks. Dann berichtet sie dem Sohn Mark von der Operation in einem verlassenen Urwaldhospital und von Bea, einem Mädchen mit Tigeraugen ... Sie bürdet damit dem jungen Mann eine Verantwortung auf, die er allein nicht tragen kann. Maren 021 Call kämpft leidenschaftlich gegen die Entstehung von „Anderen“ auf der Erde und dem Mars. Sie fürchtet auf lange Sicht den Untergang des ursprünglichen Menschen. Alexander Kröger richtet in einer mitreißenden Handlung - in Sicht auf heutige Realitäten und Tendenzen wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung - das Augenmerk des Lesers auf die Verantwortung der Menschen für ihre Zukunft. INHALT: Souvenir vom Atair Andere
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Alexander Kröger
Fundsache Venus
Science Fiction-Roman
ISBN 978-3-95655-674-6 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Dem Buch liegt die 2. überarbeitete Auflage zugrunde, die 2012 im Projekte-Verlag Cornelius GmbH, Halle erschien. Es enthält die Neufassung von „Souvenir vom Atair“ (1985 erstmals erschienen im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig) und „Andere“ (1990 erstmals erschienen im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig).
© 2016 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Teil I: Souvenir vom Atair
1. Kapitel
Wenige Minuten nach dem Läuten verließen die Schüler das alte schmucklose Gebäude, verließen es so, wie alle Schüler dieser Erde Schulen verlassen: heiter, schwatzend, gemessen die einen, eilig andere.
In einer sich laut unterhaltenden Gruppe von Mädchen und Burschen schritt ein junger Mann, der auffiel. Er schien schlanker noch als andere, schlaksiger. Sein Kopf war deutlich größer als der seiner Altersgenossen, das Gesicht so glatt, wie es keine, auch nicht die sorgfältigste Rasur zuwege gebracht hätte. Ihm fehlte jeglicher Bartwuchs.
Der junge Mann schritt weitausholend, wiegend. An den Gesprächen beteiligte er sich nur gelegentlich. Als er mit der Rechten ein Insekt von der Stirn strich, tat er das mit einer vierfingrigen und daher überschlanken Hand.
An einer Kreuzung der Parkwege verharrte die Gruppe. Die jungen Leute verabschiedeten sich mit Floskeln wie: »Bis heute Nachmittag ...«, »... bis morgen!«, »... nein, ich gehe schwimmen.« Einige wollten sich am Strand treffen. Jemand fragte den jungen Mann: »Luchs, gehst du auch baden?« Nicht am schwarzen schweren Zopf, sondern an der Stimme erkannte man, dass es ein Mädchen fragte.
Er blickte sie aus Augen an, die seinen Spitznamen sofort verständlich machten. Diese Augen hatten eine goldgeflammte Iris und einen kleinen senkrechten Pupillenschlitz. Aber Gefährliches - wie bei einem Raubtier - lag nicht im Blick, eher etwas Erhabenes, Weitabgewandtes, etwas Anziehendes, Sanftes auch. »Ja«, antwortete er leise, zögernd.
»Holst du mich ab?«
Er verneinte. »Wir treffen uns unten - an unserer Stelle.«
Sie standen sich gegenüber, allein gelassen.
»Also«, sie fasste flüchtig seine Hand. »Um drei!« Sie lächelte ihn an. »Bis nachher, Mark!« Flott schritt sie davon, schlenkerte mit der Tasche.
Vor Mark erstand das besorgte Antlitz der Mutter. Obwohl er es vorher oft erwogen, aber nie eingehalten hatte, dieses Mal wollte er ihr wirklich nichts von seinem Rendezvous mit Li mitteilen.
>Dass ich im Vergleich zu meinen Mitmenschen ein wenig anders aussehe, ist kein Grund, mich nicht mit einem Mädchen, mit Li zu treffen! Und ein anderes Argument hat Mutter nicht. Meine Güte, wie viele Menschen haben einen sogenannten Geburtsfehler, und das trotz der ausgefeilten Methoden der Früherkennung. Gegenüber den Gebrechen anderer komme ich doch noch sehr gut davon!< Längst grübelte Mark nicht mehr über die Ursachen seiner äußeren kleinen Unterschiede zu männlichen Mitmenschen. >Ich sehe eben ein wenig anders aus, und bin mitnichten behindert, basta. Missbildungen, verursacht durch Medikamente, Umwelteinflüsse oder Strahlung, sind eingedämmt. Doch hie und da gibt es eben doch noch einen Fall. Ich bin einer! Noch nie habe ich den fünften Finger, den fünften Zeh vermisst. Es soll mir einer sagen, ich sei deswegen ungeschickter als andere. Und sehe ich etwa schlechter? Ägy hat ein braunes und ein blaues Auge. Niemand nimmt Anstoß daran. Und sollte sich morgen die Mode ändern, komme ich vielleicht groß heraus, wenn wenig Haar schick ist! Die Hauptsache ist doch wohl, dass Li mich mag - so wie ich aussehe, wie ich bin! Das wird Mutter akzeptieren müssen. Aber sicher ist nicht mein Aussehen der Grund für ihr Verhalten - nicht allein. Li wird schon richtig vermuten, sie meint, Eifersucht könne dahinterstecken, weil Mutter zu lange allein mit dem Sohn gelebt habe, ziemlich abgekapselt von der Umwelt. Freilich, es ist tragisch, in jungen Jahren den Gefährten verloren zu haben, mit dem man sich ein gemeinsames Leben erträumt hatte. Sie ist allein geblieben, hat sich auf den Sohn orientiert. Und nun, nach so vielen Jahren, wird ihr der Gedanke schwer, den Sohn möglicherweise mit einem anderen Menschen teilen zu müssen.<
Mark litt unter dieser Situation. Seine Mutter und er lebten zurückgezogen. Er hatte zwar die Schule, den täglichen Kontakt zu den Mitschülern, aber Gefährte und Freund war ihm bislang stets die Mutter gewesen. Denn je älter Mark wurde, desto mehr nahm er in seiner Klasse eine Sonderstellung ein. Seine schnelle Auffassungsgabe, sein phänomenales Gedächtnis, gepaart mit Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit, führten zu einer allgemeinen Achtung, ja beinahe Scheu, auf jeden Fall zur Dämpfung des altersgemäßen rüden Betragens der anderen ihm gegenüber. Nur im Sport brachte er es gerade noch auf durchschnittliche Leistungen. Hänseleien in den unteren Klassen hatte Mark längst verziehen. Sie waren es eigentlich gewesen, die seine Zuneigung zu Li ausgelöst hatten. Li hatte sich oft vor Mark gestellt, hatte Larry und andere geschickt in die Schranken gewiesen. Ihre besondere Zuneigung zu Mark wurde jedoch nicht offenkundig und sie so nicht Zielscheibe gutmeinenden Spotts. Als Mark es bemerkte, begann er ihr Tun zu beobachten. Zunächst belustigte es ihn, dann begann er Li zu bewundern.
Er suchte die Nähe des Mädchens.
*
Eines Tages hatte Li Mark einer Schularbeit wegen zu Hause aufgesucht, was sie bislang vermieden hatte. Mitten im Eifer, es waren sphärische Dreiecke zu berechnen, gewahrte Mark: Li hörte ihm offensichtlich überhaupt nicht zu. Statt dessen sah sie ihn unverwandt und lächelnd an. Er stockte, lehnte sich zurück, um sie besser anschauen zu können, und er fragte stark verunsichert: »Li ...?«
Da ergriff sie seine Hand, führte sie an ihr Gesicht, kuschelte ihre Wange hinein und lehnte den Kopf an seine Schulter.
Eine kleine Weile saßen sie so. Mark wurde es heiß und kalt. Er war überrascht, gleichsam überrumpelt. Es war unbeschreiblich, was er empfand. Er fürchtete, dass Li es spüren müsse. Und Freude, eine ungerichtete Freude durchrieselte ihn.
Mark strich Li sacht übers Haar, rückte behutsam von ihr ab, sah sie lange an, nahm ihr Gesicht zwischen die Hände und lehnte seine Stirn an die ihre. »Li«, sagte er leise. Und in diesem einen Wort, dem Namen, in seiner Stimme, schwang beglücktes Staunen ...
Auf einmal umfasste ihn Li spontan, schmiegte sich an ihn, küsste ihn auf die Wange und löste sich ebenso plötzlich von ihm. Sie sah ihn verschmitzt lächelnd an, strich sich eine Haarsträhne aus dem erhitzten Gesicht und sagte: »Deine sprichwörtliche Auffassungsgabe, Mark, ist sehr einseitig entwickelt!« Sie wies nachdrücklich auf den Aufzeichner vor ihnen auf dem Tisch, über dessen Schirm ein von Mark entworfener, von zahlreichen Linien und Großkreisen in Dreiecke zerlegter und mit Symbolen gespickter Globus flirrte.
Wenig später - ein Tablett mit zwei Gläsern Fruchtsaft tragend - betrat Marks Mutter, Wally 327 Esch, forsch das Zimmer. Sie warf, als sie die Getränke absetzte, verstohlen prüfende Blicke in die geröteten Gesichter der beiden jungen Leute. Flüchtig musterte sie auch den Aufzeichner, auf dem noch immer der Globus leuchtete.
Mark kam sich ertappt vor. Er versuchte, den Faden wieder dort aufzunehmen, wo er ihm durch Li so überraschend und aufregend abgeschnitten worden war. Auch Li konzentrierte sich erneut. Mark sagte, und es klang wie zerstreut und so, als fühle er sich gestört: »Danke, Mutter!«
Einen Augenblick noch stand die Mutter und blickte ernst auf die beiden jungen Menschen, die die Köpfe über den Aufzeichner hielten.
*
Man sah es Wally Esch beileibe nicht an, dass sie demnächst 50 Jahre alt sein würde. Die zahlreichen silbrigen Fäden im dunklen Haar wirkten interessant, fein, sie gaben ihr Reife. Die Wippfrisur stand ihr gut, passte zu den breitstehenden Augen, der kleinen Nase und dem volllippigen Mund, dessen weiße Zähne zum Haar kontrastierten. Lachte sie, ein fast lautloses, zurückhaltendes Lachen, fühlte man sich sogleich von offener, rückhaltloser Freundlichkeit umfangen.
»Also«, sagte sie, »ich gehe zum Dienst. Vergiss nicht, Mark, dass du in die Oper wolltest. Essen musst du vorher auch noch.«
Mark sah auf. »Ist gut, Mutter. Wir sind bald fertig.« Er hatte sofort ihren Vorbehalt gespürt, ihr Mahnen verstanden. Bis zum Beginn der Vorstellung blieben mehr als drei Stunden.
Wally Esch nickte grüßend, ging zögernd, so als ließe sie die beiden ungern allein zurück.
*
So hatte es begonnen.
Und seit jenem Tag war das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn verändert, so wie sich der Sohn verändert hatte. Die vordem unbefangene Herzlichkeit war einem freundlichen, aber nicht vorbehaltlosen Nebeneinander gewichen, das nicht ganz frei war von einer gewissen Bevormundung des Sohnes durch die Mutter. Dieser neue Zug ins Autoritäre, ganz fein zwar, aber merklich für Mark, war wahrzunehmen, wenn es um Li ging.
Wally versuchte zu lenken. Doch das, worauf sie bei ihrem Sohn bislang stolz war, was sie stets mit Freude empfunden hatte, kehrte sich jetzt gegen sie: seine Fähigkeit, kleinste Gefühlsregungen des anderen, Stimmungsumschwünge zu erspüren. Wally gewahrte schmerzlich: die alte Vertrautheit klang ab. Mark wandte sich mehr und mehr Li zu.
Schließlich entschloss Wally sich, dem Sohn zu begründen, weshalb ihr seine Zuneigung zu Li missfiel. Sie wies auf sein körperliches Anderssein hin. Dass sie nun plötzlich so argumentierte, schmerzte Mark am meisten und befremdete ihn zugleich. Hatte er als Kind gefragt, weshalb er nur acht Finger habe, hatte das die Mutter stets bagatellisiert, es sei kein Mangel, sei belanglos für sein künftiges Leben - was sich auch bestätigte. Die Menschen um ihn hatten ihn mittlerweile akzeptiert, niemand nahm Anstoß an seinen Augen, seinem Haarwuchs, seinen Händen. Ja, im Grunde waren es nur die Augen, die sofort auffielen. Wer zählt schon beim Nebenmann dauernd die Finger. Und dem Phänomen schütteres Haar kommen die Mediziner sowieso nicht bei! So gut wie vergessen schien das alles. Ausgerechnet die Mutter musste nun es wieder in den Vordergrund rücken.
Ihr zweites Argument: er sei für eine Liaison zu jung, begriff er überhaupt nicht. Er entgegnete ihr unumwunden, Emotionen seien wohl altersunabhängig. Li mochte ihn, wie er sei, was also solle alles Gerede. Schließlich lehnte Mark, je mehr die Mutter in ihn drang, den Dialog über dieses Thema ab. Er verstieg sich sogar zu dem Vorwurf - was Wally sehr schmerzte -, sie könne wohl deshalb nicht nachfühlen, weil sie nunmehr seit drei Jahrzehnten ohne Gefährten lebe. Andere empfänden eben anders.
Dennoch bemühten sich beide um Harmonie. Doch Unausgesprochenes gab es stets zwischen ihnen. Wally merkte es dem Sohn natürlich an, wenn er sich mit Li getroffen hatte. Er schien gelöst, verträumt auch, irgendwie glücklich. Das war der Grund, der sie einerseits in die Beziehung der jungen Leute mehr hineininterpretieren, sie intimer sehen ließ, als sie war. Andererseits geriet Wally mehr und mehr in Gewissensnot - von Mark wohl empfunden, obwohl er sich dafür nicht den geringsten Grund vorstellen konnte. Natürlich hätte sie den Sohn allzu gern glücklich gesehen, meinte aber, sich diesem Glück entgegenstellen zu sollen.
*
In dem Gewirr aus Zuneigung, Respekt und Dankbarkeit der Mutter gegenüber, aus Nichtverstehen ihrer Vorbehalte, wenn es um seine Liebe zu Li ging, verstrickten sich Marks Gedanken, als er an diesem Tag der Heimstatt zuschritt. Sein Entschluss, der Mutter diesmal nichts zu sagen, um sie nicht weiter zu beunruhigen, festigte sich.
*
Wally hatte, als sie mit Mark schwanger ging, ihren Beruf als Planetologin aufgegeben, war aus der Großstadt fortgezogen - unverständlich für die Freunde und Kollegen - und hatte eine Arbeit in einer Zweigstelle des Instituts für Lunare Metalllegierungen auf der Insel Sankt Kitts angenommen, als ungelernte Kraft. Das Einzige, was sie ein wenig mit der früheren Tätigkeit verband, war, dass in diesem Institut das auf dem Mond unter dessen geringerer Schwerkraft und fast atmosphärenfrei Erschmolzene auf seine Eigenschaften und Eignung als Substitutionsmaterial untersucht und ausgewählt wurde.
Wally hatte sich zur Kristallmikroskopie-Laborantin qualifiziert, und diese Tätigkeit befriedigte sie. Ihr freundliches, ausgeglichenes Wesen, ihr Fleiß brachten Wertschätzung, Freunde, einen kleinen Bekanntenkreis. Man respektierte, dass sie zurückgezogen lebte, hatte sich daran gewöhnt, dass sie Kontakt nur bis zu einer bestimmten Grenze wünschte. Anfangs hatte man gedeutelt, brachte ihr Verhalten mit der Andersartigkeit des Sohnes in Zusammenhang oder mit dem Tod des Gefährten, mit dem sie eine große Liebe verbunden haben sollte ...
Das war Jahre her. Man hatte sich in der kleinen Kolonie aufeinander eingestellt. Schließlich hatten alle, die auf dieser Insel einer Arbeit nachgingen, mehr oder weniger ihre eigenen Probleme.
*
Mark traf die Mutter zu Hause an. Sie hatte - wie des Öfteren - Unterlagen aus dem Institut mitgebracht und wertete sie aus. Sie saß im Halbdunkel, den Stereoprojektor vor sich, verglich Kristallstrukturen unzähliger Metallproben und ordnete sie ein.
»Hallo, Mark«, grüßte sie. »Hast du gegessen?«
»Doch«, antwortete er. Er stand vor ihrer Projektionswand und versuchte ein System aus den verwirrenden Gitterlinien herauszulesen. »Aber ich könnte noch etwas vertragen, es gab Menga, fad zubereitet außerdem.«
Wally lachte. »Das trifft sich. Ich habe ein paar echte Steaks mitgebracht. Sie sind vorbereitet. Brauchst nur den Grill einzuschalten.«
Während Mark das Fleisch briet, trat Wally zu ihm, sah dem Sohn eine Weile zu, sagte dann obenhin: »Ich muss heute Nachmittag hinüber nach Charleston, dienstlich. Ich denke, wir fahren gegen sechzehn Uhr mit dem Schnellboot. Zu tun habe ich höchstens eine Stunde, dann könnten wir ein wenig bummeln, einkaufen.«
In Mark regte sich sofort Abwehr. Zu oft sorgte die Mutter in der letzten Zeit für gemeinsames Tun. Früher wäre es ihm nicht eingefallen, ihr scharf zu entgegnen. Doch nun musste er sich beherrschen, um nicht aufzubrausen. So erwiderte er lediglich abweisend: »Ich komme nicht mit.«
Die Mutter fühlte sich durchschaut, biss sich auf die Lippen und sah zu Boden. Mark befasste sich mit den Steaks.
»Hast du etwas vor?«, fragte sie gewollt behutsam und sah ihn von unten her an.
»Ja.«
»Mit Li wieder ...!«
Nur eine Sekunde zögerte Mark. »Ja!« Es klang patzig und verbindlich.
Sie schwieg, kehrte aber nicht wieder an ihre Arbeit zurück. Sie sah dem Sohn zu, wie er das Steak aß, ohne rechte Freude am seltenen Genuss. Und auf einmal tat es ihr leid, diese Unlust verursacht zu haben. In diesem Augenblick wurde es Wally Esch bewusst, sie würde so nichts, gar nichts erreichen. Der Spalt zwischen ihr und dem Sohn würde sich vergrößern. Und ein weiteres Mal setzte sie an, sich Mark völlig zu offenbaren, ihm rückhaltlos erklären, ihn einweihen ... >Er hat das Recht darauf, zu wissen!< Aber auch das hatte sie sich schon hundertmal vorgenommen - immer wieder. Stets fielen ihr die gleichen Gegenargumente ein: >Der Sohn ist zu jung. An seinem Anderssein hat er ohnehin genug zu tragen. Und du, Wally, kannst du es noch verkraften? Ich konnte nicht ahnen, dass er bereits in diesem Alter eine Gefährtin wünscht. Musste ich nicht annehmen, dass er wie andere noch fünf bis zehn Jahre damit warten würde? Nein, Wally! Das sind Ausreden! Gerade, dass er sich verhält wie andere, kannst du am allerwenigsten annehmen! Nichts überstürzen!
Aber wie soll Mark ein Vermächtnis erfüllen, wenn er davon nichts weiß, Wally, wenn du dich ihm nicht mitteilst? Er kennt nur Versionen, die alle kennen. Die vereinsamte, vergrämte Mutter, das gezeichnete Kind ...
Eine Liebelei, etwas Vorübergehendes ...!
Aber so von Herzen glaubst du nicht mehr daran, Wally. Es wäre deinem Sohn auch nicht gemäß. Ich hoffe auf eine Lösung, die mich nicht zum Letzten zwingt.<
Nachdenklich begab sie sich an ihre Arbeit zurück.
*
Mark kam zu früh zum Treffpunkt, einer Felsgruppe oberhalb des Strandes. Die Steine bildeten ein Rondell, das so viel Boden festhielt, dass kurzes Gras und Moose gediehen, eine Wanne gleichsam, die den steten Wind von See her abhielt und das Sonnen auch an kühlen Tagen gestattete.
Mark lehnte am Fels, hielt die Augen geschlossen. Die andauernden Vorbehalte der Mutter zermürbten. Er litt unter dem gespannten Verhältnis, wünschte sich die Zeit zurück, als sie wie gute Freunde lebten. Aber das war vor Li. Und ein Zurück, wenn es das überhaupt gäbe, wäre ein Leben ohne die Freundin. Schmerzhaft wurde er sich bewusst: Wenn zwischen der Mutter und Li zu entscheiden wäre, ohne zu zögern schlüge er sich zu Li. Aber bewusst war er sich auch, er würde dann nie völlig glücklich sein. Mark wünschte sehr, es möge zu einer solchen Entscheidung nicht kommen, die Mutter gäbe die unverständlichen Vorbehalte gegen Li auf, und sie könnten zu dritt harmonisch leben. Im Augenblick aber wusste Mark nicht, wie es in diesem Spannungsdreieck weitergehen könnte. Er fürchtete, das Missverhältnis zur Mutter würde ihn so belasten, dass darunter auch ungewollt seine Beziehung zu Li litte.
Schon als Lis Gesicht über dem Steinwall auftauchte, glaubte Mark etwas Fremdes darin zu bemerken, etwas, das er in dem vertrauten Antlitz bisher nicht festgestellt hatte, ein ungewöhnlicher Ernst, Traurigkeit ... Aber in der nächsten Sekunde war dieser Eindruck verwischt, schien Li die alte.
Mark ging ihr einige Schritte entgegen, nahm ihre Hände, und sie zog ihn über den Wall. »Mir ist so warm, komm ins Wasser!« Sie ließ die Kleider fallen und sprang voraus, wäre im Geröll beinahe gefallen, lachte und warf sich in die Wellen, dass das Wasser aufspritzte.
Mark sah Li vor sich gegen die Sonne, eingehüllt in eine silbrige Tropfenaureole. >Was ist mit ihr? Ganz selten taucht sie so ins Wasser. Im Gegenteil, sie dehnt sonst den Körper, zieht ihn in die Länge, dass die Rippenbögen arg hervortreten, um das Wasser möglichst langsam an sich empor kriechen zu lassen.<
Beim Hinausschwimmen rekapitulierte Li die Mathematikstunde vom Vormittag, und sie parodierte die Verlegenheit Grapers, des Lehrers, als er in der 14. Zeile einer komplizierten Formelableitung feststellte, ihm wäre in der zweiten ein Fehler unterlaufen.
Mark lachte. Er sagte nicht, dass er diesen Fehler vorzeitig entdeckt, aber Graper nicht aufmerksam gemacht hatte, um die Mitschüler nicht um das Vergnügen zu bringen, den Lehrer verwirrt zu sehen.
Sie tollten ausgelassen im Wasser, und Mark vergaß abermals, dass ihm Li verändert vorgekommen war an diesem Nachmittag.
Nach geraumer Zeit schwamm Li zurück, legte sich auf den Strand und ließ sich von den Wellen umspülen.
Mark setzte sich zu ihr, sie schwiegen, blickten in den Horizont. Mark bohrte mit den Zehen Löcher in den Sand, die die nächste Welle einebnete.
Dann sagte Li: »Komm ...!« Sie nahm seine Hand, und sie stiegen die Küste hinan.
Als sie den Steinwall überschritten hatten, lehnte sie sich an Mark, legte die Arme um ihn, den Kopf an seine Schulter.
Mark durchrieselte es heiß. Mit jeder Faser seines Körpers spürte er: Es war anders als sonst, es war etwas Besonderes geschehen. Er fühlte Lis Erregung. Behutsam zog er sie enger an sich, strich ihr zärtlich übers Haar, hauchte: »Li ...«
Li flüsterte zurück: »Komm, Mark«, und sie ließ sich in das dichte Gras sinken.
Später, als sie gelöst nebeneinander lagen, sagte Li plötzlich mit rauer Stimme: »Die Eltern wollen es nicht, Mark!«
Und sofort verstand er. Er drückte Li an sich, küsste sie aufs Haar, und nach einer Weile sagte er: »Wir haben uns, Li!« Er hielt ihre Hand ganz fest, drückte die Finger.
Li richtete sich auf, blickte in sein Gesicht: »Ja, Mark.« Und sie zog ihn an sich und küsste ihn.
*
Tags meldete sich Wally Esch beim Leiter des Institutes.
411 Kraszan blickte erstaunt, lud Wally in die Sesselecke, bot ihr Yucci und blickte sie dann erwartungsvoll an.
»Ich will ..., ich muss weg von hier, Rocco!«, erklärte sie rundheraus und fügte hinzu: »Es ist wegen Mark. Ich weiß, das ist vielleicht unverständlich ...« Sie brach ab.
Kraszan schwieg. Er trank von seinem Fruchtsaft, sah ab und an auf seine Besucherin. »Du hast es dir gut überlegt?«
Wally nickte nachdrücklich.
»Ich brauche dir nicht zu versichern: Es tut mir, es tut uns sehr leid, wenn du gehst. Aber wenn du es - musst.. Ich lege dir keinen Stein in den Weg. Doch versteh es wer will.«
»Danke, Rocco!« Wally räusperte sich. »Es fällt mir nicht leicht, glaube mir!«
Es entstand eine Pause.
»Wohin willst du?«
»Ich würde gern im Institut bleiben, wenn es geht. Kannst du mich unterstützen? Mich würde ...«, Wally zögerte, »eine Arbeit in unserem Stützpunkt auf Gunungapi interessieren.«
Rocco Kraszan atmete erleichtert auf »Da verlässt du uns ja gar nicht! Egoistisch sollte ich nicht sein, andere brauchen auch gute Leute. Aber ausgerechnet in diesen Krähwinkel?« Er schüttelte verwundert den Kopf. »Natürlich unterstütze ich dich, und ich denke, es wird gehen. Wann möchtest du?«
»Zum nächsten Ersten - wegen der Ferien.«
»Schon!« Kraszan seufzte. »Gut, ich spreche mit der Leitung.«
»Da ist - noch etwas, Rocco ...« Wally zögerte abermals. »Entschuldige. Könnte es - nach außen so aussehen, als müsste ich aus dienstlichen Gründen versetzt werden? Als müsstet ihr mich, im Interesse des Instituts, von einem solchen Schritt überzeugen? Es läge mir sehr viel daran.«
Kraszan zog die Stirn in Falten, wiegte den Kopf. »Wally, Wally«, sagte er, und es klang wie beschwörend, »hoffentlich machst du das Richtige. Ich - wir haben immer geglaubt, du würdest mehr Vertrauen zu uns finden. Gespürt hat es jeder, dass dich etwas bedrückt. Aber natürlich ist es deine Sache.« Dann lächelte er. »Ja, auch das lässt sich natürlich arrangieren.«
»Danke!« Wally erhob sich, reichte Rocco die Hand. »Es geht nicht in erster Linie um mich, es geht um Mark. Verzeih!«
»Alles Gute, Wally!«
Als sie an der Tür war, rief er: »Aber um eine Abschiedsparty kommst du nicht herum!«
Wally lächelte, hob die Hand, nickte. »Versteht sich.«
2. Kapitel
Sie verließen mit der Urlauberjacht des Instituts ihre langjährige Wohnstatt.
Mark hatte zunächst kein Wort verloren, als die Mutter ihm offenbarte, die Institutsleitung hätte sie gebeten, eine Tätigkeit auf Gunungapi anzunehmen, man würde dem sehr viel Wert beimessen. Sie freue sich darauf. Zum nächsten Ersten ...
Mark war ans Fenster getreten, hatte lange schweigend hinausgestarrt.
»Wohnen werden wir dort ähnlich wie hier ...«
»Das ist ja sehr wichtig«, hatte Mark dann bitter und traurig zugleich erwidert, ohne sich der Mutter zuzukehren. Mit der Stirn lehnte er am Fensterrahmen.
Wally hatte es einen Stich gegeben. Der Zweifel, ob sie so Mark wieder ganz für sich gewänne oder - gänzlich verlöre, nagte an ihr. Am meisten aber litt sie darunter, dass er von dieser einschneidenden Veränderung überhaupt nicht mehr sprach und sich offenbar nicht im Geringsten für das Neue interessierte. Er hielt sich in der Freizeit kaum zu Hause auf, kam abends spät und ging früh - lange vor Unterrichtsbeginn. Sie sprachen nur das Nötigste miteinander, nicht unfreundlich, aber Mark blieb zurückhaltend.
*
Das Schiff legte bereits um fünf Uhr morgens ab. Mark stand wie abwesend am Heck. Wally trat zu ihm, wagte nicht, ihn anzusprechen. Die Maschinen ließen die Jacht zittern. Unten quirlte Wasser.
Sie hatten schon einige 100 Meter seewärts zurückgelegt, da erst erblickte Wally die einsame Gestalt vor der noch tiefstehenden Sonne am Pier.
Mark lehnte mit steinernem Gesicht an der Reling und starrte hinüber, rührte sich nicht ...
Wally traten Tränen in die Augen. Sie legte ihre Hand auf die des Sohnes, die das Geländer umkrampfte.
Später, als sich undurchsichtiger Dunst zwischen sie und den Hafen geschoben hatte, der Wind Gischt über das tiefliegende Heck trieb, fasste Wally den Sohn um die Schulter und sagte leise: »Komm, Mark ...«
*
Als nach drei Tagen Seereise die Insel vor ihnen auftauchte, Wally und Mark als Einzige mit ihrem Handgepäck auf Deck standen und erwartungsvoll nach vorn blickten, schien die alte Harmonie zwischen ihnen wieder hergestellt. Wally hoffte, die neuen Eindrücke, neue Freunde würden bald Marks Wunde vernarbt haben.
Sie sah den Sohn von der Seite her an. Er war wohl noch schmaler geworden. Sein Blick hing an der malerischen Insel, an den bewaldeten Hängen der erloschenen Vulkane. Es schien, als sei Mark schon jetzt von der Exotik des Eilandes gefangen. »Warane, Mutter, sagst du, leben hier noch wild?«
Wally nickte glücklich. »Wieder. Es ist rigoros verbannt worden, was einst die Natur geschädigt und verschandelt hatte. Es gibt hier keine Industrie - ein paar Institute, Wohnungen, Dienstleistungsstätten ... zwanzig- bis dreißigtausend Menschen leben hier.«
Die Maschinen der Jacht stoppten. Matrosen machten die Barkasse klar. Deutlich scholl das Rollen der Brandung von Gunungapi herüber.
»Dort oben in den Hängen - siehst du die hellen Flecke? - dort liegt die Wohnsiedlung.«
Auf Marks erstaunte Bemerkung, sie kenne sich, ohne jemals hier gewesen zu sein, offenbar gut aus, antwortete Wally nicht. Sie nahm eilig das Gepäck auf und lud es in das Boot.
Später, als die Barkasse um eine Landzunge bog, hielt es Mark nicht mehr auf dem Sitz. Aufrecht sah er nach vorn. Ein vorgelagertes Riff brach die Wellen, die sich wie wütend auf dieses Hindernis stürzten. Aus der Bucht heraus streckte sich der Pier weit ins Meer. Palmen wippten im Seewind. Im Schutz des Damms tummelten sich Menschen mit Brettern auf den noch immer beachtlich hohen Wellen, andere spielten Ball auf dem breiten Sandstrand. Vor einem kräftig-blauen Himmel standen plastisch die Vulkankegel. >Brächte das ein Maler auf die Leinwand, man würde es für Kitsch halten<, dachte Mark. Er konnte es nicht erwarten, das neue Ufer zu betreten.
Erst spät abends vor dem Einschlafen dachte Mark sehnsüchtig an Li, und es wollte ihn der Jammer überkommen. >Wie wundervoll wäre es, erlebten wir Gunungapi miteinander, kosteten die Schönheit der Insel gemeinsam ... Ein schönes Erlebnis ist erst dann vollkommen, wenn man es mit dem liebsten Menschen teilt ...<
Aber im Grunde fühlte Mark sich optimistisch gestimmt. >Was bedeuten in der heutigen Zeit schon einige tausend Kilometer. Man muss ja nicht mit dem langsamen Schiff reisen.< Das Eiland wurde dreimal wöchentlich angeflogen, hatte er erkundet. >In weniger als zehn Stunden kann ich bei Li sein oder sie bei mir. Und ich stehe zu meinem Versprechen: Wird die Sehnsucht unerträglich, werden wir ein Wiedersehen organisieren. Man kann sich auch auf halbem Wege treffen ... Gleich morgen schreibe ich Li.< Mark bedauerte, dass man einiges Moderne hier abgeschafft oder gar nicht eingeführt hatte. Videofonate waren ausgeschlossen, und problemlos telefonieren konnte man nur in dringenden Fällen oder dienstlich. >Auch das wird uns nicht erschüttern.< Mit diesem zuversichtlichen Gedanken schlief Mark ein.
*
Wally Esch begann ihre neue Tätigkeit mit 20 Tagen Urlaub. Da Mark Ferien hatte, sollte diese Zeit zum Einleben, Erkunden der Insel genutzt oder faul verbummelt werden.
Beiläufig hatte Wally angekündigt, sie wolle auf einer der Touren gern feststellen, ob sich eine frühere Bekannte noch hier befände. Diese hätte vor Jahren hier im Gesundheitswesen gearbeitet. Crini Kuryn sei eine amüsante Person ...
Mark sog alles Neue in sich auf. Er konnte stundenlang dem Zirpen und Schnarren der tropischen Tiere lauschen oder nistenden Vögeln zusehen, die Einheimischen beim Ernten der Palmenfrüchte ebenso beobachten wie die geschickten Wellenreiter. Abends teilte er in langen Briefen Li seine Eindrücke mit, was Wally zwar mit einigem Unbehagen registrierte, aber sie hütete sich, alte Vorbehalte wieder auszugraben. Es erschien ihr verständlich, dass man sich noch eine Weile aneinander erinnerte, anders hätte sie den Sohn auch nicht erleben wollen ...
*
Wäre nicht all das Neue gewesen, Mark hätte sicher bemerkt, die Suche nach der früheren Bekannten war überflüssig. Wally kannte die medizinische Forschungsstätte, in der jene Crini Kuryn arbeitete, und wusste die Wohnadresse. Doch Mark schöpfte, abgelenkt, keinerlei Argwohn.
Wally hatte für die Tour ein Auto besorgt, das ein steinalter einheimischer Mann steuern konnte, und diesem bereitete es offenbar Vergnügen, die Neulinge zu kutschieren. Es traf genau Marks Geschmack, und das allein schon machte ihm Mutters Bekannte sympathisch.
*
Der Elektromotor summte leise, der Fahrtwind spielte in den Haaren. Mark genoss, und Wally, deren Herz bis zum Hals klopfte, ließ sich zeitweise von ihm ablenken. Sie machten sich bald gegenseitig auf allerlei Sehenswertes aufmerksam.
Die Straße wand sich spiralig um einen der Vulkankegel. Schwand rechts das Gebüsch, tat sich ein einmaliges Panorama auf, begrenzt vom gischtumhäkelten Meer ... Später bog der Wagen von der Hauptstraße ab und hielt nach einer Kurve vor einem in den Hang hineingebauten flachen Haus mit ausladender Terrasse, die in einen verwilderten Garten ragte.
Mit weitgeöffneten Armen stürzte ihnen von dorther eine Frau in einem wehenden Gewand entgegen: Crini 187 Kuryn. Mark erkannte sie nach Mutters Beschreibung sofort. Sie war schlank, hatte ein schmales Gesicht mit großen, weit auseinanderstehenden Augen, dazu gekräuseltes, dunkles Haar.
Die beiden Frauen umarmten, drückten sich, wechselten freudige Worte.
Dann löste sich Crini von Wally, wandte sich Mark zu, fasste ihn an den Schultern, sah ihm aufmerksam ins Gesicht, trat dann einen Schritt zurück, musterte ihn von oben bis unten. »Du bist also Mark«, stellte sie überflüssigerweise fest. »Willkommen, Junge!« Ihre Stimme hatte einen Unterton, mit dem Mark nichts anzufangen wusste. »Gut siehst du aus.«
»Naja«, erwiderte Mark, aber er lächelte und hob seine Rechte, dass Crini die vier Finger bemerken musste, deutete auf seine Augen, strich übers schüttere Haar.
Jetzt lächelte Crini hintergründig, und sie winkte ab.
Mark hatte das Gefühl, sie sei nicht im Geringsten überrascht. Sonst zuckte meist ein leichter Schreck über das Gesicht dessen, dem Mark zum ersten Mal gegenüberstand. >Aber es ist ja möglich, dass sie es gewusst hat<, dachte er. >Mutter wird es ihr früher einmal mitgeteilt haben ...<
Crini bestand darauf, dass die Gäste über Nacht blieben, was Wally sofort annahm. Sie vereinbarten mit dem Fahrer einen Zeitpunkt, zu dem sie tags darauf abzuholen wären.
Erst als sie auf der Terrasse Platz genommen hatten, fragte Wally: »Deine Leute, Crini, wo sind sie?« Die Frage klang unangemessen nervös, fand Mark.
»Ich erwarte sie jede Minute ...« Crini sprach das nachdrücklich, blickte betont auf Mark, wie abwägend, dann zu Wally. Eine stumme Frage.
Fast unmerklich schüttelte Wally den Kopf.
Mark entging das stille, merkwürdige Einvernehmen der beiden Frauen nicht. Er war plötzlich sehr aufmerksam.
Nach kurzer Zeit ließ sich näher kommender Hufschlag vernehmen.
»Das sind sie!«, rief Crini. Es klang wie >es geht los< vor einem mit Spannung erwarteten Theaterstück. Sie stand auf, ging ein, zwei Schritte dem Geräusch entgegen, wandte sich dann zu Wally, verharrte.
Mark fühlte sich, zuerst durch das Getue der beiden Frauen und jetzt durch diesen merkwürdig nuancierten Ausruf Crinis, eigenartig erregt.
Um die Hecke bog ein braunes Pferd, auf dem lässig ein großer Mann saß, dessen Gesicht, aus dem lediglich Zähne und das Weiß der Augen hervor schimmerten, ein breitkrempiger Hut überschattete.
Dem großen Pferd folgten ein Shetland-Pony, das ein Mädchen von vielleicht fünf Jahren trug, und ein Esel, auf dem ein ebenso alter Junge saß.
»Unser Besuch ist da!«, rief Crini den Ankommenden entgegen.
Mark starrte auf das Mädchen, das jetzt nahe an ihn heranritt und das Tier knapp vor ihm zügelte - mit Händchen, die vier Finger hatten. Er sah der Kleinen fassungslos ins Gesicht. Ihre Augen blickten mit goldgeflammter Iris und senkrechtem schwarzen Pupillenschlitz.
Der Junge, der ebenfalls angehalten hatte und ihn mit offenem Gesicht anschaute, hatte große blaue Augen und seine Hand fünf Finger.
Da wies Mark mit beiden Händen auf das Mädchen, drehte sich hilflos halb um, dorthin, wo er die beiden Frauen wusste, und rief: »Mutter ...!« Aber noch während er den Ruf ausstieß, begriff er: Dieses Kind war für Wally nichts Überraschendes, sie hatte davon gewusst, hatte das Zusammentreffen natürlich arrangiert. Das merkwürdige Einverständnis zwischen den beiden Frauen, das schnelle Auffinden der Crini Kuryn, der gesamte Wechsel auf diese Insel...?
Aber angesichts des Kindes war Mark bereit, die Heimlichtuerei zu verzeihen. Wally hatte vollendete Tatsachen geschaffen, vielleicht das Beste so.
Wally und Crini hielten sich umfasst und sahen lächelnd auf die beiden. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Frauen im Bunde waren, dieses Bild lieferte ihn.
Crini nickte Mark aufmunternd zu. Da reichte er dem Kind die Hand und half ihm vom Pferd.
»Ich kann alleine absteigen«, maulte es ein wenig vorwurfsvoll.
»Ich glaub es dir«, entgegnete Mark lächelnd. »Aber es muss wohl nicht sein, wenn ich da bin.«
Die Kleine lachte fröhlich. »Komm, ich zeig’ dir Lacky!«
»Wer ist Lacky?«
»Na, unser Waran!« Sie fasste Mark an der Hand und zog. Plötzlich stutzte sie, betrachtete diese Hand, wendete sie hin und her und rief dann zu dem Jungen auf dem Esel: »Siehst du, Tommy, du Doofer. Es gibt noch viele solcher Hände. Wie Mutti sagt! Kannst du zählen, vier Finger, ätsch! Und solche Augen hat der auch.«
Der Junge machte erhaben und abwinkend »Ph!« und rief: »Mutti, wir haben Hunger!«
Crini sagte, zu dem Mädchen gewandt: »Der heißt Mark, Bea! Der Kaffee wartet auf euch, Tom! Kommt!«
Die Kleine aber zerrte Mark unerbittlich an dem Mann vorbei. Der streckte seine behaarte Rechte vor und sagte: »Hallo, Mark, willkommen!«
Mark erhaschte die Hand, drückte sie flüchtig, lachte und deutete auf Bea, die ihn ungeduldig hinter das Haus zog.
*
Zwei Tage später, abends, schrieb Mark an Li: >...eine wunderbare Duplizität der Ereignisse: Mutter hat mich mit einem Mädchen zusammengeführt, Bea 188 Kuryn, das die gleichen Abnormitäten hat wie ich! Du kannst dir denken, wie mich das überrascht. Ich sehe Deinen erhobenen Zeigefinger: Bea ist fünf Jahre alt! Ja, freilich, Mutter hat es gewusst. Ich glaube, es sollte eine Art Trost für mich sein, zu zeigen, es ergeht anderen ebenso wie mir, und ich bin ein so großer Ausnahmefall nicht.
Bea ist ein liebes Ding. Bislang habe ich nicht gewusst, dass Umgang mit Kindern so viel Freude machen kann. Natürlich - es wird schon eine Rolle spielen, dass sie mir äußerlich so ähnlich ist, das macht sie besonders sympathisch.
Der Gefährte Crinis wird demnächst eine Tätigkeit auf dem Festland übernehmen, vorübergehend. Wir bemühen uns, wenigstens für den Zeitraum seiner Abwesenheit, Wohnung in der gleichen Siedlung zu nehmen. Diese Crini 187 Kuryn ist ein lustiger Vogel. Sie in der Nähe zu haben, könnte amüsant sein.
Aber das Schönste wäre, Li, wenn Du hier sein könntest. Sobald ich weiß, wie es in der neuen Lehranstalt läuft, und ich Fuß gefasst habe, organisiere ich ein Wiedersehen. Ich sehne mich nach Dir ...<
Als Wally diesen Abend zu Bett ging, sah sie unter Marks Tür einen Lichtschimmer. Sie trat leise in sein Zimmer. Der Sohn schlief, hatte seine Schreibtischlampe nicht gelöscht. Voll angestrahlt lag da der unvollendete Brief. Wally überflog ihn. Sie knipste die Lampe aus und ging nachdenklich in ihr Zimmer. Es schmerzte nicht, dass die jungen Leute ein Wiedersehen vorbereiteten. Das hatte noch gute Weile. Nein, Wally kam sich arg hinterhältig, unehrlich und schäbig vor. Sie hatte den Sohn getäuscht. All die Jahre hatte sie mit Crini in Verbindung gestanden, sie sogar einige Male besucht und mit ihr um das Aufwachsen Beas gebangt. Und wie komplikationslos war doch alles verlaufen. Offenbar begannen die eigentlichen Sorgen erst jetzt. Wally seufzte. Allzu deutlich erinnerte sie sich ihres Besuches, damals vor sechs Jahren, bei Crini:
>Wie wir uns fast gleichzeitig erblickten! Auf der Veranda hatte sie gesessen, kam mir förmlich entgegengeflogen, fiel mir um den Hals. Da wusste ich, sie hatte viel von der alten Crini über die zehn Jahre gerettet. Dass wir lange keinen Kontakt hatten - bedeutungslos! Wie sie übersprudelte mit Fragen, Antworten und Berichten ... »Und Bernhard ist neugierig auf Wally Esch, sage ich dir, eine, die solches wagt!« Von der Seite hatte sie mich angesehen, den Kopf gewiegt, als wollte sie sagen: Na - und in dieser Sache kommst du doch, Wally? Wie gut sie mich kannte!
Dann wurde mir doch bang, als sie mich ins Haus gezogen, geheimnisvoll geraunt hatte: Komm mit!, und wir dann vor dem Inkubator standen, ich den Fötus pulsieren sah. Unser Mark, hatte Crini geflüstert. Sicher hatte ich zunächst verständnislos geblickt, sodass sie hinzufügte: »Natürlich einer von uns, Bernhards und mein Sohn ...« Ich hatte genickt, mich um ein erfreutes Gesicht bemüht, aber die Kehle war wie zugeschnürt.
Wir machten es uns auf der Terrasse bequem, und sie forderte mich auf, zu erzählen ...
Sie saß im Schaukelstuhl, hielt die Augen geschlossen, stieß sich mit der Zehenspitze rhythmisch ab. Sie strahlte noch immer jene jugendliche Frische von damals aus, schien aber wesentlich fraulicher, reifer ...
Als ich schwieg, schaute sie mich einen Augenblick an, hob den Kopf ein wenig, schaukelte weiter ...
»Ich ...«, hatte ich erneut begonnen, sicher ohne verbergen zu können, dass es mir schwer fiel.
Da hörte Crini auf zu schaukeln, sah mich an und sagte rundheraus: »Wally, ich freue mich riesig, dich wiederzusehen – und nicht nur wegen unseres gemeinsamen Erlebens. Und ich bin von ganzem Herzen froh, dass sich ...«, hier hatte sie gezögert, »dein Sohn prächtig entwickelt. Aber um mir das zu berichten, bist du nicht um den halben Erdball gereist, nachdem du vorher hundert Registrierstellen bemüht hast, um mich aufzuspüren. Also worum geht es dir wirklich? Um Mark?«
Ich konnte nur noch nicken. »Um Mark«, hatte ich wiederholt und schwieg mit einem Seufzer, weil mir der Inkubator wieder in den Sinn gekommen war.
»Etwas Schlimmes?«
»Nein, eine Bitte, Crini, eine dringende allerdings. Aber ich weiß nicht, ob ich sie - nach allem, was ich sehe - noch vorbringen, dich damit belasten darf ...«
»Quatsch, Wally, großer Quatsch!« Sie schüttelte missbilligend den Kopf, goss einen Wermut ein und ließ die Eisstücken plumpsen, dass es spritzte.
»Mark ist jetzt elf Jahre ...« Ich hatte versucht, das bedeutungsvoll zu sagen.
Sie unterbrach: »Meine Mathematikkenntnisse sind zwar nicht übertrieben gut, aber das hätte ich noch rausbekommen.« Ihr Lachen lockerte die Atmosphäre endgültig.
»In zehn, spätestens fünfzehn Jahren wird er sich nach einer Gefährtin um tun ...«
Crini merkte auf. »Ja, so geht die Entwicklung wohl auch dort.« Sie betrachtete erneut das Foto von Mark. »Ich fürchte das und - ich wünsche es natürlich.«
Eine Weile schwieg Crini. Ihre Gedanken hatten eine Reise in den südamerikanischen Urwald angetreten. Dann sah sie mich an und fragte unvermittelt: »Wie alt bist du, Wally?«
»Zu alt, Crini zu alt. Und außerdem: Vor den Leuten wäre es so etwas wie seine Schwester.«
»Leute ...! Und das Gut - lebt?«
»Ja, es lebt.«
»Warum, zum Teufel, scheust du die Öffentlichkeit? Du hast den Beweis erbracht.«
Ich schüttelte langsam, aber nachdrücklich den Kopf. Der Beweis. Nichts hatte ich beweisen wollen! Nichts! An etwas ganz anderes hatte ich geglaubt. Doch das war ein Irrtum, ein unverzeihlich großer Irrtum. Sollte ich das Crini eingestehen? Nein. Soll ich die Öffentlichkeit auf Mark loslassen? Nein! Ich müsste ihn einweihen. Mit seinen elf Jahren würde er das nicht verstehen. Und ein Leben lang würde er ein Gezeichneter bleiben, eine Art Kalb mit zwei Köpfen, von allen bestaunt und von vielen betatscht. Nein, Crini, nein!
Ich stand auf, trat an das Geländer der Terrasse. Ich musste ihr Zeit lassen.
»Und wenn ich nein sage?«
Ruckartig drehte ich mich um, schaute sie an, lange und sicher traurig. »Das würde alles sehr komplizieren. Ich müsste eine andere Frau suchen ... eine Crini von damals ... mit Mut zum Risiko ...«
»Auf eine echte Schwangerschaft würdest du bestehen ...« Der Satz klang eher wie eine Feststellung denn eine Frage.
»Ja, kein Fehlschlag, Crini. Wir wissen nicht, weshalb dein Fötus damals abgestorben ist. Und ich möchte auch nicht mehr Zeit verlieren.«
»Ja, ja ...« Es klang zerstreut, als seien ihre Gedanken anderwärts. Doch dann war sie wieder anwesend. »Und wie, meinst du, könnte es später einmal weitergehen? Du schiebst doch das Problem nur vor dir her, Wally!«
»Nein! – Ja ...« Da begann ich zu heulen. Crini trat zu mir, zog mich an sich. Ich hatte das Gefühl, es würde alles gut werden.
»Leicht machst du es dir nicht - und mir auch nicht.«
»Natürlich muss Mark eines Tages über seine Herkunft informiert werden. Dann könnte man die beiden zusammenführen. Sie trügen es gemeinsam leichter, und es erhielte die Art.« Ich sagte es eifrig.
»Das sind Wunschträume!« Crini setzte sich auf die Lehne des Schaukelstuhls und wippte heftig.
»Wenn sie erwachsen sind, Persönlichkeiten, reif, können sie es selbst entscheiden. Doch solange wir ihnen helfen können, sollten wir das tun.« Mit meinem Eifer wollte ich meine Unsicherheit überspielen. Ja, Crini hatte recht, ich träumte, und die Realität war anders. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht stimmte, einmal wenigstens, mein Traum mit der Realität überein?
Das war vor sechs Jahren.<
*
Wally strich sich über die Augen. >Nun waren wir hier bei Crini, bei Bea. Und drüben liegt ein sehnsüchtiger Liebesbrief.< Wally wurde sich abermals schmerzlich bewusst, es durfte nicht mehr lange dauern, bis Mark die Wahrheit erfuhr. Aber sie hätte gewollt, er würde wenigstens die allgemeine Ausbildung bis dahin abgeschlossen haben. Noch drei Jahre. >Und wenn er doch von Li nicht lässt?< Es tat ihr um das Mädchen leid. >Bin ich nicht auch verantwortlich für sie?< Verantwortlich, verantwortlich, immer wieder ... Konnte man nicht wenigstens eine kurze Spanne, einige Jahre für sich leben? Musste es stets etwas geben, das einen in diese verdammte Verantwortung zwang? Machte das das menschliche Dasein aus?
Und trotzdem fühlte Wally sich glücklich, dass Mark sich gut mit Bea verstand. In den letzten beiden Tagen hatten sie miteinander herumgetollt, waren sie geritten, wobei sich Mark, der zum ersten Mal auf einem Pferd saß, zu Beas Gaudi recht ungeschickt anstellte, schwammen im nahegelegenen Meer, und abends erzählte Mark ihr am Bett Geschichten.
*
Wally war Crini unendlich dankbar, dass sie damals, nach längerem Zögern, zugestimmt hatte. Vielleicht hatte sogar Bernhard den Ausschlag gegeben, zumal sie in jener Zeit ohnehin mit dem Gedanken spielten, ein zweites Kind haben zu wollen, allerdings nicht über eine Schwangerschaft. Bernhard war es dann auch, der viel von der Vorbereitung übernahm und Crini, während sie das Kind austrug, sehr unterstützte. Wally hingegen verbrachte zu Hause unruhige Wochen und Monate, strapazierte oft das dienstliche Telefon. Und es war einer der glücklichsten Augenblicke in ihrem Leben, als sie vom guten Verlauf der Geburt, vor allem aber erfuhr: das Kind ist ein Mädchen und wohlauf.
Wally sprach damals mit Crinis Arzt, der ihr auf ihr Drängen zögernd mitteilte, leider wären eine kleine - oder eigentlich zwei - Fehlbildungen zu bedauern. Das Kind habe jeweils nur vier Finger und Zehen und eigenartige Augen ...
Hätte er Wallys Schmunzeln bemerkt, wäre er sicher sehr verwundert gewesen.
*
Wally stellte sich vor, wie es sein könnte, wenn sie nach Crinis Vorschlag demnächst unten an der Küste gemeinsam ein Haus bewohnten, wenn in einem Jahr Mark Bea mit zur Schule nähme ...
>Man würde sie für Geschwister halten! Aber sie sind keine Geschwister! <
3. Kapitel
Schule und neue Arbeit ließen Mark und Wally in den ersten Monaten nicht viel freie Zeit. Man war in der hiesigen Lehranstalt im Plan etwas weiter - kein Wunder, wenn auf die Klasse nur zehn bis zwölf Schüler kamen - und Mark musste ein wenig fleißiger sein als sonst, um Fehlendes nachzuholen. Schwierigkeiten hatte er nicht, auch nicht, was das Verhältnis zu den Mitschülern betraf. In Marks Klasse lernten - über die Hälfte der Kameraden - Mischlinge vieler Schattierungen - negroide wie solche aus dem ostasiatischen Raum, und natürlich unterschieden sich die Einheimischen von den Zugewanderten. Ferner gab es in der Klasse zwei Jungen mit angeborenen Körperfehlern.
Die Schüler hatten schnell Marks Qualitäten erkannt und begannen alsbald auch hier, sie auf gutmütige Art ordentlich auszunutzen. Mark dagegen guckte sich das Reiten auf Wellenbrettern ab, das Fischestechen, und beteiligte sich an abendlichen Katamaranfahrten. Es wurden - als ein Überbleibsel des Touristenbooms - Lieder mit anspruchslosen Texten und einschmeichelnden Melodien gesungen, die bei glutrot untergehender Sonne, lauem Wind, Palmwedelgeflüster und dem Rhythmus der ewigen Brandung eigenartige Stimmungen heraufbeschworen, denen sich die jungen Leute hingaben und die auch Mark nicht unbeeinflusst ließen.
Aber stets bei solcher Gelegenheit überkam ihn wenigstens minutenlang die Sehnsucht nach Li. Und die Angewohnheit, ihr fast täglich zu schreiben, wurde ihm lieb, zum Bedürfnis. Er meinte, dieses Zwiegespräch, diesen Dialog zu brauchen, wenn es auch einer mit um zehn Tage versetzten Fragen und Antworten war. Ein Wiedersehen allerdings hatten sie erst für die nächsten Ferien vorgesehen.
Dieses Getrenntsein von Li machte Mark jedoch keineswegs traurig oder lustlos. Da gab es ein dunkelhäutiges einheimisches Mädchen, dem er gefiel, und auch er fand es mehr als nur sympathisch. Mit dieser Paola, mit Gregor und Daggy bildete er eine Gruppe, die nicht nur Mathematikaufgaben löste, sondern, von Paola geführt, die Insel gründlich durchstreifte. Paola kannte viele Winkel, welche die Zugereisten allein vielleicht nicht oder nur durch Zufall aufgespürt haben würden. Sie wusste von historischen Kultstätten allerlei Gruseliges zu erzählen, sodass solche Abende - auf Wochenendtrips bei Lagerfeuer und selbstgefangenem Fisch am Spieß - mit zu Marks eindrucksvollsten Erlebnissen wurden.
Auch Wally hatte anfänglich zu tun, sich in die neue Tätigkeit hinein zu qualifizieren. Die Arbeit hatte mit der früheren viel gemeinsam. Es galt auch hier zu mikroskopieren: Proben aus der nahegelegenen Meerwasserentsalzungsanlage, Qualitätskontrolle spezieller Legierungen, und einen Analyseprozessor musste sie bedienen lernen. Das Institut, aus einem Rekultivierungsstützpunkt hervorgegangen, besaß nur einen kleinen Stamm ausgebildeter Leute; denn einfach war es nicht, für diesen Winkel der Erde, trotz bester Bedingungen, geschultes Personal zu gewinnen. Sehr schnell fand Wally Kontakt zu den neuen Kollegen, man respektierte ihre Erfahrung und Arbeitsroutine. Oft wurde sie eingeladen, und es wurden mehr als Höflichkeitsbesuche.
Der Umzug auf die Insel stellte sich also nicht als falsch heraus. Mark entwickelte sich prächtig. Und wenn auch die Beziehung zu Li weiter bestand, beruhigte Wally die räumliche Trennung der beiden doch sehr. Sie bemerkte mit Freude, wie innig sich Mark und die kleine Bea verstanden. Crini, die den Wohnungswechsel vorbereitete, kam wenigstens einmal in der Woche an die Küste und brachte stets die Tochter mit, die dann Mark voll beschäftigte, was dieser sich auch sehr gern gefallen ließ. Es schien, als erfülle sich Wallys heimlicher Wunsch ganz von allein.
Sie ging also guter Dinge daran, Mobiliar und Hausrat auszuwählen, hatte ein neues Haus bekommen, das sie selbst einrichten konnte, ein Vergnügen, was ihr bisher versagt geblieben war. Stets hatte sie möblierte Wohnungen bezogen und, im Eifer der Arbeit oder weil sie zu träge war, darauf verzichtet, sich individuell einzurichten.
Das Haus stand 100 Meter über den Klippen, war in den Hang hineingebaut, besaß zwei voneinander getrennte Wohntrakte, vor denen sich eine gemeinsame teilüberdachte Terrasse befand. Wally lief zehn Minuten zum Institut, Mark und Bea hatten es ebenso weit zur Schule. Crini wurde wie vordem mit einem Luftbus abgeholt.
Eine Zeit der denkbar besten Harmonie durchlebten die sechs Menschen. Bernhard besuchte die Seinen alle drei Wochen für einige Tage. Oft fuhren sie dann gemeinsam in die Berge, wanderten, hantierten im Haus oder entspannten sich. Seltener besuchten sie Nachbarinseln oder das Festland. Auf der Insel gab es Zerstreuung genug: Ein Theater, das vom Festland aus regelmäßig durch ein gutes Ensemble bespielt wurde, Bars mit echten Musikbands und ein Live-Illustrium, selbstverständlich eine große Bibliothek und einen Tiergarten, dazu viele Zirkel der künstlerischen Selbstbetätigung. Fast alle Sportarten konnte man betreiben.
Die Zugereisten bekamen nun auch einen Einblick in Crinis Tätigkeit. Sie hatte sich als Genoperateuse einen Namen gemacht. Ihr Institut lag auf einer winzigen, vorgelagerten Insel, einem abgeflachten Vulkankegel. So war es einfach, die strengen Sicherheitsbestimmungen durchzusetzen. Man flog die Mitarbeiter direkt in die Sperrzone ein. Crini schimpfte mächtig über die Torturen, die Säuberungen, die sie beim Verlassen der Arbeitsstätte täglich über sich ergehen lassen musste, aber sie maulte unernst, denn selbstverständlich sah sie die Notwendigkeit solcher Maßnahmen ein. Die dort gezüchteten neuen Mikrolebewesen sollten für die Menschen nützlich arbeiten, doch bevor sie das durften, musste man sichergehen, dass sie nur das taten.
4. Kapitel
Für seine letzten Ferien wünschte Mark sich eine Europareise. Er wollte Kulturstätten besuchen, in denen große Europäer gewirkt hatten, wollte Baudenkmäler und Landschaften erleben. Einen Teil der Ferien in den Vorjahren hatte Mark mit Li verbringen können. Sie hatten sich stets auf halbem Wege getroffen, weil Wally diese Wiedersehen nicht auf der Insel wünschte, nicht, weil es sie bedrückte, dass sich der Sohn in dieser Zeit gänzlich von ihr abwandte. Sie dachte mehr an Bea. Zweimal trafen sie sich nahe bei Tokio, genossen die freundliche Geschäftigkeit der Japaner, bewunderten die Genialität ihres Bauens. Stundenlang konnten sie Hand in Hand schlendern, schauen, sich wortlos unterhalten. Schmerzlich gestalteten sich stets die Abschiede, zumal Lis Eltern es ihr immer schwerer machten, sich mit Mark zu treffen. Sie versuchten, die beiden voneinander abzubringen, Marks Herkunft sei ungewiss, weil er ohne Vaterschaft registriert sei, etwas höchst Ungewöhnliches in der heutigen Zeit. Und dann sein vom Normalen abweichendes Äußeres ... Li stand zu Mark, obwohl die ständigen Vorhaltungen zermürbten.
Wally legte die Tour für die Europareise fest. Sie führte über Madrid, Rom, Paris nach London, von dort nach Berlin, Prag, Wien - ihre alte Wirkungsstätte -, nach Budapest, Bukarest und Moskau. Wenn es die Zeit zuließ, sollte ein Abstecher nach Sankt Petersburg und Stockholm die Reise abrunden. Die Reihenfolge allerdings würden die jeweils günstigsten Reisebedingungen bestimmen, sie wollten nicht von Stadt zu Stadt hetzen, sondern sich erholen, verweilen, wo sie es als besonders schön empfanden.
Wally hatte die Reise gut vorbereitet. Trotz des Touristenstroms gab es keine Quartier- oder Transportsorgen. Allgemeinen Führungen schlossen sie sich kaum an. Mark, sehr gut eingestimmt und viel Angelesenes im Gedächtnis, gefiel es ausgezeichnet. Wally, die seinerzeit eine ähnliche Reise mit Dirk, ihrem Gefährten, unternommen hatte, erinnerte sich an vieles. Mitunter schmerzten diese Reminiszenzen, dann vor allem, wenn sich an diese besonders schönes Erleben band. Einige Male begann sie zu erläutern mit den Worten: »Hier hat Dirk ...«, und für Augenblicke fühlte sie sich zurückversetzt in ihre Jugend. Wenn sie dann abbrach und minutenlang wie abwesend schwieg, ließ Mark sie ungestört. Er glaubte, ihr nachfühlen zu können, empfand mit ihr, dachte an den ihm Unbekannten, der seiner Mutter so nahe gestanden hatte, ein Mann, der in Marks Kinderträumen, in seiner Fantasie, ein Held war, von der Mutter so gezeichnet, der für den menschlichen Drang nach Wissen sein Leben gelassen hatte, selbstlos, im Grunde namenlos ...
Und Mark dachte in solchen Augenblicken an Li, verglich, überlegte, wie er oder sie sich in ähnlichen Situationen wohl verhalten würden.
*
Je näher sie auf ihrer Route Wien kamen, desto mehr verlor sich Wally in solchen Erinnerungen. Sie versuchte dieses Aufbrechen der alten Narben mit Gewalt zu unterdrücken. Mark beobachtete das aufmerksam. Und wenn er spürte, sie kämpfe gegen allzu Schmerzliches, nahm er ihre Hand oder umfasste ihre Schultern. Sie standen sich wieder nah wie selten.
Mark schlug dann auch vor, behutsam und zu einem Zeitpunkt, als sie beide in froher Stimmung waren, Wien aus dem Programm herauszulassen. Wally lehnte nachdrücklich ab, strich sich übers Haar und sagte: »Es ist lieb von dir, Mark, aber es gibt Schmerzen, die man herbeiwünscht, nach denen man sich sehnt.« Und dann scherzte sie: »Es ist wie das Fädenziehen als Letztes vor dem endgültigen Verheilen einer Wunde.«
*
Wien machte auf Mark einen tiefen Eindruck. Wally hatte ihm von den Österreichern erzählt, von ihrem Hang zur Fröhlichkeit, von ihrer gemütlichen Muttersprache. Und er empfand so in Wien. Er konnte lange den Leuten zuhören, brachte Stunden im Stephansdom zu und im Hoftheater, der Wiege vieler klassischer Werke und Wirkungsstätte ihrer berühmten Schöpfer.
Das Institut wollte Wally nicht besuchen. Sicher gab es dort noch den einen oder anderen Bekannten aus ihrer früheren Tätigkeit. Aber von solchen Begegnungen hielt sie nicht viel. Jeder hat sein Leben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt gelebt, alte Kontakte sind gelöst, manch ein Zug aus der Jugend, den man an jemandem wiederentdeckt, wirkt auf einmal albern und merkwürdig ...
*
Sie setzten sich auf eine Bank am Hang des kleinen, über dem Institut gelegenen Hügels, von dem aus sie das Gelände überschauen konnten, und Wally begann dem Sohn zu erklären, was in dieser Einrichtung alles zur Planetenforschung getan wurde. Sie zeigte ihm natürlich auch die Fenster, hinter denen sie und Dirk gearbeitet hatten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Gefährte Mitglied jener Expedition wurde.
Eine Weile saßen sie versonnen. Später stellte Mark Fragen. Wally wies zum Gebäude, beschrieb und zeigte. Sie achteten nicht auf die wenigen Spaziergänger, die auf dem Weg defilierten. Sie bemerkten daher auch nicht die Frau, die zunächst an ihnen vorbeigegangen, dann aber stehen geblieben war und mit allen Anzeichen heftiger Aufmerksamkeit zu ihnen herüber sah. Dann, als sei sie sich ihrer Sache sicher, näherte sie sich forsch der Bank, blieb seitlich davor stehen und fragte zögernd: »Wally?«
Wally fuhr herum. Anzeichen des Erkennens gingen über ihr Gesicht, zunächst freudig, die sich jedoch wie in einer Enttäuschung, einem Schreck gar, verloren. Tiefe Röte stieg ihr in die Wangen. »Maud«, sagte sie leise. Es klang wie ein Seufzer, und sie biss sich auf die Lippen.
Plötzlich wurde das Gesicht der anderen hölzern. Sie kniff die Augen zusammen, als sei sie kurzsichtig. Ihr Blick hatte Mark erfasst.
Wally sprang förmlich auf und trat Maud einen Schritt entgegen. »Das ist Mark, mein Sohn«, sagte sie unangemessen scharf, und sie stellte sich zwischen die Frau und den Jungen.
Mark folgte der Szene mit einigem Erstaunen. Er sah die Erregung seiner Mutter, ihr hochrotes Gesicht, die bebenden Lippen. Instinktiv fühlte er Gefahr. Diese Frau wollte in irgendeiner Weise der Mutter übel.
Die Röte aus Wallys Gesicht wich, sie zwang sich zur Ruhe, streckte den Arm vor, um den Sohn, der sich zwischen sie und diese Frau schieben wollte, zurückzuhalten. »Das ist Maud dreihundertsechsundvierzig Chladkov, eine Bekannte, eine Arbeitskollegin von damals. Setz dich, Maud!« Sie versuchte ein Lächeln. »Das ist eine Überraschung. Ein Zufall ...« Unsicherheit schwang in ihren Worten.
Sie nahmen Platz. Die Chladkov saß, von Wally beabsichtigt, nicht neben Mark. Dennoch starrte sie, vornüber gebeugt, eine peinlich lange Zeit den Jungen an. »Das also ist dein Sohn«, sagte sie dann ohne besondere Betonung und mit undurchdringlichem Gesicht. Und sie blickte von Mark auf Wally. »Ein - hübscher Junge.«
»Wie geht es dir, Maud?«, fragte Wally, sichtlich um ein neutrales Gespräch bemüht. »Du bist also noch in Wien.«
Mark ließ sich nicht täuschen. Zwischen diesen beiden Frauen bestand etwas. Nie hatte Mutter von dieser Bekannten gesprochen. Welche Rolle spielte sie? Eine für Mutter unerfreuliche, das schien gewiss. Nun, man traf im Leben sicher viele solcher unangenehmen Menschen, mit denen man auskommen musste, die man aber vergaß, wenn man mit ihnen nichts mehr zu tun hatte. Maud war offenbar ein solcher Mensch. Und dennoch war Wally vom Aufeinandertreffen sofort peinlich berührt worden! Fürchtete sie diese Maud? Mark gab seine Igelhaltung nicht auf. Er beobachtete aufmerksam beider Frauen Gesichter auch während des harmlos erscheinenden Gesprächs, das sich zögernd entspann.
»Es geht«, antwortete Maud. »Man wird älter, Wally.« Sie lächelte wie abwesend. »Ich bin wieder in Wien, seit Jahren.«
>Eigentlich hat sie kein böses Gesicht<, dachte Mark. >Sie wirkt betagter als Mutter, aber das mag an den tiefen Stirnfalten liegen.< Ein schmaler Mund, kleine graublaue Augen mit dichten Brauen darüber schienen Mark auf Strenge zu deuten. Den Eindruck verstärkte das lange, ein wenig gekräuselte blonde Haar, das sie in einem Nackenknoten trug. Das weite, faltenreiche Gewand ließ dennoch auf einen großen knochigen Körper ohne überflüssige Polster schließen. Beinahe wider seinen Willen konstatierte Mark: Ein Mensch, zu dem man Vertrauen fassen, auf dessen Zusage man sich wohl voll verlassen kann, der aber ebenso konsequent seine Meinung zu vertreten wusste, demzufolge ein hartnäckiger Kontrahent sein mochte. >Ein Gegner von Mutter? Warum?<
»Das hätte ich nicht vermutet«, bemerkte Wally gefasster.
»Seit fünf Jahren arbeite ich wieder am Institut. Mit einem Arzt zusammen. Du wirst ihn nicht kennen, er hat - nach euch angefangen. Und du - bist du ... allein geblieben?« Sie sprach langsam, mit Pausen, so, als überlege sie ihre Worte sehr genau. In unnatürlicher Haltung musterte sie dabei die beiden.
»Ja. Ich habe Mark.« Wieder schwang Trotz mit. Wally legte dem Sohn die Hand auf den Arm, straffte sich mit abweisendem Gesicht.
Und erneut musterte Maud Mark. »So hätte ich mir deinen Sohn nicht vorgestellt«, bemerkte sie vieldeutig. »Wie ein Wunder ist das ...«
Es schien, als wollte Wally erneut aufbegehren. Da setzte Maud hinzu, und sie lächelte dabei: »In gewisser Weise ist er euch - ähnlich ...«
»Auf welchem Teilgebiet arbeitet ihr jetzt?«, fragte Wally mit der deutlichen Absicht, das Thema zu wechseln.
»Nach wie vor an meinem Steckenpferd, dem Winterschlaf des Menschen.« Sie lächelte.
»Was ist noch offen? Ich habe ihn selbst probiert. Gibt es Fortschritte?« Wally fragte eifrig, offenbar dankbar, dass das Gespräch eine andere Wendung nahm.
Maud zuckte mit den Schultern. »Schon. Der eigentliche Nachweis, zum Beispiel für vollautomatische Langzeitreisen, fehlt noch immer. Du weißt ja, wie das ist, sie sind übervorsichtig geworden seit damals.«
»Wieso?«, fragte Wally hellhörig. »Was hat das mit - damals zu tun?«
»Sie meinen - aber das weißt du doch - Erik hätte seinerzeit auf der Heimreise der LUX drei einen Großversuch ... eigenmächtig ...« Sie brach ab, als hätte sie zuviel gesagt.
»Das weiß ich nicht!«, rief Wally. Sie saß kerzengerade, der Chladkov zugewandt.
Einen Augenblick überlegte Maud. »Kann schon sein«, sagte sie dann zögernd einlenkend. »Es ist, glaube ich, erst einige Jahre her, dass irgend so ein Neunmalkluger diese Idee in die Welt setzte. Ich persönlich glaube natürlich nicht daran. Erik hatte zwar vor dem Abflug davon gesprochen ... Aber er hätte so etwas lang und breit ins Bordbuch eingetragen, schon um sich der Nachwelt zu erhalten.«
»Er hätte ..., aber du weißt, was davon übrig ist«, erwiderte Wally erregt. »Und sie lagen im Tiefschlaf, bevor sie ... als wir ... als ich sie fand. Daran gibt es keinen Zweifel.«
Mark wusste nur, es ging um die Strandung des Raumschiffes, zu dessen Besatzung Dirk 212 Sonen, der Gefährte Wallys, und offenbar auch jener Erik gehört hatten, von dem Maud sprach.
Maud zuckte mit den Schultern, bagatellisierte offenbar. »Was soll’s. Zum Leben erweckt das Mutmaßen keinen mehr, und unsere Arbeit hält es auf.«
»Man möchte doch gern Gewissheit ...« Wally sprach es wie zu sich selbst, fasste sich dann, richtete sich auf. »Es war schön, dich getroffen zu haben. Wir müssen jetzt ...«, sagte sie leicht. »Touristen haben wenig Zeit.«
»Wo wohnt ihr?«
»Im Praterhotel.« Wally griff nach der Hand des Sohnes.
»Hast du eine Viertelstunde Zeit heute Abend, sagen wir, gegen achtzehn Uhr? Ich müsste dringend mit dir reden.« Sie sagte es sehr zwingend mit einem Blick auf Mark.
Wally schien verunsichert. »Wir sind wirklich angespannt«, sagte sie abweisend mit undurchdringlicher Miene.
»Wally!« Es klang beschwörend. »Es ist zwar ein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Aber da du mich damals einbezogen hast, möchte ich vom Ergebnis wissen. Ich will jetzt ...«, sie warf einen Blick auf Mark und hob die Stimme, »deutlicher nicht werden.«
»Also gut.« Ärger stand in Wallys Gesicht. Sie biss sich auf die Lippen. »Ich erwarte dich gegen achtzehn Uhr.«
*
Während sie zum Hotel gingen, gab sich Wally zunächst einsilbig, als ob sie fürchtete, Mark könne in sie dringen. Dann begann sie, was an ihrem Weg lag, ausführlich zu erläutern, machte Mark auf Kirchen und allerlei Stätten aufmerksam.
Mit einem Satz erwähnte sie, es sollte obenhin klingen: »Maud war schon immer unbequem in ihrer brüskierenden Art. Sie hat nicht viel Freunde. Wer weiß, was sie vorhat; es wird nicht lange dauern.« Sie ließ es damit bewenden, fuhr fort, zu zeigen, zu erklären.
Mark fühlte zum ersten Mal, die Mutter belog ihn, aber er fragte nicht. Sie wird von sich aus reden, wusste er, wenn sie mit sich selbst im Reinen ist.
Sie aßen zu Abend. Und kurz vor der verabredeten Zeit verabschiedete sich Mark zu einem Stadtbummel.
Als Wally in die Halle trat, wurde sie bereits von Maud 346 Chladkov erwartet.
5. Kapitel
Tags darauf setzten sie die Reise wie geplant fort. Aber noch immer nicht, auch nicht im Luftschiff, wo gute Gelegenheit dazu gewesen wäre, sprach Wally von ihrer Unterredung mit dieser Maud. Sie erwähnte die merkwürdige Zusammenkunft nur mit einem lapidaren Satz. Es sei eine alte Geschichte gewesen, aber sie, Wally, hätte dazu nichts sagen können.
Mark fühlte eine eigenartige Spannung, spürte instinktiv, dieser Affront der beiden Frauen hatte mit ihm zu tun. Zum ersten Mal in all den Jahren war er sich sicher, in der Vergangenheit, vermutlich zusammenhängend mit dem verunglückten Vater, mit Crini und ganz gewiss mit dieser Maud, gab es ein Geheimnis, das offensichtlich von wenigen Leuten furchtsam behütet wurde. Die Versetzung der Mutter auf diese Insel, der Zufall Crini und vor allem Bea, die ihm so ähnelte, waren wohl Ergebnis durchdachten Handelns. Und es machte ihn traurig, weil es so aussah, als vertraute ihm die Mutter nicht. Wegen Li konnte sie nicht gekränkt sein. Nein, es musste in der Vergangenheit wurzeln! Mark wurde sich mit einem Mal bewusst, wie isoliert sie im Vergleich mit anderen gelebt hatten. Er litt nicht darunter, auch jetzt nicht, da er zu dieser Erkenntnis gelangte. Er hatte nie etwas vermisst, hatte jene, die mit ihren Ferienerlebnissen prahlten, nie beneidet. Aber warum war das so? Warum hatte die Mutter sich zurückgezogen? >Es war nicht der Verlust des Gefährten, der sie weltabgewandt gemacht hatte; ich bin der Grund! Warum spricht sie nicht mit mir?<
Mark betrachtete die Mutter. Sie hielt die Augen geschlossen, aber sie schlief nicht.
Wie abgespannt sie war - von heute auf morgen! Bis zu jenem Treffen mit dieser Maud war sie trotz manch schmerzlicher Erinnerung aufgelebt, förmlich aufgeblüht, als kehrte die Jugend wieder, die ihr aus jeder Gasse, jedem Winkel offenbar entgegenlachte. Und nun das! Sich einem anderen mitzuteilen, half viel. Warum nur tat sie es nicht? Er spürte Trotz in sich und Bitterkeit.
*
Wally ahnte den Zustand, in dem sich der Sohn befand. Sie hatte mehr als einmal seinen forschenden Blick aufgefangen. Es war ihr gewiss, sie würde handeln müssen, in den nächsten Stunden schon. Und obwohl sie lange gewusst hatte, dass dieser Tag unerbittlich kommen würde, fühlte sie sich nun hilflos und überrumpelt, fand den Faden nicht, von dem aus sie verständlich und behutsam das Vergangene aufrollen konnte. Sie, Wally, hatte damals nach dem Gefühl entschieden, wo nach dem Verstand hätte entschieden werden müssen. Das hatte ihr Maud vorgeworfen. Nach sachlichem Entschluss und wissenschaftlichen Motiven würde es Mark nicht geben. Würde Mark sie auch so hart verurteilen wie Maud? Selbst wenn er das nicht täte, würde er nicht an der Wucht dessen, was ihm über sein Dasein mitgeteilt werden musste, zerbrechen? Niemals zuvor hatte ein Mensch so etwas aushalten müssen. Würde es Mark? Würde es Bea?
Es war für Wally all die Jahre schwer gewesen, diese ungeheure Verantwortung zu tragen, und es war von Jahr zu Jahr schwerer geworden. Vielleicht verwirklichte sich ihr Wunsch, der, seit es Bea gab, überhaupt erst real geworden war. Aber wenn nicht?
Alles hing ab von der Reaktion des Jungen.
*
Wally blickte zu Mark. Er saß halb vorgebeugt und schaute aus dem Fenster. Das Schiff folgte im Niedrigflug dem Lauf der Donau. Weiße Boote fuhren stromauf und stromab, Menschen winkten herauf. >Er ist kein Junge mehr<, dachte Wally. >Er war nie ein Junge, nur manchmal. Schade eigentlich ... Stets zeigte er sich verständiger, reifer als seine Altersgenossen, hatte das Stadium zwischen Kind und Erwachsenem gleichsam übersprungen. Da gab es nicht diese Unausgeglichenheit, das Unausstehliche, das andere Eltern von ihren Halbwüchsigen zu berichten wussten, die Sucht, von der Umwelt akzeptiert zu werden, und den Hang, Kindliches nicht zu lassen ... Oh, Mark!< Wieder seufzte Wally.
Mark kehrte ihr das Gesicht zu, und in beider Augen war es wieder da, dieses Verstehen, das über Jahre lange Dispute überflüssig machen konnte.
»Mark«, sagte die Mutter in einem plötzlichen Entschluss, und sie legte ihm die Hand auf die seine. »Wir lassen uns die Reise nicht verderben, ja? Sobald wir zu Hause sind, erfährst du von mir, wer diese Maud ist und - eben alles. Es gibt in meiner Mottenkiste Filme und andere Erinnerungsstücke, sie würden es mir erleichtern ...« Sie blickte ihn unverwandt an, und es schien, als schwämmen ihre Augen in ein wenig zuviel Wasser. »Einverstanden?«
Mark nickte. »Einverstanden«, sagte er.
*
Sie machten, wie sie sich vorgenommen hatten, Station in Budapest, trieben, meist abseits vom Touristenstrom, durch Stätten, die, sorgfältig restauriert, von Vergangenem zeugten. Mark bewunderte die Kunstfertigkeit alter Meister, die mit ihren Augen, ihrem Verstand und ihren Händen das von Millionen Menschen Bestaunte schufen, ohne Computer und Presslufthammer und ohne gesicherten Auftrag oft.
Wally und Mark machten sich meist am frühen Vormittag auf, wenn andere noch schliefen oder in ihrer großen Herde frühstückten. Sie genossen einen Sonnenaufgang über der Donau von der Fischerbastei aus; »neckisches Eckchen« und »Zuckerbäckerei«, wie Wally witzelte, ohne eigentlichen historischen Wert. Sie schauten auf das ehrwürdige Parlamentsgebäude und die belebten Brücken.
Wally hatte in Marks Alter dieses Land »per pedes apostolorum« bereist, mit einem oder auch mehreren Gleichgesinnten, einem großen Rucksack, hatte im Zelt geschlafen, abends am Lagerfeuer gesessen und, oft schleppte jemand eine Gitarre mit, gesungen, bis in die späte Nacht, sich von Mücken zerstechen lassen und im Übrigen aus der Konservendose gelebt. Sie behauptete dem Sohn gegenüber, es wären mit ihre tiefsten Erlebnisse und seien die schönsten Erinnerungen ...
Wally bemühte sich, und sie musste sich dazu gar nicht sehr anstrengen, alles Sentimentale aus diesen früheren Bildern fortzulassen. Es fiel ihr deshalb leicht, weil sie damals, als sie diesen »großen Trip« machte, ihren späteren Gefährten Dirk noch nicht gekannt hatte.
Und sie nahmen das nicht gar so ernst mit den historischen Stätten. So verplanschten sie im Thermalbad einen Vormittag auf der Margareteninsel, genossen einen auf altungarisch gemachten Abend bei Zimbalmusik und feurigem Gulasch und gestatteten sich einen Tag per Schiff auf der Donau.
Von Maud sprachen sie nicht, aber irgendwie war sie gegenwärtig. Mark bemerkte oft das sorgenvolle Antlitz der Mutter, wenn sie mitunter traurig den Sohn betrachtete.
Diese Maud Chladkov hatte ihr etwas angedroht, und sie würde ihre Drohung wahr machen. Daran zweifelte wohl Mutter nicht. Was ihn, Mark, aber immer wieder ablenkte, das waren die Menschen, die sie trafen. Er konnte stundenlang an einem Boulevard sitzen und die Vorübereilenden oder Schlendernden betrachten. Und wenn es auch stets, gleichgültig, wo sie sich befanden, ein buntes Nationalitätengemisch war, überwogen doch die Bodenständigen, und Mark versuchte sich daran, sie an ihnen nachgesagten Eigenheiten und Wesenszügen herauszufinden.
Oft machten sie einen Bummel durch Läden, versuchten dort echte, rar gewordene Volkskunst von den Erzeugnissen der raffiniert automatisierten Souvenirprodukte zu trennen. Schließlich wurden dafür noch Leistungsbons verlangt, und damit, so Wallys Devise, sollte man sparsam umgehen.