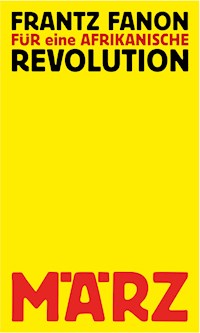
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Diese Sammlung enthält 28 der politischen Aufsätze Frantz Fanons. Sie stammen aus seiner aktivster Periode und reichen von der Erstveröffentlichung von »Schwarze Haut, weiße Masken« im Jahr 1952 bis zu »Die Verdammten dieser Erde« (1961). Seiner Diagnose nach gibt es am Rassismus nichts Zufälliges. Vielmehr fügt er »sich in ein charakteristisches Ganzes ein, das der Ausbeutung einer Gruppe Menschen durch eine andere« impliziert. Für Fanon konnte es daher nur eine einzige Lösung geben: »Das logische Ende dieses Kampfwillens ist die totale Befreiung des nationalen Territoriums« und »der Kampf ist von Anfang an total«. Die hier versammelten Aufsätze erlauben einen umfassenden Einblick in das Leben und Denken eines der spannendsten und produktivsten Denker des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Frantz Fanon
Für eine afrikanische Revolution
Politische Schriften
Aus dem Französischen übertragen vonEinar Schlereth
Herausgegeben von Barbara Kalender
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I.Der Kolonisierte in Frage
1.Das »nordafrikanische Syndrom«
2.Antillesen und Afrikaner
II.Rassismus und Kultur
III.Für Algerien
1.Brief an einen Franzosen
2.Brief an den Ministerpräsidenten (1956)
IV.Der Befreiung Afrikas entgegen
1.Täuschungen und Illusionen des französischen Kolonialismus
2.Algerien und die französischen Folterknechte
3.Aus Anlass eines Plädoyers
4.Die Haltung der französischen Intellektuellen und Demokraten zur algerischen Revolution
5.Entsteht auf den Antillen eine Nation?
6.Das maghrebinische Blut wird nicht vergeblich fließen
7.Eine Farce, die die Stellung wechselt
8.Entkolonisierung und Unabhängigkeit
9.Eine anhaltende Krise
10.Brief an die afrikanische Jugend
11.Grundlegende Wahrheiten des kolonialen Problems
12.Die Lehre von Cotonou
13.Appell an die Afrikaner
14.Der Morgen nach dem Plebiszit in Afrika
15.Der Krieg in Algerien und die Befreiung des Menschen
16.Algerien in Accra
17.Accra: Afrika stärkt seine Einheit und legt seine Strategie fest
18.Die verzweifelten Anstrengungen des Herrn Debré
19.Rassistischer Terror in Frankreich
20.Unter französischer Herrschaft fließt Blut auf den Antillen
21.Einheit und effektive Solidarität sind die Bedingungen der afrikanischen Befreiung
V.Afrikanische Einheit
1.Afrika im Werden
2.Der Tod Lumumbas: Hätten wir anders handeln können?
Anmerkungen
Vorwort
Die politischen Texte von Frantz Fanon, die in diesem Band veröffentlicht werden, umfassen die aktivste Periode seines Lebens, von der Veröffentlichung von Peau noire, masques blanches im Jahre 1952 – er war gerade achtundzwanzig Jahre alt – bis zu Les damnés de la terre im Jahre 1961, die fast mit seinem Todestag zusammenfallen sollte.
Die Mehrzahl dieser Texte wurde bereits veröffentlicht. Sie wurden in verschiedenen Zeitschriften und Periodika abgedruckt, die jeweils mit dem Erscheinungsdatum angegeben sind. Aber sie waren verstreut und schwierig aufzufinden.
Besonders jene aus dem El Moudjahid sind heute kaum noch zugänglich, waren selbst damals nur einem eng umgrenzten Publikum zugänglich.
In chronologischer Reihenfolge zusammengefasst, stellen diese Texte eine einzigartige lebendige Einheit dar. Sie markieren die sukzessiven Etappen ein und desselben Kampfes, der sich entwickelt und ausdehnt, dessen Ziel und Mittel jedoch von Anfang an klar gesehen und fest umrissen waren. Die drei bis jetzt veröffentlichten Bücher waren drei Analysen, die sich an bestimmten Punkten der Entwicklung Frantz Fanons herauskristallisierten. Die folgenden Texte sind ein allgemeinerer Leitfaden durch sein Leben und Werk, die Marschroute eines Denkens in ständiger Entwicklung, sich ständig erweiternd und bereichernd, gleichwohl sich selbst immer die Treue haltend.
Die zwei ersten Artikel, Das nordafrikanische Syndrom und Antillesen und Afrikaner, veröffentlicht 1952 und 1955, können die ersten Etappen markieren. Zu diesem Zeitpunkt hat Frantz Fanon seine Studien der Psychiatrie abgeschlossen: Er ist somit in der Lage, einerseits aus seiner täglichen medizinischen Erfahrung heraus wissenschaftlich über die Situation des Kolonisierten Bericht zu erstatten; andererseits ist diese Situation – er hat sie historisch miterlebt, er erlebt sie noch immer – für ihn eine persönliche Erfahrung, die er auch von innen heraus beurteilen kann. Einmal entschlossen, gleicherweise von dem »großen weißen Irrtum« und dem »großen schwarzen Wahn« loszukommen, beschreitet er einen neuen, einen revolutionären Weg; um das Problem des Kolonisierten aufzuwerfen und um es zu lösen, bringt er alle Voraussetzungen mit; sein Selbstbewusstsein und die Klarheit seiner Vision verstärken noch die Entschlossenheit seines Engagements. Frantz Fanon trifft seine Wahl. Er wird in Algerien praktizieren, einem Land des Kolonialismus par excellence, um unter den gleich ihm Kolonisierten zu leben und zu kämpfen. Das Thema wird in Rassismus und Kultur behandelt, ein Vortrag, den er 1956 auf dem I. Kongress der Schwarzen Schriftsteller hielt. Diesmal ist die Analyse schärfer, die Anklage ist radikal, das Engagement ist eindeutig und präzise. Seine Diagnose des Rassismus, die »nicht eine zufällige Erfindung ist«, sondern »sich in ein charakteristisches Ganzes einfügt, das der Ausbeutung einer Gruppe Menschen durch eine andere«, impliziert nur eine Lösung: »Das logische Ende dieses Kampfwillens ist die totale Befreiung des nationalen Territoriums« und »… Der Kampf ist von Anfang an total, absolut«. Dieser Kampf ist nicht verbal. Seit er Psychiater am Krankenhaus in Blida ist, und erst recht nach dem Beginn des Aufstandes, kämpft Frantz Fanon konkret in der revolutionären algerischen Organisation. Zur gleichen Zeit vollendet er eine bemerkenswerte medizinische Arbeit, bahnbrechend in jeder Beziehung, tiefschürfend, innigst verbunden mit seinen Kranken, in denen er in erster Linie die Opfer des Systems sieht, das er bekämpft. Er sammelt die klinischen Berichte und die Analysen der Phänomene der kolonialen Entfremdung, die sich hinter den Geisteskrankheiten verbergen. Er erforscht die lokalen Traditionen und ihre Beziehungen zur Kolonisierung. Dieses äußerst wichtige Material ist zugänglich, aber es ist ebenfalls verstreut, und wir hoffen, es in einem gesonderten Band zusammenfassen zu können. Seine Arbeit als militantes Mitglied der FLN bringt ihn bald mit der französischen Polizei in Berührung. Ende 1956, bevor er nach Tunis geht, bringt er in seinem Demissionsbrief ein totales Engagement zum Ausdruck, das allerdings schon weit zurückliegt. Mit dem unveröffentlichten Brief An einen Franzosen, dem einzigen Text, der über diese Periode Zeugnis ablegt, haben wir das Kapitel Für Algerien bestritten. Aus den Erfahrungen, die er im unmittelbaren Kampf macht, sollte später L’an V de la révolution algérienne entstehen.
In Tunis wird Frantz Fanon dazu berufen, im Pressedienst der FLN mitzuarbeiten. Er gehört zu den geistigen Urhebern des El Moudjahid, von dem die ersten Nummern erscheinen. Ohne Unterlass widmet er sich der Aufgabe, die Totalität, die unverschleierte Einheit des kolonialistischen Systems aufzuzeigen, die Solidarität, zu der es wohl oder übel jene verpflichtet, die auf seiner Seite stehen, während sich der Völkermord an einer Million Algeriern vollzieht. Seine Analyse in Linksintellektuelle und der Krieg in Algerien greift die französische Linke auf das Heftigste an. Er weist darin die Heuchelei jener nach, die im Kolonialismus und seinen Folgen, Krieg, Torturen, nur einen monströsen Auswuchs sehen, den zu beschreiben und zu missbilligen es genügt, während es sich doch um ein völlig logisches unbedingt zusammenhängendes Ganzes handelt, das alle jene, die in seiner Mitte leben, unwiderruflich zu Komplizen macht. Fanon hat nun die Möglichkeit, eines seiner ersten Themen ausführlich zu behandeln: die Verbindung des Kampfes aller Kolonisierten. Als einer der ersten, der auf konkrete Weise die Einheit Afrikas ins Auge fasst – nicht als eine »prophetische Vision«, sondern als Ziel des unmittelbaren Kampfes – verbindet er ständig das Schicksal der algerischen Revolution mit der Gesamtheit des Kontinentes, nicht die algerische Revolution, die Avantgarde der afrikanischen Revolution. El Moudjahid verfolgt unbeirrt diese Linie: Die algerische Revolution und die Befreiung Afrikas, Titel einer Broschüre mit Artikeln und Dokumenten der FLN und zu jener Zeit am weitesten verbreitet, bezeichnet treffend die Bedeutung, die die algerischen Revolutionäre damals dieser Linie beimaßen. Die Artikel des El Moudjahid wurden niemals signiert. Die Anonymität war total. Die hier unter der Kontrolle von Frantz Fanon veröffentlichten Artikel sind ausschließlich solche, bei denen wir die unwiderlegbare Sicherheit haben, dass sie von Frantz Fanon geschrieben wurden. Gewiss hat sich seine Mitarbeit nicht nur auf diese Artikel beschränkt. Aber wie in jedem Team, und besonders in dieser Revolution auf ihrem Höhepunkt, findet bei der Arbeit eine ständige Osmose, Wechselwirkung und gegenseitige Anregung statt. In dem Moment, wo das Denken Frantz Fanons im Kontakt mit dem schöpferischen Kern der algerischen Revolution neue Dimensionen erreicht, verleiht es auch diesem neue Anstöße. Wir haben die in jener Zeit entstandenen Texte unter dem Titel Die Befreiung Afrikas zusammengefasst.
Die Idee, die Fanon von dem »Afrika auf dem Marsch«, hatte, konkretisiert sich in der Mission, die er in den westafrikanischen Ländern durchführt, nachdem er Botschafter in Accra geworden war. Er untersuchte besonders die Bedingungen für eine engere Allianz der Afrikaner, die Rekrutierung schwarzer Freiwilliger, die Eröffnung einer neuen Front im Süden der Sahara … Die Seiten, die wir im letzten Kapitel veröffentlichen – Die Afrikanische Einheit – stammen aus einem unveröffentlichten Reisebericht, in dem dieser Plan in seiner ganzen Klarheit und Vehemenz Gestalt gewinnt.
Frantz Fanon kehrt von dieser Mission erschöpft zurück: Er hatte Leukämie bekommen. Seine letzte Kraft widmete er der Redigierung der Damnés de la terre. Er starb ein Jahr nach dem Sturz Lumumbas, den er unmittelbar miterlebt hatte, dessen Freund er gewesen war und der zu den afrikanischen Führern gehörte, dessen afrikanische Vision der seinigen am nächsten kam. Er starb mit der Gewissheit der baldigen totalen Befreiung Afrikas, überzeugt, wie er in L’an V de la révolution algérienne geschrieben hatte, dass die algerische Revolution eine »nicht umkehrbare Situation« geschaffen hatte.
François Maspero
I.DER KOLONISIERTE IN FRAGE
1.Das »nordafrikanische Syndrom«1
Man sagt gerne, dass der Mensch sich selbst ununterbrochen infragestellt, und dass er sich selbst verleugnet, wenn er behauptet, es nicht mehr zu sein. Also scheint es, dass es möglich sein muss, eine höchste Dimension aller menschlichen Probleme darzustellen. Genauer noch: dass alle Probleme, die sich der Mensch in Bezug auf den Menschen stellt, sich auf die folgende Frage zurückführen lassen:
»Habe ich nicht, durch meine Taten oder meine Unterlassungen, zu einer Abwertung der menschlichen Realität beigetragen?« Eine Frage, die sich auch formulieren ließe:
»Habe ich unter allen Umständen den Menschen, der in mir steckt, angerufen und herausgefordert?«
Ich will mit diesen Zeilen zeigen, am besonderen Beispiel des nach Frankreich emigrierten Nordafrikaners, dass eine Theorie der Inhumanität Gefahr läuft, ihre Gesetzmäßigkeiten zu finden. All diese Menschen, die Hunger haben, all diese Menschen, die frieren, all diese Menschen, die Furcht haben …
All diese Menschen, die uns Furcht einflößen, die den smaragdfarbenen Schleier von unseren Träumen reißen, die die zerbrechliche Wölbung unseres Lächelns zerstören, all diese Menschen uns gegenüber, die uns keinerlei Fragen stellen, denen aber wir ungewöhnliche Fragen stellen.
Wer sind sie?
Ich frage es euch, ich frage es mich. Wer sind sie, diese nach Menschlichkeit begierigen Wesen, die sich stemmen gegen die nicht fassbaren Grenzen (die ich aber mit furchtbarer Deutlichkeit aus Erfahrung kenne) der vollständigen Anerkennung?
Wer sind sie wirklich, diese Wesen, die sich verstecken, die sich in der sozialen Wirklichkeit hinter Attributen wie bicot, bounioule, arabe, raton, sidi, mon z’ami verbergen? (In Frankreich gebräuchliche Schimpfworte für Araber. D. Übers.)
I. These. – Dass das Verhalten des Nordafrikaners häufig bei medizinischem Personal eine misstrauische Haltung hervorruft, in Bezug auf die Echtheit seiner Krankheit.
Mit Ausnahme von dringenden Fällen, wie Darmverstopfung, Verwundung, Unfällen, ergeht sich der Nordafrikaner in vagen Andeutungen.
Er hat Schmerzen im Bauch, im Kopf, im Rücken, er hat überall Schmerzen.
Er leidet furchtbar, sein Gesicht ist beredt, es ist ein gebieterisches Leiden.
»Was gibt es denn, mein Freund?«
»Ich sterbe, Herr Doktor.«
Sagt es mit beinahe gebrochener Stimme.
»Wo hast du Schmerzen?«
»Überall, Herr Doktor.«
Vor allem verlange man keine präzisen Angaben: Ihr werdet sie nicht bekommen. Bei Schmerzen, die von Geschwüren herrühren, ist es zum Beispiel wichtig, den Stundenplan der Schmerzen zu kennen. Dieses Sich-halten-an zeitliche Kategorien scheint der Nordafrikaner zu hassen. Es ist keineswegs Unverständnis, denn oft kommt er in Begleitung eines Dolmetschers. Man könnte sagen, dass es ihm schwerfällt, sich in eine Lage zurückzuversetzen, in der er nicht mehr ist. Die Vergangenheit, das ist für ihn heftig schmerzende Vergangenheit. Was er erhofft, ist nie mehr leiden zu müssen, niemals mehr mit dieser Vergangenheit konfrontiert zu werden. Dieser gegenwärtige Schmerz, der die Muskeln seines Gesichtes derart verzerrt, genügt ihm. Er versteht nicht, dass man ihn zu etwas zwingen will, und sei es nur in der Erinnerung, was schon nicht mehr ist. Er versteht nicht, warum der Arzt ihm so viele Fragen stellt.
»Wo hast du Schmerzen?«
»Im Bauch.«
(Er deutet auf Thorax und Unterleib.)
»Wann?«
»Immer.«
»Auch in der Nacht?«
»Besonders in der Nacht.«
»Hast du mehr Schmerzen in der Nacht oder am Tag?«
»Nein, immer.«
»Aber mehr in der Nacht als am Tag?«
»Nein, immer.«
»Und wo tut es am meisten weh?«
»Da.« (Er deutet auf Thorax und Unterleib.)
Da steht man nun, draußen warten die Kranken und, was noch schlimmer ist, man hat den Eindruck, dass die Zeit nichts an der Angelegenheit ändert. Man entlässt ihn also mit einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose und verordnet entsprechend eine annähernde Therapeutik.
»Nimm dieses Mittel einen Monat lang. Wenn es dir nicht besser geht, kommst du wieder.«
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Dem Kranken geht es nicht sofort besser und er kommt drei, vier Tage später wieder in die Sprechstunde. Dadurch werden wir gegen ihn aufgebracht, denn schließlich ist der Wirkung des verschriebenen Medikamentes eine bestimmte Frist gesetzt worden (womit wir entschuldigt sind).
Man macht es ihm verständlich: er muss sich exakt daran halten, sagt man ihm. Aber unser Patient hat gar nicht zugehört. Er ist nur Schmerz und er weigert sich, das ganze Gerede zu verstehen und der Grund für diese Behauptung ist nicht weit zu suchen: »Es ist nur, weil ich Araber bin, dass sie mich nicht wie die anderen pflegen.«
2. Dem Kranken geht es nicht sofort besser, aber er kommt nicht zum selben Arzt zurück und nicht zum selben Krankenhaus.
Er geht woanders hin. Er geht von dem Prinzip aus, dass man erst dann Genugtuung erhält, wenn man an alle Türen geklopft hat und er klopft. Er klopft mit Erbitterung. Mit Sanftmut. Mit Naivität. Mit Wut. Er klopft. Man öffnet ihm. Und er erzählt seinen Schmerz. Der immer mehr zu seinem Schmerz wird. Er schildert ihn mit großer Beredsamkeit. Er packt ihn, dreht und wendet ihn mit allen zehn Fingern, entfernt alle Hüllen, führt ihn vor. Der Schmerz wird zusehends größer. Er rafft ihn aus allen Körperenden und -ecken zusammen und nach fünfzehn Minuten gestenreicher Erklärungen übersetzt uns der Interpret (mit Umschweifen, wie es sich gehört): Er sagt, dass er Schmerzen im Bauch hat.
Alle diese Streifzüge in den Raum, diese Zuckungen des Gesichtes, dieses ganze Augenaufreißen wollten nur einen vagen Schmerz zum Ausdruck bringen. Und dann kommen wir mit unseren Erklärungen und empfinden eine Art Enttäuschung. Die Komödie oder das Drama beginnt von vorne: Diagnose und annähernde Therapeutik.
Es gibt keinen Grund, weshalb das Spiel aufhören sollte. Eines Tages wird man eine Röntgenaufnahme machen, die ein Geschwür oder eine Gastritis zum Vorschein bringt. Oder die in den meisten Fällen gar nichts ergeben wird. Man wird von seinen Schmerzen sagen, sie seien »funktional«.
Diese Erfahrung ist bedeutsam und verdient, dass man bei ihr verweilt. Eine Sache wird vage ausgedrückt, wenn es ihr an Konsistenz ermangelt, an einer objektiven Realität. Der Schmerz des Nordafrikaners, für den wir keinen Krankheitsgrund feststellen können, wird als inkonsistent, als irreal beurteilt. Oder der Nordafrikaner ist einfach einer, der die Arbeit scheut. Sodass sein ganzes Verhalten, von diesem a priori ausgehend, dementsprechend interpretiert wird.
Ein Nordafrikaner kommt aus Faulheit, Schlaffheit, Schwäche in Behandlung. Man verordnet ihm kräftigende Mittel, um ihn wiederherzustellen. Nach zwanzig Tagen ordnet man seine Entlassung an. Dann entdeckt er eine neue Krankheit.
»Das Herz, das hüpft da drinnen.«
»Der Kopf, der zerspringt mir.«
Angesichts dieser Angst vor der Entlassung beginnt man sich zu fragen, ob die Schwäche, derentwillen er behandelt wurde, nicht einer Laune entspringt. Man beginnt sich zu fragen, ob man nicht der Spielball dieses Kranken gewesen ist, den man sowieso nie richtig verstanden hat. Der Verdacht nimmt Formen an. Von nun an wird man den angegebenen Symptomen misstrauen.
Im Winter ist die Sache klar; wenn die große Kälte einsetzt, sind manche Hospitäler buchstäblich überfüllt. Es ist so angenehm in einem Krankensaal.
In einem Hospital schalt ein Arzt einen Europäer, der Ischias hatte, weil er den ganzen Tag in den Krankenzimmern herumschwirrte. Er erklärte ihm, dass die Ruhe in diesem besonderen Fall schon die halbe Behandlung ist. Speziell zu uns gewandt fügte er hinzu, dass es bei den Nordafrikanern ganz anders sei: Ihnen brauche man nicht die Ruhe zu verordnen, sie seien sowieso den ganzen Tag im Bett.
Angesichts dieses Schmerzes ohne Krankheit, dieser Krankheit, die sich im und über den ganzen Körper verteilt, dieses beständigen Leidens, ist die allereinfachste Haltung die, zu der man sich mehr oder weniger schnell verleiten lässt, diejenige, dass man jeden krankhaften Zustand leugnet. Im äußersten Fall ist der Nordafrikaner ein Simulant, ein Lügner, ein Drückeberger, ein Nichtsnutz, ein Faulenzer, ein Dieb.2
II. These. – Die Einstellung des medizinischen Personals ist sehr häufig vorgefasst. Der Nordafrikaner ist nicht in seiner Rasse verankert, sondern er betritt einen Boden, der von den Europäern bereitet wurde. Mit anderen Worten, er gerät, im Augenblick seines Erscheinens, in einen präexistierenden Rahmen.
Seit einigen Jahren tritt eine medizinische Richtung in Erscheinung, die man, kurzgefasst, als Neohypokratismus bezeichnen könnte.
Diese Tendenz beabsichtigt, dass die Ärzte sich weniger bemühen, beim Kranken eine Diagnose der Organe zu erstellen, als vielmehr eine Diagnose der Funktionen. Aber diese Gedanken sind noch nicht bis zu den Lehrstühlen gedrungen, an denen Pathologie gelehrt wird. Es gibt einen Konstruktionsfehler im Denken des praktischen Arztes. Einen äußerst gefährlichen Fehler.
Wir werden ihn an einem konkreten Fall aufzeigen.
Ich werde zu einem Kranken gerufen, einem dringenden Fall. Es ist zwei Uhr morgens. Das Zimmer ist schmutzig, der Kranke ist schmutzig. Seine Eltern sind schmutzig. Alle heulen. Alle schreien. Der seltsame Eindruck, dass der Tod nicht weit ist.
Der junge Arzt verscheucht alle Abschweifungen seiner Seele. Er beugt sich ganz »objektiv«, mit typisch chirurgischer Miene über den Bauch.
Er fasst ihn an, er betastet, er klopft, er fragt, aber er bekommt nur Seufzer zu hören, er betastet wieder, klopft abermals, und der Magen zieht sich zusammen, wehrt sich … Er »sieht nichts«. Und wenn es dennoch etwas Chirurgisches wäre? Wenn er etwas übersehen hätte? Seine Untersuchung ist negativ, aber er wagt nicht zu gehen. Nach vielem Zögern steuert er seinen Kranken auf die Diagnose akute Bauchentzündung zu. Drei Tage danach sieht er seine akute Bauchentzündung lachend und vollständig geheilt in sein Zimmer hereinspazieren. Aber was der Kranke nicht weiß, ist, dass es ein anspruchsvolles medizinisches Denken gibt und dass er dieses Denken lächerlich gemacht hat.
Das medizinische Denken schließt vom Symptom auf eine Verletzung. In hervorragenden Kreisen, auf internationalen Medizinerkongressen ist man sich über die Bedeutung des neurovegetativen Systems, des Zwischenhirnes, der endokrinen Drüsen, der psychosomatischen Zusammenhänge, des vegetativen Nervensystems im Klaren, aber man fährt damit fort, die Ärzte zu lehren, dass jedes Symptom eine Läsion erforderlich macht. Der Kranke ist derjenige, der, wenn er von Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schwindelanfällen spricht, gleichzeitig überhöhten Blutdruck präsentiert. Aber wenn man anhand dieser Symptome weder überhöhten Blutdruck, noch einen Gehirntumor, auf jeden Fall nichts Positives findet, dann versagt für den Arzt das medizinische Denken; und da jedes Denken ein Denken von etwas ist, wird für ihn der Kranke versagen, – ein uneinsichtiger, undisziplinierter Kranker, der nicht die Spielregeln kennt. Diese unumstößliche Regel, die sich darin ausdrückt: Jedes Symptom geht auf eine Läsion zurück.
Und der Kranke, was mache ich mit ihm? Von der Chirurgie, wohin ich ihn wegen eines möglichen Eingriffes geschickt hatte, kommt er mit der Diagnose »nordafrikanisches Syndrom« zurück. Und es ist wahr, dass der junge Arzt von Anfang an durch die Nordafrikaner in seiner Abteilung mit Molière in Berührung kommt. Eingebildeter Kranker! Wenn Molière (ich werde eine Dummheit sagen, aber diese Zeilen sollen ja nur eine viel größere Dummheit deutlich und offensichtlich machen), wenn Molière das Privilegium genießen würde, im XX. Jahrhundert zu leben, hätte er sicherlich nicht Der eingebildete Kranke geschrieben, denn niemand ist sich darüber im Zweifel, dass Argan krank ist. Er ist aktiv krank:
Was sagst du, Schurkin! Und ob ich krank bin! Und ob ich krank bin, Schamlose!
Das nordafrikanische Syndrom. Wenn sich heutzutage ein Nordafrikaner in die Sprechstunde begibt, dann trägt er die tote Last all seiner Landsleute mit sich. All jener, die nur Symptome hatten, all jener, von denen man sagte: »Nichts, um sich graue Haare wachsen zu lassen.« (Wohlgemerkt: keine Läsion.) Aber der Kranke, der mir hier gegenübersteht, dieser Körper, von dem ich gezwungen bin anzunehmen, dass er von einem Bewusstsein beherrscht wird, dieser Körper, der schon nicht mehr ganz oder der vielmehr doppelt Körper ist, da mit Schrecken erfüllt – dieser Körper, der von mir gehört zu werden erwartet, ohne Umschweife – er provoziert in mir eine Revolte.
»Wo hast du Schmerzen?«
»Im Magen.« (Und er zeigt auf die Leber.)
Ich ärgere mich. Ich sage ihm, dass der Magen links liegt, dass das, was er mir zeigt, der Sitz der Leber ist. Er lässt sich keineswegs aus der Fassung bringen, er fährt mit der Handfläche über diesen geheimnisvollen Bauch:
»Das alles tut mir weh.«
Aber ich weiß, dass es in »das alles« drei Organe gibt; zur Not sogar fünf oder sechs. Dass jedes Organ seine Pathologie hat. Diese vom Araber erfundene Pathologie interessiert uns nicht. Das ist eine Pseudopathologie. Der Araber ist ein Pseudokranker.
Jeder Araber ist ein eingebildeter Kranker. Der junge Arzt oder der junge Student, der niemals einen kranken Araber gesehen hat, weiß (vergleich die alte medizinische Tradition), dass »diese Typen Schauspieler sind«. Etwas jedoch könnte Anlass zur Überlegung bieten. Gegenüber einem Araber ist der Student oder der Arzt geneigt, die zweite Person Singular zu verwenden. Das ist nett, wird man uns sagen … damit sie sich wohlfühlen … sie sind es nicht anders gewohnt. Tut mir leid, ich fühle mich nicht in der Lage, dieses Phänomen zu analysieren, ohne meine objektive Haltung, die ich mir auferlegt habe, aufzugeben.
Das ist stärker als ich, sagte mir ein Assistenzarzt, ich kann sie nicht genauso anreden wie die anderen Kranken.
Sehr gut! Das ist stärker als ich. Wenn ihr wüsstet, was in meinem Leben stärker als ich ist. Wenn ihr wüsstet, was mich in meinem Leben in den Stunden quält, wo die anderen ihren Verstand einschläfern. Wenn ihr wüsstet … aber ihr werdet es nicht wissen. Das medizinische Personal entdeckt die Existenz eines nordafrikanischen Syndroms. Nicht auf experimentellem Wege, sondern durch mündliche Überlieferung. Der Nordafrikaner nimmt Platz in diesem asymptomatischen Syndrom und begibt sich automatisch auf eine Ebene der Undiszipliniertheit (im Verhältnis zur medizinischen Disziplin), der Inkonsequenz (in Beziehung zu dem Gesetz: Jedes Symptom setzt eine Läsion voraus), der Unaufrichtigkeit (er sagt leiden, wenn wir doch wissen, dass es für das Leiden keine Ursachen gibt). Eine vage Idee ist bereits vorhanden, an der Grenze meiner Unehrlichkeit, besonders wenn der Araber sich vermittels seiner Sprache verrät:
»Herr Doktor, ich sterbe.«
Diese Idee, nachdem sie einige Haken geschlagen hat, setzt sich fest, zwingt sich mir auf.
Diese Typen sind einfach nicht ernsthaft.
III. These. – Der beste Wille und die besten Absichten nutzen nichts, wenn sie sich nicht manifestieren.
Über die Notwendigkeit, eine Situationsdiagnose zu stellen.
Doktor Stern schreibt in einem Artikel über psychosomatische Medizin, wobei er die Arbeiten von Heinrich Meng stützt: »Man muss nicht nur herausfinden, welches das angegriffene Organ ist, welcher Art die organischen Verletzungen sind, wenn welche bestehen, und welche Mikroben den Organismus befallen haben; es reicht nicht, die somatische Konstitution des Kranken zu kennen, sondern man muss das versuchen, herauszufinden, was Meng seine Situation nennt, das heißt seine Beziehungen zu seiner Umgebung, seine Beschäftigungen, seine Sorgen, seine Sexualität, seine inneren Spannungen, sein Gefühl der Sicherheit oder Unsicherheit, die Gefahren, die ihn bedrohen; und, fügen wir auch hinzu, seine Entwicklung, seine Lebensgeschichte. Man muss eine Situationsdiagnose3 machen.«
Doktor Stern schlägt einen hervorragenden Plan vor, dem wir folgen.
1. Beziehungen zu seiner Umgebung. – Muss man wirklich darüber sprechen? Liegt nicht eine gewisse Komik darin, über die Beziehungen des Nordafrikaners zu seiner Umgebung, in Frankreich, zu sprechen? Hat er Beziehungen? Ist er nicht alleine? Sind sie nicht alleine? In den Straßenbahnen oder Trolleybussen kommen sie uns nicht absurd vor, sozusagen ohne jeden Hintergrund? Woher kommen sie? Von Zeit zu Zeit sehen wir sie auf irgendeinem Bau arbeiten, aber man sieht sie nicht, man bemerkt sie, man sieht sie nur flüchtig. Umgebung? Beziehungen? Es gibt keine Kontakte. Es gibt nur ein Darauf-stoßen. Weiß man, was das Wort Kontakt an Sanftem und Höflichem umfasst? Gibt es Kontakte? Gibt es Beziehungen?
2. Beschäftigungen und Sorgen. – Er arbeitet, er ist beschäftigt, er beschäftigt sich, man beschäftigt ihn. Seine Sorgen? Ich glaube, dass es dieses Wort nicht in seiner Sprache gibt. Sich sorgen um was? In Frankreich sagt man: Er kümmert sich darum, Arbeit zu finden; in Nordafrika: Er ist damit beschäftigt, Arbeit zu finden. »Entschuldigung, Madame, welches sind ihrer Meinung nach die Sorgen des Nordafrikaners?«
3. Sexualität. – Ich verstehe, es dreht sich um Notzucht. Um zu zeigen, bis zu welchem Punkt eine obskure Studie für den gültigen Nachweis eines Phänomens von Nachteil sein kann, möchte ich einige Zeilen aus einer medizinischen Doktorarbeit wiedergeben, die 1951 von Doktor Léon Mugniery geschrieben wurde:
»In der Region von Saint-Étienne haben acht von zehn Arabern Prostituierte geheiratet. Die Mehrzahl der anderen leben in zufälligen und kurzfristigen Verbindungen, die manchmal einer Ehe gleichkommen. Oft beherbergen sie für einige Tage eine oder mehrere Prostituierte, denen sie ihre Freunde zuführen.
Denn die Prostitution scheint im nordafrikanischen Milieu eine bedeutende Rolle zu spielen4 … Sie entspringt dem starken sexuellen Appetit, mit dem diese heißblütigen Südländer ausgestattet sind.«
Weiter unten:
»Zweifelsohne kann man zahlreiche Einwände machen und an vielfältigen Beispielen zeigen, dass die Versuche, die unternommen wurden, um die Nordafrikaner angemessen unterzubringen, ebenso viele Fehlschläge waren.
In der Mehrzahl handelt es sich um junge Männer (25–35 Jahre) mit starken sexuellen Bedürfnissen, die durch das Band einer Mischehe nur zeitweilig gestillt werden können, weshalb für sie die Homosexualität zu einem verhängnisvollen Laster wird … Es gibt kaum eine Lösung für dieses Problem: Entweder muss man trotz der Risiken5, die eine solche Invasion durch arabische Familien darstellt, die Bildung von Familien in Frankreich begünstigen und muss junge Mädchen und arabische Frauen kommen lassen, oder man muss für sie geschlossene Häuser in Kauf nehmen …
Wenn man diesen Fakten nicht Rechnung tragen will, wird man riskieren, sich noch häufigeren Notzuchtversuchen auszusetzen, wovon uns die Zeitungen ständig genug Beispiele bieten. Die öffentliche Moral hat zweifelsohne mehr von der Existenz dieser Tatsachen zu fürchten als von der Existenz solcher geschlossener Häuser.«
Und zum Abschluss beklagt der Doktor Mugniery einen Irrtum der französischen Regierung, indem er in seiner Arbeit diesen Satz mit großen Buchstaben schreibt:
»DIE BEWILLIGUNG DER FRANZÖSISCHEN STAATSBÜRGERSCHAFT MIT RÜCKSICHT AUF DAS GLEICHE RECHT FÜR ALLE SCHEINT ZU ÜBEREILT GEWESEN ZU SEIN UND SICH MEHR AUF SENTIMENTALE UND POLITISCHE GRÜNDE ZU STÜTZEN ALS AUF DEN UMSTAND DER SOZIALEN UND INTELLEKTUELLEN EVOLUTION EINER RASSE MIT ZUWEILEN ENTWICKELTER ZIVILISATION, ABER EINEM NOCH PRIMITIVEN SOZIALEN, FAMILIÄREN UND SANITÄREN VERHALTEN.« (S. 45)
Gibt es dem noch etwas hinzuzufügen, muss man diese absurden Sätze, einen nach dem anderen durchgehen, muss man den Doktor Mugniery daran erinnern, dass wenn die Nordafrikaner sich in Frankreich mit Prostituierten begnügen, erstens nur deshalb, weil sie dort Prostituierte vorfinden und zweitens, weil sie dort keine arabischen Frauen vorfinden (die ja die Nation überschwemmen könnten)?
4. Seine innere Spannung. – Wirklich? Dann könnte man auch von der inneren Spannung eines Steines sprechen. Innere Spannung! Welch ein Witz!
5. Sein Gefühl der Sicherheit oder Unsicherheit. – Der erste Terminus muss gestrichen werden. Der Nordafrikaner ist eine ständige Unsicherheit. Eine mehrschichtige Unsicherheit.
In gewissen Augenblicken frage ich mich, ob es nicht gut wäre, dem durchschnittlichen Franzosen klarzumachen, dass es ein Unglück ist, Nordafrikaner zu sein. Der Nordafrikaner war niemals sicher. Er hat Rechte, werdet ihr mir sagen, aber er kennt sie nicht. Ah! Ah! Er muss sie nur kennen. Die Kenntnis. Na ja! Und wir fallen wieder auf unsere Füße. Rechte, Pflichten, Bürgerschaft, Gleichheit, wie wunderbar! Der Nordafrikaner an der Schwelle der französischen Nation – die, wie man uns sagt, die seine ist – fristet auf politischer und ziviler Ebene ein verzwicktes Dasein, auf das niemand auch nur einen Blick werfen möchte.
Was für eine Beziehung zum Nordafrikaner gibt es in einem gastfreien Milieu? Genau, es gibt eine Beziehung.
6. Die Gefahren, die ihn bedrohen.
Bedroht in seinem Gemütsleben,
bedroht in seiner sozialen Aktivität,
bedroht in seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft,
vereinigt der Nordafrikaner alle Bedingungen auf sich, die einen Menschen krank machen.
Ohne Familie, ohne Liebe, ohne menschliche Beziehungen, ohne Verbindung mit der Umgebung, wird die erste Begegnung mit sich selbst auf neurotische oder pathologische Art verlaufen; er wird sich leer fühlen, ohne Leben, ganz nahe dem Tode, ein Tod diesseits des Todes und was ist bewegender, als dass dieser Mann mit seinen starken Muskeln mit wahrhaft gebrochener Stimme zu uns sagt: »Herr Doktor, ich sterbe.«
7. Seine Entwicklung und seine Lebensgeschichte. – Es wäre besser zu sagen, die Geschichte seines Todes. Eines täglichen Todes.
Ein Tod in der Straßenbahn,
ein Tod im Sprechzimmer,
ein Tod bei den Prostituierten,
ein Tod am Arbeitsplatz,
ein Tod im Kino,
ein vielfacher Tod in den Zeitungen,
ein Tod aus Furcht, nach Mitternacht das Haus zu verlassen vor lauter netten Menschen.
Ein Tod,
ja ein TOD.
Das ist alles sehr schön, wird man uns sagen, aber was für eine Lösung schlagen sie vor?
Sie wissen doch, sie sind so gestaltlos, so unbestimmt – …
»Man muss in ihrer Haut stecken.«
»Man muss sie aus dem Krankenhaus werfen.«
»Wenn man auf sie hörte, würden sie nie gesund werden.«
»Sie können sich nicht ausdrücken.«
Und sie sind Lügner.
Und außerdem sind sie Diebe (klauen wie Araber).
Und dann, und dann, und dann
Der Araber ist ein Dieb
alle Araber sind Diebe.
Sie sind eine faule Rasse
dreckig
zum Kotzen.
Nichts daran zu machen
nichts daran zu ändern.
Sicher, es ist schwer für sie, so zu sein
und nicht anders
aber, schließlich, sie müssen zugeben, dass das nicht unsere Schuld ist.
Doch, es ist unsere Schuld.
Doch, es ist DEINE Schuld.
Wieso; die Menschen kommen und gehen einen Gang entlang, den du für sie eingerichtet hast, wo du keine Bank aufgestellt hast, damit sie sich ausruhen könnten, wo du eine Menge Ramsch hingestellt hast, der ihnen um die Ohren fliegt, an dem sie sich das Gesicht, die Brust, das Herz verletzen können.
Wo sie keinen Platz finden
wo du ihnen keinen Platz machst
wo es absolut keinen Platz für sie gibt
und du wagst mir zu sagen, dass dich das alles nichts angeht!
Dass das nicht dein Fehler ist!
Wie, dieser Mensch, den du verdinglichst, indem du ihn systematisch Mohammed nennst, den du dir aufbaust, vielmehr, den du auflöst, ausgehend von einer Idee, einer Idee, von der du weißt, dass sie abscheulich ist (du weißt sehr wohl, dass du ihm etwas nimmst, dieses etwas, für das du vor nicht allzu langer Zeit bereit gewesen wärst, alles hinzugeben, selbst das Leben) nun gut! Dieser Mensch hier, hast du nicht den Eindruck, dass du ihn seiner Substanz beraubst?
Sie brauchen ja nur zu Hause zu bleiben!
Aha! Da beginnt das Drama: Sie brauchen nur zu Hause zu bleiben. Nur hat man ihnen gesagt, dass sie Franzosen seien. Das haben sie in der Schule gelernt. Auf der Straße. In den Kasernen. (Wo sie noch Schuhe an ihren Füßen hatten.) Auf den Schlachtfeldern.
Man hat ihnen überall das Frankreich hineingestopft, wo immer in ihrem Körper und ihrer Seele ein bisschen Platz für etwas offensichtlich Großes war.
Jetzt wiederholt man ihnen in allen Tonarten, dass sie »zu Hause« sind. Und wenn sie nicht zufrieden sind, brauchen sie ja nur in ihre kasbah zurückzukehren. Aber auch da gibt es ein Problem. Welches Schicksal sie auch in Frankreich finden würden, behaupten manche, der Nordafrikaner würde sich zu Hause glücklicher fühlen …
Man hat in England festgestellt, dass Kinder, die prächtig genährt werden, die jedes zwei Ammen zu ihrer alleinigen Verfügung haben, aber außerhalb des familiären Milieus leben, eine Kränklichkeit zeigten, die doppelt so groß ist als bei schlechter genährten Kindern, die jedoch mit ihren Eltern lebten. Man braucht gar nicht so weit zu gehen und nur an jene zu denken, die in ihrem Land ein Leben ohne Zukunft führen, sich aber weigern, im Ausland ein schönes Leben zu führen. Wozu ist dieses schöne Leben gut, wenn es kein familiäres oder elterliches Milieu mit sich bringt, wenn es nicht ein Gedeihen des Milieus erlaubt? Die psychoanalytische Wissenschaft hält den Verlust der Heimat für ein Krankheitsphänomen. Worin sie vollkommen recht hat. Diese Betrachtungen erlauben uns, zu folgern:
1. Der Nordafrikaner wird in Europa niemals glücklicher sein als bei sich zu Hause, weil von ihm verlangt wird, ein Leben ohne den eigentlichen Gegenstand seines Gemütslebens zu führen. Von seinen Wurzeln und seinen Lebensinhalten abgeschnitten, wird er zu einem Ding, das in einen großen Strudel geworfen wurde, dem Trägheitsgesetz unterworfen.
2. Diesem Vorschlag liegt eine offenbare, verächtliche Unehrlichkeit zugrunde. Wenn der Lebensstandard (?), der dem Nordafrikaner in Frankreich geboten wird, höher ist als der, an den er bei sich gewöhnt ist, heißt das, dass in seinem Land noch sehr vieles zu tun ist, in diesem »anderen Teil Frankreichs«.
Dass Häuser gebaut werden müssen, Schulen eröffnet, Straßen gelegt, Slums abgerissen, Städte erbaut werden müssen, dass Männern, Frauen und Kindern ein Lächeln entlockt werden muss. Würde das heißen, dass es dort Arbeit gibt, menschliche Arbeit, das heißt Arbeit, die einer Heimat Sinn verleiht. Nicht Kasernenarbeit oder Arbeit in einer Zelle. Das würde heißen, dass auf dem gesamten Territorium der französischen Nation (Metropole und Französische Union) Tränen getrocknet, unmenschliche Verhaltensweisen bekämpft werden müssen, dass das herablassende mon z’ami (Freundchen) nicht mehr vorkommt, dass Menschen menschlich gemacht werden, dass Straßen wie die Rue Moncey6 menschenwürdig werden.
Ihr Vorschlag zur Lösung, mein Herr?





























