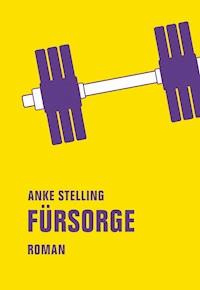I.
Rechenschaft ablegen, Rechtschaffenheit behaupten. So etwas ist Nadja fremd, auf die Idee kommt sie nicht. Sie ist in Städten auf der ganzen Welt zu Hause, hat in New York, Havanna und Sankt Petersburg alles getanzt, was das klassische Ballett hergibt, hat in Hotels gewohnt und mit Choreographen geflirtet, Kaviar gegessen und ihn hinterher wieder ausgekotzt – weil Kaviar zu fünfzig Prozent aus Fett besteht und Nadja, seit sie fünf ist, streng auf ihr Gewicht achten muss.
Seit dreißig Jahren hält Nadja Diät.
Niemals ein Stück Torte oder eine Scheibe Schweinebraten essen, die auch verdaut werden dürfen, ein Stück Schokolade zum Trost, einen Topf Spaghetti, weil’s draußen kalt ist. Für Nadja ist das nicht schlimm, Nadja kennt das Gefühl von Befriedigung durch Nahrungsaufnahme nicht. Für Nadja hat Ernährung nichts mit Genuss, sondern nur mit Effizienz zu tun. Wie viel Energie muss dem Körper zugeführt werden, damit er volle Leistung bringt? Nadja isst, wie andere Menschen ein Auto betanken oder Kohlen in einen Ofen schippen: Es ist mühsam, es macht Dreck, es kostet Geld, aber es muss sein.
Bestimmt habe ich mit dieser Beschreibung übertrieben. Weil ich neidisch bin auf Nadja.
Wie herrlich es wohl ist, Genuss und gutes Aussehen nicht ständig gegeneinander abwägen zu müssen! Wäre ich Nadja, wären Faulheit und Gefräßigkeit Fremdwörter für mich. Ich könnte meine Fersen bis zu den Ohren bringen und würde immer noch aussehen wie fünfzehn, zumindest von Weitem. Außerdem käme ich nie auf die Idee, über Leute nachzudenken, die nichts mit mir zu tun haben, und schon gar nicht hätte ich das Bedürfnis, mich in sie hineinzuversetzen. Was für ein hässliches, sperriges Wort. Wäre ich Nadja, wüsste ich gar nicht, was es heißt, und würde stattdessen mit Haut und Haar ich selbst sein: eine Frau, der egal ist, was andere von ihr denken.
Nadja ist mir nicht näher bekannt, und doch weiß ich Dinge über sie, die sonst keiner weiß. Leute erzählen mir ungefragt ihre Geschichten, und die, die es nicht tun, laden stillschweigend dazu ein, dass ich mir ihre Geschichten selbst ausdenke.
Eines weiß ich bestimmt: Ich bin nicht Nadja. Ich bin wenn dann ihr Gegenteil. Während sie von klein auf nur ein einziges Ziel gehabt hat – rauf auf die Zehenspitzen und dann auf die Bühnen der Welt –, will ich immer alles und möglichst alles auf einmal. Unbeschwert sein, aber in der Verantwortung, dünn, aber satt, nach strenger Berechnung spontan und mit lässiger Geste sehr gründlich. Während Nadja, um ihr einziges Ziel zu erreichen, allem anderen widersteht, verfranse und verheddere ich mich in der Vielzahl der Möglichkeiten und bekomme deshalb nichts oder von allem nur ein bisschen. Und dieses Bisschen ist dann so ausgefranst und verfilzt, dass ich es vorsichtshalber keinem Menschen zeige.
Alles, was leicht aussieht, ist in Wirklichkeit das Ergebnis harter Arbeit.
Nadja drückt den Knopf ihrer Stereoanlage, und schon erfüllt Musik den Raum. Ein Streichkonzert, schwerelose Töne – doch für den Geiger bedeuten sie blutige Fingerkuppen, verkürzte Halssehnen, Fehlstellungen der Wirbelsäule. Um bei der Aufnahme dieses Konzertes mitwirken zu dürfen, haben er und seine Lieben ein Leben voller Entbehrungen hinter sich. Die Mutter des kleinen Geigers musste sich anfangs das hilflose Gekratze des Bogens über die Saiten anhören, das Kind zum Üben zwingen, jeden Tag mindestens zwei Stunden lang. Gehasst wurde sie von dem Kind für ihre Strenge, bis der Hass dann in Dankbarkeit umschlug, weil Anerkennung von außen die inneren Qualen vergessen ließ.
Das ist das Stichwort: Vergessen! Dieser gnädige Mechanismus im menschlichen Gehirn – oder funktioniert es chemisch? Jedenfalls gibt es keine körperliche Erinnerung an den Schmerz, und falls es je etwas anderes im Leben gab als die Musik, ist das inzwischen vergessen, verdrängt von Orchesterfreizeiten, Auftritten, einem Preis bei ›Jugend musiziert‹, dem Schulterklopfen des Musiklehrers, den neidvollen Blicken der Mütter abgeschlagener Konkurrenten – Mütter, deren Kinder zu viel am Computer spielen. Nicht so der kleine Geiger! Der geht am Abend erfüllt von seinem Erfolg zu Bett und weiß am nächsten Tag schon beim Aufwachen, was er zu tun hat.
Nadja gleitet vor der Stereoanlage in den Spagat. Ihre Knochen knacken. Ergeben legt sie die Stirn auf den Holzfußboden. Die Töne der Streicher liebkosen ihren Nacken. Nadja streckt die Füße: verkrüppelt, verhornt. Während die erste Geige sich zu Höherem aufschwingt, schwingt auch Nadja sich auf; wie durch ein Wunder ist sie zurück in der Senkrechten, als führe jemand sie an Fäden, ein unsichtbarer Puppenspieler, eine gnadenlose Mutter.
»Dreh dich, Mädchen, dreh dich!«
Wobei Nadja eine solche Mutter nie hatte. Nadja hört von jeher ihre eigene Stimme, die ihr sagt, dass Grenzen dazu da sind, überwunden zu werden.
Nadja knickt in der Hüfte ein, verharrt für ein paar Sekunden, bevor sie sich wieder rühren kann. Diese Pause könnte ein Element der Moderne sein, pfiffige Idee eines begabten Choreographen; in Wahrheit wird sie verursacht durch Nadjas Hüftgelenk, das Verschleißerscheinungen zeigt, Arthrose wie bei einer Siebzigjährigen. Nadja geht in gebeugter Haltung ins Badezimmer und schluckt eine Handvoll Tabletten. Langsam, ganz langsam lässt der Schmerz nach.
Und ist im nächsten Moment auch schon wieder vergessen.
Konzentration und Selbstdisziplin. Bestimmt hat Nadja es das eine oder andere Mal in dieser Hinsicht übertrieben, aber es hat sich gelohnt.
Nadja kommt aus dem Badezimmer, geht aufrecht, sehr aufrecht zurück zur Stereoanlage und stellt das Violinkonzert aus. Es ist Freitagvormittag, und sie hat noch eine halbe Stunde, bevor sie zur Arbeit muss, zu ihrer Lehrtätigkeit an der Ballettakademie.
Seit Nadja der Bühne krankheitsbedingt den Rücken kehren musste, unterrichtet sie dreimal in der Woche den Nachwuchs, hat also weiterhin ihr Auskommen, hat mehr als das – diese schöne Fünfzimmeraltbauwohnung, die sie morgens nach dem Aufstehen durchschreiten kann, hierhin, dorthin. Genug Raum für spontane Übungseinheiten, das Schlafzimmer geht nach hinten raus, in der Küche steht ein Tisch, an dem problemlos zwölf Leute Platz finden.
Nadja geht durch die Küche, hierhin, dorthin, Leinsamen und Weizenkleie; Nadjas Verdauung ist träge, sie versucht auf natürliche Art, dem entgegenzuwirken, trinkt literweise Wasser direkt aus der Filterkanne, isst einen Löffel voll Heilerde, die ihr aus den Mundwinkeln staubt und zwischen den Zähnen knirscht. Während Nadja zu schlucken versucht, wäscht sie den Löffel ab, dreht ihn unter dem Strahl des Wasserhahns hin und her, reibt ihn sorgfältig trocken und legt ihn zurück in die Besteckschublade. Immer noch hat sie die lehmige Paste im Mund, die ihr an Zähnen und Gaumen klebt; Nadja spült nach, spült, weil sie ohnehin schon am Spülen ist, noch eine Abführtablette hinterher; ja richtig, ich weiß, was bringt das denn dann mit den Naturheilmitteln? Nichts bringt es, Nadja rollt den Kopf nach vorn, zur Seite und in den Nacken; sie bewegt ihn, als sei er gar nicht angewachsen.
Die Küche ist lichtdurchflutet, Staubflöckchen tanzen in der Sonne; der Boden unter Nadjas Füßen ist ebenfalls staubig; trockene, rissige Hartholzdielen unter Nadjas trockenen, rissigen Fußsohlen. Sie schlüpft in die Pumps und greift nach der Handtasche. Zwei Klassen hat sie heute und eine einstündige Besprechung.
Die Linde vor dem Haus blüht, den Bürgersteig bedeckt ein klebriger Film. Nadja geht nach vorn bis zur Straßenbahnhaltestelle. Warum Nadja kein Auto hat, weiß niemand. Vielleicht hatte sie eines und hat es zu Schrott gefahren. Vielleicht besitzt sie gar keinen Führerschein, weil sie mit achtzehn Wichtigeres zu tun hatte, als Fahrstunden zu nehmen. Vielleicht hat man ihr die Fahrerlaubnis entzogen, weil sie mal massiv die Regeln verletzt hat.
Mollstraße Ecke Otto-Braun-Straße steigen zwei junge Frauen mit großen Taschen in die Straßenbahn ein. Noch wirken sie entspannt und schlürfen Milchkaffee aus Pappbechern, doch sobald sie Nadja entdecken, geht ein Ruck durch ihre Körper, ihre Brustkörbe heben, ihre Köpfe senken sich, die Augenlider flattern, und ein fast unhörbares »Guten Morgen« entweicht ihren Mündern in Richtung Nadja.
Nadjas Augen sind riesig, erfassen alle Insassen der Straßenbahn mitsamt ihren Bewegungsabläufen; selbst am äußersten Rand, wo bei anderen Gesichtsfeldern bereits Unschärfen auftreten, kann Nadja noch ein gebeugtes Kreuz oder ein nach innen gedrehtes Knie erkennen, und nun sind ihre Pupillen, sind die Spitzen ihrer Zäpfchen und Stäbchen auf die beiden jungen Frauen gerichtet. Das »Guten Morgen« der beiden bleibt unerwidert, doch eine leichte Aufwärtsbewegung von Nadjas Kinn signalisiert Gnade und Sanftmut, und der Kaffee darf ausgetrunken werden.
Die beiden jungen Frauen sind zwei von Nadjas ›Böckchen‹ – Böckchen deshalb, weil sie erst außerhalb der staatlichen Ballettschule Abitur gemacht haben, bevor sie auf die Akademie kamen, im Gegensatz zu den ›Schäfchen‹, die bereits seit der Grundschule mit der Einrichtung vertraut sind.
Die Böckchen sind lustig, stoßen sich sogar in Nadjas Stunden, in der kurzen Zeit, die ihnen für ihr Weiterkommen bleibt, die Hörner ab. Dumm sind sie und widerborstig. Sie bringen Farbe in Nadjas neuen Alltag, zaubern ihr ein Lächeln in die leicht gefurchten Mundwinkel – wer seid ihr, dass ihr denkt, ihr hättet irgendeine Chance?
Nadja geht mit großen Schritten und nach außen gedrehten Fußspitzen durch den Flur der Ballettakademie. Die Flügeltüren schwingen auf, Nadjas Arme schwingen mit; sobald Nadja ihre Schritte noch ein wenig beschleunigt, könnte sie abheben, davonfliegen, gegen die Decke stoßen.
Nein.
Nadja kann nicht fliegen, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Aber da ist diese Linie, die ihren Körper in zwei symmetrische Hälften teilt. Wenn sie diese Symmetrie kurz aufgibt, indem sie zum Beispiel nach der Türklinke greift, um die Tür zum Besprechungszimmer zu öffnen, hält die Welt für einen Moment den Atem an, wartet erregt, bis sie zurück in die Grundstellung kommt. Und da ist sie – gerahmt von der Türzarge, freundlich begrüßt vom Chef und den Kollegen.
Papiere, Prüfungstermine. Es riecht nach Aktenordnern, altem Linoleum und neuen, billig besorgten Polsterstühlen. Obwohl sie nun bereits eine Weile, seit Beginn des Wintersemesters, regelmäßig hierherkommt, hat Nadja sich noch nicht an den sitzenden Teil ihrer Tätigkeit gewöhnt. Für die Hüfte mag es erholsam sein, doch Nadjas Hände sind unruhig, ihre Schrift ist klein und seltsam abgesetzt, sie malt die Buchstaben einzeln, anstatt zusammenhängend zu schreiben. Vermutlich macht sie Fehler, verrutscht in den Zeilen, verwechselt Namen und Geburtsdaten.
Aber das sind Interna, das geht mich im Grunde nichts an. Außerdem ist fraglich, ob es etwas zu bedeuten hat, genau wie all die anderen, breit ausgewalzten Details.
Nadjas Freundin zum Beispiel ist Apothekerin. Nicht aus Berechnung, nein, Nadja kannte Andrea schon, bevor sie all die Tabletten geschluckt hat, und dennoch ist der Zufall praktisch, denn er spart ein ums andere Mal den Weg zum Arzt.
»Sei vorsichtig«, sagt Andrea, »sei vorsichtig mit dem Darm.«
In Andreas Apotheke gibt es viele bunte Pappaufsteller. Manche zeigen lediglich Medikamentenschachteln, andere aber auch Tiere, Organe oder Körperteile. Es gibt einen Aufsteller mit dem Gesicht einer Frau, das von Rissen durchzogen ist wie äthiopische Erde in der Dürreperiode. Es gibt einen Aufsteller, auf dem eine Frau die hubbelige Haut ihrer Oberschenkel abstreift wie eine Hose. Es gibt einen Aufsteller, auf dem der nackte Körper einer Frau aus verschiedenen bunten Puzzleteilen besteht, von denen das eine oder andere herausfällt.
Andrea stört es nicht, wenn Nadja im Gespräch abwesend zu sein scheint, denn Andrea redet selbst gern und viel. Dann ergibt eins das andere, ohne dass Nadja etwas beisteuern müsste, und Andrea weiß hinterher selbst nicht genau, wie sie auf all die interessanten Themen und Zusammenhänge gekommen ist.
Die beiden kennen sich von früher, von viel früher, schon aus Kindertagen. Sie sollten eigentlich wissen, wie die andere zu der wurde, die sie ist. Und Andrea weiß viel, sie kennt Mittel gegen jedes Leiden, alliopathische Mittel, homöopathische Mittel, Andrea kennt die bildhafte Sprache der Pappaufsteller und die Artikel und Anzeigen in der Apothekenrundschau mitsamt den Sonderheften für Babys und Senioren, sie kommt auf all die interessanten Zusammenhänge während ihrer einseitigen Gespräche mit Nadja, doch wenn jemand sie fragt, wie das passieren konnte, das mit Nadja und Mario, schiebt Andrea nur die Hände in die Taschen ihres Kittels, der über den Hüften ein wenig spannt, und sagt: »Mit vierzig muss eine Frau sich zwischen ihrem Gesicht und ihrer Figur entscheiden.«
Als ob das eine passende Antwort auf die Frage wäre.
Aber wer weiß.
Auch mir erschließen sich die Zusammenhänge erst durch das unermüdliche Beschreiten verschlungener, unübersichtlicher Pfade. Und deshalb folge ich Nadja, die nach der Arbeit auf direktem Weg nach Hause geht. Dort wartet Daniel auf sie, ihr Freund, ihr Lebensgefährte, mit dem sie vielleicht schon verheiratet wäre, wenn sie sich nicht beide dazu entschlossen hätten, Daniels Antrag von vor ein paar Jahren als Witz einzustufen, als romantische Verirrung nach allzu viel Rotwein.
»Hast ja recht«, hat Daniel gesagt und zu Boden geschaut, um Nadjas zweifelndem Blick zu entkommen – wobei gar nicht sicher ist, dass Nadjas Blick wirklich zweifelnd war, vielleicht hat Daniel auch nur seine eigenen Zweifel in Nadjas Blick hineingelesen, denn Daniel hatte bis dahin selbst noch nie ans Heiraten gedacht. »Wozu und für wen?«, hat er gesagt, wenn jemand davon anfing, aber an diesem Abend ist ihm plötzlich danach gewesen, etwas zu sagen, das Nadja eine Reaktion abverlangte, Nadja, die mit ihrem Glas in der Hand auf dem Sofa saß, die Beine angezogen, den Blick aus dem Fenster in die Ferne gerichtet. Und Nadja drehte prompt den Kopf und sah Daniel direkt ins Gesicht.
»Hast ja recht«, hat Daniel daraufhin schnell gesagt, »hast recht.«
Daniel hat einen sehr großen Schwanz. Ich weiß, was für ein blödes Statement das ist, wie nichtssagend, wie uninteressant, wie irrelevant, selbst als Hinweis auf Daniels eventuelle sexuelle Attraktivität völlig unpassend –
Nein, wirklich. Ich hätte es nicht erwähnt, wenn mir irgendein besseres Merkmal eingefallen wäre. Aber das Zweite, was ich erwähnen könnte, ist seine Heroinsucht, und mit der verhält es sich ähnlich wie mit der Penislänge, nur umgekehrt. Die Schwanzgröße darf nichts über ihn aussagen, die Heroinsucht sagt angeblich alles über ihn aus.
Er interessiert sich für Möbeldesign und für Küchengeräte. Er hat, als er ein Kind war, Streichholzschachteln gesammelt, vor allem italienische, mit diesen kurzen, dünnen, wild durcheinandergewirbelten Zündstiftchen aus Wachspapier.
Nadja geht auf direktem Weg nach Hause, und egal, wer ihr entgegenkommt, er dreht sich nach ihr um. Dreißig Jahre Tanz haben sich in Nadjas Körper eingeschrieben, und auch wenn er nun in gewisser Weise in den Ruhestand getreten ist, spricht er weiterhin davon, Nadjas Werkzeug zu sein.
Ich selbst habe mir immer gewünscht, beruflich mit meinem Körper zu tun zu haben – weil ich mich dann nach Feierabend nicht mehr um ihn zu kümmern bräuchte. In meiner Freizeit könnte ich ihn einfach nur genießen, ihn die Straße entlang ausführen wie Nadja, der die Männer aus den Autos und Straßenbahnen hinterherschauen: ihrer hinreißenden Erscheinung, zierlich und aufrecht, den Mantelgürtel straff um die verschwindend schmale Taille gebunden. Nadja scheint im Gehen ganz bei sich selbst zu sein, aber wenn dort, wo sie entlanggeht, plötzlich geschossen würde – Bandenkrieg, Schusswechsel aus vorüberfahrenden Autos, Kugelhagel überm Bürgersteig –, dann würde Nadjas Körper äußerst behände ausweichen, sich automatisch nach vorne und zur Seite biegen, ohne großes Zögern hinter einem Laternenmast verschwinden oder sogar an ihm hinaufklettern – während untrainierte, unförmige Leute wie ich schnaufend davonhasten oder als schlaffer Haufen ohnmächtig in sich zusammensinken.
Mag sein, dass meine Hüfte weniger verschlissen ist als Nadjas, dafür weiß ich aber auch nichts mit ihr anzufangen. Weder im Ernst- noch im Normalfall.
Nadja geht doch nicht auf direktem Weg nach Hause, sondern beim italienischen Feinkosthändler vorbei. Nicht, weil sie Lust auf getrocknete Tomaten oder original florentinische Biscotti hätte – ich erwähnte ja bereits, dass für Nadja Nahrung nichts mit Lust zu tun hat. Zum Feinkostladen geht sie, um das Läuten der getöpferten Glocke über der Ladentür zu hören, einer Glocke, die nicht klingt, sondern in der der Klöppel nur dumpf hin und her schabt.
Nadja kauft Pecorino für Daniel, legt beim Hinausgehen die Hand auf das in Wachspapier gewickelte, kalte Stück Käse in ihrer Handtasche. Es hat scharfe Kanten, die leicht abbröckeln und nur von den Kniffen des Papiers zusammengehalten werden.
Daniel sieht nicht auf, als Nadja durch den Flur kommt und ihre Handtasche ablegt. Er sitzt in seinem Arbeitszimmer am Keyboard, hat einen Kopfhörer auf den Ohren und tippt mit einem einzelnen Finger in unregelmäßigen Abständen auf die Tastatur. Dabei hat er die Augen geschlossen, denn er komponiert.
Er kratzt sich.
Er nimmt den Kopfhörer ab und fährt sich durchs Haar, greift nach der Schachtel mit den Mentholzigaretten, geht zu Nadja in die Küche, wo sie am Herd steht und getrocknete Stiefmütterchen aufgießt.
Anstatt Nadjas herrliches, dichtes, zum Knoten zusammengedrehtes Haar zu bewundern – einen Knoten, der auch ohne eingelegtes falsches Haarteil einen Durchmesser von fünfzehn Zentimetern hat – bleibt Daniels Blick an den roten, erhabenen Stellen hängen, die Nadjas Hals bedecken.
Nadja tunkt einen kleinen Lappen in den heißen Stiefmütterchensud, knickt den Kopf ab und legt sich das Läppchen auf den Hals. Zwei weitere, mit heißem Sud getränkte Lappen legt sie sich in die Armbeugen, dann steht sie da, mit abgeknicktem Kopf und angewinkelten Ellbogen, und schließt die Augen.
Daniel wendet den Blick ab. Deshalb sieht er auch nicht, wie Nadja den Schmerz, den ihr die kochend heißen Läppchen verursachen, nach innen in den Körper nimmt – um nicht aufschreien und die Läppchen abschütteln zu müssen. Nadjas Lippen haben sich ein klein wenig geöffnet; das tun sie sonst nie, Nadja hat normalerweise auch ihre Lippen fest im Griff. Doch jetzt bilden sie ein Ventil, durch das die Abluft des im Innern gespeicherten Schmerzes entweichen kann. Der Schmerz selbst sinkt zusammen, fällt in Nadjas Unterleib und wird vom Beckenboden aufgefangen und abgefedert. Von dort strahlt er zurück auf ihre Haut und mildert den unerträglichen Juckreiz.
Nadja schlägt die Augen auf und nimmt die Läppchen beiseite.
Daniel raucht Mentholzigaretten. Er erwähnt, dass Leute zum Abendessen kommen, reibt mit dem Fußrücken die eigene Wade entlang; er mag sich Nadja nicht nähern, ihr nicht beistehen oder sie gar berühren.
Und auch Nadja steht da, ohne in irgendeiner Weise Bezug auf Daniel oder Daniels Körper zu nehmen.
Nadja und Daniel sind voll und ganz mit ihren eigenen Körpern beschäftigt und haben kein Interesse mehr an dem des jeweils anderen.
Ein Körper reicht, um den man sich kümmern muss.
II.
Ich hatte persönlich wirklich nichts mit Nadja zu tun.
Natürlich war sie mir schon auf der Straße aufgefallen, allein durch die Art, wie sie geht, diese Tänzerinnenart, und dann die irre langen Haare –
Eine Frau wie Nadja fällt jedem auf, der nicht auf beiden Augen blind ist. Wobei Volker, mein Mann, sie mir gegenüber nie mit einem Wort erwähnt hat. Volker war schon mehrfach bei Daniel zum Abendessen, aber dass Nadja Daniels Freundin ist, hatte er mir bislang nie erzählt.
Warum?
Ja, warum wohl.
Ich bin nicht eifersüchtig. Neidisch ja, auf Nadjas Figur, ihre Beweglichkeit und ihren Ehrgeiz, aber eifersüchtig? Ich gestehe Volker seine Phantasien zu, ich habe nicht das Gefühl, dass sie unsere Ehe gefährden. Seine Phantasien gehören ihm, genau wie mir die meinen. Es muss Abstand geben zwischen den Menschen, die Verschmelzung ist ein Zustand, der nur Sekunden anhält und auf Dauer auch gar nicht auszuhalten ist.
An diesem Abend Mitte Mai war ich jedoch mit dabei.
Nadja trug olivgrüne, bauschige Cordhosen; typisch Primaballerina, Beine bis in den Himmel, trainiert und wohlproportioniert, und doch versteckt in viel zu weiten Hosen.
Warum?
Weil sie’s nicht nötig hat.
Sie sitzt da, zupft an ihrer Artischocke und würdigt die Gäste nur gelegentlich eines Blickes. Die meiste Zeit sieht sie auf den Tisch, still und geheimnisvoll; eine Frau, die jede andere am Tisch dazu zwingt, sich in sie hineinzuversetzen: ihre Situation am Ende einer glänzenden Karriere, ihre Beziehung zu Daniel, der doch wohl offensichtlich ein Drogenproblem hat. Warum trägt sie diese Cordhosen, wo sie doch alles hätte anziehen können?
Ich bin in meine hellblaue Umstandsbluse gewickelt und wünsche mich weit weg, aber Volker hat den Babysitter bestellt, Volker will wieder mehr mit mir zusammen ausgehen, kinderlose Freunde haben, Künstlerfreunde, Freunde mit Ostbiographie.
Wobei es am Tisch dann doch die meiste Zeit wieder um die Kinder geht.
Fast alle, die dort sitzen, haben eines, manche bereits zwei, ich das dritte im Bauch, und es ist leichter, über andere zu reden als über sich selbst.
Nadja spielt mit der Gabel und sagt nichts.
Daniel ist als Einziger tatsächlich kinderlos und erwähnt deshalb, dass immerhin Nadja eines habe.
»Ach so?«, sagen die Gäste erstaunt, und Daniel führt aus, dass Nadjas Sohn schon groß sei und sie vermutlich bald zur Oma machen werde.
Die Gäste lachen. Nicht nur, dass Nadja nicht besonders mütterlich wirkt, jetzt soll man sie sich gleich als Großmutter vorstellen! Aber klar, warum nicht. Die meisten der Gäste sind aus dem Westen, sodass sich niemand traut, weiter nachzufragen; man weiß ja, dass die drüben zum Teil schon recht früh ihre Kinder gekriegt haben, weiß auch, dass es keine Skrupel gab, sein Baby in die Krippe oder gleich ganz wegzugeben.
»Wie heißt er denn?«, frage ich möglichst unverfänglich, aber Nadja tut so, als habe sie mich nicht gehört, und alle anderen nehmen meinen missglückten Versuch zum Anlass, nun auf jeden Fall den Mund zu halten. Ich selbst sage auch nichts mehr, erst später, auf dem Nachhauseweg, frage ich Volker, wo das Kind denn sei. Volker zuckt mit den Schultern. Ob aus Diskretion oder Desinteresse, ist bei ihm nie so recht festzustellen.
Hanne, Nadjas Mutter, hat das Baby damals behalten.
Damit Nadja in Ruhe ihren Körper trainieren, verbiegen und vorführen konnte, in Berlin, New York, Sankt Petersburg – Nadjas Körper schwebte über die Bühne, unbeschwert von einem Säugling, der an ihm dranhing und gefüttert werden wollte. Und Hannes Körper blieb ohnehin zu Hause, an Hanne hing auch so schon einiges dran. In Hannes Haus ist ständig der Fahrstuhl kaputt, und im Hausmeisterstützpunkt geht keiner ans Telefon.
Hanne trägt die Einkäufe zu Fuß in den zehnten Stock. Es hat keinen Sinn, sich darüber zu beklagen. Bei wem auch, und wozu?
Mario, der inzwischen groß gewordene Enkelsohn, isst seit geraumer Zeit nichts mehr von den Einkäufen, er ernährt sich hauptsächlich von synthetischen Eiweißprodukten, die den Muskelaufbau beschleunigen und die er günstiger bekommt, seit er im Fitnessstudio als Aushilfe arbeitet.
Hanne öffnet den Hängeschrank, und da stehen sie, harmlose Plastikbüchsen mit Drehverschluss; wie Säuglingsnahrung sehen sie aus, wie das Milchpulver, das Hanne Mario vor sechzehn Jahren angerührt hat, weil ihr Körper ihn nicht ernähren konnte, weil sie nur die Großmutter war und der Körper seiner Mutter für Höheres bestimmt.
Hanne verstaut drei eingeschweißte Tortenböden.
Hanne wird diesen Sonntag sechzig.