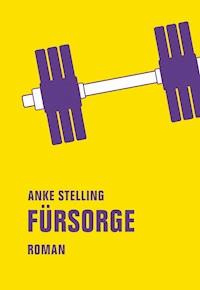Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Schäfchen im Trockenen
Weiß man doch
Selbst schuld
Weiß man nicht
Wie man’s macht
Der Aufstieg
Die richtig großen Dosen
Pech
Bewahren
Die Wahrheit
Das Elendscasting
Die Liebe
Der Wille
Die Scham
Das Elend
Der Sprung
Opfer
Impressum und Copyright
Klappentext
Über dieses Buch
Über die Autorin
Anke Stelling
SCHÄFCHEN IM TROCKENEN
Roman
Hör zu, Bea, was das Wichtigste ist und das Schlimmste, am schwierigsten zu verstehen und, wenn du’s trotzdem irgendwie schaffst, zugleich das Wertvollste: dass es keine Eindeutigkeit gibt. Das muss ich hier, ganz zu Anfang, schon mal loswerden – weil ich es immer wieder vergesse. Und vermutlich vergesse ich es deshalb, weil meine Sehnsucht nach Eindeutigkeit so groß ist und die Einsicht, dass es keine gibt, mich so schmerzt. Aber gleichzeitig ist sie auch tröstlich.
Wie kann etwas, das weh tut, mich trösten? Da hast du’s schon. Genau so was meine ich.
Wenn ich zum Beispiel sage: Ich liebe dich. Oh ja, ich liebe dich. Es ist unglaublich. Du bist unglaublich! Du bist so schön und klug und lebendig, du bist zum Küssen und zum Streiten und zu allem bist du die Beste. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, und gleichzeitig wär’s mir lieber, du würdest nicht existieren, denn ich halte dich, und dass du da bist, nicht aus. Wie ich um dich fürchte, wie ich um mich fürchte, nur, weil du gebor en bist. Und ich muss dir ganz im Ernst auch raten, dass du deinerseits schleunigst das Weite suchst. Renn, so schnell du kannst, bring Platz zwischen dich und mich, werde nur schnell erwachsen. Ich bin Gift für dich, verstanden? Die Familie ist der Hort der Neurosen, und die Herrscherin im Hort, in unserm Horst, das bin ich. Ich bin der Adler mit den Krallen und dem warm-weich brütenden Hintern, mit der krächzenden Stimme und der enormen Spannbreite, ich hacke jedem, der dir zu nahe kommt, die Augen aus, ich kreise über dir, bringe dir das Fliegen bei und bin dir in allem voraus. Ich zeige dir die Schönheit dieser Welt und die Gefahren, und wenn du alleine losfliegst, warte ich im Horst auf dich: voller Güte und Missgunst und Stolz.
Du weißt ja längst, wovon ich rede.
Neulich hast du dich geschüttelt, als du nach Hause kamst. »Ehrlich, Mann, das stinkt hier so!«
Und du hast recht, mein Schatz. Es stinkt. Nach uns. Nach Familie. So köstlich, geborgen und eklig, hau ab! Komm an mein Herz. Und erinnere dich, dass du da weg musst.
Weiß man doch
Ich bin ein echter Spätzünder. Oder geht das allen so, dass ihnen mitten im Leben plötzlich auffällt, was sie nicht kapiert haben, all die Jahre über, obwohl es doch mehr als offensichtlich ist?
Ich dachte immer, ich sei klug, würde die Welt kennen und die Menschen verstehen. Schließlich konnte ich schon vor der Einschulung lesen, mich gut ausdrücken und problemlos kopfrechnen. Ich wusste, dass ich mich vor Frank Häberle und dem Hausmeister in Acht nehmen muss, aber auf Simmi Sanders und die Handarbeitslehrerin verlassen kann. Doch von größeren Zusammenhängen, Strukturen oder Machtverhältnissen hatte ich keine Ahnung. Da fehlten mir die einfachsten Erkenntnisse – zum Beispiel die, dass mein Leben auch anders hätte sein können. Das nennt man wohl Sicherheit. Geborgenheit. Glückliche Kindheit.
Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich dachte: Fuck!, wenn meine Eltern woanders gewohnt hätten, hätten wir einen anderen Küchenfußboden gehabt.
Bei dieser Einsicht war ich bereits über zwanzig und schon mehrfach umgezogen: von zu Hause fort nach Berlin und dann hierhin und dorthin.
Diesmal hatte ich einen traumhaften Küchenfußboden erwischt: Dreißiger-Jahre-Holzestrich, dunkelgrün und sehr gut erhalten.
Meine Eltern hatten so ein Sechziger-Jahre-West-PVC gehabt, grau mit grauem Schlierenmuster, dreißig mal dreißig Zentimeter große Platten – weshalb das Schlierenmuster ständig die Richtung änderte. Nichts gegen diesen Fußboden; ich bin gut und gerne darauf aufgewachsen. Pflegeleicht war er auch. Erst wenn man kleben blieb, meinte meine Mutter: »Hier muss mal wieder gewischt werden«, und dann streute ich Scheuerpulver und schrubbte ohne Lappen vor, und es war erstaunlich, wie schwarz das Wasser war, das ich hinterher in die Toilette goss.
Der Fußboden war der Fußboden. Wenn Leute einen anderen hatten, lag es daran, dass sie andere Leute waren.
Der Spülkasten der Toilette hatte seitlich einen schwarzen Griff. Den zog ich, um das Fußbodenwischwasser wegzuspülen.
Der Spülkasten wurde nicht ausgewechselt, nicht, als irgendwann Spülstopptasten zum Wassersparen in Mode kamen und auch nicht als die alte Mechanik kaputt und der Griff wegen Materialermüdung abgebrochen war. Meine Eltern sagten niemals dem Vermieter Bescheid. Während der vielen Jahre, die ich bei ihnen wohnte, habe ich den Vermieter kein einziges Mal gesehen. Vielleicht habe ich deshalb erst so spät begriffen, was der Unterschied zwischen Miet- und Eigentumswohnen ist – weil meine Eltern ihre gemietete wie eine eigene Wohnung behandelten und, wenn’s nicht mehr anders ging, den Klempner selbst bestellten, ihn auch aus eigener Tasche bezahlten. Warum? Um sich nicht streiten zu müssen, schätze ich. Um so zu tun, als wären sie frei.
»Warum bist du so wütend?«, hat Renate, eine Freundin meiner Mutter, mich gefragt, als ich mit ihr im Café saß.
Ich zuckte zusammen, weil ich mir eigentlich recht gefasst vorkam, wie ich da meinen Tee trank und über alles Mögliche mit ihr plauderte. Sie aber wollte über das Buch reden, das ich geschrieben hatte, und in dem ich Müttern wie meiner vorwarf, ihre Träume von Freiheit ihren Töchtern aufgehalst zu haben – ohne Idee davon oder Hinweis darauf, wie sie vielleicht zu verwirklichen wären. Renate hatte diesen Text persönlich genommen; zu Recht, wie ich fand, auch wenn ich beim Schreiben nicht speziell an sie gedacht hatte.
»Keine Generation kommt davon«, antwortete ich, »ohne dass die nächste ihr was vorwirft.«
»Na dann viel Spaß mit deinen eigenen Kindern«, sagte sie, und ich nickte.
»Danke. Werd ich haben.«
Ich habe gern das letzte Wort. Sie aber auch.
»Bitte.« Und dazu dieser spezielle Gesichtsausdruck: schlecht kaschiertes Besserwissertum, vorgetäuschte Milde.
Diesen Gesichtsausdruck habe ich auch, diesen Gesichtsausdruck geben Mütter ihren Töchtern weiter, genau wie die ungelebten Träume, ja: dieser Gesichtsausdruck erzählt von diesen Träumen, während der Mund verkniffen schweigt. Der Mund ist verkniffen, das Kinn ein wenig vorgereckt. Renate ist groß darin, so zu gucken. Ich aber auch.
Und Bea fängt jetzt ebenfalls schon damit an, und ich ertrage nicht, dass es immer so weiter geht, lieber will ich wütend sein, reden und schreiben und Renate in den Tee spucken – damit sie mal sieht, was wütend sein heißt.
»Erinnerst du dich an den Fußboden, den wir zu Hause hatten?«, fragte ich.
»Nein. Wieso?«
»Er war hässlich. Und nicht selbstverständlich! Aber das musste ich alleine rausfinden, ihr habt ja nicht mit uns geredet.«
»Natürlich haben wir mit euch geredet, von morgens bis abends, jetzt tu doch nicht so.«
»Aber nicht über Fußböden und wie’s zu ihnen kam.«
Renate zog die Augenbrauen hoch und sah mich spöttisch an. Das kann sie auch gut: einem das Gefühl geben, man sei nicht ganz bei Trost.
Das hat sie schon getan, wenn sie früher bei meiner Mutter zu Besuch war und ich dazukam und irgendwas erzählte: von der Schule, von Freunden, von der Ungerechtigkeit der Welt. Dann zog Renate die Augenbrauen hoch und meine Aussagen in Zweifel, wies mich auf Aspekte hin, die ich übersehen hatte, setzte alles daran, mich zu verunsichern. Und ich ließ mich verunsichern, anstatt ihren Widerspruch als Diskussionstraining zu nutzen.
Das ist heute anders, heute halte ich dagegen. Sagte ihr also, dass ich inzwischen überzeugt sei, dass meine Mutter den Boden auch hässlich gefunden habe, ihn aber hingenommen als das, was sie sich eben leisten konnte, was nun mal da war, und außerdem noch meinte, sie habe weiter nichts mit ihm zu tun. Womit sie sich jedoch getäuscht habe, denn jetzt stehe er für sie. Na gut, das sei vielleicht übertrieben. Für mich ist meine Mutter die Frau, die auf diesem Fußboden steht.
Renates Augenbrauen blieben gehoben.
»Verstehst du denn nicht?«, fragte ich aufgebracht. »Ich hätte wissen sollen, was sie eigentlich wollte, wie’s zu dem gekommen ist, was dann das Normale war, was vielleicht die Alternativen gewesen wären und warum sie die nicht ergriffen hat!«
»Und was hat das mit dir zu tun?«
»Alles! Ich stand schließlich auch auf diesem Fußboden.«
Renate schüttelte den Kopf und bestellte noch mehr Tee. Ging erst mal aufs Klo, wollte offensichtlich nicht darüber reden. Doch sie muss, denn meine Mutter kann nicht mehr. Ist gestorben, bevor ich begriffen hatte, wonach ich sie unbedingt fragen muss, an welcher Stelle nachbohren, weil, wie ich nun von Renate erfuhr, das Schweigen Absicht gewesen sei, kein Versäumnis. Keine von ihnen, weder Renate noch meine Mutter, habe ihre Kinder mit Anekdoten und alten Geschichten belasten wollen, schon gar nicht mit solchen, die von mangelnden Alternativen, schlimmen Voraussetzungen und geringerem Übel handelten.
»Ihr solltet frei sein und eure eigenen Wege gehen.«
»Ja, genau«, sagte ich, »völlig unbelastet.«
Renate hatte keine Lust auf meine Ironie, wollte lieber selbst sticheln.
»Natürlich hätte deine Mutter gern einen Terrazzoboden in einem Chalet am Genfer See gehabt.«
Ja, ja. Natürlich.
Liste für Bea: Holzestrich finde ich den schönsten aller Böden, der ist heutzutage aber wahnsinnig teuer, weil er nicht mehr üblich ist. Sich Holzestrich legen zu lassen, ist inzwischen ein nerdiger Luxus, also vergiss es.
Dielen in der Küche sehen vielleicht auf den ersten Blick schön aus, sind aber anfällig für Fettflecken, und in den Ritzen sammelt sich der Dreck. Das kennst du ja von zu Hause, so ein Boden ist alles andere als pflegeleicht.
Allerdings ist ein Fliesenboden, der sich ganz einfach wischen lässt, auch nicht das, was man pflegeleicht nennt, denn den muss man dann auch täglich wischen, weil nichts einzieht oder sich wegguckt, es sei denn, die Fliesen haben dieses Schlieren- oder Sprenkelmuster, und dann, Bea, finde ich sie echt zum Davonlaufen. Schlimmer noch als PVC, denn Fliesen sind außerdem fußkalt, es sei denn, es liegt eine Heizung darunter. Sagen wir mal so: Einfarbige Terrakottafliesen mit Fußbodenheizung sind okay – wenn man eine Putzfrau hat, die sich ständig um sie kümmert.
Ich hatte noch nie eine Putzfrau. Ich habe als Putzfrau gearbeitet, aber das passt nicht in die Auflistung der Fußböden, oder doch?
Doch. Ja. Natürlich.
Ich habe beschlossen, alles zu erzählen. Nichts ist natürlich, alles ist gemacht, hängt miteinander zusammen, nutzt oder schadet dem einen oder der anderen, und was als selbstverständlich gilt, ist in besonderem Maße verdächtig.
Bea ist jetzt vierzehn und gehört initiiert. Aufgeklärt und eingeführt in die Welt der Küchenböden, Arbeitsteilung, Arbeitsverteilung, Putzjobs, Lohnkosten, Wohnkosten, Haupt- und Nebenkosten, Kosten-Nutzen-Rechnungen, das große Auf- und Abrechnen, monetär wie emotional.
Anders als meine Mutter werde ich nicht davon ausgehen, dass sie mit der Zeit schon erfährt, was sie wissen muss; anders als Renate und ihre Freundinnen werde ich nichts zurückhalten in der Vorstellung, dass meine Erzählung die Kinder negativ beeinflussen, entmutigen oder in ihrer Entfaltung behindern könnte. Im Gegenteil, ich stelle mir vor, dass ich sie ausrüste mit Wissen und Geschichten. Dass ich sie nicht naiv und leichten Mutes, sondern beladen mit Erkenntnissen und Interpretationen losschicke – Rüstung und Waffen wiegen nun mal.
Apropos Waffen.
Ich habe diesen Brief bekommen. Er ist an mich adressiert und enthält ein sauber geknifftes Blatt Papier – die Kündigung unserer Wohnung, nein, falsch: eine Kopie der Kündigung unserer Wohnung zur Kenntnis. Denn unsere Wohnung ist in Wahrheit Franks, Frank ist der Hauptmieter, und er hat die Wohnung gekündigt.
Seit vier Jahren wohnen wir hier. Nachdem Frank und Vera in die K23 gezogen sind, haben wir ihre Wohnung übernommen; ein Glücksfall, weil unsere bereits mit drei Kindern zu klein war und inzwischen hatten wir vier; ein Glücksfall, jemanden zu kennen, der einen achtzehn Jahre alten Mietvertrag besaß und nicht mehr brauchte.
Doch wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Der Brief ist die Quittung für das, was ich getan habe, deshalb ist er auch an mich und nicht an Sven oder an uns beide adressiert. Ich bin schuld an der Misere, ich habe Frank in die Lage gebracht, diese Konsequenz zu ziehen. Alles, was passiert, habe ich mir selbst zuzuschreiben, und das tue ich, hier in meiner Kammer, diesen zwei Quadratmetern neben der Berliner Altbauküche, eigentlich gebaut als Speisekammer, eigentlich der hintere Teil des Klos, mit dem sie sich das Fenster teilt. Die Kinder sind in der Schule beziehungsweise Kita, Sven ist in seinem Atelier – das er auch nur zwischennutzt, bis der Investor den abgelehnten Bauantrag umformuliert hat und durchbekommt. Die Formulierung ist entscheidend. Ich starre auf den Brief.
»Sehr geehrte Damen und Herren«, steht da, unpersönlich, an die Hausverwaltung gerichtet, und für mich gibt es diesen Stempel, »Zur Kenntnis«, und überhaupt keine Anrede. Nur die grüne Stempelfarbe. Sehr amtlich. Sehr seltsam, wo Frank doch nicht das Amt ist, sondern ein alter Freund. Woher hat er bloß diesen Stempel? Hätte er nicht vielleicht mal anrufen können?
Nein. Frank will nicht mit mir reden.
»Geht ja auch nicht«, würde Vera sagen.
Vera hat mir schon vor Monaten eine E-Mail geschickt, in der stand: »Unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende.« Was ich nicht übersetzt hatte mit: »Überleg dir besser gleich mal, wo ihr hinzieht, als nächstes schick ich nämlich Frank.«
Ich hatte ihre E-Mail so verstanden, dass sie mir die Freundschaft kündigt, sich nicht mehr mit mir treffen mag.
»Ich liebe Dich«, stand da noch, und erst mit der Kündigung in der Hand fiel mir auf, dass es zwei Arten gibt, das zu sagen: schlicht und ergreifend, weil es stimmt – oder drohend, um eine Maßnahme einzuleiten. Eltern reden so. Und Götter.
Mit der Kündigung in der Hand wurde mir klar, dass Veras Art die zweite war, denn ich bin zwar nicht ihr Kind, aber eine uralte Freundin, quasi eine Wahlverwandte, und damit gelten die Familienregeln auch für mich.
Bei Vera in der Familie wurde die Liebe stets sehr betont, ganz egal, was für Scheußlichkeiten abliefen oder darauf folgten; Veras Liebeserklärung hätte mich misstrauisch machen müssen, schließlich habe ich »massiv die Regeln verletzt« und brauche mich deshalb »nicht zu wundern«.
Die Regel, die ich verletzt habe, heißt: »Schmutzige Wäsche wird nicht in der Öffentlichkeit gewaschen.« Auch ein schöner Spruch, der Familien zusammenhält. »Wäsche« steht für privat, »schmutzig« steht für nicht herzeigbar und »waschen« steht für ausplaudern, verraten, erzählen. Und wenn ich sage, dass Erzählen mein Beruf ist, dann sagt Ulf: »Dahinter kannst du dich bestimmt nicht verstecken.« Denn mein Beruf sei schließlich selbstgewählt.
Es gibt ein Bilderbuch von Leo Lionni, in dem er den Beruf des Künstlers verteidigt. Das Buch war schon vor vierzig Jahren ein Renner und ist jetzt ein Klassiker – was nicht heißt, dass seine Botschaft durchgedrungen wäre.
In diesem Buch gibt es eine Gruppe von Mäusen, die für den Winter Vorräte sammeln und sich ordentlich abplagen – während eine von ihnen nur in der Sonne liegt und angeblich Farben, Gerüche und Eindrücke sammelt. Hat die überhaupt ein Recht, von den Vorräten zu essen, wenn der Winter kommt? Doch siehe: Irgendwann im dunkelsten und hungrigsten Moment am Ende des Winters schlägt die Stunde der angeblich faul herumliegenden Maus, und sie rettet die anderen mit ihrer Beschreibung der Farben und Gerüche und des Geschmacks der Welt. »Du bist ja ein Dichter«, sagen die Mäuse, und die Künstlermaus wird rot und nickt.
Ob Leo wegen dieser Geschichte auch aus seiner Wohnung gejagt wurde? Bestimmt haben einige seiner Freunde mit Festanstellung sich in den stumpfsinnigen Sammelmäusen wiedergefunden, und seine Ex-Frau hat gesagt, wie arrogant er sei, sein offensichtliches Versagen als Familienernährer zur Weltenrettung aufzublasen. Aber wer weiß. Vielleicht haben sie auch alle gelacht und das Buch Freunden und Verwandten zum Geburtstag geschenkt, waren stolz auf Leo und dankbar, dass er sich die Mühe gemacht hat, ihrer Ambivalenz und dem ewigen Kampf um Lebensentwürfe Ausdruck zu verleihen.
Vera, Friederike, Ulf, Ingmar und so weiter waren jedenfalls nicht dankbar, dass ich Worte für unsere Misere gefunden hatte, im Gegenteil. Sie fanden schon »Misere« eine unzulässige Bezeichnung. Weil doch in Wahrheit alles gut war.
Gut: Es geschafft zu haben. Bis hierher gekommen zu sein, seine Schäfchen im Trockenen zu wissen – zumindest jedes im eigenen Zimmer, in der Kita oder an der Wunschschule, die der Einzugsschule aus diversen Gründen vorzuziehen ist.
Alle gesund. Und munter – zumindest nicht so schlecht gelaunt, dass was verändert werden müsste; noch genügt es, die miese Laune an den andern auszulassen, an all denjenigen, die sich nicht so benehmen, wie man es sich vorgestellt hat.
Mies: Diese Art von gutem Leben eine Misere zu nennen.
Im dunkelsten Moment habe ich statt von Sonne und Farben vom Dunkel des Moments erzählt – was nur manche Mäuse tröstlich finden, andere nicht, und manche von denen, die in meinem Dunkel eine Rolle spielen, haben sich verraten gefühlt und benutzt.
»Wer bist du, dass du deine Sicht über andere stellst?«, fragten sie. »Wer hat dir das bitte sehr erlaubt?«
Ich mir selbst. Die Dichtermaus.
Dunkel ist es im Dunkeln und einsam in meiner Kammer.
Drei Monate beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist. Ende des Jahres müssen wir hier raus.
Weißt du überhaupt, Bea, dass Frank unser Hauptmieter ist? Ich fürchte, ich hab dich ebenso im Unklaren über die Verhältnisse gelassen wie meine Eltern mich. Ich fürchte, du nimmst unseren Küchenboden auch für selbstverständlich.
Ich habe ihn aufs Spiel gesetzt. Jetzt ist er weg. Selbst schuld; wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. »Hallo, hört mich wer?« Nein. Keiner sagt was.
Niemand redet, jedenfalls nicht über die wichtigen Fragen, persönlichen Nöte, den Eigenanteil.
Fünfundzwanzig Prozent der Gesamtsumme – was das wohl in Euro ist?
Ich kann schreiben, was ich will, nur das Surren der Lüftung meines Laptops ist zu hören. Beunruhigend laut ist dieses Surren inzwischen, wer weiß, vielleicht setzt es demnächst aus. Ich brauche ein Backup, eine Sicherungskopie.
Wusstest du, dass Schreiben Sicherheit bedeutet? Versicherung, Rückversicherung, einen Halt- und Angelpunkt auch noch in die Zukunft hinein; da steht’s doch, ja, ich erinnere mich!
Ein Haus kann ich dir nicht bieten, Bea, nicht mal eine Wohnung, aber ich kann dir was erzählen, dir alles sagen, was ich weiß.
Ist mir egal, ob du’s hören willst. Ich bin Resi, die Erzählerin, ich bin Schriftstellerin von Beruf. Pech für dich, warum suchst du dir so eine Mutter?
Das ist nämlich auch eine weitverbreitete Erzählung: Dass Kinder sich die Eltern aussuchen. Dass sie vor ihrer Geburt kleine, umherschwebende Seelen sind, unterwegs zu dem passenden Paar. Genauso die Idee, dass Eltern das Kind bekommen, das sie verdienen – oder brauchen auf dem Weg zur vollen Reife.
Gefallen dir solche Geschichten? Mir nicht.
Aber du siehst, ich kenne sie, denn sie werden erzählt und entfalten ihre Wirkung. Noch so was, das ich viel zu spät begriffen habe: Wie stark Geschichten sind und dass Erzählen Macht bedeutet.
Es gab diesen Elternabend vor einigen Jahren an deiner Schule, einen Abend, wo es ziemlich hoch herging und Männer mit grauen Schläfen und rauen Stimmen sich gegenseitig ins Wort fielen – späte Väter, die, wie mir hinterher gesagt wurde, für die FAZ oder den Deutschlandfunk schrieben.
Ach, dachte ich, natürlich! Man kann auch Journalist werden, um Macht zu erreichen, Schreiben muss nicht zwangsläufig Ausdrucksmittel gebeugter Figuren und stotternder Redner sein, es kann auch betrieben werden, um Pflöcke einzuschlagen, Meinungspfosten, Deutungspfeiler.
»Ich mach dich fertig«, war jedenfalls die Haltung hinter den Redebeiträgen auf jenem Elternabend, und der Stuhlkreis war die Arena, in die die Redner traten, um Stärke zu demonstrieren und Schrecken zu verbreiten – zum Wohle und Schutz ihrer Kinder, versteht sich.
Ich war damals hoffnungslos unveröffentlicht. Niemand hätte hinterher gesagt: »Das ist Resi, die Schriftstellerin«, sondern: »Das ist Resi, die Mama von Bea«, und das hätte wohl reichen sollen als Basis für einen Redebeitrag auf dem Elternabend. Aber nein. In willkürlich gebildeten Gemeinschaften ist wichtig, wer man ist. Und wer man ist, ist nichts anderes als das Maß an Macht, das man besitzt – was besonders erbärmlich ist, wenn »Achtsames Miteinander«, »Nie wieder Mobbing« oder »Jeder ist anders« auf der Tagesordnung stehen.
Weißt du, Bea: Ich bin inzwischen selbst eine späte Mutter. Ich merke es daran, dass mir die Puste ausgeht – vor allem im Miteinander mit Miteltern. Ich habe den Optimismus und die Neugier verloren, die ich noch hatte, als ich zu deinen Kita-Elternabenden ging: Da war ich Anfang dreißig und hatte Lust, Mutter zu sein. Jetzt bin ich Mitte vierzig und will meine Ruhe vor diesen Arschgesichtern, ehrlich, ich verachte sie. Die Angst, die ihnen aus den Poren tritt, und wie sie poltern und hetzen und versuchen, sich mit irgendwem gemein zu machen, der ihnen Schutz bieten könnte, weil er stark ist. Wie sie Grüppchen bilden, Schwächere ausschließen, darauf lauern, dass jemand anderes sich lächerlich macht –
Ich bin auch so.
Da kann man gar nichts tun, das ist die Angst. Kaum etwas ist unheimlicher als willkürlich gebildete Gemeinschaften, kaum etwas ist furchteinflößender als ein Haufen Leute, der glaubt, zu gemeinsamen Beschlüssen kommen zu müssen.
Aber Wegbleiben geht eben auch nicht, schließlich muss ich euch beschützen, indem ich markiere, dass ihr Eltern habt, und zwar solche, die Macht besitzen. Die immerhin so viel Macht besitzen, dass sie einen Elternabend durchstehen können! – Ja, richtig, Liebling. Es ist ein Teufelskreis.
Wenn’s um Machthunger geht, ist es jedoch durchaus praktisch, Kinder zu haben. Die kann man vorschieben, es müssen nicht mal die eigenen sein. »Kindeswohl« zieht immer, denn wer will schon, dass es Kindern schlecht geht? Mich schüttelt es ob der Verlogenheit.
Doch was soll ich tun? Nicht mehr hingehen, zu keinem Elternabend, zu keinem Eltern-»Stammtisch« – die heißen so, ohne dass sich jemand überlegt, dass der Name vielleicht das Niveau festschreibt, auf dem sich dort unterhalten wird.
»Hab dich doch nicht so, Resi«, heißt es. »Ist doch nur ein Name!« »Ist doch nicht so schlimm.«
Ich weiß inzwischen, wie viel Macht Wörter, Sprüche und Geschichten haben, doch der Ausweg kann nicht sein, deshalb auf sie zu verzichten. Ich bin links, also für Gerechtigkeit und Rücksichtnahme und dafür, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und die Welt noch lange nicht so, wie sie sein soll. Wenn alle Menschen gleich viel wert sind, steht aber auch nicht fest, wer Recht hat und bestimmen darf, es herrscht im Gegenteil ein Misstrauen gegenüber solchen Machtansprüchen, ein Misstrauen, das am Ende dazu führen kann, lieber gar nichts zu machen, als in den Verdacht eines Machtanspruchs zu geraten. Linke Leute haben furchtbare Angst vor der Schuld – eben, weil sie so sehr für Gerechtigkeit und Rücksichtnahme sind. Doch das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht, und das Gegenteil davon, das Wort zu haben, ist, es den anderen zu überlassen.
»Du missbrauchst es«, sagt Friederike, »du benutzt es, um andere fertigzumachen.«
Ob sie recht hat?
Es stimmt schon, ich spüre das Wort auch als meine eigene Waffe, während ich auf dem Elternabend sitze. Beruhige mich mit der Vorstellung, irgendwann von dem Irrsinn, der da abläuft, berichten zu können. Die Welt aufzurütteln anhand meiner Beschreibung.
Aber das ist lächerlich, so funktioniert es ja nicht.
Der nächste Elternabend wird genauso ablaufen oder, wie Erich Kästner gesagt hat: »Mit den Fingern auf der Schreibmaschine hält man das Unheil nicht auf.«
Ich halte mich nur selbst zusammen. Ich bin es, für die ich schreibe, niemand sonst, jedenfalls nicht Friederike, die ohnehin meint, ich verharre in Klischees. Wieso müssen die Journalistenpapas bitte graue Schläfen haben?
Ja, genau, und wenn ich jetzt noch eins draufsetze und anmerke, dass diejenigen in der Runde, die den ganzen Abend über nichts gesagt haben, jüngere Frauen mit roten Schuhen und Filzjacken waren und dass sowohl bei den Schuhen als auch Jacken die Nähte auf lustige Art außen saßen, dann denkst du vielleicht auch, Bea, das tue nichts zur Sache, doch das sind entscheidende Hinweise, Hinweise auf die Wirklichkeit, und die muss rein in den Text, auch wenn er dadurch schmerzt. Zwickt und beißt und birst vor Klischees.
Ich hätte’s auch gerne alles ganz anders.Utopien könnte ich schreiben. Fantasy.»Es war einmal ein Mann, der hatte gar nichts an.Der Mann ging in den Wald, doch da war’s ziemlich kalt.Er traf die weise Frau, die sagte: ›Nicht so schlau:so ohne was im Wald.‹ Er hat sie abgeknallt.«
Ich kann’s nicht, Bea. Egal, was ich versuche, es kommt stets aufs Selbe raus. Ich finde lustig, wenn’s sich reimt – und tröstlich, wenn ein Wort vorkommt, das mich an meine Kindheit erinnert.
»Bähmullig«, zum Beispiel. Weißt du, was eine Bähmull ist? Eine beleidigte, nein, eine nur leicht vergrätzte, vermutlich Vierzehn-, vielleicht doch auch schon Vierzigjährige, die alles blöd findet, was man ihr vorschlägt. Müde und missgelaunt – bähmullig eben.
Es ist eitel, dass ich die sein will, die dieses Wort in der Literatur bewahrt. Andere könnten das auch; überhaupt gibt es schon genügend Texte, zu viele Bücher, Millionen von Geschichten, wozu also meine noch? Doch wenn ich mich auf diesen Gedanken einlasse, kann ich auch fragen: Wozu mich? Gibt schon genügend Frauen, Überbevölkerung, die Welt geht zugrunde daran.
»Du musst nicht schreiben«, hat Friederike gesagt, »bitte tu nicht so, als sei das nicht deine eigene, selbstsüchtige Entscheidung.«
Sie hat sich wiedergefunden, und es hat ihr nicht gefallen. Bähmullig will niemand sein.
»Tu nicht so«, hat auch Ulf zu mir gesagt, in derselben Kneipe, in der ich mit Renate saß, mit Friederike, mit Ulf, mit Ellen, mit Renate; eine nach der andern traf ich sie und musste erklären, warum ich das getan hatte. Ulf wollte, wie er sagte, in erster Linie vermitteln: als einer, der nicht so stark betroffen war.
»Betroffen wovon?«
»Das weißt du genau.«
Ich schwieg.
»Stell dir vor, über dich würde geschrieben.«
»Ja.«
»Und wie gefällt dir das?«
»Das muss mir nicht gefallen.«
»Du hast Intimsphären verletzt!«
»Das tut mir leid.«
»Das kommt mir aber nicht so vor. Du siehst so aus, als würdest du es jederzeit wieder tun.«
»Ja, das stimmt. Weil ich glaube, dass es notwendig ist.«
»Es ist notwendig, andere zu verletzen?«
»Ja, ich fürchte schon.«
»Und dann wunderst du dich, dass sie nicht mehr mit dir reden?«
»Ja. Dass sie nicht sehen können, was der Anlass ist. Dass sie nur Beispiele sind, dass es um mehr geht.«
»Um dich.«
»Ja, natürlich um mich! Ich leide darunter, zum Schweigen verdammt zu sein!«
»Das hab ich befürchtet.«
»Was?«
»Dass du dich selbst zum Opfer stilisierst.«
Ulf, mein alter Freund. Nicht so stark betroffen, aber dennoch mit seinem Latein am Ende.
Apropos Latein.
Ulf hat das große Latinum. Hat es ganz nebenbei schon in der Schule gemacht. Augen auf, ob A- oder B-Klasse!, meine Eltern dachten, das gälte nur bei Mercedessen.
Ulf glaubt an das Gute, muss mich dazu kriegen, Einsicht zu zeigen – sonst kehrt nie wieder Frieden ein.
Frieden kehrt ein, wenn man sich auf eine Erzählung einigt, die Rollen festlegt und den Text. Solange sich alle um die Opferrolle streiten, wird das nichts. So lange ich bestimme, wer wer ist.
Da ist also Friederike. Die Bähmull. Die Prinzessin, nach deren Laune man sich richtet, die auch nicht anders kann – es ist ihre Aufgabe, bähmullig zu sein, es gehören immer zwei dazu. Eine, die ablehnt, ein anderer, der ständig neue Angebote macht und sich bemüht. Bemühen und Bähmullen gehören zusammen, das hört man doch, das ist fast ein Anagramm.
Und dann Ulf, mein Vermittler, mit dem ich schon zusammen zur Grundschule ging und der später mein erster richtiger Freund war. Damals. Im Gymnasium.
Wo wir auch Friederike kennengelernt haben, die inzwischen sagt, man müsse sich vorher überlegen, ob man sich die Kinder leisten kann. »Weiß man doch«, hat sie gesagt, als ich mich darüber beschwert habe, wie teuer die Klassen- und die Kitafahrten sind.
Friederike hat zwei Kinder, Silas und Sophie, von Ingmar, dem Arzt, den sie auf Christians Hochzeit kennengelernt hat, Christian, der auch mit Ulf, Friederike und mir aufs Gymnasium ging.
Vera nicht, die ist auf die Privatschule gewechselt nach der Vierten.
Vera war mit mir und Ulf in der Grundschule und dann mit Friederike und Christian im Tennisverein.
Vera und Frank haben auch zwei Kinder, Willi und Leon.
Ulf hat keine Kinder, er hat Carolina und das Architekturbüro.
Christian und Ellen haben drei Kinder: Charlotte, Mathilda und Finn.
Jetzt ist die Frage, ob mit dieser Art von Aufzählung irgendwer was anfangen kann.
Ich könnte wetten, die einzige, die einem länger als zwei Sekunden im Gedächtnis bleibt, ist Friederike – weil die so ein schönes schwäbisches Adjektiv und einen Ausspruch zur Charakterisierung bekommen hat. Genau wie im Jahrbuch: »Friederike, bähmullig, ›Weiß man doch‹«.
In dem Jahrbuch, das zu unserem Abitur Anfang der Neunziger von ein paar Leuten, die zu viele US-amerikanische Highschoolfilme gesehen hatten, angelegt wurde, waren Ulf, Friederike, Christian und ich auf einer Seite gruppiert unter der Überschrift »Die Intis«.
Ich musste meiner Mutter erklären, was das heißt, dass es sich um eine Abkürzung für »Die Intellektuellen« handelte und nicht unbedingt freundlich gemeint war. Aber hey! – Es hätte schlimmer kommen können. Es gab auch die Abteilung »Stricklieseln« für die Mädchen, die im Unterricht immer ihr Strickzeug dabei hatten, oder die Abteilung »Keine Ahnung« für all jene, zu denen den Machern nichts eingefallen war.
»Bähmullig« lässt sich zum Beispiel auch mit »anspruchsvoll« übersetzen; und natürlich waren wir mit neunzehn bähmullige, abgehobene Intis in den Augen unserer feierfreudigen, unkomplizierten Klassenkameraden, und dann sind wir auch noch alle nach Berlin gezogen, wo diejenigen hingehen, die meinen, sie wären was Besonderes.
So grob ist das nämlich.
Und dennoch ist es wahr.
Apropos wahr.
Das ist ein Kampfbegriff, Bea. Damit plausibilisiere ich meine Geschichte auf ziemlich plumpe Art und Weise; geschickter wäre es, davon auszugehen, dass sie von alleine wahrscheinlich erscheint. Denn du siehst Friederike ja vor dir! Und dir leuchtet das mit den Angebern, die nach Berlin gehen, ein.
In Wahrheit sind das natürlich alles nur Worte. Wahre Worte, sicher, wieso sollte ich Unsinn verbreiten?
Eine dieser Geschichten, die immer und immer wieder, quasi bis zum Erbrechen (»bis zur Vergasung« hätten unsere antiintellektuellen Klassenkameraden gesagt und nicht verstanden, was daran das Problem sein soll) erzählt werden, ist die, dass die Wahrheit früher oder später ans Licht kommt. Verschleiern hilft nicht, verdrängen erst recht nicht, untern Teppich kehren rächt sich, und also fange ich erst gar nicht damit an.
Ich lerne nämlich aus Geschichten.
Lieber als aus den Leitsätzen einer angeblich gesellschaftlichen Übereinkunft, die sich – plump plausibilisierend – »gesunder Menschenverstand« nennt.
»Hey, das weiß man, dass man sich mit der Zeit entfremdet, vor allem, wenn alle über vierzig sind und Kinder haben.«
Ja, genau. In meinem Fall heißt das, dass wir ab Januar auf der Straße sitzen oder mal eben die dreifache Miete bezahlen.
»Hey, das weiß man, dass die Kinder Geld kosten, größer werden, Platz brauchen; das sollte man sich vorher überlegen, ob man sich das leisten kann.«
Ja, genau. Ich habe mir zu viel geleistet und kann nun sehen, wo ich bleibe.
»Innerhalb des S-Bahn-Ringes jedenfalls nicht.«
Es gibt kein Recht auf Wohnen im Innenstadtbezirk. Das hat ein Mitglied des Berliner Bausenats gesagt, und in ein paar Jahren, vielleicht auch schon Monaten, wird das ebenfalls Teil des gesunden Menschenverstands geworden sein, und ein Spätzünder, wer etwas anderes denkt.
Ich werde mich nicht beklagen. Mitleid gibt es nur für demütige Menschen und Mäuse, die lediglich missverstanden wurden in ihrer Art, zum Gemeinwohl beizutragen. Wer sich beschwert, wer sich selbst nah ist, nimmt dem Mitgefühl der anderen den Platz.
Auf keinen Fall wünsche ich mir was, das ich nicht kriegen kann. Ich will kein Opfer sein, ich bin stark. Kann meine Gefühle im Griff behalten, notfalls lügen, so wie der Fuchs: »Die sind mir zu sauer«, sagt er von den Trauben, an die er nicht rankommt.
Noch so eine Geschichte, Bea.
Wir sind umgeben von Geschichten.
»Weiß man doch« ist auch eine, zugegebenermaßen eine sehr kurze.
So lange Friederike die erzählt, werde ich meine erzählen, in der die Hauptfigur ein solches »Weiß man doch« versteht als: »Halt die Fresse, du Fotze, und find dich damit ab.«
Ich weiß, du hasst es, wenn ich ausfällig werde. Du bist mein Korrektiv, mein sanfter Engel, mein besseres Ich –
Nein. Du bist einfach nur meine Tochter. Und ich habe Angst vor dir. Um dich? Vermutlich ist beides dasselbe.
Ich will, dass es dir gut geht, will zumindest nicht schuld sein, wenn dein Leben oder das deiner Geschwister misslingt. Doch wie misst sich das Gelingen eines Lebens? Was braucht ihr, was soll ich euch geben, womit euch verschonen, was soll ich bloß tun?!
»Wie man’s macht, ist’s falsch«, lautet ein allseits beliebter Elternsatz. Er dient der Entlastung, wirkt aber immer nur kurz – denn auf lange Sicht will man’s dann ja doch ganz gerne richtig machen.
Eine Möglichkeit ist, es einfach anders zu machen als die eigenen Eltern. Selbst wenn man denen nichts vorwerfen kann: Irgendwas ist immer, und wie man’s macht, ist’s falsch, also haben sie auf jeden Fall irgendwas falschgemacht. Was man jetzt wiederum anders machen kann und, ganz richtig: wieder falsch.
Sag mir, wie man darüber nicht den Verstand verlieren soll.
Apropos Verstand verlieren.
Ingmar hat mich für verrückt erklärt. Und wenn er das tut, ist es heikel, denn er ist Arzt und besitzt dadurch die Macht, Leute in die Psychiatrie zu bringen.
Nun sage ich natürlich auch gerne, dass Leute, die mich nerven, verrückt seien, Ingmar zum Beispiel, doch bei mir ist das was anderes, nur ein Ausdruck dafür, dass ich seine Ansichten nicht teile und die Art, wie er sie ausspricht, nicht mag – und vor allem nicht das, was am Ende dabei rauskommt: meine Einweisung in die Psychiatrie.
Ulf sagt daraufhin, ich solle mich nicht zum Opfer stilisieren. Schließlich sei ich diejenige, die angefangen habe, und ich könne es jetzt auch mal gut sein lassen.
»Aber es ist nicht gut«, sage ich.
Und schon geht’s wieder los.
»Du bist nicht die, die das entscheidet, Resi.«
»Wer denn dann?«
»Jeder für sich.«
»Ja, genau. Ich find’s nicht gut.«
»Das wissen wir. Dafür hast du gesorgt.«
»Wer ist denn ›wir‹?«
»Du hättest mitmachen können.«
»Will ich aber nicht.«
»Und warum nicht?«
»Weil’s nicht gut ist!«
Und dann noch mal von vorn.
»Das sagst du.«
»Ja, genau.«
»Behalt’s für dich.«
»Ich bin Schriftstellerin.«
»Dann schreib von dir.«
»Genau das hab ich doch! Ich – find’s – nicht – gut!«
Bis einer aufgibt oder man anfängt, sich zu prügeln.
Frank hat zum Schlag ausgeholt. Er hat mein Erzählen als Kampfansage verstanden und kontert mit dem, was ihm zur Verfügung steht.
Tatsächlich habe ich mich, als nach der Veröffentlichung des Buches rauskam, wer sich davon alles beschämt und beschädigt fühlt, so erschreckt, dass ich dachte, ich müsse aufhören zu schreiben. Ich wollte niemanden verletzen, aber dann fiel mir auf, dass ich von Ingmar auch nicht verlange, nicht mehr als Arzt zu praktizieren.
»Wie man’s macht, ist’s falsch«, Macht macht verantwortlich, und wenn ich gar nichts mehr mache, bin ich schuld, dass ich nichts gemacht habe.
Wer in dieses Dilemma nicht geraten will, muss sterben. Ich meine: sich aus der Welt zurückziehen. Schon gar nicht Kinder in die Welt setzen, obwohl die dann wiederum einen Grund bieten, das Dilemma zu ignorieren und nach bestem Wissen und Gewissen weiterzumachen. Irgendwie. Zum Beispiel anders als die eigenen Eltern, zum Beispiel im Erzählen von Geschichten, die ich euch an die Hand gebe, damit ihr die Welt besser versteht. Entweder im Einklang oder im Widerspruch zu diesen Geschichten, ich habe euch auch alle impfen lassen – Na? Von wem? – von Ingmar natürlich.
Idee für einen Fernsehfilm: Das anderthalbjährige Kind der Protagonistin Resi, einer Schriftstellerin, die sich aus Angst vor Machtmissbrauch, falschen Worten und ihrer eingeschränkten Perspektive aus dem Berufsleben zurückgezogen hat – sich also nun ausschließlich um die Familie und deren Wohlergehen kümmert – erleidet nach einer Dreifachimpfung bei Doktor Ingmar einen Impfschaden und fällt ins Koma.
Das Schlimme ist, dass Resi ursprünglich gegen jede Art von Impfung war – zu riskant! Nur Profit für die Pharmaindustrie! –, aber von Doktor Ingmar dazu überredet wurde.
Impfgegnerschaft sei ein Hobby von Vollzeitmüttern, die nichts anderes zu tun hätten, als ihre kranken Kinder zu pflegen, und als solche wollte Resi nicht gelten.
Sie verklagt Doktor Ingmar und verliert – weil sie natürlich im Vorhinein bei seiner Sprechstundenhilfe ein Risikoblatt unterschrieben hat und somit an allem selbst schuld ist.
Ich bin Schriftstellerin. Ich tue einfach das, was ich für richtig halte (Was war das gleich noch? Impfen? Oder lieber nicht? Reden? Oder doch die Klappe halten? Machen oder lassen, verneinen oder befürworten, genauso oder alles ganz anders?), wie auch immer: Meine Kinder haben sich mich ausgesucht, werden die Windungen und Widersprüchlichkeiten mitmachen – weil sie mich kennen und mir wohlgesonnen sind.
Hoppla. Nein. Genau das hab ich von den alten Freunden auch gedacht.
Botschaft an alle alten Freunde: Das hier ist nichts für euch. »Unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende« – dieser Satz stammt von Vera, aus ihrer Abschiedsmail an mich. Ich finde ihn pastoral und betulich, könnte mir jedoch vorstellen, dass er euch genau deshalb gefällt. Besser jedenfalls als alles, was ich so von mir gebe, also nehmt ihn, bitte, und geht scheißen.
Bea hasst es, wie gesagt, wenn ich fluche. Sie ist meine Älteste, aber gerade noch jung genug, um mich dennoch zu lieben, also: mich irgendwie sehen und verstehen zu wollen.
Noch kann sie nicht anders, sie hängt von mir ab.
Ist es gewalttätig, meine Botschaft an sie zu adressieren?
Kann sein. Aber ich habe sie auch impfen lassen. Sie hätte sterben können daran.
Selbst schuld
Bea kommt an einem Wintermorgen zur Welt, vor mehr als vierzehn Jahren, in Leipzig. Den Winter könnte ich raunend zu »einem dieser Winter« zählen, so als sei ich eine alte Frau, die sich an noch viel ältere Zeiten erinnert.
»Damals waren die Winter noch hart, und die Menschen heizten mit Kohlen, die auf knatternden Diesellastwagen gebracht und von Männern mit rußigen Gesichtern und Schürzen um den Leib in die feuchten, gemauerten Keller geschleppt wurden. Kannst du dir das vorstellen, Bea?«
Nein. Vierzehn Jahre sind für Bea eine lange Zeit, die Dauer ihres Lebens. Für mich sind sie kurz, denn ich weiß noch genau, wie es roch in unserem Keller und dass ich gegen Ende der Schwangerschaft einen zweiten Kohleeimer aus dem Nachbarabteil stahl, um das Gewicht ein wenig zu verteilen. Links ein halbvoller Eimer, rechts ein halbvoller Eimer, und in der Mitte Bea im Bauch. Minus fünfzehn Grad vor dem Fenster und dickes Eis auf den Gehsteigen.
Es waren keine uralten Zeiten, sondern auch schon die Nullerjahre des neuen Jahrtausends mit Mobilfunk und Cyberspace, erdwärmebetriebenen Fußbodenheizungen und Kellern aus Stahlbeton; nur da, wo wir wohnten, war es noch so wie damals und deshalb erschwinglich für Geringverdiener wie Sven und mich.
Ich hätte Bea durchaus in einer modernen Klinik zur Welt bringen können, doch stattdessen kam eine Hebamme mit Hörrohr zu uns nach Hause. Weil wir das so wollten. »Leben und Tod nicht in die Hände von Maschinen legen, auch nicht in die Hände von Menschen, die sich zu Handlangern von Maschinen gemacht haben. Das geht zu weit, dachten wir, Bea, hörst du zu?«
Die Hebamme hat ihr Hörrohr an meinen Bauch gehalten und den kindlichen Herzschlag gesucht. Mit ihren Händen hat sie die Lage des Kindes ertastet und für gut befunden; so würde es problemlos rauskommen, ja, und das war dann auch so.
Sven hatte ordentlich eingeheizt. Doppelt so viele Briketts im Ofen wie sonst.
»Sven hat dich abgenabelt, Bea, hörst du? Das ist wichtig, dass wir bei deiner Geburt nur zu dritt waren, die Hebamme, Sven und ich. Dass diese Geburt nach uralten Methoden uns aber satte dreihundertfünfzig Euro Zuzahlung gekostet hat, während die Geburt in der Klinik und unter Einsatz aller möglichen Hightechgeräte und der Aufsicht von fünf Ärzten von der Krankenkasse gedeckt gewesen wäre.«