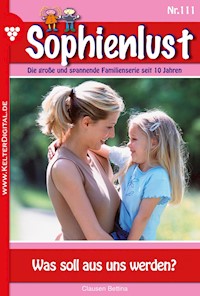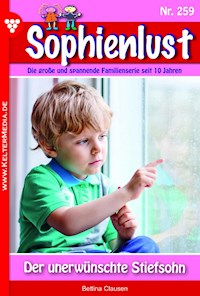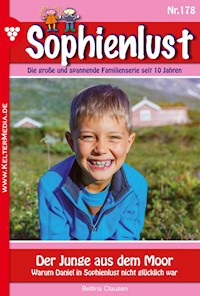Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. "Fürstenkrone" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. Sie dachte sich gar nichts, als sie die Stimme vernahm, die plötzlich über den Bordlautsprecher kam: »Meine Damen und Herren! Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind gezwungen, eine Gewitterwand zu durchfliegen. Bitte, legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein!« Marion Wächtler, zweite Stewardess der Lufthansa-Maschine München-Rom, warf einen raschen Blick durch eine der Fensterluken. Eben war der Himmel noch blau gewesen. Nun flogen dunkle Wolkenfetzen vorüber, und die ersten Regentropfen klatschten gegen die Scheiben. »Mir ist schlecht, Tante«, flüsterte das Kind, das neben Marion hertrippelte. Das kleine Mädchen mochte etwa vier Jahre zählen. Es trug ein Latzhöschen aus leuchtend rotem Cordsamt, und seine dunklen Locken waren mit einer ebensolchen Schleife zu einem Pferdeschwänzchen aufgebunden. Seit sie in München die Maschine bestiegen, hatte sein Plappermäulchen keinen Augenblick stillgestanden. Nun zuckte es weinerlich um den kleinen Kindermund.Marion beugte sich mitleidig über die Kleine.»Es gibt öfters Kinder, die das Fliegen nicht gut vertragen«, bemerkte sie tröstend. »Ich gebe dir gleich eine Tablette. Dann wird es dir bald besser gehen.Einen Augenblick lang dachte sie an die elegante silberblonde Dame im violetten Hosenanzug, die vorne im Abteil der Ersten Klasse saß. Es war ihr deutlich anzumerken gewesen, dass sie die Übelkeit ihres Töchterchens als höchst unwillkommene Komplikation der Reise betrachtete. Auf jeden Fall hatte sie sich mit Genuss ihrem Martini gewidmet und es vorgezogen, ihr Kind einer Stewardess anzuvertrauen.Kaum eine Minute war seit der Lautsprecherdurchsage vergangen, und schon war das Flugzeug mittendrinnen in einem Inferno entfesselter Naturgewalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone – 127–
Bleibt die Vergangenheit lebendig?
Warum Marion gegen einen Schatten kämpfen muss ...
Bettina Clausen
Sie dachte sich gar nichts, als sie die Stimme vernahm, die plötzlich über den Bordlautsprecher kam: »Meine Damen und Herren! Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind gezwungen, eine Gewitterwand zu durchfliegen. Bitte, legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein!« Marion Wächtler, zweite Stewardess der Lufthansa-Maschine München-Rom, warf einen raschen Blick durch eine der Fensterluken. Eben war der Himmel noch blau gewesen. Nun flogen dunkle Wolkenfetzen vorüber, und die ersten Regentropfen klatschten gegen die Scheiben. »Mir ist schlecht, Tante«, flüsterte das Kind, das neben Marion hertrippelte. Das kleine Mädchen mochte etwa vier Jahre zählen. Es trug ein Latzhöschen aus leuchtend rotem Cordsamt, und seine dunklen Locken waren mit einer ebensolchen Schleife zu einem Pferdeschwänzchen aufgebunden. Seit sie in München die Maschine bestiegen, hatte sein Plappermäulchen keinen Augenblick stillgestanden. Nun zuckte es weinerlich um den kleinen Kindermund.
Marion beugte sich mitleidig über die Kleine.
»Es gibt öfters Kinder, die das Fliegen nicht gut vertragen«, bemerkte sie tröstend. »Ich gebe dir gleich eine Tablette. Dann wird es dir bald besser gehen.«
Einen Augenblick lang dachte sie an die elegante silberblonde Dame im violetten Hosenanzug, die vorne im Abteil der Ersten Klasse saß. Es war ihr deutlich anzumerken gewesen, dass sie die Übelkeit ihres Töchterchens als höchst unwillkommene Komplikation der Reise betrachtete. Auf jeden Fall hatte sie sich mit Genuss ihrem Martini gewidmet und es vorgezogen, ihr Kind einer Stewardess anzuvertrauen.
Kaum eine Minute war seit der Lautsprecherdurchsage vergangen, und schon war das Flugzeug mittendrinnen in einem Inferno entfesselter Naturgewalten. Blitze zuckten durch die fahlgelben Wolken, aus denen einem Sturzbach gleich der Regen herniederprasselte. Obwohl die Uhr kaum die vierte Nachmittagsstunde zeigte, war es auf einmal so dunkel, dass im Passagierraum die Beleuchtung eingeschaltet werden musste.
Doch Marion war so mit dem Kind beschäftigt, dass sie kaum wahrnahm, was um sie vorging. Sie spürte nur den Sturm, der die Maschine erfasste, sie immer wieder durchschüttelte, als wäre sie nicht ein viele Tonnen schwerer Jetriese, sondern nur ein Spielzeug in seiner Gewalt.
Mit einem Papiertaschentuch trocknete sie dem Kind den Schweiß von der Stirn.
»Geht es dir ein bisschen besser?«
Die Kleine nickte erleichtert. »Warum rüttelt es auf einmal so?«, fragte sie.
»Wir fliegen durch ein Gewitter«, erklärte Marion. »Aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Es wird bestimmt nicht lange dauern.«
»Ich fürchte mich auch nicht«, antwortete das Kind ernsthaft. »Mein Papa sagt immer, man brauche vor einem Gewitter keine Angst zu haben.«
Marion lächelte. »Nun, wenn sogar dein Papa es sagt … Und nun halt dich an mir fest! Ich bringe dich jetzt zurück zu deiner Mami.«
Doch sie hatte den Satz kaum zu Ende gesprochen, als sie merkte, dass die Maschine auf einmal steil nach unten glitt.
Entsetzensschreie gellten auf, Geschirr schlug klirrend zu Boden. Instinktiv umklammerte Marion das Kind mit beiden Armen. Sie wusste nicht, was es zu bedeuten hatte. Sie fühlte nur die drohende Gefahr, die ihr Herz auf einmal wie einen Hammer dröhnen ließ. Sie kam nicht mehr dazu, auch nur einen Gedanken zu fassen, denn mit einem ohrenbetäubenden Krach prallte die Maschine gegen die Felswand.
Marion merkte noch, wie sie stürzte, spürte den jähen Schmerz, der ihr den Atem raubte.
Es ist zu Ende. Das ist der Tod, schoss es ihr durch ihr Gehirn. Es war der letzte Eindruck, den sie mit sich in die Dunkelheit nahm.
*
Das Erste, was Marion vernahm, als ihre Sinne sich langsam ins Bewusstsein zurücktasteten, war ein hohes, schluchzendes Weinen.
Das ist ein Kind, dachte sie, und es gelang ihr nicht ganz, die Benommenheit abzuschütteln, die sie noch immer umfangen hielt.
Ein Kind. Es gab nur ein Kind unter den Passagieren. Sylvia. So hatte ihre Mutter sie genannt.
Sylvia war nicht tot. Sie lebte. Auch sie selbst, Marion, lebte.
Ein brennender Schmerz zuckte hinter ihrer linken Schläfe. Am liebsten hätte sie die Augen gar nicht aufgemacht und wäre zurückgesunken in die wohltätige Dunkelheit ihrer Ohnmacht. Doch da war das Weinen des Kindes, da waren seine Hände, die sie an den Schultern spürte, was sie zwang, ins Dasein zurückzukehren.
Mit unsäglicher Mühe schlug sie die Augen auf. Es war ein Blick, der wie aus weiter Ferne kam und erst allmählich das Grauen erfasste, das sich ihr bot.
Die ganze rechte Seite der Maschine war aufgerissen, fast der gesamte Passagierraum wie von einer Riesenhand zusammengedrückt. Wo einmal Sitzreihen gewesen waren, herrschte nun ein Gewirr von verbogenem Stahl, zersplittertem Holz und zerfetztem Stoff.
Doch das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren jene entsetzlich verstümmelten Menschen, die sich mittendrinnen in diesem Inferno von Verwüstung befanden, waren jene unnatürlich verrenkten Körper, die noch zum Teil in den Gurten hingen, war das viele Blut.
Und über allem hing Stille, die entsetzliche Stille des Todes, die nur unterbrochen wurde vom Rollen des Donners und vom Rauschen des niederströmenden Regens.
Marion fühlte, wie Eiseskälte sie erfasste und wie eine jähe Übelkeit in ihr aufstieg. Sie bedeckte die Augen mit den Händen, um ja nichts mehr sehen zu müssen, und wusste doch zugleich, dass dieser Anblick sie verfolgen würde, solange sie lebte.
»Mami! Wo ist denn die Mami?« Die dünne Stimme erstickte in verzweifelt schluchzendem Nichtbegreifen.
Erst jetzt erfasste Marion, dass sie sich auf dem mit Porzellanscherben übersäten Boden dicht neben dem hinteren Ausstieg der Maschine befand. Offensichtlich hatte sich das Flugzeug beim Aufprall aufgebäumt und war in einer schrägen Lage hängen geblieben. So war sie mit dem Kind an jenen Platz geschleudert worden, dem sie beide ihr Leben verdankten. Und genau genommen verdankte sie das ihre dem kleinen Mädchen mit seiner Mutter, die sie gebeten hatte, sich dessen anzunehmen.
Marion schüttelte erneut das Grauen. Waren sie und Sylvia womöglich die einzigen Überlebenden dieser fast vollbesetzten Maschine?
Sie horchte in die graue Dämmerung hinein, in die monoton der Regen herniederströmte, und plötzlich war es ihr, als hätte sie ein Stöhnen gehört, das irgendwo da vorne laut geworden war. Sie rappelte sich hoch und versuchte, auf allen vieren die schräge Ebene hinaufzukriechen.
»Wohin gehst du, Tante? Ich will mit!«, rief die Kleine klagend.
Marion drehte sich um und setzte das Kind in eine geschützte Ecke.
»Bitte, bleib hier, Sylvia!«, bat sie drängend. »Ich bin gleich wieder zurück.«
»Gehst du zur Mami?«
»Ja. Aber du musst ganz ruhig sitzen bleiben.«
Marion setzte ihren Weg fort. Doch schon nach wenigen Schritten erkannte sie die Nutzlosigkeit ihres Beginnens. Nie würde sie es schaffen, die ineinander verkeilten Hindernisse wegzuräumen, die ihr weiteres Vordringen vereitelten. Allein war sie völlig machtlos.
In diesem Augenblick kam ihr ein Gedanke, der ihr Herz vor Schrecken beinahe stillstehen ließ. In den Tanks befanden sich noch Tausende von Litern hochentzündlichen Treibstoffs! Es grenzte sowieso an ein Wunder, dass die Maschine nicht gleich beim Absturz explodiert war.
Wir müssen hier weg, dachte Marion in panischem Entsetzen. Einen Augenblick lang lauschte sie in die Stille. Auch das schwache Stöhnen, das sie vorhin zu hören geglaubt hatte, war wieder verstummt. Hier konnte sie nicht helfen, also musste sie wenigstens trachten, das Kind in Sicherheit zu bringen und vor allem versuchen, Hilfe zu holen.
»Wo bist du denn, Tante? Ich fürchte mich«, vernahm sie von Neuem Sylvias Stimme.
»Ich komme schon, mein Schatz! Hab nur keine Angst!«
Mehr schlitternd als gehend erreichte sie den Platz, an dem die Kleine noch immer saß und ihr mit großen, verschreckten Augen entgegenblickte.
»Bleib noch einen Augenblick, wo du bist«, sagte Marion. »Ich muss jetzt versuchen, diese Tür zu öffnen.«
Mit Schrecken dachte sie daran, was sie wohl antworten würde, fragte Sylvia nach ihrer Mutter. Doch das Kind meinte nur:
»Sind wir schon in Rom?«
»Nein, mein Schatz, aber wir müssen trotzdem hier heraus«, sagte Marion mit heiserer Stimme.
Marion hielt sich mit der Linken fest und stemmte sich mit der rechten Schulter gegen das Metall. Und das Wunder geschah: Die Tür war nur ein wenig verklemmt und flog bereits beim zweiten Versuch mit einem Ruck auf.
Der Ausstieg war frei. Kalte Nässe schlug Marion entgegen. In diesem Augenblick empfand sie es als Glück, noch dazu, als sie mit grenzenloser Erleichterung feststellte, dass der Abstand zu der steinigen Halde, auf der die Maschine lag, zwar annähernd zwei Meter betragen mochte, aber durch einen Sprung immerhin zu schaffen war, wenn auch die Beschaffenheit des felsigen Abhangs dessen Gefährlichkeit beträchtlich erhöhte.
»Setz dich hier hin und bleib einstweilen ganz ruhig«, befahl sie dem Kind. Dann legte sie sich auf den Bauch und ließ sich langsam hinuntergleiten. Ihre Länge reichte nicht aus, es war doch weit tiefer, als sie es geschätzt hatte. Beim Aufsprung rutschte sie ab und stürzte zu Boden. Doch sie kam unverletzt unten an.
Sie raffte sich wieder auf und hob ihre Arme dem Kind entgegen.
»Setz dich ganz an den Rand, Sylvia«, forderte sie es auf, »und dann spring! Ich fange dich auf.«
Eine Sekunde später hielt sie die Kleine in den Armen und ließ sie aufatmend zu Boden gleiten. Es war geschafft.
»Du blutest ja, Tante«, rief die Kleine auf einmal bestürzt. »Da, am Kopf! Bist du hingefallen?«
Marion griff sich ans Haar. Es fühlte sich feucht und klebrig an. Die leichte Berührung brannte wie Feuer. Doch sie musste froh sein, so gut davongekommen zu sein.
»Halb so schlimm«, antwortete sie. Dann sah sie auf das Kind nieder, das sich zusammenschauernd an sie schmiegte. »Und du, Sylvia? Tut dir irgendetwas weh?«, fragte sie rasch.
»Hier im Bauch«, antwortete die Kleine weinerlich. »Da tut es immer noch weh, ganz schrecklich weh.«
Marion erinnerte sich, dass Sylvia schon vor dem Absturz über Bauchschmerzen geklagt hatte. Doch so sehr sie gewünscht hätte, ihr zu helfen, sie hatte nicht die geringste Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Sie mussten hier fort. Fort von diesem unheimlichen Wrack, fort aus dieser steinigen Wüstenei, irgendwohin, wo Menschen waren, die Rettung und Hilfe bedeuteten.
Marion nahm das Kind an der Hand.
»Komm«, sagte sie mit einer Stimme, die ihr kaum gehorchte. »Wir müssen laufen.«
Die steinige Halde wollte kein Ende nehmen. Obwohl das Gewitter sich allmählich entfernte, strömte noch unablässig der Regen hernieder, machte die Geröllbrocken glatt und rutschig. Tiefhängende Wolken verhüllten die Berge und machten jede Orientierung unmöglich. Kein Haus war weit und breit zu sehen, nicht einmal eine Almhütte. Die ganze Formation der Landschaft deutete daraufhin, dass sie sich noch in großer Höhe befanden. Manchmal glitten sie aus, rafften sich wieder auf und liefen weiter, so rasch sie es vermochten.
Endlich bemerkte Marion die ersten Zeichen einer Vegetation: Latschengestrüpp, windzerzauste Kiefern, endlich das weiche Gras des Almbodens. Einmal sah sie auch eine Hütte. Doch sie lag dunkel und verlassen und hätte zwar einen Unterschlupf geboten, aber keine Hilfe.
Sie folgte einem schmalen Pfad, der talwärts wies.
»Ich kann nicht mehr, Tante. Ich bin so müde, und mein Bauch tut mir so schrecklich weh. Wohin laufen wir denn eigentlich?«, rief Sylvia verzagt.
Marion blieb stehen. Auch sie war müde. Ihre Wunde schmerzte, und sie hatte keinen trockenen Faden mehr am Leib.
»Klettere auf meinen Rücken«, sagte sie. »Ich werde dich ein Stück tragen.«
Schwankend kam sie mit ihrer Last wieder hoch und schritt taumelnd weiter, setzte behutsam Fuß vor Fuß, um nicht auszugleiten und nicht zu stolpern. Im Wald, den sie inzwischen erreicht hatten, war es schon fast dunkel. Noch immer regnete es in Strömen.
Endlich lichtete sich der Wald. Marion hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, aber trotzdem stieg eine vage Hoffnung in ihr auf. Vielleicht kam nun doch bald einmal ein Dorf, oder zumindest ein Gehöft …
Auf einmal tat ihr Herz einen schnellen Schlag. Es war ihr vorgekommen, als schimmere vor ihr auf dem Abhang ein Licht durch die Bäume. Nun war es verschwunden, aber nach ein paar Schritten sah sie es wieder. Sie hatte sich nicht geirrt. Es war tatsächlich ein Licht.
Mit frischer Hoffnung schritt sie aus. Wo ein Licht war, mussten auch Menschen sein.
Doch in ihrer unendlichen Erleichterung hatte sie auf den Stein nicht geachtet, der mtten auf dem Weg lag. Sie stolperte und versuchte mit aller Kraft, das Gleichgewicht zu halten. Doch sie war viel zu erschöpft, und das Kind auf ihrem Rücken zog sie vollends zu Boden. Sie stürzte und schlug hart auf. Zugleich spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrem linken Knöchel, der ihr die Tränen in die Augen trieb.
Sie legte das Kind in das Gras. Es musste irgendwann einmal vor Müdigkeit eingeschlafen sein, nun schreckte es mit einem kläglichen Gewimmer auf.
»Sind wir noch nicht da, Tante? Mir ist so kalt.«
»Gleich, Schätzchen. Siehst du dort das Licht? Es ist ganz nahe«, antwortete Marion tröstend. »Wirst du laufen können? Ich fürchte nämlich, dass ich dich jetzt nicht mehr tragen kann. Ich glaube, ich habe mir den Fuß verknackst.«
Sie versuchte, aufzustehen, sank jedoch mit einem unterdrückten Wehlaut wieder ins Gras zurück. Sie bemühte sich ein zweites Mal, doch so sehr sie auch die Zähne zusammenbiss, sie vermochte es nicht, den verletzten Fuß nur im Geringsten zu belasten.
Noch einmal quälte sie sich in die Höhe. Dort unten schimmerte noch immer das Licht, warm und tröstlich, Hilfe und Geborgenheit verheißend.
Marion nahm ihr letztes bisschen Kraft zusammen, ließ sich auf Knie und Hände nieder. Sie konnte nicht laufen, aber vielleicht konnte sie auch so ihr Ziel erreichen.
Meter um Meter kroch sie vorwärts. Doch auf einmal war die Wiese zu Ende. Abgeerntete, mit spitzen Stoppeln bedeckte Felder säumten nun den Weg, auf den sie wohl oder übel ausweichen musste. Steine schürften ihr Knie und Hände auf, ihr Fuß schmerzte bei jeder ihrer holprigen Bewegungen.
Und dann kam der Augenblick, wo der letzte Rest von Kraft sie verließ. Keuchend, völlig erschöpft brach sie zusammen. Sie konnte nicht mehr.
Sie blickte auf das Licht. War sie ihm überhaupt näher gekommen? Sie wollte um Hilfe rufen, doch nur ein heiserer Laut entrang sich ihrer Kehle. Sie musste erst zu Atem kommen, ehe ihre Not und Verzweiflung sich in einem Schrei Luft machte.
»Hilfe! Hilfe!« Sie rief es immer wieder in der irren Hoffnung, die Menschen in jenem Haus dort unten würden sie hören. Es war die einzige Hoffnung, die ihr blieb.
Marion schrie, solange sie konnte, und ihre Schreie mischten sich mit dem kläglichen Weinen des Kindes, das sich zitternd vor Kälte an sie schmiegte. Sie schrie, bis die Erschöpfung sie endgültig übermannte. Die Augen fielen ihr zu. Man hatte sie nicht gehört. Alles war vergeblich. Dem Tod im Flugzeug war sie entronnen. Kam er jetzt mit der Nacht und der Kälte?
*
Dr. Frank Heltau betrachtete mit mürrisch zusammengezogenen Brauen den weißen Bogen Papier in seiner Schreibmaschine. Es war acht Uhr abends. Vor zwei Stunden hatte er ihn eingespannt, und noch immer befand sich keine einzige Zeile darauf. Und das, was er vorher geschrieben hatte, lag zusammengeknüllt im Papierkorb. Es taugte nicht einmal für das schäbige Wochenblatt, für das es bestimmt war.
Ein Artikel über Gallenleiden war diesmal verlangt. Mit wenigen, sorgfältig dosierten Fachausdrücken, damit es zwar gelehrt klang, aber doch auch von jedem, aber wirklich von jedem Leser verstanden wurde. Nicht länger als drei Schreibmaschinenseiten mit vorbestimmter Anschlagzahl, denn mehr Platz hatte das Blatt für den »Medizinischen Ratgeber für alle« nicht frei.
Neben ihm auf dem Tisch lag ein ganzer Stapel Briefe. Denn der »Medizinische Ratgeber für alle« hatte auch die Leserpost zu beantworten, die sich mit medizinischen Problemen befassten: Anfragen wegen Bandscheibenleiden, Fußbeschwerden oder Magenschmerzen, deren freundliche Beantwortung neben ein paar allgemein verständlichen Fachbemerkungen und einschlägigen Hausmitteln doch nur darin gipfelten, einen Arzt aufzusuchen. Manche dieser Ratschläge wurden sogar in der Zeitung abgedruckt.
Seitdem Frank diese Arbeit bei der »Großen Wochenschau« übernommen hatte, fand er sie widerlich. Er fand überhaupt das ganze Leben widerlich – seit damals.
Damals, das war ein Tag, der schon über ein Jahr zurücklag. Bis dahin war Dr. Frank Heltau Chirurg in einer großen Münchener Klinik gewesen, ein äußerst begabter Chirurg sogar, auf den sein Chef, ein hervorragender Fachmann auf seinem Gebiet, große Stücke hielt, und dem jedermann eine glänzende Zukunft voraussagte. Er hatte diese Zukunft in wenigen Stunden verspielt, durch seine eigene Schuld.
Nun saß er hier in diesem Jagdhaus in den Tiroler Bergen und schrieb populärwissenschaftliche Artikel für ein Wochenblatt, beantwortete Leserbriefe, weil das Leben weiterging, und dieses Leben, auch bei größter Bescheidenheit, Geld kostete.
Frank schob die Schreibmaschine zurück. Ach was, morgen war auch ein Tag! Er hatte einfach keine Lust, sich jetzt über diesen Artikel den Kopf zu zerbrechen.
Er stand auf und schaltete das Radio aus, dessen lärmende Musik ihn schon seit dem Augenblick gestört hatte, als die Station sie zu senden begonnen hatte. Wohltuend empfand er die Stille, die auf einmal im Raum herrschte. Er hatte diese Art von Musik nie ausstehen können.
In dieser Sekunde hörte er den Laut zum ersten Mal. Es war ein eigenartiger Laut, den er zunächst nicht identifizieren konnte und der doch fremdartig die Stille durchschnitt. Doch als er zum Fenster trat und hinaushorchte, war alles ruhig bis auf das Klappern der Fensterläden, an denen der Wind rüttelte, und das Rauschen des Regens, der monoton herniederströmte.
Frank ging zum Wandschrank und holte eine Flasche hervor. Einen Augenblick lang hielt er sie wie abwägend in der Hand. Seit damals hatte er nie wieder einen Tropfen trinken wollen. Und doch hatte er es immer wieder getan, gepackt von jener Gier nach Alkohol, die er früher nie gekannt hatte, getrieben von Sehnsucht nach jenem leicht benebelten Zustand, in dem Gleichgültigkeit und Vergessen war.
Er setzte die Flasche an die Lippen. Aromatisch und brennend zugleich spürte er den Grappa in seiner Kehle. Er wusste, dass er ein Schwächling war und brachte nicht die Energie auf, es zu ändern.
Schon wollte er einen zweiten Schluck nehmen, da hörte er den Schrei noch einmal. Diesmal klang er ganz deutlich.
Der Mann erschrak. Das war kein Tier, wie er vorhin angenommen hatte, das war ein Mensch, der sich in Not befand.
Rasch trat er vor die Hütte. Er legte die Hände wie ein Trichter um den Mund.
»Hallo!«, rief er, so laut er konnte. »Hallo!«
Draußen blieb es still.
Verständnislos lauschte Frank in die Dunkelheit. Er hatte den Schrei vorhin deutlich gehört. Er war doch noch völlig nüchtern und imstande, den Laut eines Tieres von dem eines Menschen zu unterscheiden.
»Hallo! Hallo!«, rief er noch einmal.