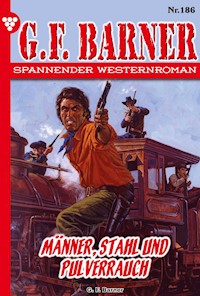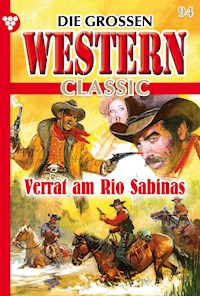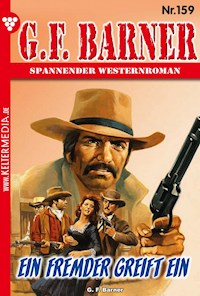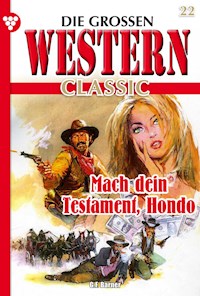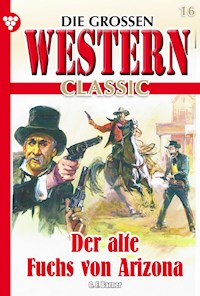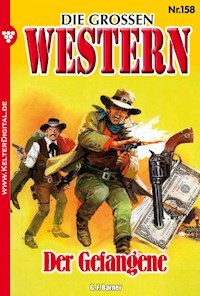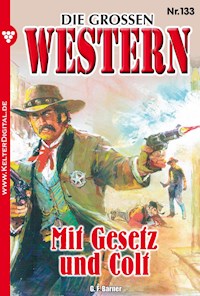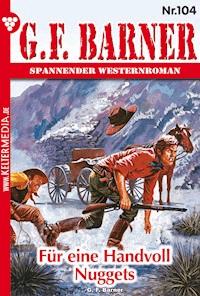Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Er ist elf Jahre alt, als es geschieht. Und er weiß nicht, daß alles, was von diesem Tag an in ihm vorgeht, mit diesem Erlebnis zu tun hat. Es wird zum tragenden Moment seines Lebens, jenes Erlebnis, das er mit elf Jahren hat. An diesem Tag unterhalb des Moencopi Plateaus, an jener abfallenden Ward Terrasse, die in die Painted Desert übergeht, geschieht es. Es ist früher Morgen, als der Prospektor David Reynolds erwacht und fröstelnd in den kühlen Morgen blickt. Reynolds liegt einen Augenblick still, er sieht die ferne Kette der Coconinos in der außerordentlich klaren Luft über der Wüste im Westen. Die Berge, deren höchster der Humphreys Peak, der größte Berg in ganz Arizona, ist, scheinen sehr nahe zu sein. Die Luft mit ihren rauchgrauen Schatten, der violetten Färbung an den Bergen, auf deren Gipfel schon die Sonne strahlt, scheint alles heranzurücken. Und doch sind die Berge Meilen entfernt. Von ihrem Rastplatz genau vierzig Meilen. Eine unendliche Entfernung, die jetzt im Morgenlicht gering erscheint. David Reynolds hebt den rechten Arm, wendet etwas den Kopf und blickt nun auf seinen Sohn. Jim ist elf Jahre alt und ein aufgeweckter Bursche, der seinem Vater hilft. Der Junge ist in Ordnung, David könnte niemals einen besseren Sohn haben. Manchmal entdeckt er Züge an dem Jungen, die ihm fremd sind. Niemals ist David Reynolds verbissen gewesen, niemals hat er eine Sache um jeden Preis machen wollen – und darin gleicht ihm der Junge nicht. Bereits seit zwei Jahren hat David Reynolds das bestimmte Gefühl, daß aus seinem Sohn einmal ein guter Mann werden wird. Was immer Jim beginnt, er führt es durch und fragt nicht danach, ob die nächste Feuerholzstelle zehn oder nur sieben Meilen entfernt ist. Der Junge holt Feuerholz, wann immer sie etwas brauchen, er besteht darauf, immer einen Vorrat mitzuführen, ein Junge, der mit beinahe diktatorischem Einfluß seinen Willen durchzusetzen vermag. Jim schläft noch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 313 –
Klapperschlangen-Jim
G.F. Barner
Er ist elf Jahre alt, als es geschieht. Und er weiß nicht, daß alles, was von diesem Tag an in ihm vorgeht, mit diesem Erlebnis zu tun hat. Es wird zum tragenden Moment seines Lebens, jenes Erlebnis, das er mit elf Jahren hat.
An diesem Tag unterhalb des Moencopi Plateaus, an jener abfallenden Ward Terrasse, die in die Painted Desert übergeht, geschieht es.
Es ist früher Morgen, als der Prospektor David Reynolds erwacht und fröstelnd in den kühlen Morgen blickt. Reynolds liegt einen Augenblick still, er sieht die ferne Kette der Coconinos in der außerordentlich klaren Luft über der Wüste im Westen. Die Berge, deren höchster der Humphreys Peak, der größte Berg in ganz Arizona, ist, scheinen sehr nahe zu sein. Die Luft mit ihren rauchgrauen Schatten, der violetten Färbung an den Bergen, auf deren Gipfel schon die Sonne strahlt, scheint alles heranzurücken. Und doch sind die Berge Meilen entfernt. Von ihrem Rastplatz genau vierzig Meilen. Eine unendliche Entfernung, die jetzt im Morgenlicht gering erscheint.
David Reynolds hebt den rechten Arm, wendet etwas den Kopf und blickt nun auf seinen Sohn.
Jim ist elf Jahre alt und ein aufgeweckter Bursche, der seinem Vater hilft. Der Junge ist in Ordnung, David könnte niemals einen besseren Sohn haben. Manchmal entdeckt er Züge an dem Jungen, die ihm fremd sind. Niemals ist David Reynolds verbissen gewesen, niemals hat er eine Sache um jeden Preis machen wollen – und darin gleicht ihm der Junge nicht. Bereits seit zwei Jahren hat David Reynolds das bestimmte Gefühl, daß aus seinem Sohn einmal ein guter Mann werden wird. Was immer Jim beginnt, er führt es durch und fragt nicht danach, ob die nächste Feuerholzstelle zehn oder nur sieben Meilen entfernt ist. Der Junge holt Feuerholz, wann immer sie etwas brauchen, er besteht darauf, immer einen Vorrat mitzuführen, ein Junge, der mit beinahe diktatorischem Einfluß seinen Willen durchzusetzen vermag.
Jim schläft noch. Er liegt auf der Seite, das Haar wirr, die Augen geschlossen. David lächelt, als er ihn betrachtet. Es ist vier Jahre her, daß Myrna, Jims Mutter, gestorben ist. Seit diesem Tag ist es mit David bergab gegangen. Zuerst hat er trinken müssen, um über Myrnas Verlust hinwegzukommen. Dabei sind ihre mühsam ersparten Gelder verbraucht worden, jene Gelder, die aus dem einzigen großen Silberfund Davids am Meldeena stammen. Die Abfindung, die er von dem Minenkonzern bekommen hat, sie ist verbraucht worden. Und es ist vielleicht der eine Satz gewesen, der David aus seinem Trinken gerissen hat, der eine Satz des siebenjährigen Jim Reynolds:
»Vater, ich bin so schrecklich hungrig!«
An dem Tag ist David Reynolds erwacht. Sein Junge hat Hunger, sein Junge hat nichts zu essen. Myrna würde ihm nie verzeihen, daß der Junge Hunger leiden muß, während der Vater sich seinem Schmerz hingibt. Und so ist David losgezogen. Zuerst hat er gearbeitet, hat hier und da ein wenig Geld verdient, um den Jungen und sich durchzubringen. Dann aber ist die alte Traumwelt in einer Nacht gekommen, jene Welt, die ihn einen Fund machen sieht, einen gewaltigen Fund. Jenen, von dem jeder Prospektor, der mit Schürfgerät und Maultieren durch die Berge zieht, ein ganzes Leben lang träumt.
David ist losgezogen und hat seinen Jungen mitgenommen. Vor zwei Jahren hat es begonnen.
Und heute wird es enden.
Mit seinem letzten Blick wird er die Berge sehen, seinen Sohn und dann nichts mehr.
David bewegt das Bein, er will aus der Decke kriechen. Und das ist die Bewegung, die ihm den Tod bringt, dieses kurze Anziehen seines rechten Beines.
Reynolds spürt den heftigen, brennenden Schmerz am Bein, genau in seiner Kniekehle und zuckt heftig zusammen. Er schleudert die Decke fort, spürt einen dumpfen, ziehenden Schmerz in der Kniekehle, der sein Bein fast taub erscheinen läßt und stemmt sich hoch.
Die Decke fliegt weg, der Mann zuckt noch einmal zusammen und sieht dann auf die Schlange.
In dem Augenblick, da er sie sieht, bricht ihm der Schweiß aus allen Poren, und ein heiserer, keuchender Seufzer steigt aus seinem Mund.
David Reynolds weiß, wie giftig diese Schlange ist. Man überlebt ihren Biß nur, wenn man sofort etwas macht.
Der Mann hat keine Sekunde zu verlieren und greift auch schon, den Schweiß innerhalb von drei, vier Sekunden am ganzen Körper spürend, zu seinem Gurt, in dem das Messer steckt.
Und Jim schläft, Jim ist müde, denn sie haben spät Rast gemacht.
Jim weiß nicht, daß die Schlange an den wärmenden Körper seines Vaters gekrochen ist, daß sie sich in seinen gebeugten Knien zusammengeringelt hat.
Und als sich David bewegt hat, da beißt sie, vom Knie gedrückt, jäh zu.
David Reynolds rollt sich herum, hört das Zischeln der Klapperschlange, deren Leib mit den fast silbernen Schuppen, zwischen denen die schwarzen, gezackten Linien der Querstreifen stehen, sich jetzt schnell davonwindet.
»Brennt – oh, Teufel, brennt das!« sagt David Reynolds stöhnend und schneidet sich mit zwei, drei Schnitten die Hose auf. »Wie kann sie denn unter die Decke… Ich habe mich doch eingerollt?«
Er sieht auf seine Kniekehle und die Adern, die schon immer besonders stark ausgeprägt hervorgetreten sind.
Sofort entdeckt er die beiden Einstiche, an denen nicht einmal Blut steht. Es sind nur kleine rote Punkte, deren Umgebung sich jedoch bereits blau zu färben beginnt. Zudem breitet sich jetzt im Bein ein kaltes Gefühl aus, als ob ihm jemand ein Stück Eis in die Kniekehle gelegt hat. Er jagt sein Messer mit einem kurzen, heftigen Stoß in den Boden und schnallt den Hosenriemen ab. Mit zwei Griffen hat er ihn um sein Bein geschlungen, streift ihn bis fast zur Mitte des Oberschenkels und zieht den Riemen dann an.
Vielleicht hilft es, denkt er, aber er muß wieder auf die Punkte sehen, die direkt über der Ader liegen.
Es wird nicht helfen – plötzlich ahnt er es. Die Gewißheit, verloren zu sein, läßt ihn einen Augenblick ganz mutlos den Kopf senken. Zu dicht an der Ader, vielleicht hat die Schlange sogar direkt in die Ader gebissen.
Das Bein wird kalt, als er das Messer ansetzt und eine Sekunde zaudert. Er starrt auf sein Bein, auf das Fleisch und die Spitze der Klinge. Dann setzt er entschlossen das Messer an, weiß, daß er nicht zu tief schneiden darf, um sich nicht die Ader aufzuschneiden und zu verbluten. Seine Lippen sind aufeinandergepreßt, als er das Blut fließen sieht, er stöhnt tief und schmerzhaft.
Und da sagt Jim neben ihm:
»Vater – Vater, was ist? Vater, was tust du da?«
David kann keine Antwort geben, er muß den Querschnitt ausführen und hört Jims rasches Atmen, dann taucht Jims Kopf neben seinem Bein auf.
»Eine Schlange«, sagt David stöhnend, als er das entsetzte Gesicht von Jim sehen muß. »Eine Schlange, Junge, da hinten ist sie zwischen die Steine gekrochen, hinter uns – am Hang. Mach Feuer, mach schnell Feuer, hörst du?«
»Was für eine…«
Jim ist schon hoch. Und hat Müdigkeit in seinem Gesicht gestanden, ist die Verschlafenheit in diesem Gesicht gewesen, dann ist sie jetzt verschwunden.
»Klapperschlange, Junge! Mach, mach schnell Feuer!«
Jim Reynolds stürzt los, macht voller Eile Feuer und sieht dann wieder zu seinem Vater hin, der heftig am Bein blutet und der leise stöhnt.
Plötzlich hat der Junge Angst, Angst, daß sein Vater auch so fortgehen kann, wie damals seine Mutter fortgegangen ist.
»Vater – Vater, ist es schlimm, hast du Schmerzen?« fragt er angstvoll.
»Nein, Jim, nur ein taubes Gefühl in meinem Bein. Junge, ich glaube… Haben wir noch Whisky?«
Ab und zu trinkt David immer noch einen Schluck, aber wirklich nur einen Schluck und keine ganze Flasche.
»Ich sehe nach!«
Jim sieht nach. In der Flasche im Packen ist wirklich noch ein kleiner Rest.
»Gib her, Junge!«
Zwei Stunden, denkt David Reynolds, zwei Stunden dauert es, wenn das Gift direkt in die Blutbahn kommt, sieben, wenn man nur etwas Gift behält, aber nach sieben Stunden ist man mit Sicherheit tot und lacht nie mehr. Mein Gott, lieber Gott, ich werde nie mehr mit meinem Jungen lachen. Und was haben wir schon für Spaß gehabt? Auf die Jagd sind wir gemeinsam gegangen, der Junge kann für sein Alter besser schießen als mancher Mann. Er hat mir geholfen, die Beute abzuziehen, die Felle zu gerben, er ist geschickt in allen Dingen. Hat es noch Sinn, daß ich den Biß ausbrenne?
Er weiß, daß er es wenigstens versuchen muß, wenn es vielleicht auch nicht mehr viel Sinn hat.
»Jim, nimm mein Messer hier und halte es in die Flammen«, sagt er heiser, nachdem er getrunken hat. »Ich muß den Biß ausbrennen!«
Jim kommt sofort, kauert dann am Feuer und wendet die Klinge in den Flammen.
»Vater, ist es sehr gefährlich? Ich weiß noch von dem alten Daniels…«
Sie denken beide an den alten Fallensteller aus dem Rincon Basin, den eine Echse gebissen hat und der daran langsam gestorben ist. Das Gilatier mit dem seltsamen Namen Heloderma suspectum, den der Vater genannt hat, hat Daniels umgebracht. Daniels hat geschrien in seiner Bewußtlosigkeit, die Stunden gedauert hat.
»Ich glaube, es ist nicht schlimm«, sagt David Reynolds leise. »Ich habe gleich geschnitten, und jetzt noch ausbrennen, das muß helfen. Ist die Klinge glühend, Jim?«
»Ja, ich denke, Vater.«
Der Junge sieht auf das Messer, dessen Klinge hellrot ist und schließt, während ihm die Hitze des Feuers auf der Haut heftig brennt, die Augen. Einen Moment denkt er, daß die Hitze jetzt schon schlimm genug ist, wie heftig muß es dann erst brennen, wenn man sich die Klinge, die hellrot glüht, in das Fleisch…
Jim Reynolds zieht die Hand mit dem Messer schnell zurück, macht dabei die Augen wieder auf und hastet dann zu seinem Vater.
David Reynolds nimmt das Messer in die Hand und spürt die Kälte, die in seinem Bein hochsteigt.
Zu spät, sagt er sich bitter, während er das Messer an sein Bein führt. Ich habe genug von Schlangenbissen gehört, ich habe einige Leute an ihnen sterben sehen und weiß, was diese Kälte für mich bedeutet. Zuerst wird es kalt, dann wird man müde und will schlafen. Danach kommt die Bewußtlosigkeit, vielleicht redet man oder schreit, aber dann ist es vorbei. Man ist tot – man? Ich habe doch den Jungen…
»Sieh weg!« sagt er laut und heiser, als Jim immer noch neben ihm kauert. »Sieh weg, Jim. Geh los, such dir aus dem Feuerholz einen Gabelstock und fang die Schlange. Drüben unter den Steinen ist sie verschwunden, hol sie, mach es!«
»Ja«, sagt Jim und wendet sich ab. »Ja, ich hole…«
Er kommt nicht weiter, er kann nicht mehr sprechen, denn er hört hinter sich den Vater stöhnen und dann das Klirren, mit dem das Messer auf dem Boden landet.
»Vater?« fragt er mit abgewendetem Gesicht. »Vater, soll ich den Packen holen? Brauchst du ihn?«
»Ich hole ihn mir selbst, Junge«, erwidert David mühsam und umklammert sein Bein, denkt daran, daß er den Riemen lösen muß, sonst wird es brandig. »Geh nur – fang die Schlange. Du weißt, wie man es macht, Jim!«
Jim geht los, aber ihm ist seltsam und erschreckend elend zumute. Helfen kann er nicht, der Vater liegt dort, er rutscht jetzt über den Boden auf den Packen zu. Wenn es nur nicht schlimmer mit dem Vater wird, wenn er die Bißstelle nur rechtzeitig im Kreuzschnitt zum Bluten gebracht hat und das Ausbrennen noch hilft – wenn!
Jim sucht einen Stock und erinnert sich, schon öfter eine Schlange mit dem Stock erwischt zu haben. Er nimmt sein Taschenmesser, als er den Stock hat, schneidet die Gabel spitz und geht dann auf die Steine zu. Dort muß die Klapperschlange stecken, dort wird sie sein, hier zwischen den beiden Steinen in dem Spalt. Er stochert im Spalt, hört das Zischeln und weicht dann zurück. Der Spalt zwischen den Steinen läuft wie ein kleiner Tunnel an der anderen Seite wieder hinaus. Und dort erscheint sie jetzt, sie schlängelt sich schnell davon, will den Hang abwärts, über den gerade die Sonne fällt.
Der Junge sieht die Klapperschlange und fühlt auf einmal Zorn in sich. Daß es Haß ist, weiß er nicht, denn Haß ist ihm bis zu dieser Sekunde unbekannt geblieben.
Er haßt die Schlange und weiß es nicht, als er sie in den Sonnenschein verfolgt, der auf den Hang und die kargen Büsche fällt.
Der Boden wirkt in diesem ersten, strahlenden Sonnenlicht, das von der Howell Mesa herübergreift, wie ein rotes, blutgetränktes Tuch. Staub wallt unter den Stiefeln des Jungen auf, der die Klapperschlange auf einen Busch zuschlängeln sieht und ihr in kurzen Sprüngen folgt. Er läuft, den Blick starr auf den silberglänzenden Leib gerichtet, dessen schwarze Querzackstreifen sich in der schlängelnden Bewegung dauernd verändern, an ihr vorbei, er umrundet sie und bleibt dann ganz dicht vor ihr stehen.
»Du Biest!« sagt er mit einem hohen, singenden Ton in der Stimme. »Du abscheuliches Biest!«
Dann schlägt er mit dem Stock einmal zu, vor dem Kopf der Klapperschlange wirbelt Staub hoch. Wieder saust der Stock herab, als der Schlangenleib zurückzuckt. Und dann wendet sich die Klapperschlange nach links um, sie will weg, will seitlich am Hang entlang verschwinden.
Der Stock ist fast zwei Yards lang, der sich wie ein Speer hinter der Klapperschlange nach unten senkt. Und dann stößt Jim Reynolds zu.
Er trifft mit dem linken, scharf angespitzten Spieß der Gabel den Schlangenleib und sieht Blut, als er den Schuppenleib durchstößt. Und dann drückt er den Stab mit aller Gewalt in die Erde, hinein in den Staub, und sagt keuchend:
»Da – da, jetzt hab’ ich dich, jetzt hab’ ich dich, du Biest, du abscheuliches, jetzt habe ich dich!«
Sie windet sich, sie ringelt sich um den Stock und bringt mit ihren Bewegungen den Stock zum Zittern, aber Jim hält fest und beobachtet das Winden genau. Er hat sie kurz hinter dem Kopf erwischt, genau an der richtigen Stelle.
Staub wallt hoch, der Schwanz der Klapperschlange prallt klatschend gegen den Boden, noch mehr Staub steigt auf. Und in diesem Staub tritt der Junge stampfend, mit verzerrtem Gesicht und keuchendem Atem auf die Schlange.
Die Schlange ringelt sich um den Stock, um den der Staub in bizarren roten Schleiern zieht. Und all jenes, was der Junge in sich fühlt, das bricht in dieser Minute nach außen. Es ist wie ein Sturm, der eine Befreiung sucht und findet.
Dann rutscht der Schuppenleib vom Stock, bleibt nun nicht mehr glänzend, eher matt und überpudert vom Staub auf dem Boden liegen.
Jim Reynolds blickt von seinen Stiefeln, wie aus einem Traum erwachend, der ihn gequält und bedrückt hat, hoch. Er sieht seinen Vater am Feuer liegen, das Bein erhoben, um das er einen Leinenlappen wickelt. David Reynolds führt diese Bewegungen mechanisch aus, er sieht auf seinen Jungen und schrickt zusammen, als sich ihre Blicke treffen.
Der Junge sagt nichts, er steht nur da, starrt wieder auf die Klapperschlange und sagt tonlos:
»Sie ist tot, sie wird niemanden mehr beißen, sie ist tot!«
Er wiederholt dieses »sie ist tot« ein dutzendmal, er sagt es mit einer grausigen, unfaßbaren Monotonie, völlig ausdruckslos und heiser.
»Ja«, sagt David müde und knotet das Leinen zusammen. »Ja, ist sie tot? Jim, komm her und gieß Wasser in den Topf, ich bin durstig.«
»Durstig – ja.«
Jim Reynolds geht los, kauert sich am Feuer hin und legt neue Zweige nach. Er gießt Wasser in den Topf, aus der Büchse nimmt er den gemahlenen Kaffee.
»Wir werden nach Flagstaff gehen«, sagt David auf einmal leise und setzt sich auf, aber ihm ist plötzlich schwindlig. Es packt ihn, und er sinkt wieder nach hinten. So liegt er, denkt an Flagstaff und sagt wieder: »Wir werden nach Flagstaff gehen. In der Mine haben sie mir schon vor einem Jahr einen Aufseherposten angeboten. Du kennst doch Hiram Oldbright?«
»Ja, er ist ein freundlicher Mann, Vater!«
»Das ist wahr, ich bin lange mit ihm zusammen in den Bergen schürfen gewesen«, antwortet David Reynolds. »Dort gehen wir hin, du wirst sehen, wir bekommen eine kleine Hütte, ich arbeite für uns beide. Wir brauchen nicht mehr umherzuziehen und zu suchen.«
»Dann – dann«, murmelt der Junge, »wirst du den Tag über in der Mine sein, vielleicht auch in der Nacht. Und ich bin allein. Warum sollen wir nicht hier in den Bergen bleiben, Vater? Die Berge sind unsere Heimat, ich möchte nicht in die Stadt, es ist viel schöner hier und wir sind immer zusammen.«
David sieht seinen Sohn an, blickt dann über die Berge, jene purpurne Unendlichkeit mit dem hellblauen Himmel darüber.
Zusammensein, denkt der Mann und fühlt die Müdigkeit stärker werden. Wir beide – allein in den Bergen. Ich habe geglaubt, daß es für ihn nichts ist, dauernd unterwegs zu sein, von der Jagd zu leben, vom Fang eines wilden Pferdes, das man verkauft, wie man Felle gerbt und auch verkauft, um Geld zu haben, damit man weiter suchen kann… Tag für Tag, immer auf der Suche, auf der Suche nach Gold, Silber, Kupfer oder Zinn. Und nun sagt er mir, daß er hier zu Hause ist, in diesen Bergen, daß er nicht in die Stadt will. Was wird aus ihm, wie soll ich ihm beibringen, daß ich – daß ich niemals mehr nach Hause, niemals mehr in eine Stadt kommen werde? Er wird bald ganz allein sein, ohne einen Menschen, der ihn liebt – oder?
Plötzlich erinnert er sich an Mathilda, die Tante seiner Frau. Mein Gott, Mathilda lebt in Nevada, in einem Gebiet, in dem die ständige Bedrohung durch die Modocs vorhanden ist. Eine Frau wie ein Mann, mit rauchiger Stimme, einem Saloon und festen Händen, mit denen sie manchen Sturm durchgestanden hat. Mathilda und Jimmy? Sein Junge bei der alten Ma? Das geht nicht, was soll sie mit so einem Jungen? Aber irgendwo muß er bleiben.
»Dann – dann«, sagt David keuchend, »laß uns doch zu Tante Mathilda gehen, Jim.«
»Ich möchte nicht, Vater, ich will mit dir zusammensein.«
Wo, denkt David, und spürt sein Bein schon gar nicht mehr, in das er sich kneift, wo willst du denn mit mir zusammensein, mein Junge? Ich gehe an einen Ort, an den du noch nicht zu gehen brauchst, ich gehe so weit fort, daß keine Füße jemals so weit laufen können. Ach, mein Junge, was wird aus dir, wenn ich nicht mehr – wenn ich in einigen Stunden tot bin?