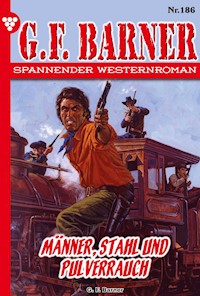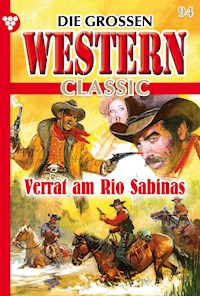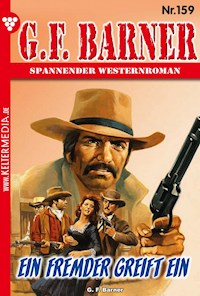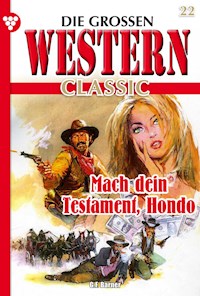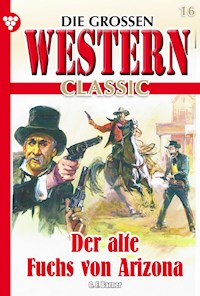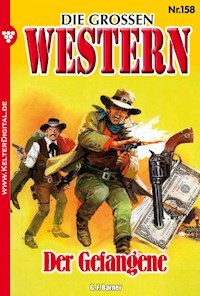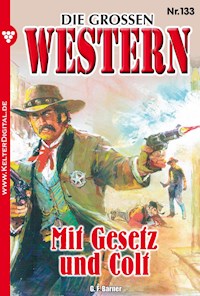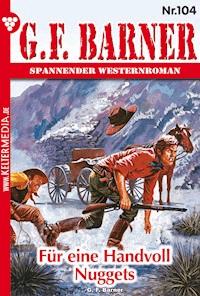Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Ein Messer fiel klirrend auf einen Blechteller. Jemand hustete bellend, weil er sich verschluckt hatte. Drüben starrten ihr der Sergeant, zwei Corporals und ein Private mit Augen nach, die ihre Gedanken nur allzu offen verrieten. Diana Markham lächelte dünn. Sie ging mit federnden Schritten und stolz zurückgeworfenem Kopf mitten durch den Schankraum von Soldiers Farewell, der Wechselstation kurz vor der Grenze von New Mexico nach Arizona, und spürte die Blicke der Männer fast körperlich. Mit fünfzehn Jahren war sie schon eine kleine Schönheit gewesen, mit achtzehn hatten Männer bei ihrem Anblick den Atem angehalten. Inzwischen war sie vierundzwanzig, und ihre Ausstrahlung war eher noch größer geworden. Diana trug im Moment einen Reitrock mit Schlitz, dazu eine hellgrüne Bluse und braune Stiefel. Bei jedem Schritt wippten ihre prallen Brüste unter der Bluse, ihre Hüften schwangen, und ihre Haare hatte sie gekämmt, gebürstet und offen gelassen. Rötlichblondes Haar, blaugrüne Augen, dazu die Figur, die eine einzige Verlockung darstellte. Vielleicht sahen einige der Männer in der Station auch den breiten Waffengurt und das schwere Messer in der Scheide am Gürtel, aber die meisten starrten auf ihren Busen. »Mann, o Mann!« entfuhr es einem der zwölf Kavalleristen. »Ich werde verrückt!« Diana hatte das so oft gehört, daß es nichts Besonderes mehr war. Sie wußte, daß sie schön war, und sie verstand es auch, ihre Schönheit einzusetzen, wenn es sein mußte. Sie war zum Haupteingang hereingekommen und blieb nun vor dem Tisch stehen, an dem der Mann saß, der ihr Leben gewesen war und bleiben sollte: ihr Vater. William Markham – Old Bill, wie man ihn nannte – grinste. Er war alt und ergraut, aber innerlich jung geblieben und immer zu Streichen aufgelegt. Da saß er, den Löffel in der schwieligen Faust aufrecht haltend, ein Bein auf der Tischplatte liegend und in den grauen Augen ein Funkeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 316 –
Stunk in Fort Grant
G.F. Barner
Ein Messer fiel klirrend auf einen Blechteller. Jemand hustete bellend, weil er sich verschluckt hatte. Drüben starrten ihr der Sergeant, zwei Corporals und ein Private mit Augen nach, die ihre Gedanken nur allzu offen verrieten.
Diana Markham lächelte dünn. Sie ging mit federnden Schritten und stolz zurückgeworfenem Kopf mitten durch den Schankraum von Soldiers Farewell, der Wechselstation kurz vor der Grenze von New Mexico nach Arizona, und spürte die Blicke der Männer fast körperlich.
Mit fünfzehn Jahren war sie schon eine kleine Schönheit gewesen, mit achtzehn hatten Männer bei ihrem Anblick den Atem angehalten. Inzwischen war sie vierundzwanzig, und ihre Ausstrahlung war eher noch größer geworden.
Diana trug im Moment einen Reitrock mit Schlitz, dazu eine hellgrüne Bluse und braune Stiefel. Bei jedem Schritt wippten ihre prallen Brüste unter der Bluse, ihre Hüften schwangen, und ihre Haare hatte sie gekämmt, gebürstet und offen gelassen. Rötlichblondes Haar, blaugrüne Augen, dazu die Figur, die eine einzige Verlockung darstellte.
Vielleicht sahen einige der Männer in der Station auch den breiten Waffengurt und das schwere Messer in der Scheide am Gürtel, aber die meisten starrten auf ihren Busen.
»Mann, o Mann!« entfuhr es einem der zwölf Kavalleristen. »Ich werde verrückt!«
Diana hatte das so oft gehört, daß es nichts Besonderes mehr war. Sie wußte, daß sie schön war, und sie verstand es auch, ihre Schönheit einzusetzen, wenn es sein mußte.
Sie war zum Haupteingang hereingekommen und blieb nun vor dem Tisch stehen, an dem der Mann saß, der ihr Leben gewesen war und bleiben sollte: ihr Vater.
William Markham – Old Bill, wie man ihn nannte – grinste. Er war alt und ergraut, aber innerlich jung geblieben und immer zu Streichen aufgelegt.
Da saß er, den Löffel in der schwieligen Faust aufrecht haltend, ein Bein auf der Tischplatte liegend und in den grauen Augen ein Funkeln. Stolz, Freude? Wer konnte es wissen.
»Aha«, sagte er nur. »Siehst gut aus, Tochter.«
Er verlor kein Wort darüber, daß sie sich umgezogen hatte. Solange sie fuhren, trug sie den derben Cordrock, ein kariertes Hemd, eine alte Weste und einen verbeulten Männerhut. Dazu oft Handschuhe. Ihr machte es nichts aus, sich bei notwendigen Reparaturen unter einen Wagen zu legen, Buchsen zu schmieren. Wenn sie dann dreckig und lächelnd wieder hervorgekrochen kam, ahnte kaum einer, daß sich unter Wagenschmiere und Erde, Staub und Schlamm das verbarg, was Diana wirklich war: eine bildhübsche Frau von vierundzwanzig Jahren.
»Die Wagen stehen, alles ist in Ordnung«, sagte Diana. »Ich gehe dann, Dad.«
»In Ordnung, Tochter.«
Sie blinzelte ihm zu, legte ihm kurz die linke Hand auf die Schulter.
»Dad, du bist der beste…«
»Ja«, unterbrach er sie. »Geh nur, viel Spaß!«
Das sagte er, obwohl er wußte, daß sie wahrscheinlich in fünf Minuten in den Armen des First Lieutenant George Coldrey liegen würde. Wie lange sie bei Coldrey blieb, wann sie wiederkam und was sie in der Zeit anstellte, schien Old Bill nicht zu kümmern. Sie war – das hatte er ihr einmal gesagt – alt genug, selbst zu bestimmen, was sie tun wollte. Bill war der Meinung, daß der Mensch nun mal brauchte, was er nötig habe. Darunter fiel gewiß auch die Liebe.
Für Bill war Diana erwachsen genug, sich ihr Leben so einzurichten, wie sie es für richtig hielt. Obwohl er sechzig Jahre geworden war, rechnete er sich nicht zum alten Eisen und besuchte regelmäßig Madam Duncan in Tucson. Aber es gab zwischen ihm und Diana eine stillschweigende Übereinkunft, daß keiner dem anderen irgendwelche Vorhaltungen machte. Zudem war Diana so gut wie verlobt.
Daß ein First Lieutenant ein Kommando von zwölf Mann führte, war absolut ungewöhnlich. Ein Sergeant hätte auch genügt. Doch immerhin war Coldreys Vater Colonel und der Kommandant der Südostregion von Arizona mit Sitz in Fort Grant. Darum konnte es sich George auch leisten, mit einem Kommando den Wagen entgegenzureiten und die Transportsicherung zu übernehmen. Eines Tages, das wußte Diana, würde George zum Major oder Colonel avancieren und sie als seine Frau eine Menge Verpflichtungen haben.
»Ja«, sagte Diana, »ich denke, er wartet. Also, ich gehe.«
Bill nickte nur. Dann blickte er ihr nach und studierte mit innerem Grinsen die Gesichter der Männer, die jeden Schritt Dianas verfolgten, bis sich die Tür hinter ihr schloß. Der Alte hörte die Seufzer der Männer, nahm seinen Löffel wieder anständig in die Hand und aß seine Bohnensuppe.
Draußen atmete Diana tief durch. Manchmal, wenn ihr Vater sie so seltsam ansah, fragte sie sich, ob er nicht doch etwas gegen George hatte. Irgend jemand mußte schließlich die über zwanzig Wagen führen, wenn Bill nicht mehr fahren konnte oder starb. Vor sechs Jahren war absolut klargewesen, daß Harry, Dianas Bruder, der Nachfolger Bills werden sollte. Dann war auch Harry von Comanchen umgebracht worden, wie vorher William, ihr ältester Bruder. Das lag nun elf Jahre zurück. Und vor genau elf Jahren war auch Dianas Mutter gestorben, Jennifer Markham, geborene O’Maily. Irin von Geburt.
Jennifer Markham war nur eine Woche nach Esther, der damals neunjährigen Schwester Dianas, am Sweetwaterfieber in Texas gestorben. Vielleicht auch, weil sie die Nachricht von Williams Tod erreicht hatte, während sie mit dem Fieber kämpfte.
Das Leben und die Arbeit gingen weiter. Man kam nicht dazu, sich lange über Schicksalsschläge den Kopf zu zerbrechen und seiner Trauer nachzuhängen. Obwohl Old Bill Grund gehabt hätte, zu verzweifeln. Aber dieser Klotz von Mann biß die Zähne zusammen. Immerhin hatte er für fünfundzwanzig Leute zu sorgen. Vielleicht fraß er auch alle Sorgen in sich hinein.
Diana war auf dem Weg, als es links von ihr knirschte und sie instinktiv reagierte. Dianas Rechte schwebte über dem Revolverkolben, während sie angestrengt lauschte und ihre Augen die Dunkelheit zu durchdringen suchten.
Und dann sah sie den Schatten des großen Mannes an der Ecke der Fenz, zehn Yards vor sich.
»Wer ist da?« fragte sie lauernd. Ihre Hand lüftete den Achtunddreißiger. »Antworte, Mann! Wer bist du, und warum stehst du da in der Dunkelheit herum?«
»Tut mir leid«, kam es zurück. »Ich bin es, McLintock. Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt haben sollte, Miß Markham.«
Chess McLintock! Irgendwie war ihr dieser baumlange, sehnige Mann unheimlich. Diana erinnerte sich, daß sie nur ein einziges Mal ein paar Worte mit ihm in Tucson gewechselt hatte.
Chess McLintock, der als Vierzehnjähriger den Vater, einen Indianerhändler, bei einem Überfall der Ute-Indianer in der Nähe der sogenannten Salt River-Rio Colorado Chiquito-Route verloren hatte. McLintock, der Mann mit der schrecklichen Nackennarbe, die ein Ute-Tomahawk hinterlassen hatte und nicht zu übersehen war. Er war damals vom Wagen gestürzt und von den Utes nicht beachtet worden, weil sie ihn für tot gehalten hatten.
Chess McLintock, der Fremden als Führer durch diese Wildnis diente, war schweigsam, kühl und abweisend. Ein undurchschaubarer Typ.
»Sie sind das?« Diana seufzte erleichtert. »Warum stehen Sie denn dort, McLintock?«
»Nur so, es gibt keinen besonderen Grund.«
»So? Dieser Doc und dessen drei Begleiter – gehören die Leute zu Ihnen, McLintock?«
»Ja, Miß, der Doc ist ein Mineraloge, er sucht nach Erzen und will über die San Pedro-Linie in die Berge drüben.«
McLintock trat aus dem Schatten in das spärliche Licht der noch brennenden Stallaterne. Er bewegte sich stets so geschmeidig wie eine Raubkatze. Sein Haar war lang, blauschwarz und leicht gewellt. Wahrscheinlich trug er es so lang, um die schreckliche Narbe an seinem Nacken zu verdecken.
Sie sah in seine hellen Augen und erinnerte sich an Phoenix. Vor zwei Jahren war die neue Stadthalle eingeweiht worden. Alle hatten gefeiert, besonders im Creston-House, dem schönsten und größten Saloon der Stadt. Paola del Ria hatte dort gesungen und getanzt, eine Mexikanerin, berühmt von Tucson bis Yuma, von Phoenix bis zum Golconda. Sie war schlank, schön, wild und feurig.
In vorgerückter Stunde hatte sie auf dem großen runden Tisch zum hackenden Rhythmus der Gitarren getanzt, war schließlich heruntergesprungen und lachend in den Armen dieses Mannes gelandet: Chess McLintock.
Chess McLintock, der Schweigsame, der Stille, der Unheimliche und Geliebte dieser bezaubernd schönen Frau, der Hunderte zu Füßen gelegen hatten. Er hatte sie fortgetragen und war nicht wiedergekommen. Dieser seltsame Mann, dieser Wilde und jene Frau – unglaublich!
Und doch ging etwas von ihm aus, das Menschen, besonders aber Frauen, in seinen Bann zu zwingen schien. War es dieser Hauch von Einsamkeit und Wildnis, der Frauen schwach machte?
McLintock kam heran und tat das, was man bei Männern in diesem Land sonst selten erlebte. Er nahm den flachkronigen, breitrandigen Hut mit dem Band aus Klapperschlangenhaut ab. Er sagte nichts, als er vier Yards vor Diana Markham stehenblieb und sie mit seinen hellen Augen, die zu flimmern schienen, ruhig ansah.
Diana fühlte sich unter diesem Blick völlig verwirrt und hilflos. »Ja, dann – dann passen Sie nur auf den Doc auf, McLintock.«
Zum Teufel, was ist denn mit mir los? Warum rühre ich mich nicht von der Stelle?
»Also, dann – gute Nacht, McLintock.«
»Ja«, sagte der Seltsame, der Wilde, der Unheimliche. »Ja, Sie sind wirklich schön.«
Es war, als hätte er sich etwas bestätigen wollen. Es war wie eine Feststellung, etwas, worauf er neugierig gewesen sein mochte, ob es auch wirklich stimmte. Eine flammende Röte überzog plötzlich Dianas Gesicht, als sie sich abrupt abwandte. Dieser Mann, das wurde ihr mit aller Deutlichkeit klar, staunte sie weder an, noch raspelte er Süßholz wie andere.
Diana ging auf die Hausecke zu und sah sich nicht um. Sie wußte, Chess McLintock blickte ihr nach. Es war, als spürte sie seine Blicke im Rücken. Dieser Halbwilde, dieses Ungeheuer, von dem man sich die schlimmsten Dinge erzählte, blickte ihr nach.
Oh, dachte sie zornig, er regt mich auf. Jedesmal, wenn ich diesen Wilden sehe, werde ich wütend. Ich weiß nicht, warum das so ist, er tut mir doch nichts. McLintock – was für ein Name. Wie ihn wohl die del Rio genannt hat, als sie in seinen Armen lag? Vielleicht Chessie-Darling? Der Teufel soll den Kerl holen!
Diana schritt um den Anbau zur Hoftür. Obwohl der Anbau mit dem Hausflur eine Verbindung hatte, war sie nicht durch den Flur gegangen. Schließlich brauchte sich niemand das Maul darüber zu zerreißen, daß sie den First Lieutenant George Coldrey besuchte und so schnell nicht wiederkam.
Die Hölle, dieser McLintock, der hatte etwas in den Augen…
Durch eine Ritze neben der Tür fiel Licht. Als Diana klopfte, räusperte sich George.
»Ja«, sagte er, »komm herein!«
George machte die Tür auf und trat zur Seite. Er war schlank, blond und blauäugig. Er trug die dunkelblaue Kavalleriehose ohne Hosenträger und war der Typ des Offiziers, wie ihn sich jedes kleine Mädchen vorstellte.
»Da bist du ja endlich«, seufzte George und zog Diana sofort an sich, die Tür mit dem Fuß zustoßend. »Mit wem hast du denn da noch geredet?«
»Es war nur McLintock, Georgie.«
Nur McLintock?
*
Es war wie ein Feuer, das in ihrem Körper zu brennen schien, als George ihr den Rock abstreifte und achtlos zur Seite warf. Dann machte er sich an den anderen Kleidungsstücken zu schaffen.
Hatte George heiße Hände!
Sie glitten über Dianas Schenkel, rauf und runter. Die Bewegungen wurden immer fordernder. Dann beugte er sich jäh vor und küßte sie mit der ihm eigenen Wildheit.
Dianas Körper vibrierte im wohligen Schauer, als sich seine Hände unter ihre Bluse schoben und am Mieder zerrten. Neun Wochen hatten sie sich nicht gesehen. In dieser Zeit hatte George nach etwas gehungert, das tief in seiner Brust genagt, gebohrt, gebrannt hatte.
»O Gott, sei doch nicht so wild, George.«
»Ich werde verrückt«, keuchte er und bekam den Hakenverschluß endlich zu fassen. »Jede Nacht habe ich an dich gedacht, jede Stunde, die ich im Sattel saß. Ah, deine Brüste…«
Die Lampe mit dem braunen Schirm warf einen so warmen Ton auf ihren nackten Leib, daß ihre Haut beinahe braun und das Tiefbraun ihrer Brusthöfe fast schwarz wirkte. Nun sah er sie, die beiden Hügel, nach denen er sich in seinen Gedanken und Träumen verzehrt hatte – prall, weich, verlockend.
»Wie schön sie sind«, flüsterte George voller Verlangen und warf sich über sie, ließ seinen Mund um die Warzen kreisen. »Du, du, mein Liebling!«
Das innere Feuer schien sie nun völlig zu verzehren. Diana spreizte wie in Trance ihre Beine, spürte die Hitze seines Leibes auf ihrer nackten Haut, die doch während dieser Nachtstunde kühl geworden war.
George verschaffte sich in leidenschaftlicher Aufwallung Eingang in ihren Schoß, drängte sich rhythmisch dagegen.
Heißes Blut, keuchender Atem, Begehren, das zueinander finden mußte und wollte. Es war, als hätte Diana zu lange gefastet, und vielleicht genoß sie es darum so tief, daß er zu ihr kam und sein Körper sich an ihren preßte. Sie umschlang den geliebten Mann und genoß dieses Zusammensein
Georg küßte sie mit einem Verlangen, daß ihr die Sinne zu schwinden drohten. Sie erstickte um ein Haar unter seinen wilden Küssen. Ein Mann und eine Frau – und die Sehnsucht vieler Tage und Nächte, die sich nun erfüllte.
Eines Tages, dachte Diana, bin ich Mrs. Coldrey, und George ist vielleicht Major oder Colonel. Aber was wird aus den Wagen und Dads Leuten? Herrgott, muß mir das denn ausgerechnet jetzt einfallen? Wie kann ich nur an solche Dinge denken, wenn ich doch will, daß er…
»Ach«, stöhnte Diana und umklammerte seine Schultern. »Ja, ja, Liebling, ja, so ist es gut!«
Und dann war der Gedanke an ihren Vater und die Wagen wie ausgelöscht. Diana glitt auf einer Woge des Glücks dahin. Nach einer Weile wölbte sie ihren Leib, als sie gemeinsam mit George den Höhepunkt erreichte.
*
Es war wie bei jeder Leidenschaft: War sie verrauscht, dachte man an ganz andere Dinge.
»Komm doch noch ein bißchen zu mir«, sagte George vom Bett aus. Er lag auf der Seite und hatte sich zugedeckt, weil er immer so leicht fror. Denn warm war es hier im Anbau nicht. »Nun komm schon!«
»Hör mal, anderthalb Stunden«, gab Diana zurück. »Was soll Dad denken, wo ich bleibe?«
»Ach, dein Vater weiß doch Bescheid«, murmelte George. »In drei Monaten verloben wir uns. Der Colonel meint, ich hätte eine gute Chance, befördert zu werden. Als Captain kann man sich schon mal verloben, auch heiraten, wenn man muß.«
»Wenn man muß«, wiederholte Diana und lächelte verschmitzt. »Nur keine Sorge. Ich habe das Buch von Doc Brewster ganz genau studiert.«
»Ach«, sagte George wegwerfend, »die Weisheit liegt nicht in solchen Büchern. Daß es überhaupt jemand wagt, über so etwas zu schreiben. Wenn wir nur erst heiraten könnten.«
»Willst du damit wirklich warten, bis du Major bist, George?«
»Der Colonel meint…«
Es regte sie auf, dieses verdammte ›der Colonel meint‹. Er hätte ja auch Vater sagen können.
»George, bis du Major bist, bin ich dreißig. Und dann Kinder? Bis dahin kann Dad krank werden oder so das Reißen bekommen, daß er nicht mehr fahren kann. Als Major hast du im Monat höchstens hundertsechzig Dollar. Wenn du aber bei uns Dads Arbeit übernimmst, hast du das Vier- oder fünffache davon. Wir hätten genug für zehn Kinder.«
»Ich habe dir doch schon gesagt, daß der Colonel bestimmt hat, was ich zu tun habe. Wir sind nun mal seit George Washington immer Soldaten gewesen.«
»Seit George Washington«, echote Diana zornig und wußte selbst nicht, warum sie sich so gehenließ. Sie zog den rechten Stiefel an und trat hart auf. »Seit George Washington, dessen Vornamen du trägst, redet man den Vater bei euch wohl immer als Colonel oder General an – oder als Sir, was? Zum Teufel, willst du deinen Vater oder mich heiraten? Diese Linie, die wir von Südtexas nach El Paso und Tucson verlegt haben, bringt mehr ein als das, was ein General jemals verdienen könnte.«
»Diana, das ist kein Vergleich.«
»Nein«, fuhr sie auf und rammte ihr linkes Bein in den anderen Stiefel. »Natürlich nicht. Ein General ist ja mehr als ein Frachtwagenboß. Nur,
Georgie, ohne Frachtwagenbosse müßte auch ein General Sand fressen, Wasser saufen oder nackt herumrennen.
Oder glaubst du nicht? Wer soll denn die Bevölkerung versorgen, wenn es nicht Leute wie meinen Vater gibt?«
»Also, nun hör doch mal, Diana, wie du redest. Wie – wie eine…«
»Wie eine was?« fauchte sie ihn an. Sie wußte genau, daß er diese Vergleiche nicht liebte, aber schließlich beschrieben sie nichts als die Wahrheit. »Ich bin die Tochter eines Frachtwagenmannes, die von Kindheit an mit rauhen Männern umgegangen ist. Die drücken sich nicht anders aus, und ich, wenn ich es nicht will, auch nicht besser. Du hast absolut keinen Grund, mein Lieber, verächtlich auf uns herabzusehen. Wenn wir nicht wären, müßten viele Menschen in diesem Land verhungern, ihr könntet nicht schießen, geschweige denn lange Ritte ohne Vorräte unternehmen. Was, zum Teufel, ist der Grund, daß du so verächtlich über unseren Beruf denkst?«
»Liebling, ich denke wirklich nicht verächtlich, aber es gibt doch Unterschiede. Der Colonel hat mir klargemacht, daß ich die Tradition…«
Als sie plötzlich herumwirbelte, dachte er, sie würde auf ihn losgehen. Bei aller Leidenschaft, die sie verband, war es doch dieser verdammte Punkt, der immer wieder Grund zum Streit lieferte. Diana gab nicht nach, das war das Fatale.
»Was ist denn?«
»Ruhig!« fuhr sie ihn an, als spräche sie nicht mit dem First Lieutenant Coldrey, sondern mit einem ihrer Fahrer. »Sei still! Ich höre Räderrollen, Wagen nähern sich, oder?«
Sie hatte die Bluse noch nicht an, trat dennoch an das Fenster und öffnete den inneren Blendladen so weit, daß sie hinausblicken konnte.
»Diana, wenn dich jemand sieht!« rief George. »Du hast ja oben herum nicht viel an. Diana!«
»Ach, mach das Licht aus, schnell!«
Kommandieren konnte sie wie ein Mann, es war schrecklich mit ihr. Er löschte die Lampe und sah dann im Dunkel das heller werdende Rechteck. Diana machte den Blendladen ganz auf.
»Tatsächlich, es sind Wagen«, sagte sie dann. »Vier, fünf, sieben! Wo kommen die denn jetzt noch nach Mitternacht her? Moment mal…«
Diana streifte sich die Bluse über und knöpfte sie zu, brachte ihr Haar einigermaßen in Ordnung.
»Ich werde verrückt, das sind ja Sturgis-Wagen. He, verdammt, Sturgis sitzt auf dem Bock des ersten Wagens.«
George wußte sofort Bescheid. Niemand brauchte ihm zu sagen, wie sich Lloyd Sturgis und Bill Markham verstanden. Sturgis hatte sich seit etwa zwei Jahren in Arizona niedergelassen und besaß über ein Dutzend Wagen. Er machte Old Bill Konkurrenz, wo er nur konnte. Zwischen seinen Leuten und Bill Markhams Fahrern hatte es bereits etliche Zusammenstöße gegeben. Sturgis fuhr immer etwas billiger für die Armee. Er war ein knapp fünfunddreißig-jähriger Mann mit glatten schwarzen Haaren und dunklen Augen. Er wirkte zwar farblos, aber das täuschte.
»Das fehlte gerade noch«, sagte Diana am Fenster. Ihre Augen hatten sich nun an die draußen herrschende Dunkelheit gewöhnt, und sie sah, wie einige ihrer Männer, die unter oder auf den Wagen geschlafen hatten, neugierig wurden. »Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Sturgis hat neulich erst die Frachtraten für den Mexikohandel unterboten, und Dad war ziemlich wütend. Ich muß hinaus und sehen…«
Sie sagte nichts mehr, dafür sah sie etwas aus den Augenwinkeln.
An der Fenz bewegte sich ein Schatten. Der Mann dort hatte an der Ecke gestanden und wich nun in die nachtschwarze Finsternis zurück.
Chess McLintock.