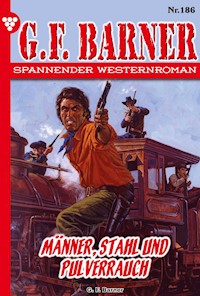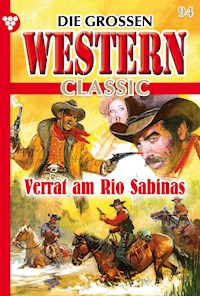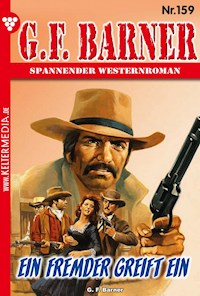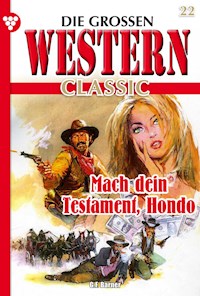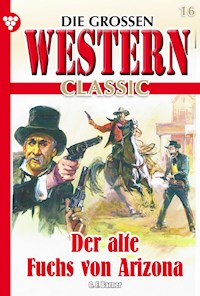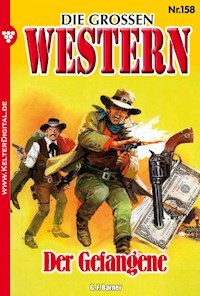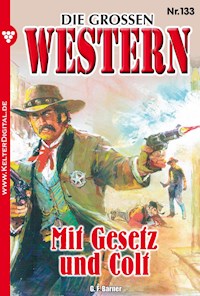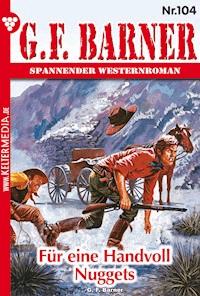Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Im Mondlicht sieht die Mauer wie vom Alter zernarbt aus. Und doch kennt Ezra Barry die Geschichte dieser Mauer und all der anderen in Santa Cruz. Die Narben rühren von Pfeilen, Kugeln oder dem sinnlosen Hieb eines Tomahawks her. Das schwere Holztor ist brandneu. Irgendwo rechts daneben ist ein Fleck auf der Mauerkrone und eine rostrote Bahn abwärts bis zum Boden. Barry gleitet aus dem Sattel, führt sein Pferd durch das Tor und bindet es an einen Balken. Der Hof liegt in trübem Licht. Von den Hügeln dringt das klagende Heulen eines Kojoten. Am Haus knarrt die Hintertür. Sie muß mich gesehen haben, denkt Barry, als das Mädchen heraustritt. Ich kann kommen, wann ich will, sie ist da. »Hallo«, sagt er leise, als sie stehenbleibt und ihn mit ihren dunklen Augen ansieht. »Guten Abend, Juana.« »Mr. Barry. Es ist lange her.« Ihre mandelförmigen Augen mustern ihn eindringlich. Ihr schwarzes langes Haar, das sie selten aufgesteckt trägt, fällt bis über ihre Schultern herab. Zum Braun ihrer Haut passen die weiße Bluse, der weite Rock mit seiner breiten Bordüre und das Kirschrot ihrer Ohrgehänge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 318 –
2000 Dollar auf den Kopf
G.F. Barner
Im Mondlicht sieht die Mauer wie vom Alter zernarbt aus. Und doch kennt Ezra Barry die Geschichte dieser Mauer und all der anderen in Santa Cruz. Die Narben rühren von Pfeilen, Kugeln oder dem sinnlosen Hieb eines Tomahawks her.
Das schwere Holztor ist brandneu. Irgendwo rechts daneben ist ein Fleck auf der Mauerkrone und eine rostrote Bahn abwärts bis zum Boden.
Barry gleitet aus dem Sattel, führt sein Pferd durch das Tor und bindet es an einen Balken. Der Hof liegt in trübem Licht. Von den Hügeln dringt das klagende Heulen eines Kojoten. Am Haus knarrt die Hintertür.
Sie muß mich gesehen haben, denkt Barry, als das Mädchen heraustritt. Ich kann kommen, wann ich will, sie ist da.
»Hallo«, sagt er leise, als sie stehenbleibt und ihn mit ihren dunklen Augen ansieht. »Guten Abend, Juana.«
»Mr. Barry. Es ist lange her.«
Ihre mandelförmigen Augen mustern ihn eindringlich. Ihr schwarzes langes Haar, das sie selten aufgesteckt trägt, fällt bis über ihre Schultern herab. Zum Braun ihrer Haut passen die weiße Bluse, der weite Rock mit seiner breiten Bordüre und das Kirschrot ihrer Ohrgehänge.
»Ja«, erwidert er ernst, »es ist lange her. Ich hatte viel zu tun. Hm, ihr hattet vor drei Wochen Besuch?«
Sie nickt, deutet dann auf sein Pferd und fragt: »Schnell geritten?«
»Das kann man wohl sagen.«
Er lächelt verkrampft, sie kennt ihn so gut, daß sie dieses Lächeln zu deuten versteht.
»Ärger, Mr. Barry?«
»Ja.«
»Apachen?«
»Nein. Es ist Jim.«
»Der Junge?«
»Ja. Hast du ihn gesehen?«
Sie hat ihn gesehen, denkt er. Jim muß ja hier vorbei, wenn er von Norden kommt. Vielleicht war es ein Fehler, aber er ist schließlich der einzige Sohn meines Onkels. Vater hätte ihn strenger anfassen müssen. Der Junge haßt jede Arbeit und treibt sich am liebsten herum. Ich bin sicher, er würde jeden Indianer töten, der ihn schief ansieht. Wenn wir nicht mit den Apachen so gut auskämen – wer weiß, ob er es nicht längst getan hätte.
»Er kam gegen Mittag, Mr. Barry.«
»Und wohin ist er geritten?«
»Ins Casa Grande, denke ich. Was ist, hat er etwas angestellt? Ezra, er ist jung.«
»Das weiß ich. Nein, angestellt hat er nichts, nur einen Fehler gemacht.«
»Einen Fehler? Jeder macht Fehler, warum er nicht auch?«
»Wir hatten eine Wildpferdherde zusammen, fast vierzig gute Tiere.«
»Ah, und nun?«
»Er sollte auf sie aufpassen – sollte.«
Er hat sie verlassen, denkt Juana bitter, es gibt nichts Schlimmeres für einen Barry, als irgend etwas im Stich zu lassen. Seltsam, sie sind immer noch drüben, und seit fünfzehn Jahren haben sie die Ranch. Vielleicht hätten sie sich so wenig halten können wie alle anderen Leute, die versucht haben, eine Ranch im gefährlichen Apachengebiet zu errichten. Vielleicht würden sie alle tot sein, wie viele, die nicht mehr da sind, von denen es auch kein Grab gibt, wenn nicht…
Einen Moment erinnert sie sich an die fast unglaubliche Geschichte jener Freundschaft, die die Barrys und Mangas Coloradas, den Chief-Häuptling der Apachen, verbindet.
»Und?« erkundigt sie sich besorgt. »Ezra, sind die Pferde weg?«
»Wir hatten nur einen einfachen Zaun gebaut«, gibt er zurück. »Jim sollte ihn befestigen und verstärken. Die Arbeit muß ihm nicht sehr gefallen haben. Niemand kann Wildpferde in einem einfachen Zaun halten. Die brechen aus, sobald sie seine schwachen Stellen entdeckt haben. Vater hat es ihm gesagt, jetzt ist er wütend.«
Sie blickt Ezra Barry groß an und schweigt. Wenn die Barrys wütend sind, dann ist das so schlimm, als wenn hundert Apachen den Kriegspfad beschreiten, so sagt man hier. Ein wütender Barry nimmt es mit zehn Gegnern auf, das sagt man auch. Sie mustert Ezra neugierig und fragt sich, welche Gedanken ihn beschäftigen mögen.
Es ist keine Frage, daß ihr dieser Mann gefällt. Wenn sich ihre Blicke treffen, dann errötet sie jedesmal. Es ist gut, daß es dunkel ist. Sie kann seine hellen Augen kaum erkennen, aber sie spürt, daß Ärger in ihnen liegt.
»Schlimm für den Vater?« fragt sie leise. »Und schlimm für Sie, Ezra.«
»Zwei Wochen harter Arbeit umsonst.«
*
Das Casa Grande, das »große Haus«, das einzige größere Hotel in Santa Cruz, gleichzeitig Station der Postlinie und Aufenthaltsplatz aller Emigranten, die nach Kalifornien gehen, wird von Pablo Mendozza geleitet. Mendozza ist ein freundlicher, aber etwas ängstlicher Mann. Man erzählt sich, daß er bei einem Indianerüberfall auf die Stadt einmal unter den weiten Rock seiner Frau gekrochen sein soll. Sie schoß, und er betete, das soll es geben…
Ezra folgt Juana ins Haus, nimmt aber sein Gewehr mit. Sie kennt das, er geht keinen Schritt ohne sein Gewehr. Es ist ein sechsschüssiger Colt-Trommel-Lader, eine Waffe, die nur wenige Männer hier besitzen. Der Lauf ist sechskantig, der Kolben glatt und gepflegt. Dazu trägt Ezra ein Messer und einen Revolver. Es ist die übliche Bewaffnung für einen Mann in einem unsicheren, wilden Land.
Als er in die Tür tritt, blickt sie kurz in seine Augen. Er ist verärgert, sie hat es gewußt. Dies ist nun schon das vierte Mal in diesem Jahr, daß er Jim Barry, seinen Vetter, aus der Stadt holen muß.
Und dann fällt Juana etwas ein: Als er ihn das dritte Mal holte, sagte er etwas davon, daß aller guten Dinge drei wären, und es nun genug sei.
»Ezra?«
»Ja?«
Er bleibt stehen, blickt sie fragend an.
»Dies ist das vierte Mal, nicht wahr? Wird es jetzt für den Jungen – ich meine, bekommt er Ärger?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie hatten doch gesagt, daß aller guten Dinge…«
»Ich weiß, ich weiß«, unterbricht er sie. »Nur, ich mag den Jungen. Er ist in Ordnung. Ich habe keinen Bruder und keine Schwester, ich mag ihn so wie einen Bruder. Vielleicht ist es darum besonders schlimm für mich, daß ich es wieder sein muß, der ihn holt. Ich wollte nicht reiten, aber Vater meinte, einen anderen Mann würde Jim gar nicht anhören.«
»Ja«, sagt sie schluckend. »Ezra, es ist schwer, sich zu fügen, wenn der Vater bestimmt, nicht wahr? Sie lieben Ihren Vater, ich weiß es.«
»Manchmal möchte ich abhauen«, sagt er, und seine Stimme klingt nun ganz rauh und heiser. »Dann denke ich, ich sollte mein Pferd nehmen und weit fortgehen mit dem Mädchen, das ich mehr als alles andere mag. Nur käme ich mir dann wie ein Mann vor, der Soldat ist und seine Fahne verläßt. Er würde es nicht überwinden können, ich bin für ihn alles, was er besitzt, vielleicht mehr als die Ranch. Und das ist immerhin sein Leben gewesen und wird es bleiben. Sie kennen ihn kaum, Juana, aber man kann einem Mann wie ihm das nicht antun.«
Er redet, denkt sie, und muß immer wieder schlucken. Mein Gott, warum sagt er es jetzt, warum ausgerechnet in dieser Stunde? Vielleicht bedrückt ihn das alles zu sehr, und er wird nicht mehr allein damit fertig. Aber wenn ich ihm sage, daß ich jeden Tag und jede Stunde auf ihn warte, dann vergißt er Major Irwings Tochter. Ich kann es dem alten Mann, der sein Vater und ein so großer Mann ist, einfach nicht antun. Er würde mich hassen, der alte Mann, und ihn verdammen. Damit würde Ezra vielleicht auch nie fertig.
Mein Gott, denkt er, ich kenne sie nun elf Jahre. Als ich sie zum erstenmal sah, war sie ein Mädchen von elf Jahren. Ob sie mich schon als Kind gemocht hat, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß ich sie in meinen Träumen sehe. Immer und immer.
Sie lehnt an der gekalkten Flurwand. Den Kopf hält sie gesenkt. Und ihr Atem geht schwer.
Und dann spürt sie seine Hand auf ihrem Haar.
»Es ist schlimm«, murmelt er stockheiser. »Es ist ganz schlimm, Mädel. Ich muß gehen und Jim suchen, ich weiß nicht, wann ich wieder in die Stadt komme.«
»Ist es schon besprochen, Ezra?«
»Nein, aber ich kenne das, wenn mein Vater etwas haben will. Er weiß nicht, daß ich es nicht haben will, er weiß gar nichts. Für ihn ist sein Sohn sein Erbe und Nachfolger. Der Sohn muß den Vater eines Tages vertreten und als Boß einer Ranch ablösen können. Zu etwas anderem hat mein Vater keine Zeit, oder nur wenig. Auf Wiedersehen, Juana.«
»Vielleicht, wenn Major Erwings Tochter auf die Ranch kommt, sehen wir uns nie mehr«, sagt sie flüsternd.
»Nein, nein, sie kommt nicht. Ich muß es ihr sagen, irgendwann muß ich es ihr sagen, nur nicht jetzt, er hat so viele Sorgen. Mangas ist nicht da, Gomez macht die Gegend unsicher. Er versteht sich mit Vater ganz gut, aber Häuptling Canochi reitet auch durch die Berge drüben. Canochi haßt alles, was weiß ist.«
»Würde er den Barrys etwas tun?«
»Ich weiß es nicht, Mangas ist nicht da. Er ist weit im Osten. Sie haben am Guadalupe-Paß vor einer Woche drei Wagen überfallen und alles getötet. Canochi mit seinen Kriegern. Ich muß jetzt gehen, Mädel. Gute Nacht.«
»Gute Nacht!«
Er kommt noch einmal, denkt sie, als er die Tür schließt und draußen im Hof das Tor klappt. Er wird Jim Barry herbringen, den wilden Jungen. Seltsam, er sagt es nie, wenn er jemanden mag, der Junge weiß es auch nicht. Und ich – ich weiß es, aber sagen… Er wird es erst sagen, wenn er es seinem Vater erzählt hat und die Entscheidung gefallen ist. Es wird eine Entscheidung gegen mich sein, Juana Ortega ist Spanierin und keine Irin.
Er ist fort, sie steht im Gang und spürt, wie ihr die Tränen kommen.
Und dann klappt die Tür, der Mann blickt Juana an und tritt auf sie zu.
»Du weinst, warum weinst du, meine Tochter? Wer hat dir etwas getan?«
Er steht da, ein kleiner, ergrauter Mann mit klugen Augen, und er spürt, daß sein einziges Kind Kummer hat. Alles, was Josef Ortega besitzt, ist seine Tochter.
»Nichts, Vater, nur – Ezra Barry ist gerade gegangen.«
»Schlimm, ja? Du mußt nicht weinen, du hast mich, Kind. Ich kenne Ezra, er ist zu gewissenhaft.«
»Ja, ja, aber Major Irwings Tochter, Vater…«
»Mañana?« fragte er leise. »Morgen, wer weiß, was morgen ist? Vielleicht kommen morgen die Apachen. Es sollen Skalpjäger im Casa Grande sein.«
»Schon wieder? Mein Gott, warum lassen wir sie in die Stadt, warum nur? Die Indianer denken, daß wir ihre Feinde sind und kommen her, um sich zu rächen. Vater, jemand muß etwas tun, um es zu verhindern.«
»Wer denn – ich?« fragt er bitter. »Ich bin ein kleiner Mann, der etwas Geld, aber keinen Einfluß hat. Zweihundert Dollar zahlen die Behörden für das Haar eines Apachenkriegers, hundert für das eines Kindes männlichen Geschlechtes. Hundertfünfzig Dollar für das Haar einer Indianerfrau. Kind, diese Welt ist grausam. Fur Skalps bekommt man Geld.«
Er fröstelt. Die Indianer sind schon dreimal in den letzten Jahren nach Santa Cruz gekommen, nachdem sich hier Skalpjäger aufgehalten hatten. Brennende Häuser, tote Frauen und Kinder, Männer mit eingeschlagenen Köpfen die Bilanz eines Besuches.
Das ist die nackte Wahrheit in Santa Cruz, die in Tubac drüben ist noch grausamer. In dieser Stadt hat es nach einem der Überfälle kein menschliches Wesen gegeben, das noch geatmet hätte. Hundertfünfzig Menschen umgebracht, alle Einwohner der Stadt.
Die Barrys, denkt Josef Ortega, denen wird man niemals etwas tun. Der junge Geronimo ist ihr Freund wie Mangas Coloradas, wie Gomez und die anderen wichtigen Häuptlinge. Dabei ist Häuptling Gomez der wildeste von allen, und die Regierung hat zweitausend Dollar auf Gomez’ Kopf ausgesetzt. Zweitausend Dollar für den, der den Kopf von Gomez bringt – den Kopf, nicht nur sein Haar! .
Er friert, als er daran denkt, daß sich seit Wochen einige Gruppen Amerikaner hier herumtreiben, die sich den Preis verdienen wollen. Zumeist Texaner, bis an die Zähne bewaffnet. Sie gehen keinem Streit aus dem Weg und brechen oft genug einen vom Zaun. Wenn die »Americanos«, so nennt man sie hier, diesseits der Grenze betrunken sind, dann kommt das große Fürchten über die Mexikaner.
*
Das Feuer brennt mitten vor dem Casa Grande auf der Straße. Es ist ein schönes Feuer, in das ab und zu etwas getrocknetes Salbeigestrüpp geworfen wird. Salbei hat die Eigenschaft, das Fleisch des über dem Feuer sich drehenden Antilopenbratens mit einem angenehm würzigen Geschmack anzureichern.
Ein Dutzend Männer liegt, hockt oder steht um das Feuer herum. Drei baumlange Texaner bewachen den Braten. Einer, ein dicker, gewichtiger Mann, gibt die Anweisungen und überwacht das regelmäßige Drehen des Spießes.
Ezra Barry sieht kurz hin. Er hat einen Moment im Schatten einer großen Agave gestanden und Jim unter den Zuschauern des Bratvorganges gesucht. Doch Jim ist sicher im Casa Grande und wird dort trinken.
Drüben hat ein baumlanger Bursche mit einem schwarzen Schnurrbart und riesengroßen Sporen an den Stiefeln einen Stuhl genommen. Er hockt unter dem Sonnendach des Casa Grande auf den Bohlen des Vorbaues. Drei Männer sind bei ihm, die auf ihn einreden.
Im Näherkommen versteht Barry ihre Worte und blickt zur Straße, als einer der Männer zu dem großen Burschen auf dem Stuhl sagt: »John, die Mexikanerin, paß auf, das wird ein Spaß.«
Das Mädchen, vielleicht siebzehn, achtzehn Jahre alt, nähert sich dem Feuer und sagt etwas zu einem der Texaner. Augenscheinlich will es um etwas Fleisch bitten. Der Texaner streckt blitzschnell die Hand aus, das Mädchen kreischt, will ihm entwischen und wird doch am Rock festgehalten.
»Sie will Fleisch!« brüllt der baumlange Bursche heiser. »John, und ich will zwei Küsse. Komm her, Chiquita, ohne Kuß kein Fleisch, na? Ho, sie will nicht, die Taube. Fort mit dir! Ohne Kuß kein Fleisch!«
Sie lachen. Auch der große schwarzhaarige Mann auf dem Vorbau des Casa Grande lacht tönend.
»He, Glanton!« ruft einer aus der Menge unten. »Sie sind spröde wie Glas, diese Mexikanermädchen, aber kennst du mal eine, dann…«
»Halt den Mund, oder willst du eine Kugel haben?« fragt John Glanton mit plötzlicher Kälte.
Kaum hört Ezra Barry Glantons Namen, als er auch schon weiß, wie gefährlich dieser Mann ist. Manche behaupten, daß Glanton nichts weiter als ein Bandit sei. Andere sagen, er sei bis zum Selbstmord verwegen. Glantons Furchtlosigkeit ist genauso gerühmt wie seine Härte und Schnelligkeit mit dem Revolver.
Der Bursche, denkt Barry, als er das verwegene Gesicht des großen Mannes auf dem Stuhl betrachtet, jagt Indianer wie Antilopen. Es heißt, er soll zwei Dutzend Indianer umgebracht haben. Was will er hier?
In diesem Moment spürt Glanton seinen Blick, dreht den Kopf herum und sieht Barry durchdringend an.
»Hallo!« sagt er dann, nachdem er ihn lange genug gemustert zu haben scheint und sein Blick auf das Gewehr in der Hand von Ezra gefallen ist. »Mein Freund, Sie haben das richtige Gewehr. Können Sie damit umgehen?«
»Würde ich es sonst tragen?«
Glanton nickt, blickt ihm nach und runzelt nachdenklich die Stirn.
»Ist was, John?« fragt Seguin Magoffin, sein bester Mann, der auf der Treppenstufe des Vorbaues sitzt. »Was interessiert dich an dem Burschen?«
»Ich möchte wissen, ob er so hart ist wie er aussieht.«
Sein Satz geht im Gejohle jener Männer unter, die in der Kneipe vom Casa Grande losbrüllen.
Es soll keine fünf Minuten dauern, dann weiß Glanton, wie hart ein Barry sein kann. Und er wird sich später immer daran erinnern und mit einer gewissen Furcht an Ezra Barry denken.
In dem Augenblick, als Barry durch die Tür kommt, brüllen zwanzig, fünfundzwanzig rauhe Kehlen los. Es gilt jedoch nicht Ezra Barry, es gilt vielmehr Pablo Mendozza, dem Besitzer des Hauses.
Mendozza, dessen Frau ein wildes Gekreische hören läßt, steht an der Wand. Kreidebleich und zitternd.
Rechts und links haben vier wilde, verwegen aussehende Burschen Aufstellung genommen. Jeder von ihnen hat den üblichen Sechsschüsser gezogen und auf den armen, zitternden kleinen Mann gerichtet.
Mendozzas Frau aber wird von zwei Männern festgehalten. Ein siebenter Mann, bärtig, Lederkleidung mit echten Haaren als Verzierung an den Nähten, steht neun Schritte von Mendozza entfernt und wiegt ein schweres Messer balancierend auf der Hand aus.
»Madre…!« kreischt Antonia Mendozza und droht in Ohnmacht zu fallen. »Ihr bringt ihn um! Das ist zuviel Spaß!«
»Sag dem Frauenzimmer, daß es den Mund halten soll!« knurrt der Mann in der fleckigen Lederkleidung und dem Messer in der Hand. »Es macht mich nervös. Und wenn ich nervös bin, dann kann ich nicht treffen. Stellt ihm den Kürbis auf den Kopf. Los, macht voran! Er hat gesagt, daß er mir nicht glaubt, jetzt soll er es erleben.«
»Ich glaube dir!« jammert Mendozza heulend. »Oh, Mama, Mammita, du machst mich tot, Amigo! Nicht werfen, ohooo, nicht bittäää!«
»Bueno«, sagt der eine von den vier Burschen rauh. »Entweder stehst du still, Amigo, oder du bist gleich eine hübsche Leiche. Steh still, Mensch, du hast es so haben wollen.«
Er reißt ihn heftig am Arm. Der andere legt Mendozza, wer weiß, zum wievielten Mal, den Kürbis auf die spärlichen Haare.
Mendozza, nun ein Gewehr in der Seite, steht still, als wenn er an einen Pfahl gebunden ist. Der Bursche aber, der das Messer hat, hebt unter dem Gelächter der anderen den Arm.
Ezra blickt nach links. Er kann, verdeckt durch drei, vier Zuschauer, Jim sehen.