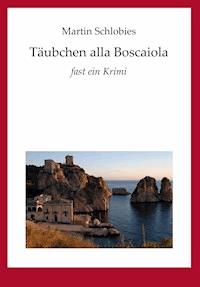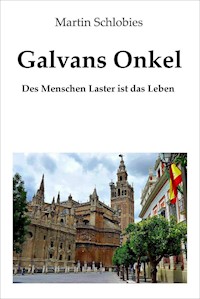
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erwartet Vicente zuviel vom Schicksal, als er versucht, sich in der Stadt seines Freundes Galván als Künstler niederzulassen? Er begegnet zwei Frauen, Amahi und Luz, die Cousine Galváns, - und verliebt sich in beide. Doch Amahi wehrt sich. Er begegnet auch Galváns Onkel, Manuel Tejada, der seine zwölf Ehefrauen aus aller Welt an sein Sterbebett ruft, und durch eine unerwartete Begebenheit zum Heiligen wird. Und als er mit seinem Freund Galván in dessen Heimatdorf fährt, malt er die Gutsherrin des Ortes; allerdings verläuft diese Begegnung tragisch für sie. - Gelingt es Vicente schließlich doch, Amahi zu gewinnen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Kapitel
Es ist immer unangenehm, die Wahrheit zu berichten, besonders dann, wenn eine Geschichte so endet wie diese. Doch die Erinnerung, wenn es schlimme Dinge zu berichten gilt, selbst wenn sie nur wenige Wochen zurückliegen, ist äußerst unzuverlässig. Schon beginnen sich die Ereignisse in meinem Gedächtnis zu verwischen, ich bemerke, wie ich versuche, schön zu färben, was ich getan habe. Ich muß mich beeilen!
Deshalb erzähle ich Ihnen jetzt, was uns - oder mir - zugestoßen ist, und zwar vor ganz kurzer Zeit, nämlich in der Nacht vom ... zum ..... Wir, das heißt mein Freund Edmund, seine Frau Michelle und ich, wollten an die Atlantik-Küste fahren.
Es war nichts weiter als Übermut, - oder vielleicht war es doch kein Zufall? - daß ich in Lissabon nicht die nächste Maschine nach Paris genommen hatte, sondern diesen Abstecher an die Atlantikküste machte, zu dem mich Edmund überredet hatte. Ich hatte Edmund viele Jahre nicht gesehen. Wie konnte ich da seine Einladung ausschlagen?
Zuvor war ich länger als einen Monat in Thailand gewesen, um einen Film zu drehen, einen Dokumentarfilm über einen Amerikaner, der buddhistischer Mönch geworden war. Ein langweiliger Mensch, der nun im Schweigen und Meditieren seiner Langeweile soetwas wie einen Sinn zu geben versuchte.
Währenddessen hatte in Portugal die unblutige Revolution gegen das Regime von Salazar stattgefunden, schon lange Totgeglaubte waren dem Staatsgefängnis entstiegen, Blitzlichter der Freude in den bleichen Gesichtern, auf den Straßen hatten Feste stattgefunden, und ich, ausgerechnet ich, hatte dieses Ereignis in Thailand verpaßt.
Schon während der letzten Tage meines Aufenthaltes in Lissabon hatte sich das Wetter geändert. Über den Bergen der Umgebung erschienen immer wieder schwarze drohende Wolken und überschütteten die Stadt mit kurzen Regengüssen. Jeden Abend begann ein heftiger kalter Wind stoßweise von Nordwesten zu wehen.
Wir konnten uns erst spät abends in Lissabon von unseren Freunden verabschieden und fuhren bei völliger Dunkelheit los. Wie Sie nicht wissen können, regnete es in jener Nacht. Dazu stürmte es fast während der ganzen Fahrt. Die Natur schien in Aufruhr geraten zu sein.
Wir waren die Fernstraße über Grandola gefahren und hatten uns vom Meer entfernt. Wir waren alle müde, hatten vor dem Aufbruch reichlich zu Abend gegessen und etwas zuviel getrunken und es fiel uns schwer, wach zu bleiben.
Als wir uns dem Atlantik wieder näherten und durch Cercal fuhren, dort, wo die Straße nach Odemira abzweigt, rief Edmund plötzlich:
"Halt einmal! Da winkt jemand!"
Durch die Schlieren, die der Scheibenwischer hin und her schlug, gewahrte ich jetzt im grünlichen Licht einer Laterne am Straßenrand einen Schatten, eine junge Frau. Ich hatte so auf die nasse Straße achten müssen, daß ich sie vorher nicht gesehen hatte.
Sie duckte sich vor dem Regen und verkroch sich in ihrem hochgeschlagenen Mantelkragen. Die langen Haare hingen ihr in das Gesicht.
Nun ist eine junge Frau, die nachts in Portugal an der Straße steht und mitgenommen werden möchte, etwas überaus Ungewöhnliches. Ich bremste also, so scharf es bei dem Wetter möglich war.
Edmund, der hinten saß, öffnete die Tür und fragte sie:
"Wo möchten Sie denn hin?"
Sie antwortete aus der Dunkelheit heraus leise und scheu:
"Nach Vila nova de Milfontes."
"Da wollen wir auch hin." rief Edmund, "Steigen Sie ein!"
Die Anhalterin setzte sich neben Edmund auf die Rückbank und murmelte mit vor Kälte zitternder Stimme ein leises "Danke!" Sie schien vollkommen durchnäßt zu sein. Wir waren froh, ihr diesen kleinen Gefallen tun zu können und auch darüber, etwas Gesellschaft zu haben. Nur Michelle gab keinen Laut von sich, sie schien ungehalten über den neuen Gast im Wagen.
Ab und zu, wenn ein Auto uns entgegen kam, und seine Scheinwerfer Licht in unseren Wagen warfen, sah ich im Rückspiegel ein blasses ovales Gesicht, verhangen mit nassen Haaren. Mein Gott, war sie blaß! Es ging mir ordentlich durch mein Inneres. Nie hatte ich ein so blasses Gesicht gesehen!
"Sie sind so blaß, Sie sind doch hoffentlich nicht krank?" fragte ich sie endlich. Sie schüttelte nur den Kopf. In dem Moment überholte uns ein Lastwagen und übergoß den Wagen mit einem wahren Sturzbach, sodaß die Scheibenwischer Mühe hatten, die Wassermassen wegzuschieben.
Aus Höflichkeit, vielleicht auch aus Neugier, versuchte ich noch ein- oder zweimal, ein Gespräch mit der jungen Frau anzufangen, doch sie war nicht sehr gesprächig. Wahrscheinlich war sie einfach nur müde.
Als wir etwa eine halbe Stunde gefahren waren, wurde sie unruhig, tippte mich an die Schulter, die Berührung war kaum zu spüren, und sagte:
"Können Sie bitte jetzt anhalten?"
"Natürlich, wenn Sie es wünschen, - aber wieso?"
"Ich muß jetzt aussteigen ..."
"Wir nehmen Sie gern mit nach Milfontes, da wollten Sie doch hin?"
"Ich habe es mir anders überlegt."
Wir hielten ihr vor, wie unvernünftig es wäre, jetzt allein durch die Nacht zu irren. Doch sie ließ sich nicht bereden. Etwas wie Panik schwang in ihrer eigentümlich rauhen, fast heiseren Stimme, als sie bat:
"Lassen Sie mich bitte jetzt gleich heraus! So schnell es geht, bitte!" Sie war vielleicht doch ein wenig krank, mindestens erkältet, dachte ich, und sagte:
"Selbstverständlich, wenn Sie es wollen!"
Wir hielten also an, an einem Rondell mit Kreisverkehr außerhalb von Cercal, und ließen sie aussteigen.
Sie beugte sich noch einmal in den Wagen, und reichte Edmund ein Kuvert,
"Hier ist ein Brief, wenn Sie so freundlich sein wollen, ihn in der ... Straße abzugeben."
"Wie sollen wir das jetzt mitten in der Nacht finden?"
"Sie nehmen die letzte Abzweigung links, bevor Sie nach Milfontes hineinfahren. Es ist das Kastell, gegenüber der Flußmündung ..." Damit verlor sie sich in die Nacht.
Wir fuhren weiter, recht beunruhigt darüber, eine junge Frau, ein Mädchen fast noch, so schutzlos und allein in der Nacht zurücklassen zu müssen.
Und wo, um Gottes Willen, wollte sie bei diesem Wetter hin?
2. Kapitel
Kurz vor Mitternacht kamen wir schließlich in Milfontes an und fanden auch gleich das Kastell. Ich hielt den Wagen an; Edmund und ich stiegen aus, um den Brief abzugeben. Michelle blieb im Wagen sitzen.
"Beeilt euch!" rief sie uns nach.
'Propriedada particulada.' stand auf einer Marmortafel. Etwas zaghaft gingen wir durch ein zierliches Eisengitter, das offen stand, dann auf den Bohlen der ehemaligen Zugbrücke über den Graben, zu einer großen eichenen Tür.
Edmund zog an der Klingelschnur. Nichts geschah.
"Du mußt vielleicht stärker ziehen!", sagte ich. Edmund tat es. Ein heller Glockenklang ertönte. Doch alles, was wir danach hörten, waren leise Schritte hinter der Tür, Schritte, die vorübergingen und verhallten.
Dann, endlich, öffnete sich die Tür. Eine Frau mittleren Alters, die schwarzen Haare streng gescheitelt, stand vor uns, offenbar die Hausdame.
Wir zeigten ihr den Brief, und wollten uns bei der Besitzerin des Kastells melden lassen, denn wir dachten, an sie sei der Brief, der nicht adressiert war, gerichtet. Doch die Hausdame nahm das Kuvert entgegen, bat uns herein und führte uns in einen großen, altmodisch eingerichteten Salon. Dort mußten wir recht lange warten.
Ich blätterte gerade neugierig im Gästebuch, das auf dem Kamin lag, neben einem Stapel Briefe, plötzlich peitschte ein scharfer Wind gegen die Fenster, schlug die Läden hin und her, und im Rauchfang kreischte es bösartig wie ein Tier. Wir schraken zusammen.
Ich spürte wie mir das Blut aus dem Gesicht wich, wechselte mit Edmund, der auch bleich wurde, einen Blick. Und auf einmal war etwas anders und wir verstanden nicht, was denn nun eigentlich anders war. Es war nicht möglich, zu sagen, was. Wir waren auf eine unerklärliche Art und Weise angestrengt. Um nur irgendetwas zu sagen, sagte ich leise:
"Was tut sich da draußen? Gott bewahre uns, kommt etwa ein noch schlimmeres Unwetter?"
Kurz danach hörten wir eine Tür gehen, ich blickte auf und sah wie Edmund sein Gesicht einer Tür im hinteren Bereich des Salons zuwandte. Und ich war kurz davor zu sagen:
"Wo bleibt sie denn?" Aber wer, fragte ich mich? Wer hätte denn kommen können?
Jetzt hörten wir es kratzen, die Tür öffnete sich einen Spalt, ein kleiner alter Hund schoß hervor und lief jemandem entgegen. - Ich habe es gesehen! Er lief jemandem entgegen, der nicht kam! Ich spürte auch merkwürdigerweise, daß es eine Frau war. Für den Hund war sie gekommen. Auch Edmund schien den Eindruck zu haben, daß der Hund jemandem entgegenlief.
Zweimal blieb der kleine Hund stehen und blickte sich nach uns um, als ob er uns etwas fragen wollte. Dann raste er auf diese Frau, - die nicht zu sehen war, - zu, so, wie er es anscheinend immer getan hatte, und erreichte sie; er begann, rund herum zu springen, - um etwas, was nicht da war, - und dann hinauf an ihr, vielleicht um sie zu lecken.
Wir hörten ihn winseln vor Freude, und wie er so in die Höhe schnellte, mehrmals rasch hinter-einander, hätte man wirklich meinen können, er verdecke sie uns mit seinen Sprüngen.
Auf einmal heulte er auf, drehte sich von seinem eigenen Schwunge in der Luft um und stürzte, merkwürdig ungeschickt, lag ganz flach da und rührte sich nicht mehr.
Eine Tür an der anderen Seite des Salons wurde jetzt geöffnet. Die Hausdame erschien, den Brief in der Hand, den wir ihr übergeben hatten. Sie zögerte; offenbar war es nicht ganz leicht, auf unsere Gesichter zuzugehen.
Sie sagte etwas zu dem Tier, etwas Kurzes, Einsilbiges. Der Hund erhob sich zögernd, und mit eingekniffenem Schwanz schlich er aus dem Raum, offenbar wußte er genau, wohin er zu gehen hatte.
Die Hausdame fragte uns, wo wir den Brief herhätten. Wir berichteten ihr von der jungen Frau, der Anhalterin, die ihn uns gegeben hatte. Die Hausdame sah uns sehr seltsam an, und schüttelte mehrmals den Kopf. Sie blickte zu meinem Freund Edmund, dann zu mir, dann wieder zu Edmund, sah mehrmals auf den Brief in ihrer Hand, und nickte endlich, wie in Gedanken.
Schließlich sagte sie:
"Der Brief ist von der Tochter der Condessa. Die Schrift läßt keinen Zweifel zu! Und sehen Sie hier," und damit deutete sie auf den Kaminsims, wo mehrere Briefe aufeinander lagen, "das alles sind Briefe von ihr, die wir ab und zu erhalten, und immer auf diese Art, wie von Ihnen!"
Wir fragten uns, was daran wohl so merkwürdig wäre und wollten gerade unsere Verwunderung darüber aussprechen, daß sie uns diese Einzelheiten berichtete, als sie uns eröffnete:
"Die Tochter der Condessa ist tot! Sie ist vor acht Jahren bei einem Autounfall in der Nähe von Sines ums Leben gekommen, genau an der Stelle, wo Sie diese junge Frau, diese Anhalterin, mitgenommen haben."
Wir erfuhren, daß im Kastell ein Hotelbetrieb war und da es spät in der Nacht war, beschlossen wir zu bleiben, gingen zurück zum Wagen und holten unser Gepäck.
"Warum seid ihr so lange fortgeblieben und warum seid ihr so blaß?", fragte Michelle mit ungnädiger Stimme. Edmund murmelte etwas Unverständliches, was wohl eine Erklärung sein sollte.
Ich habe nie Ahnungen, jedenfalls hatte ich bisher nie welche gehabt, doch als ich mein Gepäck aus dem Wagen nahm, überfiel mich ein unheimliches Gefühl, etwas legte sich auf mich, eine Beklemmung.
"Bitte, laß uns woanders ein Quartier suchen!", bat ich Edmund.
"Warum, du bist verrückt, hier ist es wunderbar, bequem, romantisch."
"Ich bin nicht verrückt, aber ich habe das Gefühl, ich könnte es hier werden."
"Es ist schon so spät," erwiderte Edmund, "wie willst du da ein besseres Hotel finden?"
Und Michelle maulte:
"Ich will ins Bett, ich fahre keinen Kilometer mehr ..." Schließlich gab ich nach.
3. Kapitel
Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, schienen die düsteren Erlebnisse der Nacht vergessen. Ich stand auf, öffnete eines der beiden Fenster meines Zimmers und das Fliegengitter davor. Es war herrliches klares Wetter. Unten, im hellen Innenhof des Kastells ruhten ein älteres Ehepaar und ein Mädchen auf Liegestühlen, offenbar Gäste des Hotels.
Das junge Mädchen hob neugierig den Kopf, als sie mich am Fenster erblickte. Ihre Lippen bewegten sich zu einem unhörbaren: "Bon jour!" mit dem sie mich begrüßte. Es trug einen Badeanzug, hatte schwarze lockige Haare, war vielleicht fünfzehn oder sechzehn Jahre alt, und hatte offenkundig Langeweile.
Auf der anderen Seite des Hofes lagen ebenfalls auf Liegestühlen zwei Frauen, von denen ich aber hier, von meinem Fenster aus, nur die Füße und die Beine bis zu den Oberschenkeln sehen konnte. Die eine der beiden drehte sich jetzt und ich sah einen schweren Rücken. Vielleicht waren es eine Mutter mit ihrer Tochter.
Das junge Mädchen drehte sich noch einmal hoch und wagte kurze Blicke voller Neugier. Doch der Wind schob jetzt die grüne Gaze des Fliegengitters an meinem Fenster vor die suchenden Augen von unten.
Ich duschte, rasierte mich, zog mich an und begann, meine Reisetasche auszupacken, in dem Moment kam Edmund in mein Zimmer.
"Komm!", sagte er, nachdem wir uns begrüßt hatten, "Komm, hilf mir, das Auto auszuräumen!"
Kaum war Edmund wach, hatte er schon eine Beschäftigung - für sich selbst, aber auch für mich. Im Auto waren nur noch wenige Dinge, aber es hätte Edmunds Freude an den Ferien sehr geschmälert, wenn sie im Wagen verblieben wären. Der mußte leer sein, frisch aufgetankt, Ölstand und Wasser nachgesehen, bereit stehen für neue Taten!
Das erste Mal ging Edmund allein und kam beladen mit Strickjacken, Karten und Mützen zurück. Das zweite Mal mußte ich mit.
"Es ist so heiß!", maulte ich. Ich hätte es vorgezogen, im Innenhof des Kastells auf einem der bequemen Liegestühle zu sitzen, zu dösen, in den Himmel zu starren und nichts zu tun.
"Heiß?", fragte Edmund in bester Laune, "Prächtiges Wetter!" Er ging zum Fenster, als hätte er dort ein Thermometer entdeckt.
"Wie sollte es nicht heiß sein? Es sind mindestens 33 Grad!" Er sah hoch zur Sonne, als könne er am Sonnenstand die geographische Position feststellen,
"Schließlich befinden wir uns auf 38 Grad nördlicher Breite und 11 Grad westlicher Länge!" Ziemlich lustlos trottete ich hinter Edmund her.
Es konnte eigentlich nichts mehr in dem Auto sein, als zerknülltes Papier, Taschentücher und Edmunds Feldstecher. Doch wir fanden noch die Thermoskanne mit Kaffee, schmutzige Tassen, und allerlei Kleinigkeiten, wie sie Frauen gern vergessen, Schals und Hüte, Michelles Klappkoffer für ihre feinen Kleider und meinen Schirm.
Edmund warf noch einen Blick auf seinen Wagen,
"Sollte ich ihn nicht waschen lassen? Er ist furchtbar schmutzig!" Edmund mußte als Repräsentant von Citroen natürlich immer die neuesten Modelle fahren, und es war so etwas, wie der Firma ein Schnippchen zu schlagen, wenn er in den Ferien seinen alten Wagen fuhr, diesen alten 'Gangster - Citroen', zudem war er sehr geräumig und bequem. Edmund hätschelte ihn, als ob es ein lebendiges Wesen wäre, ein treues edles Pferd. Michelle dagegen haßte das alte Auto.
Wir schleppten nun alles in das Kastell, und so beladen begegneten wir Michelle.
"Paß auf, daß du meine Kleider nicht wieder zerknitterst und zerdrückst!", rief sie Edmund zu. Der stand, beladen wie ein Packesel, und konnte sich nicht wehren. Michelle, Edmunds Frau, war klein, rundlich und rührte sich nie, - behauptete jedenfalls seine Mutter.
Endlich war wirklich alles ausgeräumt und nach oben getragen, und ich stand mit Edmund wieder unten im Innenhof, der jetzt leer war. Die Sonnenanbeter waren verschwunden.
Grünbewachsene Arkaden führten zum Fluß und zur See. An einer Ecke des Innenhofes war ein verglastes Teehäuschen. Die Bogenfenster waren alt, voller Spinnweben, Staub und Wasserflecke. Doch der Wind und der Lärm konnten nicht bis hier nach oben gelangen. Es war warm dort, aber es roch nach Rauch.
"Regarde! Deux femmes superbes!", sagte Edmund und deutete auf die Tür zum Flur. Durch die Scheiben sahen wir zwei große Frauen im Flur stehen.
Die größere und ältere der beiden telephonierte, die jüngere zeigte eine Königinnensilhouette; so hoch trug sie den Kopf. Die blonden Haare hinter den Ohren zusammengerafft, fielen sie schwer auf ihre Schultern, wie eine Woge. Das Kleid hielt die aufbrechenden Brüste, züchtig, am Zügel.
Das Telephonat war beendet und die beiden Frauen gingen fort, zum Ende des Flurs, wahrscheinlich in eines der anstoßenden Zimmer. Die jüngere mit besitzergreifenden Schritten, mit der wiegenden Spannung weiblicher Hüften. Ein Mädchen im Schmuck ihrer Haltung und ihrer Jugend, rasch und stolz.
Edmund verschwand im Treppenhaus. Ich sackte in einen Liegestuhl, mit völlig leerem Kopf. Die Müdigkeit überfiel mich verdoppelt. Das Ausräumen des Autos hatte mich erschöpft. Es war eine letzte kleine Aufgabe, eine letzte kleine, anstrengende Pflicht gewesen - vor dem ersehnten Nichtstun.
Bald kam Edmund zurück aus dem Flur, eine Zeitung unter dem Arm; er sah sich um, mit jenem Blick, den ich schon gut von ihm kannte. Er erfaßte das Kastell, den Innenhof, die Türme, maß sie mit drei, vier raschen, präzisen Blicken ab und murmelte:
"36 x 36 m, fast quadratischer Umriß, Türme ca. 14 m hoch, gerechnet von den Grundmauern, Bruchstein, die ältesten Teile sicherlich noch aus dem 11. oder 12. Jahrhundert." Das alles trug er in eine unsichtbare Tabelle ein, ließ sich dann ebenfalls in einen Liegestuhl fallen und las die Zeitung - wenn er sie nicht lesen konnte, würde er sich den ganzen Tag hilflos und ausgestoßen vorkommen, vielleicht würde er sogar taub und stumm werden.
Ich versuchte mich zu entspannen, doch etwas in mir ließ nicht los, und da fiel mir die vergangene Nacht wieder ein, die Anhalterin, und der Brief, den wir überbracht hatten. Ich ahnte, ich würde Tage brauchen, um das, was ich gesehen hatte, zu begreifen. So als ob da noch eine Aufgabe auf mich wartete, eine Last, etwas Anstrengendes, etwas Beunruhigendes.
Und dann kam es mir sogar vor, als ob dieses Etwas ganz in der Nähe auf mich lauerte. Ich war irritiert von etwas, was ich nicht fassen konnte, sah unwillkürlich suchend umher. - Nichts!
Doch plötzlich fesselte etwas meine Auf-merksamkeit. Oben, auf einem Wehrgang, auf der Dachterrasse, hinter einer der Zinnen, halb verdeckt durch Efeu und Winden, glaubte ich eine schlanke Frau stehen zu sehen.
Ich sprang auf, so heftig, daß Edmund zusammenzuckte.
"Was ist passiert?", fragte er erschrocken, "Was hat dich denn ...?"
"Ich dachte, ich hätte dort jemanden gesehen, - den ich kenne."
"Du kennst viele Frauen, nicht wahr?", er lachte. Aber mir war nicht nach Lachen zumute.
Mit raschen Schritten überquerte ich den Hof, suchte die Treppe zum Turm, fand die Tür im Efeu versteckt; sie war offen. Atemlos hastete ich die enge Wendeltreppe hinauf und unvermutet stand ich auf halber Treppe von Angesicht zu Angesicht dem jungen Mädchen gegenüber, das ich am Morgen von meinem Fenster aus im Innenhof auf dem Liegestuhl liegend gesehen hatte.
Sie wollte grußlos an mir vorbei, aber die Treppe war so eng, daß ich stehenbleiben mußte, um sie vorbeizulassen. Sie schien unwillig, aufgehalten zu werden.
Sie war sehr schlank, hatte schwarze Haare, einen Teint, der etwas heller war, als hier in der Gegend üblich, und gefüllte Lippen. Sie erschien mir jetzt noch jünger zu sein, als ich anfangs gedacht hatte, höchstens vierzehn Jahre alt.
Das Mädchen starrte mich an - mit großen Augen und mit einem traurigen, im Unendlichen verlorener Blick. Es kam mir seltsamerweise so vor, als blicke sie durch mich hindurch, - oder genauer, als blicke etwas anderes durch sie hindurch. Dann senkte sie kurz die Augen.
Als sie wieder aufsah, war ihr Gesicht verändert, spöttisch und fragend, ob ich ihrem Blick wohl standhalten würde. Schließlich bedachte sie mich mit einem Augenblitzen, so strafend und herrisch, daß ich erschrocken den Weg freigab.
"Wie heißt du?", fragte sie, als sie fast an mir vorüber war.
"Manfred!"
"Manfred!", wiederholte sie langsam, als fürchtete sie, meinen Namen zu vergessen, "Ich heiße Anna!"
"Anna! Sehr hübsch!" erwiderte ich.
"Wo kommst du her?" fragte sie.
"Vom Land!"
"Und du?" fragte ich.
"Vom Meer!" Sie lachte und beim Lachen konnte ich ihr in den geöffneten Mund sehen, der so rot war, als hätte sie gerade Himbeeren gegessen.
Als ich dieses Lachen hörte, diese tiefe Sorglosigkeit, vielleicht sogar eine Kälte, bekam ich Angst. Es war, als hätte jemand ein feines kaltes Messer in meine Brust gesenkt. Es war wohl das erste Mal in meinem Leben, daß ich vor einem Mädchen Angst hatte.
Ich ging die restlichen Stufen der Treppe hoch. Oben auf der Plattform war niemand.
4. Kapitel
Am späten Vormittag machte ich mit Edmund einen Spaziergang zum Dorf, dann hinaus über die Felder, um die Umgebung ein wenig kennenzulernen. Die Straße wurde bald brüchig, ein einsames Gehöft tauchte auf, es schien völlig menschenleer zu sein, nur ein einzelner Hahn pickte auf dem Weg, er suchte wohl Käfer im ockerfarbenen Staub, zwischen Mauern, die aussahen, wie aus den Wunden der Erde gerissen. Es war still hier, sehr still. Die Stille stritt mit der Einsamkeit.
Wir verließen die Straße und gingen durch brusthohe vertrocknete Felder, gelbe Blumen wuchsen zwischen dem Getreide, liefen auf trockenen Wegen, aus denen die kleinen wilden Gladiolen sprossten. Dann durch Mandelbaum-plantagen. Viele der Bäume waren tot; nackt und schwarz standen sie in Reih und Glied auf nackter roter Erde. Wieder Gehöfte wie Burgen, wieder endlose Wege zwischen Steinmauern.
Die Hitze stand wie ein flimmerndes Fieber über der Landschaft. Ab und zu wurden wir umschwirrt von einer riesigen roten oder blauen Libelle, oder von den grünschillernden Käfern des Glücks. Hoch oben über uns kreisten zwei Adler.
In einem Zitronenhain, der gesäumt war von Zypressen, legten wir uns auf eine Wiese, in den Schatten, um ein wenig auszuruhen. Ich fürchtete in dieser Gluthitze einzuschlafen, weil ich Angst hatte, in einem anderen Körper aufzuwachen, so sehr hatte mir die Hitze zugesetzt. Um mich wachzuhalten, begann ich ein Gespräch mit Edmund. Das war wirklich schön an diesen Ferien, die Aussicht, daß ich mich fast zu jeder Zeit mit Edmund unterhalten konnte.
"Kann man sich in eine Seele verlieben?", fragte ich, ohne recht zu wissen, wieso ich auf diesen Gedanken gekommen war, "In die Seele einer Frau?"
Edmund antwortete erst nicht, er war anscheinend kurz eingenickt. Er gähnte und es dauerte eine geraume Zeit, bis er zu sich kam,
"Vielleicht ist die Frage falsch gestellt," sagte er, "vielleicht hättest du fragen sollen: 'Kann man sich in eine Frau ohne Seele verlieben!'"
"Und wie ist die Antwort?"
"Zweifellos ja! Das passiert sogar sehr häufig!"
Ich erschrak vor der Bitterkeit in seiner Stimme, und spürte eine Welle von Mitgefühl, vielleicht auch von Mitleid für Edmund. Wie leer und traurig mußte sein Leben mit Michelle sein, daß er soetwas sagen konnte! Edmund lächelte schmerzlich, als hätte er meine Gedanken erraten, und sagte:
"Ich denke, die Männer sind nicht geschaffen, nur eine Frau zu lieben. - Ich würde gern frei sein! Irgendwo sein, wo ich niemandem Rechenschaft schuldig bin!"
"Frei?", fragte ich, "Wirklich frei sind wir nur wenige Minuten, dann melden sich schon wieder irgendwelche Bedürfnisse, Zwänge, andere Menschen mit ihren Anforderungen."
"So will man immer das haben, was man nicht hat!" erwiderte Edmund.
Ich nickte, stand auf und begann ein paar wilde Blumen abzupflücken. Edmund sah mir dabei zu.
"Für wen sind sie?" fragte er.
"Ich weiß es nicht. Komm, pflück du auch welche!"
"Für wen?"
"Für Michelle!" sagte ich. Er zögerte, dann sagte er:
"Meinst du?"
"Versuch's!" Schließlich pflückten wir jeder einen Strauß Feldblumen und waren sehr vergnügt bei diesem unschuldigen Tun.
Als wir endlich wieder im Kastell eintrafen, herrschte die größte Mittagshitze. Michelle war in das Dorf gegangen, hörten wir, sich eine Illustrierte zu kaufen.
Edmund sah sie durch die Glastür aus dem kleinen Flur kommen und ging mit dem Strauß auf sie zu. Ich sah sofort, Michelle freute sich nicht über die Blumen. Sie schaute den Strauß an mit einem Blick, der vermutlich bedeutete: 'Was soll ich mit wilden Blumen, die überall umsonst wachsen?' Sie wollte die Blumen nicht einmal annehmen. Edmund war darüber so überrascht und verlegen, daß er nicht wußte, was tun, bis ich eingriff.
"Gib her!", sagte ich und nahm ihm den Strauß, den er ratlos in den Händen hin und her drehte, ab.
Da sah ich, daß das junge Mädchen, Anna, wieder in ihrem Liegestuhl lag. Sie war bleich, zusammengekrümmt und ganz in sich selbst versunken. Anna blickte auch nicht hoch, als sie uns hörte. Sie sah so traurig und verloren aus, daß ich mir vornahm, sie hinterher anzusprechen und irgendwie zu versuchen, sie zu trösten.
"Was hat die Kleine?", fragte Michelle leise. In einer plötzlichen Regung ging ich zu der kleinen Anna und gab ihr die Blumen, die sie zögernd und von Rot übergossen entgegennahm. Mir schien dabei, als ob sie jede Falte meines Lächeln suchte.
Sie stand sogar auf, machte einen kindlichen Knicks, danach einen übertriebenen Theater-knicks, hatte sich aber schnell wieder in der Gewalt. Dann lachte sie auf, wie über einen kleinen Scherz. - Was war mit diesem halben Kind?
5. Kapitel
Nun waren wir also in diesem Kastell von Milfontes. Es gehörte einer alten Condessa. Edmund hatte schon allerhand Fabelhaftes von der alten Dame gehört, sodaß meine Neugierde recht gespannt war, sie kennenzulernen. Und dann sollte es noch eine hübsche Nichte oder Tochter geben, von der man sich allerhand Seltsames erzählte, die recht eigenwillig sein sollte und fast so selten zu sehen wie ihre Tante oder Mutter. Doch ich war sehr enttäuscht, daß sich die alte Dame während des ganzen Aufenthaltes im Kastell nicht einmal zeigte. Aber bald sollte eine andere Person meine Aufmerksamkeit mehr als beanspruchen.
Das Personal des Hotels war ein wohltemperiertes Quintett: der dezente Diener, das adrette Stubenmädchen, die resolute Hausdame, die rundliche Köchin, und die einfache Frau zum Abwaschen.
Edmund und Michelle hatten das Zimmer Nummer drei bekommen, ich Nummer vier, 'Heather room'. Gegenüber auf der anderen Seite des Flurs lagen die Bäder: alt und schrecklich, aber sauber. Mein Zimmer hatte zwei Betten mit grüngeblümten Decken. Pfosten, Stühle, Schrank-Ecken, Griffe; - alles aus naturverkrümmtem Kastanien-Astholz.
Das Kastell steht an der Mündung des Flusses Mira in den Atlantik. Vor der Wut des Ozeans und dem ewigen Westwind wird es geschützt durch die Felsen und Dünen weit draußen. Es war zum Schutze der kleinen Stadt gegen arabische Piraten erbaut worden. Eine geschwungene Straße führt zum Strand hinab, der streckenweise steinig ist. Im Norden der Bucht liegen Dünen, dann eine Steilküste. Im Südosten streckt sich das Dorf aus, - oder die kleine Stadt: - Vila nova de Milfontes.
Edmund und ich wollten am Nachmittag endlich schwimmen gehen. Michelle war noch müde von der langen Autofahrt, und wollte lieber etwas schlafen.
"Michelle ist keine Frau, sondern ein Murmeltier." war Edmunds betrübter und resignierter Kommentar.
Es war nur der Himmel über uns und Luft und Licht - und in der Ferne schlief blau das Meer. Wir wanderten ein wenig am Strand entlang, neben den Dünen, bis zum Beginn der Steilküste, oder eines Kliffs; ihm gegenüber ragte fahl und grau und schemenhaft, fast körperlos der Felskegel der Möweninsel auf, wie eine zweite unwirkliche Festung. Überall lag das moderne Strandgut, abgeschabte Plastikflaschen, Beutel, Kanister, von der rauhen Zunge des gierigen Meeres beleckt. Es war unwirtlich hier, der Wind war kalt, das Wasser eisig.
Auf dem Rückweg sanken unsere Füße tief im Schwemmsand ein, in einem Sand, der wie Sumpf war. Dann wurde der Sand wieder fester und wir kamen an einem kleinen hübschen Strandrestaurant vorbei, einem Holzpavillon in Weiß und Blau.
"Schade, daß wir dort nicht zu Abend essen werden!" sagte Edmund bedauernd, denn wir hatten Vollpension bestellt. Bald danach überquerten wir die Straße und warfen einen Blick in die kleine Welt am Hafen, dann gingen wir noch in den Ort - oder in das Dorf. Niedrige, meist nur zweistöckige Häuser mit Ziegeln gedeckt oder flach. Die Gärten mit Mauern oder Hecken aus Bambusschilf eingefaßt. Dazwischen standen einige ältere, vornehmere Häuser mit schönen Balkonen. Und alles wurde überragt von der Kuppel der Kirche Nossa Senhora de Piedade.
Ein Menschentypus tauchte vor meinem geistigem Auge auf, fraglich, verschlossen, mit dem Tod auf vertrautem Fuß. Die Frauen glatt gescheitelt, die lockigen Haare straff zusammengebunden, - so wie Michelle manchmal ihre Haare trug. Die Männer mit zwei unbezähmbaren Stirnlocken und grauen Augen, von der Art des silbernen Mondlichts über den Klippen. Der Sohn im steten Kampf mit dem Vater.