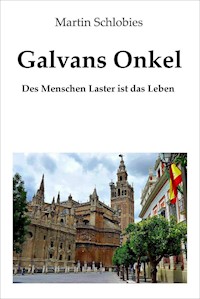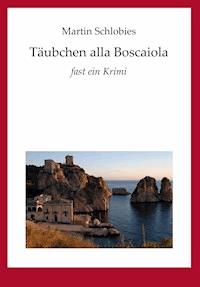
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Castellina, im Westen Siziliens. Eine wunderbare Landschaft mit gefährlichen Klippen und Abgründen - und schlummernden Leidenschaften. Für Pauline die ideale Szenerie zum Malen. Enthält die Bleierzgrube in Castellina womöglich Silber? Das soll der Bergbauingenieur Raphael herausfinden. Doch als der Grubenbesitzer Signor Botello nach der Hochzeit seines Sohnes plötzlich verschwinden ist, gerät der kleine Ort in Aufruhr ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Schlobies
Täubchen alla Boscaiola
Was will Raphael - das Silber oder Pauline?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
Impressum neobooks
1. Kapitel
Der Pastor von Castellina al Monte Largo war erstaunt, als er am Sonntag in der Sechsuhrmesse von der Sakristei aus die Kirche betrat, und den alten Signor Botello in der vordersten Bank sitzen sah, etwas, was über Jahre hinweg nicht geschehen war.
Signor Botello saß allein in der Bank, auch sonst war die Kirche halb leer, nur einige Frauen waren zur Messe erschienen, und ein paar halbwüchsige Mädchen, alle schwarz gekleidet, mit schwarzen Tüchern über den Köpfen. So gebeugt dasitzend wirkten sie wie ein in die Kirche eingefallener Schwarm Krähen.
Der Pfarrer schüttelte über das Erscheinen von Signor Botello unwillkürlich den Kopf, drängte dann den Gedanken an ihn beiseite, - schließlich war er Überraschungen gewohnt - und begann mit der Messe.
Obwohl Signor Botello in der vordersten Bank saß, blickte er den Pfarrer während der ganzen Messe kein einziges Mal an. Er saß aufrecht, sein zerfurchtes Gesicht blieb unbeweglich und starr, auch während er der Predigt lauschte, - oder wenigstens so tat, als ob er lauschte. Die Lider hielt er dabei halb gesenkt, und wenn er sie, wie überrascht, einmal aufschlug, ließen seine graue Augen keine Bewegung erkennen, nur seine buschigen Augenbrauen zuckten gelegentlich. Doch der scharfe Blick des Pfarrers hatten Tränen in seinen Augen entdeckt und der Pfarrer wußte nun, daß er den Alten bald wiedertreffen würde.
Signor Botello blieb die Messe hindurch so aufrecht sitzen, neigte nur knapp seinen Kopf beim Vaterunser, begann jetzt, statt die Hände zum Gebet zu falten, leicht über seine müden, schmerzenden Knie zu streichen und kam sich unendlich allein vor.
Nach dem Segen erhoben sich die Frauen und Mädchen murmelnd und tuschelnd von ihren Sitzplätzen, verließen die Bänke, blieben kurz an dem kleinen steinernen Becken neben der letzten Säule der Kirche stehen, benetzten ihre Fingerspitzen mit Weihwasser, bekreuzigten sich und verließen dann die Kirche; - und der alte Mann saß immer noch da.
Er stand als letzter auf, bewegte sich langsam, steif und wie verschlafen, durch den Mittelgang dem Kirchenportal zu, doch nicht so sehr die Worte des Pfarrers, - denn er hatte überhaupt nicht zugehört, und hätte kein einziges Wort der Predigt wiederholen können, - sondern die Tatsache allein, daß er in der Kirche gewesen war, versetzten ihn mit einem Male um Jahre zurück.
Am Weihwasserbecken bekreuzigte er sich, etwas beklommen, als unterdrücke er ein Lächeln, und ließ mechanisch eine Münze in den Opferstock fallen.
Auf der Straße blickte er hoch und sah, daß noch ein Streifen Sonne auf dem Turm der Kirche lag. Es erklang das Läuten der Glocke. All das rief ihm einen fernen Herbsttag ins Gedächtnis, vor vierzehn oder fünfzehn Jahren, den Tag, an dem er seine zweite Frau heimgeführt hatte.
Und als er sich in der einsamen kurzen Allee, die zu seiner Erzgrube außerhalb des Dorfes führte, dabei ertappte, wie er seinen Hut den Bäumen hinhielt und Blätter hineinfielen, begriff er, daß er alt geworden war. Ein Gedanke, der ihn veranlaßte, seinen Schritt zu beschleunigen.
Der Pfarrer und Signor Botello waren früher Jagdkumpane gewesen, und so geschah es nicht unerwartet, daß der Alte am Abend des gleichen Tages über den Vorplatz des winzigen Klosters ging, etwas außerhalb des Ortes, in dem der Pfarrer jetzt fast allein wohnte.
Von fern schon sah er den Pfarrer an das eiserne Gitter gelehnt, das den Platz einfaßte. Der Pfarrer winkte ihm näherzukommen, löste sich vom Gitter und machte einen Schritt auf ihn zu. Signor Botello hatte Lust zu ihm zu gehen, und gleichzeitig wollte er diesem Wink des Pfarrers nicht einfach folgen, und so ging er weiter den Platz entlang.
„Nanu, warum läufst du weg?“ rief der Pfarrer, um ihm zu verstehen zu geben, daß er gern mit ihm geplaudert hätte, „Komm näher!“ Signor Botello sah den Pfarrer an, wie man das Gesicht eines Schlafenden entziffert.
„Hast du gesehen, daß ich heute in der Kirche war?", sagte Signor Botello. Der Pfarrer lächelte. Signor Botello stellte sich neben ihn ans Gitter. 'Er wird mir vom Himmel erzählen,' dachte er. Doch der Pfarrer schwieg.
'Ich werde ihm sagen,' nahm sich Signor Botello vor, 'daß ich niemals an den Himmel gedacht hatte und doch leben konnte. Daß ich etwas anderes suche, - oder daß ich vielmehr gar nichts mehr suche. Daß ich auch nichts mehr erwarte.' Der Pfarrer schwieg.
„Seit ich häufiger dort draußen bin, bei der Grube,“ begann Signor Botello jetzt, und ärgerte sich über jedes seiner eigenen Worte, „sehe ich öfter den Himmel an. Früher vergaß ich, daß er existierte, aber jetzt - stell dir vor - glaube ich warten und weiterleben zu können, nur weil es den Himmel gibt.“
„Worauf wartest du denn?“
„Ich weiß es nicht. Auf irgendetwas. Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß nach Ablauf der Nacht wirklich immer nur Müll auf den Straßen liegen sollte . . . “
„Es kommt vor, daß jemand viel Geld hat und trotzdem welches auf der Straße findet.“
„Das meine ich nicht!“
„Mir gefällt es jedenfalls, daß du zu Warten gelernt hast.“ Der Pfarrer lächelte wieder.
Signor Botello sah ihn voller Mißtrauen an, rückte ein wenig von dem Pfarrer ab, um ihn besser beobachten zu können. Er hätte sich noch weiter entfernt, wenn ihn der Pfarrer nicht, immer noch lächelnd, mit einem Vorschlag festgehalten hätte,
„Wir sollten wieder einmal Angeln gehen!“
„Wir?“
„Ja, du und ich!“, erwiderte der Pfarrer.
„Ich? - und du? - Ja! - Ist gut!“ sagte Signor Botello trocken und verwirrt; er ging fort, ohne Guten Abend zu sagen; ging jetzt die schmale Straße außerhalb des Dorfes entlang, zur Bleigrube.
An einer seit Jahren vernachlässigten Baustelle blieb er stehen, schüttelte den Kopf, und murmelte seine Kritik, „Das hätte die Gemeinde nun wirklich längst in Ordnung bringen können! Ein Skandal, wie man für so eine kleine Straßenreparatur Jahre brauchen muß . . . “
Schnell nahm er seinen Weg wieder auf, aber sein Gesicht hatte jetzt einen verbissenen, bösen Ausdruck. Nur seine einsamen, sich ständig wiederholenden Gedankengänge begleiteten ihn.
Endlich war er bei der Erz-Grube angelangt, wo sein Hund schon an der langen, straff gespannter Kette stand, still, doch mit heraushängender Zunge. Signor Botello band ihn los.
Der Hund strich ihm um die Beine, bittend, doch Signor Botello war heute unwillig, das leise Fiepen und Hecheln und Winseln zu hören, sodaß er immer wieder besänftigend: „Schön ruhig!“, sagte.
Inzwischen war es dunkel geworden. Das silberne Licht, das aussah wie vom Himmel herabgefallen, war längst einem undurchdringlichen Grau gewichen und jeder Wind hatte aufgehört. Signor Botello schloß das Haus neben der Erzgrube auf und holte sich eine Flasche Wein und ein Glas. Damit setzte er sich an die Wand des Hauses, den Blick auf den unter ihm liegenden Hang neben der Grube gerichtet. Der Mond ging gerade auf, sodaß der rauhe Hang, die Kuppen der Berge und das ferne, tief unten liegenden Meer, nach und nach in gespensterhafter keuscher Klarheit emportauchten.
Nun machte Signor Botello sich ruhig an sein Abendbrot heran, das er auswickelte, auf dem Papier ausbreitete, und mit dem Hund teilte, der seinen Teil gierig verschlang und dann seinen Kopf auf die Schuhe Signor Botellos legte. Sorgfältig faltete Signor Botello das Papier wieder zusammen und steckte es in die Tasche.
An einem anderen Abend wäre er selbst bald zur Ruhe gegangen, wäre selbst gern eingeschlafen, aber heute offenbarte sich ihm das Verrinnen der Zeit so schonungslos wie nie zuvor, und er war sogar - für einen kurzen Moment - bereit, an die Ewigkeit zu glauben.
In den letzten Jahren war er oft hier, in der Nähe der Erz-Grube, allein mit seinem Hund, lieber als in seinem Zuhause, wo er sich immer mehr als Fremder fühlte. Doch heute fühlte er das unerbittliche Schweigen der Natur um ihn herum, fühlte, wie sehr er selbst allein mit diesem Hund war, der leise zu seinen Füßen schnaufte, - all das, was ihm sonst so wohltuend gewohnt war, erschien ihm heute so verloren und machte es ihm unmöglich, Ruhe zu finden. Es genügte ihm plötzlich nicht mehr, den schmeichelnden Hals und Kopf des großen Tieres an seinen Beinen zu spüren.
Er atmete tief ein, wie um die Gedanken zu verscheuchen, die ihn so oft gequält hatten. Und wie schon vor der Kirche, in der Nähe des Klosters, wurde alles blitzartig in ihm lebendig, seine frühere Jagd nach dem Glück, die Demütigungen, die Enttäuschungen, und vor allem - seine Eifersucht, seine unsinnige, heftige Eifersucht!
Schließlich wurde er doch ein wenig müde, beugte sich liebevoll über seinen Hund, der aufgeschreckt seinen Kopf hob und ihn fragend ansah. „Nun, kannst du so einschlafen oder muß ich dir eine Gutenacht-Geschichte erzählen?“
2. Kapitel
Antonio, der Hauswart der Pension in den Bergen, hatte Pauline angeboten, sie in seinem Wagen mit nach unten zu nehmen, in die Stadt, nach Cefalú, wo er sie an einem kleinen Platz absetzen sollte, oberhalb einer Kehre der Landstraße, einer Stelle, die sie sich am Tag zuvor ausgesucht hatte, um dort zu malen. Inzwischen waren sie dort angelangt.
„Halten Sie jetzt bitte!“, rief sie, „Hier ist es!“
„Unmöglich! - Impossibile! Signora!“, rief Antonio, „Ich kann hier nicht anhalten!“ Er fuhr um die Kehre herum, fuhr weiter und weiter, bremste endlich und setzte sie viel zu weit unten ab; - obwohl es weiter oben auch gegangen wäre, sie hatte es doch gesehen, dort in der Einfahrt! - sodaß sie die schwere Staffelei und ihre Tasche mit dem Wasser, dem Papier und den Farben ein ganzes Stück die Straße wieder zurück und die Treppe hoch zu der kleinen Plattform schleppen mußte.
Keuchend und ganz außer Atem langte sie oben an, konnte ihre Sachen neben dem Geländer abstellen, und warf einen ersten prüfenden Blick auf das Meer, auf Cefalú, den mächtigen Normannenfelsen, der die Stadt dominierte. - Raphael hatte es ihr erklärt, daß es ein Basaltkegel vulkanischen Ursprungs sei, - er als Bergbau-Ingenieur kannte sich in Geologie natürlich aus. - mit Tempelresten oben, - wo gab es hier in Sizilien nicht oben auf den Bergen Reste von griechischen Tempeln? -
Raphael!
Gestern noch war ihr die Aussicht hier so wunderbar vorgekommen! - Doch jetzt fiel ihr der entsetzliche Lärm auf, das Rauschen des ständig vorbeifließenden Verkehrs, die Lastwagen, die Motorräder, das Bremsen, das Hupen, die aufheulenden Motoren; dazu stieg quälend der Gestank von Dieselqualm zu ihr hoch und beleidigte ihre Nase.
Nun hatte sie alles ausgepackt, ihre Staffelei aufgestellt, und stand, das Gesicht unter dem Strohhut geschützt, und begann zu zeichnen, - doch die Striche wollten sich nicht fügen, sie war unaufmerksam, nervös, und wieder überfielen sie die Gedanken an den Mann, den sie gestern kennengelernt hatte. - Raphael.
Diese Idee, nach Sizilien zu fahren und hier allein in der Landschaft zu stehen und zu malen, - und was denn überhaupt? - erschien ihr auf einmal absurd. Der Ort, an dem sie stand, der Ausblick auf die Stadt und das Meer erschien ihr häßlich, ohne jeden Reiz, und sie begann ihn zu verabscheuen.
Plötzlich hatte sie den Wunsch, all ihre Malsachen einzupacken oder sie über die Brüstung des kleinen Platzes zu werfen, - und sie hätte es getan, wenn sie dadurch diesen Mann, den sie gestern getroffen hatte, sich hätte hierher zaubern können.
Würde sie ihn denn jemals wiedersehen?
Wie groß war Sizilien!
Sie hatte nichts zu ihm gesagt, weil sie gewartet hatte, daß er etwas sagen würde, und er hatte nichts zu ihr gesagt, - ja warum? Vielleicht hatte sie sich ihm gegenüber zu abweisend gezeigt?
So waren sie auseinandergegangen, ohne eine Verabredung zu treffen.
Warum?
Immer wieder lief die gleiche Gedankenfolge in ihr ab und wiederholte sich bis zur Sinnlosigkeit.
Pauline versuchte sich zusammenzureißen, als sie sich bei diesen sinnlosen Gedankenwiederholungen ertappte, und schalt sich innerlich selbst für ihr Trägheit und Mutlosigkeit. Sie wußte es doch: hatte sie diese erst überwunden, würde sie arbeiten können, - und was dann folgte, war die Freude, - die Freude am Schauen, am Schöpferischen. 'Und wer von der Freude erfüllt ist', dachte sie, 'ist auf dem richtigen Weg.' Deshalb war die Überwindung der Trägheit der Weg zur Kunst!
'Malen - das ist mönchisches Tun!' - sie liebte diesen Satz, obwohl sie ihn noch mehr geschätzt hätte, wenn ihr das entsprechende Adjektiv zu 'Nonne' eingefallen wäre.
Während ihre Gedanken sie so narrten, zeichnete sie beharrlich weiter, doch lange blieb alles formlos, was sie auf das Papier brachte, plump, ungestalt, - wieder riß sie einen Bogen ab.
Doch sie wußte, sie mußte sich zwingen, - war es doch schon schwierig genug, sich gegen den Verkehrslärm zur Wehr zu setzen, - und durch Geduld und Ausdauer überwand sie auch wirklich ihre innere Ablenkung, und konnte sich konzentrieren, - endlich auch hatte sie sich in die Ansicht vor ihren Augen eingesehen und eingelebt, und so belebte sich auch ihre Zeichnung.
Ganz in ihre Arbeit versunken hörte sie mit einem Male eine Kinderstimme auf italienisch sagen:
„Was machst du?“ Es lag etwas Gelangweiltes, Nörgelndes, Bösartiges in dieser Stimme, was sie sofort ärgerte.
„Zeichnen! Das siehst du doch!“, entgegnete sie heftig, ohne aufzublicken.
„Und was zeichnest du?“
„Die Stadt, - schau, da unten liegt sie!“, in dem Augenwinkeln nahm sie einen kleinen Jungen wahr, der seinen Roller auf den Boden abgelegt hatte und mit gespieltem Interesse und übertriebenen Bewegungen seines Kopfes ihre Handbewegungen über das Papier auf der Staffelei verfolgte, etwas, was sie verabscheute.
„Du, ich arbeite, verstehst du, ich wäre gern ungestört, sola, allein!“
„Ich sehe keine Stadt,“, nörgelte der Junge, „Das ist doch nur Krikelkrakel!“
An diesem Morgen schien alles daraus aus zu sein, sie zu ärgern! Empört drehte sie sich um, sah sich zum ersten Mal den Jungen richtig an, er war so alt wie ihrer, doch es ärgerte sie, daß er so wenig Kindliches an sich hatte, und schon das spätere Männergesicht in seinen groben altklugen Zügen vorgezeichnet war.
„Schenkst du mir ein Bild?“, bat der Kleine.
„Nein! Warum denn?“, erwiderte sie schroff, „Hast du keine Eltern? Wo wohnst du?“
„Dort!“, er zeigte auf ein Haus, das auf der anderen Seite des kleinen Platzes stand.
„Ich möchte arbeiten, kannst du nicht woanders weiterspielen?“
„Nein! - Und ich störe dich solange, bis du mir ein Bild schenkst!“ Der Kleine war wirklich hartnäckig. Wenn er weniger unverschämt gewesen wäre, hätte sie ihm eines gegeben, doch so? Nein!
"Fahre bitte weiter mit deinem Roller!“
„No!“ Der Junge blieb neben ihr stehen, begann, an ihrem Block, der auf der Erde lag, herumzufingern.
„Laß das!“
„No!“
„Ich sage dir: Laß das! - Te dico: lascialo!“, sagte sie gereizt. - Wenn sie beim Malen gestört wurde, packte sie etwas, was nicht weit von Mordlust entfernt war. Der Junge schielte sie boshaft von unten an.
„No!“
„Du kleiner häßlicher Teufel,“, rief sie jetzt auf deutsch, „ich bringe dich um, wenn du mich nicht sofort in Ruhe läßt!“
Der Junge glotzte blöde, griff aber weiter nach ihrem Block. Schließlich schlug sie ihm voller Wut auf die Finger. Der Junge sah sie an, fassungslos, ohne zunächst zu begreifen, was geschehen war, krümmte sich zusammen, sodaß er noch jämmerlicher anzusehen war, und fing an zu weinen. - Sie hatte ihm also wehgetan! - Und sein klägliches Greinen erfüllte sie mit Befriedigung.
Endlich raffte der kleine Kerl sich auf und rannte ohne seinen Roller laut plärrend über den Platz, - und da kam auch schon ein Mädchen, offenbar seine ältere Schwester, aus dem Haus geeilt und fing ihn auf.
Schluchzend preßte er seinen Kopf an ihre Schulter und redete heftig auf sie ein. Das Mädchen zog aus der Tasche ihres Rocks ein kleines Taschentuch, putzte dem Jungen die Nase und wischte ihm die Tränen ab. Schließlich nahm sie ihn an der Hand und kam mit ihm zu Pauline.
Sie hatte die gleichen großen, häßlichen Züge wie der Bruder, doch ihre dunklen Augen leuchteten sanft und still. Sonst hätte Pauline Mitleid mit einem so unglücklichen Geschöpf gehabt, heute brachte es sie auf. An diesem Morgen hatte sie tief innen eine solche Wut, eine solche erbitterte Gereiztheit im Leibe, daß ihr jeder Vorwand recht gewesen wäre, mit irgend jemand Händel anzufangen.
Das Mädchen blickte bewundernd auf die angefangene Zeichnung auf der Staffelei, „Oh, welch schöne Zeichnung! - Que bello disegno!“, flüsterte sie andächtig, was Pauline etwas versöhnte.
Sie schämte sich jetzt. Um die beiden loszuwerden, schenkte sie dem Jungen eine Zeichnung, die er ohne Dank an sich preßte und auf diese Weise sogleich zerknitterte. Er wollte nun noch bleiben, zuschauen, 'guardare un po', doch die Schwester hob seinen Roller auf und zog den kleinen verheulten und verrotzten Quälgeist mit sich fort.
Pauline versuchte, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, doch nichts wollte gelingen. Statt auf die schöne Ansicht von Cefalú schielte sie immer wieder auf die Straße, die sich unter ihrer Plattform nach oben in die Berge und nach unten zur Stadt hinab wand.
Und plötzlich, - tatsächlich! - sah sie jetzt einen offenen gelben Wagen die Straße von den Bergen herabkommen.
Ja, es war derselbe Wagen, dieser offene alte Sportwagen, und auch das Nummernschild war englisch!
Er mußte es sein!
Raphael!
Ihr stockte der Atem.
Ihr Herz begann heftig gegen ihre Brustwand zu pochen, und sie winkte, ohne zu überlegen mit ihrem Hut.
Der Wagen fuhr weiter, - er hatte sie nicht gesehen!
Eine abgrundtiefe Enttäuschung machte sich in ihr Raum. Unwillkürlich schossen ihr die Tränen in die Augen.
Der Wagen war jetzt hinter der Kehre unterhalb ihrer Plattform verschwunden, tauchte dann kurz wieder auf.
Da!
Er wurde anscheinend abgebremst, - blieb wirklich stehen.
Er hatte sie also doch gesehen!
Gottlob!
Schnell wischte sie ihre Tränen ab.
Der Fahrer, - ihr Raphael! - fuhr waghalsig und zu schnell mit heulendem Getriebe rückwärts, stellte den Wagen in eine Einfahrt, und kam zu ihr die Treppe hoch gelaufen. „Ich habe Sie gerade noch im Rückspiegel gesehen!“, sagte er, noch ganz außer Atem.
Ihr Herz schlug jetzt, als ob es aus dem Mund heraus wollte. Sie mußte sich sehr zusammennehmen, um diesem Mann nicht um den Hals zu fallen. Stattdessen setzte sie eine möglichst unbeteiligte Miene auf und tat so, als ob sie immer noch von der Landschaft, diesem fabelhaften Ausblick auf Cefalú fasziniert wäre. „Sieht man sich wieder?“, sagte sie mit unterkühlter Stimme und zeichnete weiter.
Er achtete nicht auf ihre Worte, sondern trat an die Staffelei, und warf einen Blick auf das angefangene Bild. Ihr kam es vor, als verzöge er das Gesicht, und schürzte die Lippen. „Machen Sie das professionell?“, fragte er ganz sachlich. Doch diese Frage und das Gesicht, das er dabei machte, kränkten sie. Kam sie sich doch schon als Künstlerin vor! Sie war so gespannt und verärgert, daß sie ihm die Staffelei samt dem Karton darauf über den Kopf zu schlagen vermocht hätte.
„Ich bin bald fertig . . . “, ließ sie sich schließlich herab zu murmeln, und war unendlich dankbar, daß ihre Stimme nicht zitterte, wie jetzt ihre Hand.„Ich warte gern ein wenig . . . “, erwiderte er ruhig und setzte sich auf die schmiedeeiserne Balustrade und schaute interessiert in die Landschaft hinaus.
Er wäre wieder in den Bergen gewesen, sagte er, als sie endlich begann, ihre Sachen zusammenzupacken.
„Was treiben Sie denn eigentlich dort?“, fragte sie.
„Ich suche etwas!“
„Was?“Er lächelte fein,
„Gemsen!“
„Haben Sie Gemsen gesagt?“
„Ja! - Nein, ich suche etwas anderes, aber das möchte ich nicht sagen! - Noch nicht, wir kennen uns noch nicht genug!“
Das war nun kein großer Vertrauensbeweis, doch Pauline nahm sein Angebot, sie einmal beim Suchen mitzunehmen, an. Gern nahm sie es auch an, als er ihr anbot, sie hoch zum Hof zu bringen, wo sie wohnte.
„In meinem letzten Gasthof war es schrecklich . . . “ , erzählte er während der Fahrt. Keine weitere Nacht würde er dort verbringen wollen. Laute Musik und Gesang bis in die tiefe Nacht hinein, eine ständige Unruhe im ganzen Haus. Er hatte all seine Sachen schon wieder hinten im Auto. Und er hatte für die Übernachtung doppelt soviel bezahlten müssen, als üblich. Pauline mußte über ihn lachen, ihn, der einen so gescheiten und weltgewandten Eindruck machte.
Raphael zog dann zu ihr auf diesen Bauern-Hof, ins Haupthaus, in dem auch sie wohnte. Wohnzimmer, Küche, Flur benutzten sie beide gemeinsam, doch jeder hatte einen eigenen Eingang, und er gelangte nur über eine Außen-Treppe in sein Zimmer, das oben im ersten Stock, direkt unter dem Dach lag.
„Ein richtiges Schwalbennest!“, so nannte sie es und bei dieser Benennung blieb es.
3. Kapitel
Die Nacht war kaum vergangen, der Himmel erhellte sich bereits, und wie von den Schreien der ersten Schwalben verjagt, verschwand der letzte Stern, da saß der Pfarrer von Castellina al Monte Largo in der Stille des Morgens am Bach, auf einem Felsen am Ufer, unbeweglich, die leichte Bambusgerte in der Hand, denn der Pfarrer war gekommen, um den Fischen aufzulauern, womöglich dem Berghecht.
Diesmal war der Pfarrer nicht allein beim Fischen. An diesem Morgen saß am anderen Ufer, wie sie es verabredet hatten, Signor Botello, und hielt die Angelrute vor sich wie eine Axt. Der schöne klare Morgen erschien ihm nach der letzten schlaflos verbrachten Nacht nicht jung und verheißungsvoll, sondern eher wie ein trüberer Abend, nur kühler und blasser.
Neidisch schaute Signor Botello mit einem Auge auf den eigenen Kork, mit dem anderen auf den Kork des Pfarrers, der diesmal eine schöne glitzernde Forelle aus dem Wasser gezogen hatte. Als alter ehemaliger Fischer war Signor Botello an ganz andere Fänge auf dem weiten Meer gewöhnt, bei den großen Fischdurchzügen.
Wenn an Bord die Salzbrühe hergerichtet und das Eis im Laderaum zerhackt wurde, waren so viele Fische da, daß sie einem zum Ekel wurden, und jetzt war es so schwer, ein gutes Mittagessen für zwei Personen zusammenzubringen, von denen der eine noch dazu mehr aß als eine ganze Bruderschaft. Gegen die Menschen allerdings war der Alte, dank der Einladung des Pastors, an diesem Morgen sanft gestimmt wie der Karpfen, der friedlich und ahnungslos am Bachufer grundelte.
So saßen sie, jeder auf einer Seite des Baches, und es entspann sich ein merkwürdiges Gespräch. Das heißt, ein wirkliches Gespräch war es nicht. Signor Botello hatte wenig zu sagen, noch weniger ließ ihn der Pastor zu Wort kommen. Der, welcher redete, war der Pastor, häufig unterbrochen von Geräuschen, einem dumpfen Zürnen, das vom anderen Ufer kam. Der alte Mann hörte zu und betrachtete dabei den tanzenden Kork, um sich an irgendetwas festzuhalten, und sei es auch nur an diesen verschwimmenden Kreisen um den Korken herum, im durchsichtigen Wasser. Dann wieder sah er den Pastor wegen seines eigenen mageren Fischzugs scheel und neidisch an. Es sah wirklich nicht so aus, als ob der eine Fischer im Beichtstuhl kniete und der andere der Beichtiger war. Und doch war es so, oder wenigstens sehr ähnlich.
„Hmm! Das sollte ich alles vergessen haben?“, sagte Signor Botello. Der Pfarrer nickte.
„Die Leute haben recht, wenn sie sagen, daß mir die Vögel das Gedächtnis ausgepickt haben!“
„Wirklich?“
„Teufel auch! - Verzeihung, Pastor . . . !“ Er kratzte sich nachdenklich den Kopf, „Gestern hast du mir gesagt . . . “
„Ich sprach von der Liebe, ich weiß . . . “, sagte der Pfarrer. Der alte Botello brauste auf,
„Was weißt du denn von der Liebe - und von der Eifersucht? Du . . . “ Er verschluckte den Rest des Satzes, der jedenfalls die Worte 'Kaftan' und 'Weiberrock' enthalten sollte.
„Mehr, als du dir vorstellen kannst . . . “, entgegnete der Pfarrer ruhig.
„Ach!“ lachte der Alte. Beim Lachen mußte er husten. Während er lachte und hustete, konnte er den Pfarrer nicht ansehen, und als er ihn wieder klar mit den Augen erfaßt hatte, war es ihm mit einem Male, als verstünde er endlich die Worte des Pastors, die ihn zum Nachdenken aufforderten und zur Verzeihung mahnten und dieses Leben auf beständiger Lauer, wie er es führte, aufzugeben.
Es war so, als würde die alte Vertraulichkeit zwischen ihnen beiden auf einmal wieder lebendig. Signor Botello wollte versuchen, sich ruhig dieser Vertraulichkeit überlassen, ohne es nötig zu haben, jedes einzelne Wort, das er hörte oder sprach, wie auf der Goldwaage abzuwägen. Und wieder - und genauso unerwartet wie tags zuvor auf dem Klostervorplatz - überkam ihn der Wunsch, von den Herbstblättern zu erzählen, die er in seinem Hut gesammelt hatte, wie einen Schatz. Von dieser ungewohnten Stimmung brummte ihm leicht der Kopf. Er machte Anstalten, sich bequemer hinzusetzen, um wenigstens seine Angelrute besser halten zu können.
„Hör einmal", begann der Alte endlich etwas mühsam, „Weißt du, ob ich bezahlen muß, damit die Glocken läuten - beim meinem Tode?“ Es war nicht das, was er sagen wollte, aber er fand keine anderen Worte.
„Natürlich mußt du bezahlen!“
„Ich möchte gern, daß eine Glocke - wenn auch nur eine winzig kleine - wenn auch nur für wenige Schläge . . . “ Signor Botello lächelte verlegen.
„Ich kann jeden Abend,“, sagte der Pfarrer trocken, „wenn du zur Messe in die Kirche kommst, ein paar Lire von der Kollekte beiseite packen, und behaupten, du hättest sie mir zu diesem Zweck in den Opferstock geworfen . . . “
„Ich fürchte, da wird nicht viel zusammen kommen!“, brummte der Alte.
„Sie war doch noch fast ein Kind damals!“, sagte der Pfarrer jetzt.
„Meinst du Luisa?“, erwiderte Signor Botello, der Pfarrer nickte.
„Ich war freilich ein ganz anderer Kerl als jetzt,", fuhr der Alte fort, „auch noch recht jung . . . “
„Luisa war noch viel jünger! Überleg einmal!“
„Ich hätte besser aufpassen sollen!“
„Man kann eine junge Frau nicht gut einsperren. Außerdem: vergiß nicht! Sie wurde dir schließlich anvertraut!“
„Und wie hat sie das Vertrauen belohnt?“ Der Alte brauste auf.
Die Erinnerung an die erlittene Ungerechtigkeit verlieh ihm Kraft. Und nun bekannte sich dieser Pfarrer, sein alter Kamerad, der doch ein abgeklärtes und friedliches Leben führte, sogar noch zu einem Leben in der Ungerechtigkeit, das aber er, Botello, ertragen sollte? Er fühlte sich nackt und wehrlos und betrogen und sah in dem Pfarrer schon wieder seinen Feind.
„Hast du ihr denn eigentlich jemals vertraut?“, sagte der Pfarrer jetzt.
„Ja, wenn ich die Wahrheit wüßte . . . “, antwortete der Alte ausweichend, denn er fand die Bermerkung seines Freundes hinterhältig.
„Würdest du ihr dann vergeben können?“, bohrte der Pfarrer weiter.
„Wenn ich sie wüßte! - “
„Vergeben ist immer schwer. - Vergessen ist leichter.“, sagte der Pfarrer.
„Kannst du selbst denn - wirklich vergeben?“, fragte Signor Botello und sah den Pfarrer prüfend an.
„Ob ich es wirklich kann,“, antwortete dieser, „Das weiß ich nicht, aber es gab einen, der es konnte.“
„Das ist lange her!“
„Lange zwar, aber nicht so lange, daß es vergessen wurde.“
Signor Botello schwieg, und dabei kam ihm ein anderes, neueres Unrecht in den Sinn, etwas, das sich immer wieder ereignete hatte und weiter ereignete. Beim Denken daran fing er an, sich erneut zu erregen, bis es endlich aus ihm herausbrach:
„Weißt du,“, sagte er mit ärgerlicher Stimme „daß Toccabellis Schweine schon wieder in meinem Kohlgarten waren?“
„So?“ murmelte der Pfarrer wenig interssiert und starrte auf das Wasser hinab.
„Wenn das noch einmal passiert, werde ich etwas tun müssen!“
„Was denn?“, fragte der Pfarrer.
„Ich habe schon eine Idee!“
„Ach, - und welche?“
„Das werde ich dir gerade verraten.“, sagte Signor Botello listig, und malte sich in Gedanken aus, was er zu tun gedachte.
„Wie du willst! Was habe ich mit Toccabellis Schweinen zu tun?“
„Du - nichts! Aber ich! Drei Kohlköpfe haben die Schweine gestern gefressen!“
„Von wievielen?“, fragte der Pfarrer.
„Das spielt keine Rolle!“, erwidert Signor Botello aufbrausend und rüttelte an seiner Angel, als sei diese eine Waffe, „Außerdem fressen sie die Eicheln in meinem Eichenwäldchen!“
„Laß sie fressen!“, sagte der Pfarrer gleichmütig, „Du ißt sie doch nicht! Aber du lenkst ab. Was ist nun mit Luisa? Wirst du dich mit ihr versöhnen?“ Eine Zeitlang herrschte Schweigen, nur das sanfte Murmeln des Wassers war zu hören, und ab und zu der Gesang einer Lerche hoch oben im Himmel.
„Ich traue den Menschen nicht mehr!“, sagte der Alte endlich, „Oder anders gesagt: ich traue ihnen alles zu!“
„Auf diese Weise kommt man dazu, Freundschaft mit den Steinen zu schließen.“, sagte der Pfarrer.
„Wenn ich die Wahrheit wüßte!“ wiederholte der Alte und fühlte sich ertappt.
„Das würde auch nichts ändern! Die arme Luisa hat nun lange genug gelitten.“
„Ich habe mehr gelitten . . . “
„Vielleicht noch nicht genug!“
Bei diesen Worten überkam den Alten wieder die Erinnerung und die Wut und die Scham und die Empörung und der alte Schmerz und er kam sich auf einmal wie frisch betrogen vor.
„Genug! Herr Pastor!“ rief er, „Soll ich etwa in Deinen Orden eintreten?“ Der Pfarrer blieb ganz ruhig,
„Das ist nicht notwendig!“
„Du redest von Dingen, die nur Dichter und Heilige verstehen können.“ Der alte Mann sprang auf, warf seine Angelrute wütend über die Schulter, „Ich kann nicht vergeben! Ich kann nicht verzeihen!!“ und stapfte ohne Gruß davon.
Der Pfarrer begriff, daß er die Schraube überdreht hatte. Nun würde es eine ganze Zeit dauern, bis er wieder mit dem alten Botello würde reden können. Er war einen Moment lang unwillig, wunderte sich über die schroffe Art und Weise, in der sein Kamerad verschwunden war, sah ihm nach, ruhig, neugierig, was nun geschehen würde. Es geschah nichts. Er zuckte mit den Schultern und wendete sich zum Bach, sah voller Geduld auf den Kork, der im Wasser schwamm. Dann erhellte sich seine Miene, ein überirdisches Leuchten verschönte seine Züge, sein Kork hatte begonnen, irrsinnige Kreise zu ziehen und er wußte, - endlich hatte der Berghecht angebissen!
4. Kapitel
Pauline hatte zum ersten Mal, in all den Wochen, seit sie hier oben in diesem ehemaligen Bauernhof lebte, schlecht geschlafen. Immer wieder hatte sie wachgelegen. Der Boiler im Bad hatte geknistert, eine Mücke gesirrt im Zimmer. Trotz der Steinböden hatte es ständig irgendwo in dem weitläufigen Haus geknarrt, hatte es unerklärliche Geräusche gegeben, eine zitternde Unruhe die ganze Nacht hindurch. Erst gegen Morgen war sie etwas fester eingeschlafen.
Die Pferde hatten sie dann geweckt mit ihrem Wiehern. Noch im Nachthemd und Morgenmantel ging sie hinaus in den Garten. Draußen war es frisch und auf dem Gras lag noch Tau. Rasch pflückte sie ein paar kleine Blümchen, und eilte zurück in ihr Zimmer, immer in Sorge, Raphael in diesem Aufzuge zu begegnen.
„Guten Morgen, Philipp!“, begrüßte sie das Foto ihres Sohnes auf dem Nachttisch, „Herzlichen Glückwunsch!“, und legte die kleinen Blumen davor. - Nachher mußte sie ihn anrufen! Unbedingt! Nicht vergessen! -
Ihr Sohn, der jetzt in den Ferien bei seinem Vater war, war heute zehn Jahre alt geworden; - der erste Geburtstag, den er ohne seine Mutter erlebte. Wie würde das sein für ihn? Wahrscheinlich würde sein Vater mit ihm im Motorsegler an die Ostsee fliegen, nach Rügen, das war des Jungen sehnlichster Wunsch gewesen. Jahrelang hatte sie sich dagegen gewehrt, daß er den Jungen in diesem zerbrechlichen Gerät zum Fliegen mitnahm, jetzt war es nicht mehr zu verhindern.
Diese Ferien in Sizilien hatte sich Pauline so schwer erkämpft, auch gegen eigene innere Widerstände erstritten, - wenigstens für ein paar Wochen die Pflichten loszuwerden, sich einmal für lange Zeit, - sechs Wochen waren es! - ganz der Kunst, ihrer geliebten Bildhauerei und der Malerei widmen zu können, diesen alten Traum endlich einmal leben, nicht immer nur davon träumen!
Schnell machte sie sich fertig und ging wieder hinaus. Alles war wie neu an diesem Morgen; alles in dem weiten Gelände war, als ob sie es zum ersten Mal sah. Die Pferde kamen neugierig angetrabt und schnupperten an ihr. Die Tiere, die Kette der Berge im Morgendunst, die frische Luft gaben ihr eine Erlaubnis, ja, eine Freude am Leben, wie sie sie selten empfunden hatte.
Vorsichtig ging sie um das Haus herum, sah suchend die kleine steile Treppe hoch, die zu Raphaels Zimmer führte, seinem Schwalbennest, - die Tür und das Fenster daneben standen offen. Er war also schon aufgestanden!
Vorsichtig lief sie ein wenig weiter in den Garten hinein, und da hatte sie Raphael auch schon entdeckt. Unter einer der Pinien, an ihrem Frühstücksplatz, saß er und las die Zeitung. Eine Kanne stand schon da, wohl mit heißem Kaffee, und ein Tablett mit Geschirr. Offenbar hatte er selbst das Geschirr geholt und hierher geschleppt. - Alles war bereit für ein Frühstück hier draußen, unter den Pinien, angesichts der Bergkette, der Ausläufer des Ätnamassivs. Und - er hatte noch nicht angefangen, hatte also auf sie gewartet!
Da blickte er auf, sah sie kommen, faltete die Zeitung zusammen und stand auf. Nach der Begrüßung sagte sie streng:
„Wie kann man angesichts dieser Natur, dieser Schönheit eine Zeitung lesen?“ Raphael lachte nur,
„Ich muß schließlich wissen, wie das Wetter ist! - Nein,“, gestand er dann, „Das ist leider Arbeit, die Rohstoffnotierungen.“
„Sind Sie schon lange auf?“
„Oh, ja, ich habe die Pferde begrüßt und begutachtet. - Wir sollten einmal zusammen ausreiten!“ Pauline geriet in Verlegenheit, denn sie konnte nicht reiten. Schließlich erwiderte sie zögernd,
„Man kann hier Reitstunden nehmen …" Anscheinend hatte er sie verstanden, denn er sagte,
„Es ist nicht so schwer!“
„Wie schön, daß Sie wir draußen frühstücken können!“, sagte sie.
„Ja,“, erwiderte er, „ich wollte es einmal anders haben als sonst! - Auch Sie sollen es anders haben, als es alle Tage war!“
„Dann hätte ich, wie jede Frau, wenigstens erwartet, daß Sie den Frühstückstisch mit Rosen dekoriert hätten. Dazu einen großen Zettel, mit einem Pfeil an einem Baumstamm befestigt: 'Für Pauline!' “ Raphael grinste nur frech und beobachtete, wie sie das Geschirr und das Besteck auf dem Tisch verteilte.
„Mir gefallen Ihre raschen Bewegungen,“, sagte er unvermittelt, „wie Sie eben auf mich zukamen, - und wie Sie jetzt den Tisch decken.“
„Soll ich jetzt verlegen sein?“ Sie war auf einmal sehr verwirrt, ging mechanisch weiter um den Tisch herum, stellte die Tassen ab, es war ein tapferes Sich-Stemmen gegen diesen Überfall! Gab es denn dagegen, gegen diese männlichen Überfälle, keinen Schutz? Mißtrauisch sah sie ihn an.
Er war schon wach, schrecklich wach, während es ihr auf einmal vorkam, als würde sie sich noch zusammensuchen müssen, - aus den Stücken, die die schlaflose Nacht von ihr übrig gelassen hatten. Dabei war er doch gerade angekommen, und sie hatte sich schon vier Wochen lang erholen können!
„Erst einmal den Kaffee bitte,“, sagte sie, „vorher findet noch gar kein richtiger Tag statt bei mir!“ Mit halboffenen Lidern beobachtete sie, wie er mit vollkommen sicherer Hand - ohne zu zittern! - ihr Kaffee einschenkte. Er redete auch schon, er hatte Pläne, - dabei war doch alles viel zu früh! Obwohl die frische Luft so aussah, sich so anfühlte, so atmete, als sei es schon hell, und als sei es wirklich der Morgen, nicht nur ein verlängerter heller Traum.
Pauline kam morgens erst langsam zu sich. Bis dahin mußte sie sich verstecken, so tun als ob. So tun, als ob sie Appetit hätte, Interesse an seinen Worten, am Tag, an sich selbst, an all dem, was mit ihr vorging, - es war ein großes Versteckspiel, jeden Morgen, und niemand merkte es, normalerweise!
Da machte Raphael den Mund auf und wollte etwas sagen.
„Noch nicht fragen, bitte!“, sagte sie. Er lachte belustigt. Und sie hielt ihm die Tasse hin, die er wieder mit Kaffee auffüllte.
Aus lauter Verlegenheit tat Pauline so, als sei sie schon konzentriert im Anschauen der Landschaft, sei schon dabei, sich auf neue Bilder vorzubereiten, - doch, wenn sie ehrlich war zu sich, mußte sie immer vorbeisehen an ihm, um ihn nicht immerzu anzusehen, - denn das wäre doch nicht gut, oder?
Und es kam ihr unwirklich und geradezu überwältigend vor, daß sie hier draußen saßen, unter den wirklichen Pinien, angesichts dieser wunderbaren wirklichen Berge, wirklichen Kaffee tranken, - alles ganz einfach, als ob nichts geschehen sei. Und es war ja auch nichts geschehen. - Und soviel!
„Milch?“ Sie schüttelte heftig den Kopf,
„This is not good for me!“
Es schien ihm zu gefallen, merkwürdigerweise, wie sie etwas ablehnte: „This is not good for me!“, wie sie Wünsche äußern konnte, etwas verwarf oder annahm, - dabei ahnte er nicht, daß sie oft, wie ein Falter zwischen ihren eigenen Strebungen hin- und hertaumelnd, - ohne jedes Konzept, aber stur, völlig zufällig Entscheidungen traf, - und sich so ihrer eigentlichen Willenlosigkeit überließ.
Sie erzählten jetzt beide von sich, und da fiel ihr plötzich etwas auf: Sie hatte nur einen Lebenslauf zu berichten, aber Raphael mußte deren mehrere haben, immer gab es, wenn er von sich erzählte, kleine Überraschungen. Wenn er Kindheits-erinnerungen auspackte, waren es die Ferienwochen, die er schon als Kind mit der Familie regelmäßig, - nein immer! - am Meer verbracht hatte, jedes Jahr! - 'Ohne das Meer könnte er es nicht aushalten!' - zeigte dann aber Ferienfotos von dem kleinen Jungen, der er gewesen war, vor einer Bergkulisse.
Stolz berichtete er, wie er als Junge die Haare immer lang getragen habe, und deswegen von den andern Jungen gehänselt worden sei, - sie nahm das Foto noch einmal zur Hand, und auf dem Foto waren seine Haare ganz kurz geschnitten, ein Igelschnitt.
Als junger Mann hätte er angeblich nur Klavier gespielt, war nicht wegzubringen gewesen vom Klavier, 'laß doch das Klimpern!', habe es in der ganzen Familie geheißen, von Musik hätte er geträumt, von Musik hätte er leben wollen, - dann behauptete er plötzlich, daß er eigentlich am liebsten habe Medizin studieren wollen, nach Afrika, nach Lambarene gehen, oder anderswohin, wo den Menschen noch zu helfen wäre, eine Mission erfüllen, eine Sendung, - egal ob es gefährlich wäre oder nicht.
Etwas war geblieben davon: Er hatte ein Patenkind in Venezuela, das hatte er einmal besucht, dort ein Vierteljahr in Armut und im Dreck gelebt.
Ihr eigenes Leben kam ihr jetzt so geradlinig vor, mit dem Studium, und ihrem Dasein als Lehrerin, die sich allerdings weiß Gott was für ein Leben erhofft hatte, - mit ihrem Aussehen, mit ihrer erstklassigen Intelligenz, mit ihrem Einserabitur und ihrem Einserexamen, ihrer Promotion, - und sich nun nach einer gescheiterten Ehe und als alleinerziehende Mutter in einer kleinen Wohnung in Berlin-Lichtenrade wiederfand.
„Sie sind also Lehrerin!“, fragte er.
„Ja! Ich bin Lehrerin, - aus Kindern Menschen machen, oder es jedenfalls versuchen!“
„Eine Lehrerin, ja, das dachte ich mir, gleich beim ersten Mal! - Welches Fach? Kunst?“
„Nein, Mathematik und Deutsch!“
„Da haben Sie ja eine große Verantwortung.“ - Sie lächelte,
„Ja, es ist wirklich eine, und eine, der ich mich nicht entziehen kann, wenn ich in der Schule bin, aber wenn ich das ausspreche, schäme ich mich, denn es kommt mir so klischéehaft vor.“
Jetzt war endlich auch ihr Hunger gekommen, und während sie aß, erklärte er ihr etwas über seine Arbeit, - aber da sie nichts davon verstand, hörte er bald wieder auf damit.
Plötzlich machte er ihr den Vorschlag, nach Agrigento zu fahren, ja, die Tempel dort! - „Nein, bitte nicht!“ widersprach sie heftig. - Mit wem sie die Tempel früher gesehen hatte, - es war ihr Mann, auf ihrer Hochzeitsreise, das ging ihn doch eigentlich nichts an, oder? Deshalb sagte sie es ihm auch nicht, sie wolle sie einfach nicht noch einmal sehen, er sei nicht der Grund dafür. Sie hätte genug Tempel gesehen in diesem Leben, nun seien Bäume dran, Berge, und Felsen, das Meer. Man müsse gelegentlich die Objekte der Anschauung wechseln.
Allein habe er keine Lust, gestand er enttäuscht; das sei einfach ein bißchen viel Kultur für ihn! Schnell lenkte sie ein, „Die Tempel, vielleicht später . . . Heute nicht!“, sie mußte das jetzt ablehnen, - sie wollte ihm doch nicht zeigen, wie schnell sie ihren Wunsch, allein zu sein, vergessen hatte, - wie sehr sie in Gefahr war, sich an ihn zu gewöhnen, in dieser kurzen Zeit.
„Ich will ein bißchen hier in der Gegend herumstreifen und malen, dort oben vielleicht, am Kamm!“, und als sie die Augen wieder hob, um den Weg zu messen, den sie heute zurücklegen wollte, fühlte sie sich tatsächlich vom Zauber dieses Himmels umfangen, und war darüber sehr erleichtert, von diesem Himmel, der jetzt glasklar war und grün erglänzte, - und wie stark war der Kontrast zu den dunklen violetten Bergketten davor, die in der klaren Luft wie mit dem Messer ausgeschnitten erschienen.
„Nun gut!“, sagte er, schien aber kaum berührt zu sein von ihrer Absage, und sie ärgerte sich ein wenig darüber. „Ich denke, die Leute werden das abräumen . . . “ Er verabschiedete sich, stand auf, stieg in seinen Wagen und fuhr davon.
Verwirrt blieb Pauline zurück, sie kam sich plötzlich so verlassen vor! - Da fiel es ihr glücklicherweise ein: Sie mußte, bevor sie zum Malen ging, zum Arbeiten, wie sie es gern nannte, noch ihren Jungen anrufen! - Jetzt waren sie vielleicht schon auf Rügen oder auf Hiddensee, und würden bei den Freunden dort übernachten; - bei gemeinsamen Freunden, den Altendorfs.
Im Restauranthaus, hinten in der Küche, hörte sie am Telefon erst die Stimme ihres getrennten Mannes, des Kindsvaters, wie sie immer sagte, dann die kleine dünne Stimme ihres Jungen, „Ja, Mammi, gut, Mammi, wir waren heute baden, nein, im Schwimmbad; ich habe ein Fernglas bekommen und eine Lederhose . . . “, und während sie dem Jungen zuhörte, der aufgeregt dieses Ferngespräch mit seiner fernen Mammi führte, und alle seine kleinen wichtigen Neuigkeiten aufzählte, dachte sie über Raphael nach.
Diese Leichtigkeit, mit der sie sich trotz ihrer Verlegenheit verständigen konnten, die Leichtigkeit, die dieser große kräftige Mann um sich verbreitete, diese Unkompliziertheit als Lebensform, konnte ihr vielleicht einen Teil ihrer verloren gegangenen Leichtigkeit zurückgeben. - Als sei irgendetwas weit Zurückliegendes, Verschüttetes wieder aufgefunden worden. Etwas, was zu ihr gehörig gewesen war. Was sie schon lange nicht mehr geglaubt oder erlebt hatte. Etwas, was in Vergessenheit geraten war, weil es so einfach war. - Gerade diese Einfachheit machte sie glücklich.
Plötzlich, mitten im Ferngespräch mit ihrem kleinen Philip, war da eine Hoffnung, glücklich sein zu können, denn das war sie ja, sofort glücklich mit ihm! Sie wagte es kaum, sich das einzugestehen.
„Tschüs, Philip,“, sagte sie zerstreut, „Bleib gesund und grüße deinen Papa!“
Als sie das Gespräch bezahlte, lächelte die Frau des Hauswarts sie verständnisvoll an, sie hatte es ihrem Gesicht angesehen, ja, sie hatte es sofort gesehen!
„ . . . mille trecento . . . “, sagte die Hauswartsfrau. Pauline bezahlte wie unter einer Betäubung; mille trecento, es war sehr billig.
5. Kapitel
Castellina al Monte Largo ist eine kleine Stadt in den Bergen im Westen Siziliens, fast ein Dorf, aber eine kleine Welt in der Welt. - Ausgestreckt auf sieben Hügeln, - nur ein wenig kleiner als Rom, - gewundene, krumme Straßen und Gassen, kleine, graue oder ehemals ocker gestrichene Häuser, viele leer oder verfallen, und die meisten verloren in einer ewigen Verlassenheit. Und an den Abenden im September erhebt sich langsam hinter den Hügeln ein roter und riesenhafter Mond, der wie eine Botschaft aus einem anderen Jahrhundert ausschaut.
Was für verwirrende Gegensätze birgt dieser Ort! An manchen Häusern hängen festgefügte hölzerne Balkone, hinter deren Jalousien man blasse, schwarzäugige Frauen reinsten Blutes hervorlugen meint - oder ihre finster blickenden, stolzen Brüder; doch die Zeit und der Staub haben alles in einen ewigen Schlaf versenkt. Statt der Mönche aller möglicher Orden laufen Ziegen herum mit ihren immer fragenden Gesichtern. In den kleineren Gassen sitzen ein paar schwarzgekleidete Frauen einsam auf ihren Stühlen vor ärmlichen Häusern und enthülsten Bohnen. Wenn ein Fremder an ihnen vorbeigeht, heben sie kaum die Augen und wagen den fremden Mann nur verstohlen zu mustern.
Heute war Castellina so totenstill, als ob überhaupt keine Menschen hier lebten. Die einzigen Wesen, die sich an diesem Septemberabend zu regen schienen, waren Fliegen. Fliegen summten an den Fenstern der 'Apotheke Meirelas', wo dunkle, mit Medizinen gefüllte Flaschen eingezwängt zwischen Hautwässern, Schwämmen und Pflastern standen. Auch an der Schaufensterscheibe, hinter der Sonnenbrillen, Kinder-Spaten, rosa Puppen und Tennisschuhen, nebst anderen hier schwer verständlichen Waren lagen, tanzten die Fliegen.
Sie krabbelten hinter einem Eisengitter über den leeren, blutbespritzten Hauklotz der 'Fleischerei von Signor Conardo - Verkauf von Fleisch und Honig'. Und der sandfarbene Hund, der mitten vor der Fleischerei auf der Straße lag, den Kopf zwischen den Pfoten, schnappte mit geschlossenen Augen nach den Fliegen, die ihn belästigten.
Aus einem kaum erleuchteten Gewölbe neben dem Laden lief Blut auf die Straße und der Fleischer, Signor Conardo kam gerade heraus und trug mit steifen Beinen und durchgedrückten Knien ein ausgenommenes Schwein auf dem Rücken in seinen Laden.
Ihm war eine grimmige Freude über das geschlachtete Tier ins Gesicht geschrieben, - seinem Lächeln nach zu urteilen, hatte er es sogar eigenhändig geschlachtet, - und so war es auch. Das Schwein war gerade erst getötet worden; seine Augen waren noch klar, doch sie sahen ins Leere, mit dem vorwurfsvollen Blick der gequälten Kreatur.
Aus der Wohnung über dem verstaubten 'Kolonialwaren-Laden' neben der Fleischerei drang jetzt das Kreischen eines Radios, das plötzlich abgedreht wurde, dann unvermutet ein unterdrückter Schrei, der eine Frau auf der Gasse übermäßig zusammenfahren ließ, danach das schwere Seufzen eines Menschen, der ungestört schlafen möchte.
Diese Frau, die in diesem Moment an dem Fleischergeschäft vorüber ging, war Luisa, die junge Frau Signor Botellos. Sie schüttelte sich unwillkürlich, als sie das tote Schwein auf dem Rücken des Fleischers sah. Sie selbst schleppte zwei Einkaufsnetze, die viel zu schwer schienen für ihre schmale Gestalt. Den Kopf hatte sie mit einem schwarzen Tuch verhüllt. Doch trotz der schweren Last, die sie tragen mußte, hatte ihr Gang eine eigentümliche Grazie und Würde.
Luisa wagte es einige Schritte lang nicht, fest aufzutreten, immer noch beladen vom Anblick des gerade eben geschlachteten Tieres. Als sie längst an der Fleischerei vorüber war, am Ende der Gasse, kam es ihr vor, als fühlte sie es immer noch im Rücken, den leeren Blick der toten Augen, wie eine wahnsinnige Erscheinung, und dann war es nur noch ein kleiner Seufzer, den sie auszustoßen wagte: „Muß das eigentlich sein, daß in diesem elenden Dorf fast auf der Straße geschlachtet wird?“
Inzwischen war sie zu einem kleinen ausgetrockneten Bach abgebogen, schritt über eine kleine Brücke und befand sich in einer kleinen Gasse, an deren Ende sich ein kleiner Platz vor ihr öffnete, Einige schöne alte Häuser mit hölzernen geschnitzten Balkonen in maurischer Art umgaben den Platz.
Ein junger, recht hübscher Mann, der ihr quer über den Platz entgegen kam, blieb stehen, als er sie bemerkte und sprach sie an: „Guten Tag, Signora Luisa! Darf ich Ihnen die Taschen bis zu Ihrem Hause tragen?“, und er wollte ihr gleich eine der Einkaufstaschen abnehmen. Luisa wunderte sich über die ungewohnte Hilfsbereitschaft des Jungen. „Laß, Angelo!“, sagte sie leise, und faßte ihre Taschen fester.
Und als er sie noch einmal bittend und hilfsbereit ansah, fügte sie hinzu: „Das ist sehr liebenswürdig von dir! Aber ich bin es gewöhnt, zu tragen! Und ich habe es nicht weit!“, damit huschte sie an ihm vorbei.
Ihre Stimme war sanft und schmerzlich, dabei warm und weiblich zart, so wenig passend zu dieser gedrückt wirkenden Gestalt. Sie blieb jetzt im Schatten des Gäßchens stehen, richtete etwas an ihrer Kleidung, und bog in eine kleine Neben-Gasse ein. Im Nu war sie verschwunden.
Angelo Toccabelli, der junge Mann, der Signora Luisa hatte helfen wollen, ging mit schnellen Schritten die Gasse entlang, die aus dem Ort hinaus führte, betrat die kleine Brücke, die sich über dem Bachbett wölbte, und befand sich nun auf einem Trampelpfad, der in einem Bogen zwischen einem großen Garten und einem Eichenwäldchen entlanglief. Dieser Pfad ging dann mitten durch das Eichenwäldchen hindurch, an dessen Ende sich überraschend ein großer, lang ausgedehnter Platz öffnete, der ehemalige Schießplatz; dort war es, wo Angelo hinstrebte.
Am westlichen Ende dieser Lichtung, in Richtung einiger niedriger Berge und des dahinter liegenden Meeres, stand die Ruine eines kleinen eingeschossigen Baus aus der faschistischen Zeit, das ehemalige Clubhaus, am anderen, östlichen Ende, in Richtung des Dorfes, fiel das Gelände steil ab, und man konnte in der Ferne den Kirchturm von Castellina erblicken, sowie die Spitzen der Dächer einiger größerer Häuser.
Eine kleine Herde von Schweinen, die auf dem wild bewachsenen Gelände grasten, flüchteten laut grunzend bei Angelos Annäherung. Aber nicht nur die Schweine zogen sich zurück, sondern auch eine Frau, die von der Erz-Grube kam und den Weg zurück zum Ort gehen wollte, versteckte sich sicherheitshalber - und auch aus Neugier - vor Angelo im Schatten des Eichenwäldchens.
Angelo stellte sich unter eine große Eiche, am östlichen Ende des Platzes, blickte einen Moment prüfend in den Himmel, ob das Wetter halten würde, und schickte sich ins Warten.
Direkt neben dem Weg, nicht weit von ihm entfernt, standen die Reste eines offenen Schuppens, des Palottolaio; darin verrostete eine große alte Maschine, zerbrochene Tonscheiben lagen herum, die sogenannten Tontauben, und die Maschine war die Apparatur gewesen, mit der sie in die Luft geschleudert wurden, - als Übungs-Ziel für die Schützen.
Angelo mußte nicht lange warten, denn kurz darauf näherte sich auf dem schmalen Weg durch das Eichenwäldchen ein Mädchen, das vom Ort her kam. Das Mädchen war hochgewachsen und recht kräftig, und ihr junges, etwas rundliches Gesicht strahlte Kraft und Sicherheit aus. Es war Agustina, die Tochter Luisas und Signor Botellos.
„Warum kommst du erst jetzt?“, fragte Angelo. Als sie beide so dicht beieinander standen, konnte man sehen, daß Agustina fast größer war, als Angelo, und schon geformt wie eine Frau. Angelo wollte sie in den Arm nehmen, doch sie entwandt sich ihm, trat einen Schritt zurück und sagte:
„Laß mich! Man könnte uns sehen!“
„Hier ist niemand!“, entgegnete Angelo unwillig und versuchte noch einmal, sie an sich zu ziehen, „Du kannst mir wenigstens einen Kuß geben!“ rief er. Doch Agustina wich ihm geschickt aus,
„Laß mich los!“, sagte sie energisch, „Ich will nicht!“ Widerwillig ließ der junge Mann von ihr ab.
„Warum mußten wir uns ausgerechnet am Schießplatz treffen?“, fragte Agustina jetzt.
„Mir gefällt es hier!“, sagte Angelo, „Es ist nicht so lange her, daß wir hier schießen geübt haben. - Jeder weiß, daß ich einer der besten Schützen in Castellina bin.“
„Nicht so gut wie dein Bruder Giovanni!“, seufzte sie leise. Angelo zuckte zusammen,
„Giovanni ist tot!“, murmelte er mit schiefem Gesicht. Das Mädchen blickte ihn nur schweigend und nachdenklich an.
„Darf man wissen,“, sagte er nach einer Weile, „warum du mich so anschaust?“
„Ich schaue dich an wie immer!“, antwortete sie, ein wenig ärgerlich.
„Sei auf der Hut, du! Ich verstehe heute keinen Spaß!“
„Ciao!“, erwiderte sie schroff und wandte sich zum Gehen.
„Du bleibst hier!“, rief er und packte sie grob an der Schulter. Sie fuhr herum und blickte ihn so böse an, daß er sie freigab. Er ließ seine Arme sinken und schaute das Mädchen an, das steif und wie erstarrt vor ihm stand. Und durch ihren Körper und ihr Gesicht hindurch sah er einen Fallschirm langsam vom Himmel herabsegeln. An dem Fallschirm hing sein Bruder Giovanni.
„Hab ich dir weg getan?“, fragte er unsicher.
„Nein, du hast mir nicht wehgetan.“ Eine Weile standen sie schweigend voreinander, während der Himmel sich verfärbte und rosa und gelbliche Wolkenbänder am Horizont entlang zogen. Der Fallschirm war wieder fort.
„Und was jetzt?“, sagte er endlich. Angelo war es gewohnt, daß die Mädchen sich aufrichteten, wenn er an ihnen vorbei ging, und ihn so lange anschauten, bis ihnen die Augen weh taten. Doch Agustina war so stolz wie eine Prinzessin!
„Und?“, wiederholte das Mädchen leise, „Kann ich jetzt gehen?“
„Nein! - So leicht wirst du mich nicht los, meine Schöne!“
„Es ist gut,“, sagte das Mädchen und blieb. Und Angelo schien es, als ob sie lächelte.
Er betrachtete sie erwartungsvoll, und als sie immer noch nichts sagte, fragte er:
„Und? - Was meint dein Vater?“
„Ich bin gekommen, um dir zu sagen, daß es nicht meine Schuld ist. Vater sagt, ich muß warten! - Soll ich jetzt gehen?“
„Ich mag nicht länger warten!“ rief der Junge, „Wir sind alt genug. Wenn dein Bruder heiraten kann, warum nicht du?“
„Ich bin viel jünger als er!“, sagte Agustina.
„Was hat dein Vater gegen mich?“
„Nichts!“, sagte das Mädchen ruhig, „Er sagt, du bist zu jung! Er sagt, es geht nicht, daß eine Frau einen Minderjährigen heiratet. Er sagt, wenn du wenigstens schon beim Militär gewesen wärest . . . “ Angelo ballte seine Fäuste,
„Mein liebes Mädchen, glaubst du, ich bin ein Dummkopf? Wenn ich das Militär hinter mir habe, bin ich einundzwanzig. Und dann fängt die Geschichte von vorne an.“
„Nein!“, antwortete das Mädchen, „Er sagt, achtzehn oder einundzwanzig bei einem Mann ist ein großer Unterschied. Außerdem sagt er: Du bist noch nicht fertig mit deiner Ausbildung. Und er sagt, vorher kommt Heiraten nicht infrage. - Warum bist du überhaupt in Castellina? Habt ihr denn jetzt Ferien?“
„Ich mußte dich sehen! Ich habe es nicht mehr ausgehalten!“
„Und da fährst du mitten im Semester nachhause?“, das Mädchen schüttelte verwundert den Kopf.
„Warum nicht?“, entgegnete der Junge trotzig, „Es ist so langweilig in Palermo.“
„Wie lange mußt du denn noch auf diese Fachschule gehen?“
„Ach, diese Schule! - Weißt du, ich bin nicht einmal sicher, ob ich das überhaupt weiter mache.“
„Und was dann?“, fragte das Mädchen verwundert, „Was willst du anfangen? Wovon willst du später leben? - Wovon sollten wir beide denn einmal leben?“
Statt einer Antwort zog Angelo ein Messer aus der Tasche und ließ es aufspringen, hielt die Klinge spielerisch hoch in die Sonne, sodaß die reflektierten Lichtstrahlen das Gesicht des Mädchens trafen.
„Mal sehen! Vielleicht - Geschäfte!“, sagte er und zog dabei die Mundwinkel hinunter. Als er diese 'Geschäfte' erwä