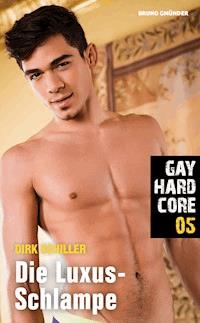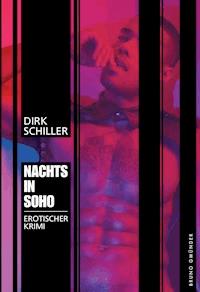Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Gay Hardcore
- Sprache: Deutsch
Regeln, Vorschriften, Verbote -- irgendwann reicht's! Sebastian büxt vom Anwesen seiner wohlhabenden Familie aus und schlägt sich bis nach Amsterdam durch. Doch völlig blank, wie er ist, heißt es erst mal Endstation. Bis ihn eine mysteriöse Bruderschaft verdorbener -- und ständig ralliger -- Burschen anwirbt, die ihn aus der Pleite direkt in die Arme ihres strengen und sadistischen Meisters führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GAY HARDCORE 12
Jung, pleite,hemmungslos
Dirk Schiller
Gay Hardcore 12
© 2018 Salzgeber & Co. Medien GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
Umschlagabbildung: ©Ragingstallion.com
Falcon Studios Group (Model: Shawn Wolfe)
Printed in Germany
ISBN 978-3-95985-309-5
eISBN 978-3-95985-344-6
Die in diesem Buch geschildertenHandlungen sind fiktiv.
Im verantwortungsbewusstensexuellen Umgang miteinander geltennach wie vor die Safer-Sex-Regeln.
Ein Blowjob zum Abschied
Ankunft in Amsterdam
Ein ziemlich geiles Wohnprojekt
In der Sex-Falle
Nachtschicht mit Pornos
Konkurrenz unter Kollegen
Der nächtliche Besucher
Reitstunden mit zwei Hengsten
Wiedersehen mit Daddy
Eine grausame Entdeckung
Die große Chance
Im Auge des Sturms
Ein Blowjob zum Abschied
Das angebliche schwarze Schaf in der Familie zu sein, hat zumindest einen großen Vorteil: Keine Sau gibt sich besondere Mühe, dich zu suchen, wenn du dich mitten in der Nacht auf Nimmerwiedersehen davonmachst. Eher das Gegenteil: Mein Vater hat wahrscheinlich erst mal eine Flasche Schampus geköpft, nachdem sie den Zettel mit meiner kurzen Grußbotschaft gefunden hatten. Und meiner Mutter wird es einfach egal gewesen sein, so wie ihr eigentlich alles egal war, seit ich denken konnte. Wahrscheinlich war es ihr dann nicht mehr ganz so egal, als sie irgendwann entdeckt hat, dass ich ihre heißgeliebte Diamantenbrosche eingesackt hatte, und das tat mir auch fast ein bisschen leid, weil ich wusste, wie sehr sie an diesem Stück hing. Aber ein Junge braucht doch einen kleinen Notgroschen, wenn er sich in die weite Welt aufmacht, oder? Und ich hatte mir ja sogar vorgenommen, das hässliche Ding nur im äußersten Notfall zu versetzen und es ihr zurückzuschicken, sobald alles in trockenen Tüchern war. Zumindest war das noch der Plan, als ich in dieser sternenklaren Oktobernacht quer über ein Kürbisfeld Richtung Autobahn stapfte. Aber in dem Moment hatte ich ja noch keinen blassen Schimmer, was mir – und der Brosche – in den nächsten Wochen alles passieren würde.
Stattdessen fühlte ich mich so frei wie noch nie in meinem Leben, atmete die frische, kalte Herbstluft ein und bemühte mich, in der Dunkelheit möglichst wenige Kürbisse plattzutreten. Dass ich auch einige Monate nach meinem achtzehnten Geburtstag noch keinen Führerschein hatte, war zugegebenermaßen etwas hinderlich für meinen Fluchtplan. Andererseits hätte ich mir eh kein eigenes Auto leisten können, und von meinem Vater wollte ich mir keines ausleihen, weil ich wusste, dass die alle mit GPS-Sendern ausgestattet waren und es deshalb nur eine ziemlich kurze Reise für mich geworden wäre. Musste ich eben trampen, um meine Familie, das piefige Essen und den ganzen dreckigen Ruhrpott für immer hinter mir zu lassen. Was für ein filmreifer Start in mein neues Leben!
Nach 15 Minuten erreichte ich endlich den unscheinbaren kleinen Rastplatz, an dem die meisten achtlos vorbeifuhren, weil sich darauf keine Tankstelle, kein Imbiss und nicht einmal ein Klohäuschen befand. Eingeweihte wie ich wussten aber, dass das hier einer der bekanntesten Sextreffs im ganzen Ruhrgebiet war, weshalb auch jetzt um kurz vor Mitternacht noch zwölf Autos aufgereiht Spalier standen, als ich aus der Dunkelheit auf den asphaltierten Bürgersteig trat.
Normalerweise zog es mich hier sofort in das kleine Wäldchen am oberen Ende des Rastplatzes, wo ich im vergangenen Sommer mehr Zeit verbracht hatte als meine Mutter bei den Anonymen Alkoholikern (und das wollte etwas heißen!). Doch in dieser Nacht interessierten mich die geparkten Autos mehr als die Typen, die darin hergefahren waren. Ich hatte vor, eines mit einer möglichst exotischen Autonummer zu finden, in der Nähe zu warten und dann den Fahrer dazu zu bringen, mich mitzunehmen, wenn der irgendwann mit offenem Hosenladen und noch tropfendem Schwanz aus dem Wald zurückkam. Dummerweise entdeckte ich beim ersten Abschreiten der Reihe aber nur Nummernschilder aus dem Pott oder höchstens aus Düsseldorf. Na toll, dachte ich. Das half mir ja nicht besonders viel.
Missmutig lehnte ich mich an einen der drei festbetonierten Picknick-Tische und machte mir eine Kippe an. Ich blickte auf meine Rolex, die ich zur Konfirmation von meiner Großmutter bekommen hatte, und von der ich inständig hoffte, dass ich sie nie aus Geldnot würde versetzen müssen: Es war schon kurz nach Mitternacht. Meiner Erfahrung nach war hier unter der Woche noch bis ungefähr eins oder höchstens halb zwei was los, doch dann würde es deutlich ruhiger werden, bis so ab sechs wieder die ersten Berufspendler einen kleinen Stopp einlegten, um sich auf dem Weg zur Arbeit schnell einen Schwanz in den Rachen schieben zu lassen. Ich hatte aber absolut keinen Bock, die ganze Nacht hier zu verbringen. Blöde Scheiße! Ich schnippte meine aufgerauchte Kippe weg und beobachtete, wie nach und nach drei Kerle aus dem Wald gelaufen kamen, sich in ihre Familienkutschen setzten und davonfuhren. Erst nach über zehn Minuten bog ein neues Auto von der Autobahn auf den Parkplatz ein, aber das war ausgerechnet ein mir gut bekannter, quietschgelber Fiat Punto. Ich seufzte. War ja klar, dass der kleine Karl hier auftauchen und mir mein geräuschloses Verschwinden versauen würde. Trotzdem war ich mir nicht sicher, ob ich mich darüber wirklich ärgerte oder ob ich mich nicht doch ein bisschen freute, ihn noch einmal zu sehen. Karl jedenfalls freute sich offenbar wie Bolle, denn er sprang auf mich zu, sobald er seine Schrottkarre geparkt hatte, und umarmte mich fest.
»Wo haste denn dein Fahrrad abgestellt, Sebastian?«, fragte er zur Begrüßung.
»Hab’s daheim gelassen. Bin von der Bahnstation zu Fuß gekommen«, antwortete ich schmallippig. Er holte gerade Luft, um mir die nächste Frage zu stellen, doch ich zeigte nur auf die große Reisetasche, die vor meinen Füßen im braunen Gras lag: »Hab sie nicht hinten drauf gekriegt.« Außerdem wollte ich mein Rad nicht hier stehen lassen, wo es vielleicht irgendwann die Polizei gefunden und mir anhand der Rahmennummer zugeordnet hätte. Aber das brauchte Karl ja nicht unbedingt zu wissen.
»Äh, wo soll’s denn hingehen?«, fragte er jetzt interessiert.
»Weiß ich noch nicht«, brummte ich. »Weg von hier.«
»Na ja«, sagte er unsicher, »ich kann dich wo hin fahren, wenn du willst.«
Obwohl Karl drei Jahre älter war als ich, war er trotzdem sowas wie mein kleiner Bruder. Seit ich ihn vor ein paar Monaten entjungfert hatte, klebte er an mir wie ein Katzenbaby, und weil ich ihm dann auch noch gezeigt hatte, wie er sich mit seinem drahtigen Körper und seinem durch mich zum Leben erwachten Hunger auf Schwänze sein Studium finanzieren konnte, fühlte er sich mir erst recht zu ewigem Dank verpflichtet. Deshalb hätte er mich wahrscheinlich tatsächlich mitten in der Nacht bis mindestens nach Köln gefahren, wenn ich das von ihm verlangt hätte.
»Danke, aber lass mal«, antwortete ich nur und tätschelte ihm grob den Nacken, weil ich wusste, wie sehr er das mochte.
»Du willst also echt abhauen?«, fragte er nun. Ich hatte ihm schon oft von meinem Plan erzählt, alles hinter mir zu lassen, aber damals hatte ich ehrlich gesagt selbst noch nicht daran geglaubt, dass ich das irgendwann tatsächlich durchziehen würde.
Ich sah ihm lange in seine großen, blauen Augen, die im Schein der Straßenlaterne unter seiner Cappy hervorleuchteten, und überlegte, was ich sagen sollte. Auch wenn ich wusste, dass Karl mich nie verpetzen würde, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, absolut niemanden in meine Pläne einzuweihen. Doch der kleine Scheißer blickte mich schon wieder so treudoof an, dass ich einfach nicht anders konnte, als zu nicken: »Jepp«, sagte ich. »Ich verpiss mich.«
»Krass«, rief er aufgeregt, um etwas später halblaut hinterherzuschieben: »Aber ich werd dich vermissen.« Ich schmunzelte und zündete mir eine neue Zigarette an. »Bin mit ’nem Kunden verabredet, der muss jeden Moment hier auftauchen«, fuhr er fort. »Aber wenn du danach noch da bist, lutsch ich dir noch mal einen zum Abschied.« Er grinste verschmitzt. »Oder vielleicht willst du mich auch ficken.«
»Vielleicht komm ich darauf zurück«, sagte ich und fuhr dabei mit der Hand an seinem Rücken herunter und in seine Hose rein, wo ich mich schnell zu seinem Schlampenloch tastete. Die kleine Sau hatte sich schon eingeschmiert und das glitschige, feucht-warme Gefühl an meinem Zeigefinger sorgte dafür, dass mein Schwanz in Sekundenschnelle steinhart wurde.
»Was ist das für ein Kunde?«, fragte ich, während er zu schnurren begann, weil ich sanft seine Rosette massierte.
»So ein Business-Futzi aus Amsterdam«, antwortete Karl kurzatmig, »ist oft geschäftlich im Ruhrgebiet und bestellt mich an die unmöglichsten Orte, um mich noch schnell durchzuficken wie ein Presslufthammer, bevor es zurück nach Hause geht. Ich glaub, der muss irgendwie Druck ablassen.«
»Soso«, sagte ich und zog langsam meine Hand aus Karls Kimme, weil mich die Aussicht auf eine Freifahrt nach Holland in diesem Moment noch mehr interessierte als sein startklares Loch. Gedankenverloren hielt ich ihm der Reihe nach meine Finger zum Sauberlecken hin. »Und denkst du, der würde mich vielleicht mitnehmen?«, fragte ich.
»Hm, ich weiß nicht«, antwortete Karl, während er die Mischung aus Gleitgel und seinem Arschsaft von meinem Mittelfinger lutschte. »Ehrlich gesagt, ich glaube eher nicht. Aber wenn du willst, frag ich ihn.«
»Ich will«, sagte ich und zog meinen Finger aus seinem Maul. »Und jetzt guck, was du angerichtet hast!«
Wir blickte beide auf die dicke Beule in meiner Jeans und Karl sagte grinsend: »Tut mir leid, Sebastian.« Dann zog er geschickt meinen Reißverschluss auf, griff hinein und holte meinen Ständer heraus, den er sanft zu wichsen begann. »Gut, dass du nie Unterwäsche trägst, großer Bruder«, flüsterte er.
»Geldverschwendung«, antwortete ich schulterzuckend. Außerdem mochte ich das reibende Gefühl des Jeansstoffes an meinen Eiern. Ich schloss für einen Moment die Augen und genoss die Kombination aus Karls Fingerfertigkeit und der kalten Nachtluft an meiner Eichel. Dann griff ich ihm hinters Genick und drückte ihn zu Boden.
»Weißt du, inzwischen hab ich mich ja echt von vielen Typen ficken lassen«, säuselte Karl und begann, mir über meine Eichel zu lecken. »Aber so einen perfekten Schwanz wie deinen hab ich seither nicht mehr gesehen.«
»Schmeichler«, sagte ich lächelnd und gab ihm einen spielerischen Klaps auf den Hinterkopf.
»Ich mein’s ernst. Dein Teil hat die perfekte Größe. Und ich steh drauf, wie er meinen Mund ausfüllt.«
Wahrscheinlich war ich eitel, aber was sollte ich machen? Ich fand’s einfach geil, wenn mir eine kleine Sau wie Karl beschrieb, was an meinem Schwanz alles einzigartig war. Ich nahm mir vor, ihn auf jeden Fall noch einmal zu ficken, bevor ich mich vom Acker machte, schon allein, um ihn noch ein letztes Mal zu markieren. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen, denn als ich nach einer Minute die Augen öffnete, bog gerade ein Jaguar Cabrio auf den Rastplatz ein.
»Ist das dein Kunde?«, fragte ich.
»Jepp«, antwortete Karl, nachdem er einen Blick über seine Schulter riskiert hatte, und sprang schnell wieder auf die Beine. »Besser, du verschwindest erst mal im Gebüsch und lässt mich das klären.«
»Keine Sorge«, sagte ich. »Das kläre ich schon selber.« Nach Karls gelber Bananenkiste war der Jaguar nämlich schon das zweite Auto, das mir an diesem Abend bekannt vorkam. Trotzdem schnappte ich mir erst mal meine Tasche und ging ein paar Schritte rückwärts, um aus dem Lichtkegel der Laterne herauszutreten und mich dadurch unsichtbar zu machen.
Die Luxuskarosse parkte direkt vor unserem Tisch, und die Fahrertür öffnete sich.
»Bingo!«, murmelte ich, als ich sah, wer da aus dem Auto stieg und meinen Freund mit einem strengen Nicken Richtung Wald begrüßte.
»Hi«, hörte ich Karl unsicher sagen. »Kann ich dich erst was fragen?«
Der Kerl blickte irritiert und wirkte auch schon etwas verärgert, weil die Sache dieses Mal nicht so reibungslos ablief, wie er es offenbar gewohnt war. »Was ist?«, knurrte er mit leichtem niederländischen Akzent.
»Ähm, was hältst du davon, wenn du mich heute umsonst ficken darfst und du dafür einen Freund von mir nach Amsterdam mitnimmst?«
Der Typ machte ein Gesicht, als hätte Karl ihn gerade gebeten, in einem Kokosnussbikini durch den Essener Hauptbahnhof zu laufen. Doch bevor er etwas antworten konnte, sagte ich laut und deutlich: »Ich bin mir sicher, dass er mich mitnimmt, Karl. Und ich glaube, du wirst trotzdem bezahlt werden.«
Ich trat wieder ins Licht und beobachtete grinsend, wie sich der Gesichtsausdruck des Typs von ungeduldiggenervt zu erschrocken und panisch wandelte. Zu meinem Glück und seinem Pech war er nämlich kein Geringerer als Martijn Stoffers, der aktuelle Geschäftsführer der letzten Kohlemine, die unserer tragisch verarmten Familie noch geblieben war. Ich wusste, dass Martijn aus Amsterdam stammte und öfters ein langes Wochenende dort verbrachte, weil seine Frau und die beiden Kinder dort lebten.
»Hi, Martijn«, sagte ich und schwenkte auffordernd meine Tasche in der Luft. »Hab gehört, dass du heute meinen Taxifahrer spielst.«
»Sebastian …«, stammelte der arme Kerl. Offenbar konnte er sich nicht entscheiden, ob er mir ins Gesicht oder auf meinen immer noch aus dem Hosenladen ragenden Schwanz starren sollte. »Ich … äh … die Sache ist …«
»… ganz anders, als sie aussieht? Ist schon klar. Ich bin überzeugt, dass du niemals fremdgehen würdest, Martijn. Nicht mit meinem hübschen Freund Karl, und erst recht nicht mitten in der Nacht an der Autobahn, während sich deine Alte wahrscheinlich gerade noch die Möse rasiert, weil Papi bald nach Hause kommt.«
»Ich hab mir auch die Möse rasiert«, säuselte Karl.
»Weiß ich doch«, antwortete ich. »Hab ich ja schon gefühlt.«
»Wenn ich das deinem Vater erzähle …«, setzte Martijn zu einem verzweifelten Angriff an, doch ich unterbrach ihn schnell.
»… dann wäre er über dein Verhalten deutlich schockierter als über meines. Von mir kennt er es nämlich nicht anders. Also, fahren wir los? Oder willst du noch schnell mit Karl in den Wald? Aber ich glaube, du bist nicht mehr in Stimmung, oder?«
Martijn wusste offensichtlich nicht so richtig, was er sagen sollte, und wenn ich ihn nicht schon immer so unsympathisch gefunden hätte, hätte er mir jetzt fast ein bisschen leidgetan. »Wir fahren«, presste er leise hervor und wollte gerade schon wieder in sein Auto steigen.
»Erst gibst du Karl sein Geld. Er ist ja extra wegen dir hier rausgefahren.«
Jetzt sah er aus, als wäre er kurz vorm Explodieren. Er sagte aber nichts mehr, sondern holte schweigend einen Zweihunderter aus der Innentasche seines Sakkos, den er zusammenknüllte und hasserfüllt in Karls Richtung warf. Der fing ihn problemlos.
»Bist ganz schön teuer, Kleiner«, sagte ich anerkennend.
»Hab ich nur dir zu verdanken«, gab er stolz zurück.
»Aber ich glaube, meinetwegen hast du gerade einen Stammkunden verloren.«
»Och, macht nix«, grinste er mich kess an. »Bin vor lauter Anfragen eh kaum mehr hinterhergekommen.« Plötzlich fiel er mir um den Hals. »Ich werd dich vermissen, Sebastian«, sagte er und klang auf einmal, als würde er gleich losheulen.
»Ich dich auch«, antwortete ich und war über mich selbst erstaunt, weil ich plötzlich merkte, dass ich es wirklich ernst meinte.
Martijn hupte ungeduldig, also löste ich mich aus der Umarmung und quetschte meine Reisetasche in den Kofferraum des Zweisitzers, wo sie gerade noch so neben den darin liegenden Pilotenkoffer von Rimowa passte. Dann winkte ich Karl ein letztes Mal zu und setzte mich auf den Beifahrersitz.
»Nur, damit wir uns einig sind …«, knurrte Martijn, als er den Gang einlegte und langsam losrollte.
»Ist schon klar«, unterbrach ich ihn schon wieder. »Ich werd’s niemandem sagen, Martijn. Nicht deiner Frau und auch nicht meinem Vater. Und ich bin dir echt dankbar, dass du mich mitnimmst.«
»Hab ich denn eine Wahl, du Klootzak?«, fragte er gepresst.
»Nö, eigentlich nicht«, antwortete ich fröhlich, während er auf die Autobahn fuhr und sofort auf 180 beschleunigte. »Aber es ist höflich, sich zu bedanken.«
»Seit wann versuchst du, höflich zu sein?«
»Ach komm, sei nicht so streng mit mir«, sagte ich, obwohl er natürlich recht hatte. Martijn war alle zwei Tage bei uns zu Hause in der Familienvilla, um sich mit meinem Vater zu besprechen, der sich, warum auch immer, schon seit Jahren weigerte, einen Fuß in seine eigene Firma zu setzen. Und jedes Mal, wenn der schneidige Holländer mir im Treppenhaus über den Weg gelaufen war, hatte ich mir größte Mühe gegeben, mich von meiner schlimmsten Seite zu zeigen, um dadurch meinen Vater zu beschämen. »Im Ernst«, fügte ich ruhig hinzu. »Ich würde nie jemandem davon erzählen, was du mit Karl treibst. Ich bin ein Arsch, aber kein Wichser. Okay?«
»Mh-hm«, antwortete er nur und drückte das Gaspedal noch weiter durch.
Ich betrachtete ihn von der Seite und musste zugeben, dass mir noch nie aufgefallen war, wie gut Martijn eigentlich aussah. Seine rasierten hellbraunen Haare waren genauso lang wie sein Fünftagebart und obwohl er nicht dick war, wirkte er irgendwie bullig, aber auf die gute Art. Ich legte ihm meine linke Hand auf den Schenkel und sagte: »Wenn du möchtest, zeige ich mich auch erkenntlich für deine Mühe.«
»Danke, aber du bist nicht mein Typ«, kam als knappe Antwort zurück.
»Wer ist denn dein Typ?«, fragte ich und ließ meine Hand einfach trotzdem auf seinem Schenkel liegen.
»Süße Jungs. Jungs, die machen, was ich sage. Nicht andersrum.«
»Verstehe«, antwortete ich grinsend. »Siehst du, da haben wir doch mehr gemeinsam, als ich bis vor ein paar Minuten dachte.«
Einfach nur zum Spaß ließ ich meine Hand weiter zwischen seine Beine wandern, bis ich unter dem dünnen Seidenstoff der teuren Anzugshose Martijns dicke Klöten ertasten konnte. Und weil er mir nicht sagte, dass ich meine Finger dort weglassen sollte, kraulte ich sie ihm ein bisschen, während ich versonnen durch die Windschutzscheibe in die Dunkelheit starrte und mich auf mein neues Leben freute, das nun also in Amsterdam beginnen würde. Ich war noch nie dort gewesen, aber hatte natürlich schon die aufregendsten Geschichten über diese sündige Stadt gehört. Ob es mich dort halten würde oder ob ich mich von dort aus weiter durchschlug, bis es mir endlich irgendwo gefiel? Abwarten. Ich hatte bei der ganzen Sache auf jeden Fall ein verdammt gutes Gefühl.
Was für ein beschissener Irrtum.
Ankunft in Amsterdam
Ich lass dich am Hauptbahnhof raus, ja?«, brummte Martijn, als wir zwei Stunden später von der Autobahn runterfuhren. Nachdem er wenige Minuten nach unserer Abfahrt meine Hand von seinen Eiern geschoben und mir schmallippig erklärt hatte, dass er sich auf die Straße konzentrieren musste, hatten wir die gesamte Zeit über kein Wort mehr miteinander gesprochen.
»Hauptbahnhof ist gut«, antwortete ich, während mein Blick aus dem Fenster und über die menschenleeren Straßen der eher trostlosen Außenbezirke schweifte. Hier war ja schon mal nicht besonders viel los.
»Was hast du jetzt vor?«, fragte er, und sein Tonfall war dabei so bemüht neutral, dass ich keine Ahnung hatte, ob er sich wirklich für meine Pläne interessierte oder ob er sie nur herausfinden wollte, damit er schnellstmöglich bei meinen Eltern petzen konnte.
»Wird sich schon was ergeben«, antwortete ich deshalb nur, was praktischerweise sogar die Wahrheit war.
Nachdem er seinen protzigen Schlitten vor dem Hauptbahnhof zum Stehen gebracht hatte, sah er mich streng an und sagte: »Also dann, gute Reise.«
»Mit ein bisschen Startkapital reist sich’s deutlich besser«, erwiderte ich und setzte dabei mein unschuldigstes Lächeln auf. »Ich meine, du hast ja auch ein Interesse daran, dass mir mein Geld nicht nur bis übermorgen reicht und wir uns dann wieder ständig zu Hause über den Weg laufen, oder? Wär doch irgendwie peinlich nach heute Nacht.«
Martijn seufzte tief, dann schob er unsanft meine Knie beiseite, damit er das Handschuhfach aufklappen konnte, um seine Brieftasche herauszuholen. Er öffnete sie und zog erst zwei Hunderter heraus, denen er nach kurzem Zögern noch einen dritten folgen ließ.
»Schicke Manschettenknöpfe«, sagte ich, als er mir die Scheine hinstreckte. »Waren bestimmt teuer.«
»Raus jetzt, du kleiner Scheißer«, knurrte Martijn, der seine Wut offensichtlich nur noch mühsam unter Kontrolle halten konnte. »Und lass dir beibringen, dass man irgendwann auch genug haben sollte.«
Na gut, dachte ich grinsend. Wäre ja auch fast zu schön gewesen, wenn er die auch noch rausgerückt hätte. »Bin ja schon so gut wie weg. Danke fürs Fahren. Und grüß deine Frau von mir.« Ich stieg aus und beeilte mich, den Kofferraum zu öffnen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ihn vielleicht so sehr gereizt hatte, dass er einfach mitsamt meiner Tasche davonrauschen würde. Doch er wartete brav, bis ich den Deckel wieder geschlossen hatte. Dann fuhr er an und ließ währenddessen extra das Fenster herunter, um mir zum Abschied seinen ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen.
»Du mich auch!«, rief ich und winkte ihm fröhlich hinterher, bis er um die nächste Ecke verschwunden war. Dann blickte ich mich auf dem hell erleuchteten Bahnhofsvorplatz um und stellte fest, dass auch hier kaum eine Menschenseele zu sehen war. Das konnte aber natürlich auch daran liegen, dass es inzwischen fast drei Uhr am frühen Freitagmorgen war und ein eisiger Nieselregen den Aufenthalt im Freien wirklich ziemlich ungemütlich machte. Weil ich auf Anhieb keinen besseren Plan hatte, flüchtete ich mich erst einmal ins Bahnhofsgebäude, das ironischerweise von außen gar nicht so viel anders aussah als die Villa, in der ich mein bisheriges Leben verbracht hatte – innen war es dann aber doch um einiges schmuddeliger.
Soweit ich das sehen konnte, hatte nur noch der McDonald’s geöffnet, also ging ich rein, kaufte mir eine kleine Pommes und einen Cappuccino und setzte mich damit in die hinterste Ecke, damit ich in Ruhe und vor allem unbeobachtet einen Kassensturz machen konnte: Zusammen mit den 300 Euro von Martijn, dem Geld von meinem Girokonto und dem, was ich ein paar Stunden zuvor aus den Portemonnaies meiner Eltern gefischt hatte, hatte ich nun knappe 5.000 Euro in dem kleinen Seitenfach meiner Reisetasche stecken. Eigentlich ein ganzer Batzen und wahrscheinlich mehr, als so ziemlich jeder Ausreißer vor mir mit sich herumgeschleppt hatte. In dem Moment kam es mir aber trotzdem nicht besonders viel vor, weil ich ja noch keine Ahnung hatte, wie lange ich damit würde auskommen müssen. Monate? Vielleicht sogar Jahre? Aber wie sollte das gehen?
Ich schob mir schnell ein paar Pommes in den Mund, um das aufkeimende flaue Gefühl in meinem Magen zu bekämpfen, was fürs Erste auch ganz gut funktionierte. Aber ich bin ja nicht doof, deshalb war mir natürlich klar, dass ich mir irgendwas überlegen musste, um dauerhaft über die Runden zu kommen. Denn eine Sache wollte ich um jeden Preis vermeiden: irgendwann abgebrannt und mit eingezogenem Genick zurück nach Hause trampen zu müssen, um dort in die triumphierenden Gesichter meiner beknackten Eltern zu blicken.
Ich hatte absolut keinen Bock mehr auf diese scheinheiligen Spießer. Ich wollte weit weg von Essen und am besten noch ganz weit weg von Deutschland ein neues Leben beginnen, und zwar für immer, auch wenn mich die meisten deswegen für bescheuert halten würden. Immerhin wurde ich in eine der ehemals wohlhabendsten und einflussreichsten Familien des ganzen Ruhrgebiets geboren, die sich seit Generationen an Stahl und Kohle dumm und dämlich verdient hatte. Aber was helfen einem schon die ganzen Moneten, wenn der komplette Rest des Lebens einfach nur beschissen ist? Mein Vater zum Beispiel: ein Waschlappen, der zu gar nichts zu gebrauchen war. Saß morgens alibimäßig ein paar Stunden in seinem Arbeitszimmer in unserer Villa rum, um dann den Rest des Tages Golf zu spielen und seiner Frau aus dem Weg zu gehen. Wobei ich von Mama gar nicht anfangen will, die hatte nämlich noch mehr Schrauben locker als Karls Schrottkarre. Aber mich den missratenen Sohn nennen – schon klar. Nur, weil ich im Gegensatz zu ihnen und meinen beiden unerträglich glattgebügelten BWL-Streber-Schwestern sagte, was ich dachte, und machte, worauf ich Lust hatte. Ich war wenigstens der Einzige von uns, der einigermaßen mit sich im Reinen war, weil er nicht sein ganzes Leben lang damit beschäftigt war, irgendeinen Schein aufrechtzuerhalten. Mit Reichtum und Macht war es bei uns nämlich nicht mehr weit her, und sowas wie glückliche Gesichter gab es bei uns zu Hause wahrscheinlich sowieso das letzte Mal, als Adenauer mal zum Geburtstag meines Großvaters vorbeigeschaut hatte. Ich war also in gewisser Hinsicht einfach die Ratte, die schlau genug war, das sinkende Schiff zu verlassen. Nur musste ich jetzt schauen, dass ich schnell genug an Land schwamm, bevor mir die Puste ausging und ich absoff.
Die Einzige in meiner Familie, mit der ich mich immer gut verstanden habe, war meine Oma gewesen, also die Mutter meines Vaters. Denn im Gegensatz zu allen anderen mochte sie mein ungestümes, raues Wesen, wie sie es immer nannte. Das hatte ich nämlich von ihr geerbt. Auch wenn sie immer behauptet hatte, dass unter meiner harten Schale irgendwo ein weicher Kern verborgen wäre. Den hatte ich aber noch nie zu Gesicht bekommen. Nach ihrem Tod hatte sie dann auch mir und nicht meinem Vater den größten Teil ihres Geldes hinterlassen, und das war wirklich ein ganz schöner Haufen. Auf jeden Fall genug, um den Rest meines Lebens nicht mehr nach Essen zu müssen – sobald ich die Kohle erst einmal hatte. Denn ich würde sie erst an meinem 21. Geburtstag in die Finger bekommen, diese kleine Gemeinheit hat sie sich dann doch noch einfallen lassen.
Das bedeutete, für die nächsten zweieinhalb Jahre würde ich mich noch irgendwie so durchschlagen müssen. Ich versuchte, die Sache positiv zu sehen und als eine Art Abenteuerurlaub zu betrachten. Ich hatte mir vorgenommen, mich durch die Weltgeschichte treiben lassen, mir hier und da auf legale oder halblegale Art was dazuzuverdienen, und für den schlimmsten Fall hatte ich ja noch Muttis Diamantbrosche dabei, die ich sicher für ein paar tausend Euro hätte versetzen können, wenn es hart auf hart gekommen wäre.
Mir war zwar nicht gerade wohl dabei, die ganze Kohle in bar mit mir herumzuschleppen, aber auf der Bank hatte ich sie nicht lassen können, weil ich mir sicher war, dass mein Vater meine Kontobewegungen überwachen lassen würde – wenn auch nur, um zumindest den Anschein zu erwecken, dass er mich gerne wiederfinden würde. Aus genau diesem Grund hatte ich auch schweren Herzens Abschied von meinem noch fast brandneuen iPhone genommen und es in einen Karton gesteckt, den ich ohne Absender an eine erfundene Adresse in Bangkok geschickt hatte. Sollte die Polizei also mein Handy orten, würde es demnächst einen kleinen Aufruhr in einem thailändischen Lagerhaus für unzustellbare Pakete geben, und dieser Gedanke tröstete mich ein wenig darüber hinweg, dass ich mich nun bis auf Weiteres mit einem Billig-Smartphone mit Prepaidkarte herumschlagen musste, das niemand mit mir in Verbindung brachte.