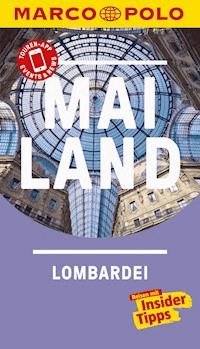12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ferien auf dem Juwel unter den Mittelmeer-Inseln Eine Insel, die gegensätzlicher nicht sein könnte: ob in der Universitätsstadt Sassari oder in den vom Wind gebeugten Eichenwäldern des Nordens; an den Badestränden des Westens oder bei Schäfern in den Gebirgsdörfern des Inneren; bei den Schönen und Reichen an der Costa Smeralda im Osten, in den Olivenhainen der Ebenen oder unter Palmen im südlichen Cagliari. Henning Klüver, verheiratet mit einer Sardin, kennt viele Winkel Sardiniens und legt mit seiner Gebrauchsanweisung dem Leser eine faszinierende Mittelmeerinsel zu Füßen. Er berichtet von Feengräbern und Banditenhöhlen, Modedesignern und Literaturpreisträgern, Trockenmauern und Betonsünden, schillernden Festen und einer kulturellen Vielfalt, die auch Lust auf Wein und Küche macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Lidia, Gianna und Mara
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-95535-5
© Piper Verlag GmbH, München 2012
Umschlagkonzept: Büro Hamburg
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Umschlagabbildung: Johanna Huber / Bildagentur Huber (Felsküste der Cala Golritzé am Golfo di Orosei)
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Die Insel der Sehnsucht – ein Vorwort
Es war einer jener Tage im Juni, die typisch sind für die Norddeutsche Tiefebene. Der Himmel hing tief, aber am Horizont hatte er sich geöffnet und zeigte einen Streifen milden Abendlichts. Ich wollte ihr meine Heimat zeigen, wir waren in Hamburg gewesen und jetzt an die Küste gefahren. Vom Deich aus hatte man einen weiten Blick in die Wattlandschaft der Nordsee. »Wo ist das Meer?«, fragte sie, und ich erzählte von Ebbe und Flut, von Strudelwürmern und Furten, vom Schimmelreiter und von Krabbenfischern, und das Abendlicht legte sich wie ein goldener Teppich unter den grauen Himmel aufs Wattenmeer. Ein kühler Wind wehte, sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und fragte: »Ist dir nicht kalt?« Man sah ihr jedoch an, dass sie etwas anderes sagen wollte: »Das soll Meer sein?«
Ein paar Wochen später fuhren wir auf der Küstenstraße von Alghero nach Bosa. Schroffe Gebirgszüge, nur mit der buschigen Macchia und hier und da mit Olivenbäumen bedeckt, fallen steil zum Meer ab. Die wenig befahrene Straße windet sich auf und ab und lässt immer wieder den Blick auf das Wasser frei, das an diesem Septembernachmittag tiefblau unter uns leuchtete und im Sonnenlicht glitzerte, als würden Tausende von Brillanten auf der Oberfläche schwimmen. Eine leichte Brise hinterließ kräuselnde Spuren auf dem sonst ganz ruhigen Meer. Vor einer Bucht lag ein Segelboot, und weiter draußen konnte man mit etwas Glück einen Schwarm Tümmler springen sehen. »Siehst du«, sagte sie, als hätten wir unser Gespräch erst kurz zuvor unterbrochen, »das ist Meer.«
Es ist nicht leicht, einer Sardin zu erklären, dass man beides mögen kann: die wattbraune Herbheit der Nordsee und die brillantenblaue Schönheit des Mittelmeers. Wohingegen es verhältnismäßig leicht ist, jemanden von den sommerlichen Vorzügen des Südens zu überzeugen. Unsere Tochter Gianna lebt zurzeit in Kopenhagen – gleichsam am Meer, aber spätestens im Juni, wenn am Öresund die Temperaturen kaum 18 Grad übersteigen, Regenwolken tief hängen und ein kalter Wind durch Islands Brygge weht, hört man sie am Telefon stöhnen: »Ich will hier raus, ich brauche Sonne, Wärme, Meer!«
Sehnsucht nach Meer
Sardinien und seine Nebeninseln berühren mit einer Küstenlänge von 1849 Kilometern das Mittelmeer in allen natürlichen Spielarten – vom sanften Ufer bis zur gebirgigen Steilküste. Da ist für viele Urlauber Platz, auch wenn man Klippen und schroffe Felsen abziehen muss, und manche Traumstrände nur mit einem Boot zu erreichen sind. Die Sehnsucht nach einer stillen Bucht, kristallklarem Wasser und einem warmen Strand wächst wie die Liebe mit dem Zunehmen der Entfernung (und dem Wechsel der Klimazone). »Wenn ich mir einen Strand erträume«, heißt es in einem Internetchat (siehe Seite 61), »dann eben Spiaggia Rosa auf Budelli mit einigen lieben Menschen, wolkenlos, 30 Grad mit leichter permanenter Brise, das reicht, Essen und Trinken haben wir dabei.« Man wird ja noch mal träumen dürfen. In der harten Wirklichkeit bleibt der rosa Strand von Budelli nämlich eine verbotene Zone. Die kleine vorgelagerte Insel zwischen Sardinien und Korsika, auf der Michelangelo Antonioni 1964 einige Szenen seines Filmes »Il Deserto rosso« (Die rote Wüste) drehte, ist Teil eines nationalen Schutzgebietes, welches das ganze Archipel der Maddalena umfasst. Auf Sardinien gibt es nur noch zwei weitere solcher nationalen, das heißt staatlich verwalteten Naturschutzgebiete: auf der nördlich gelegenen Insel Asinara und – allerdings bei der Bevölkerung und den Lokalverwaltungen umstritten – am Gennargentu-Massiv im Zentrum Sardiniens. Dazu kommen weitere von der Regionalregierung eingerichtete Schutzgebiete. Die Insel Budelli wurde rund um den Strand mit dem berühmten rosa Sand zur Sperrzone erklärt, nachdem der Fremdenverkehr dort wie eine Heuschreckenplage eingefallen war und den Sand tonnenweise in Flaschen und Eimern weggeschleppt hatte. Aus der Traum.
Die meisten suchen schöne Strände, ganz wenige suchen sie ab. Zu Letzteren gehört Alberto, ein Italiener von der Adriaküste, der seit zwanzig Jahren jeden Sommer mit einem Camper nach San Teodoro fährt und sich dort sein Urlaubsgeld auf eigenwillige Art verdient. Gegen sieben Uhr abends, wenn die Menschen gegangen sind und die Möwen kommen, prüft er mit einem Metalldetektor, ob sich im Sand Geldstücke, Uhren oder sogar Schmucksachen versteckt haben. Ganz große, wertvolle Funde gibt er ab, das Geld behält er, der Kleinkram wird verkauft. Früher kamen so an die 100 Euro pro Woche zusammen, inzwischen sind es, wenn es hoch kommt, nur noch 25 Euro, berichtete er der L’Unione Sarda, der auflagenstärksten Zeitung der Insel. Die Finanzkrise ist schuld. Warum aber kommt er zum Strandbesuch nach Sardinien, hat nicht die Adria auch lange Strände? Schon, aber der Sand auf Sardinien, so Alberto, sei sauberer. Und er muss es ja wissen.
Irgendwann wird aber auch der schönste Strand langweilig, ist auch der dickste Roman auf dem Kindle gelesen, und kann man auch den Kellner in der Pizzeria nicht mehr hören, wenn er zum dritten Mal von seinen Erfahrungen als Gastarbeiter in »Dortomundo« erzählt. Dann steigt aus der Macchia ein betörender Duft, und man fragt sich, was eigentlich hinter den Hügeln liegt, die die Küste säumen. Woher kommt der aromatische Käse, den man hier manchmal jung und säuerlich-frisch als Vorspeise, dann wieder gereift und leicht nussig im Geschmack nach dem Hauptgericht auf den Tisch bekommt? Wieso knistert das Brot so dünn wie Papier? Was haben die Bäume den Menschen getan, dass man ihre Stämme nackt abschält? Woher weht dieser nervige Wind? Und warum scheint hier so vieles anders zu sein als auf Mallorca, Sizilien oder Kreta?
Sardinien ist einfach anders. Die zweitgrößte Insel des Mittelmeers ist zwar nur unwesentlich kleiner als Sizilien. Doch leben hier weniger Menschen (1,6 Millionen auf Sardinien, 5 Millionen auf Sizilien), die entsprechend viel Platz haben – im Durchschnitt teilen sich 69 Personen einen Quadratkilometer. Allein in der Regionalhauptstadt Cagliari und ihrem Einzugsgebiet konzentriert sich ein Drittel aller Einwohner, das heißt, der Platz für den Einzelnen ist im restlichen Teil der Insel sogar noch größer. Einsamkeit und Stille ziehen sich durch merkwürdige Naturräume, und man fühlt sich wie auf einem fremden Stern. Einzigartig im ganzen Mittelmeerraum sind auch die sonderbaren kegelartigen Steintürme aus der Vorzeit: die Nuraghen. Für die altlateinische Sprache der Einwohner gibt es im restlichen Italien keinerlei Entsprechungen. Und der Verlauf der Geschichte hat hier ganz eigene Bahnen genommen.
Melancholie und Verzauberung
Aus der Insellage erklärt sich vieles. Man wird hier keine extrovertierten Charaktere vorfinden, die bei der Arbeit singen, immer einen Scherz auf den Lippen haben und das Leben leichtnehmen. Schweigen, so schreibt die Autorin Michela Murgia, ist hier der meistgesprochene Dialekt. Und wie die Sarden die Außenwelt eher fremd empfinden (was für andere Regionalkulturen sicher auch gilt), werden sie umgekehrt von dieser als ebenso fremd empfunden (was anderswo weniger der Fall ist). Auf Sardinien spürt man mehr als auf anderen großen Inseln im Mittelmeer, dass man sich »weit ab vom Schuss« bewegt. Isola lautet das lateinische (wie italienische) Wort für Insel. Isol-iert zu sein, Inselbewohner zu sein, gehört zum Grundgefühl eines jeden Sarden.
In früheren Generationen war der Lebensraum eines jeden Bewohners nicht vom Meer umgeben, sondern vom wilden Bergland und von undurchdringlichen Wäldern. Man igelte sich geradezu ein und kannte die Leute aus dem Nachbardorf nur vom Hörensagen (oder lernte sie bei gewaltsamen Auseinandersetzungen kennen). Das eigene Dorf war eine Insel. Der Schriftsteller Marcello Fois, der aus Nuoro stammt, erzählte mir in einem Interview: »Es scheint paradox, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt haben die Sarden sich nicht auf Sardinien bewegt. Und es gab viele Sardinien, das war und ist wirklich ein kleiner Kontinent. Der Norden ist mehr urbanisiert, es gibt auch viel Landwirtschaft, man könnte sagen, der Norden ist genuaisiert, dazu kommt die katalanische Enklave Alghero. Dann gibt es das Zentrum, das alte Herz der Barbagia, das weite Land der Hirten. Der Süden wiederum ist mehr industrialisiert, aber auch mehr levantinisch. Er ist, unter verschiedenen Gesichtspunkten, Afrika sehr nah, mit volkreichen Städten, Menschen mit dunklerer Hautfarbe, krausem Haar, einer anderen Küche, anderen Verhaltensweisen und einer ganz anderen Sprache. Diese Teile von Sardinien lebten miteinander, es gab einen gewissen Austausch, aber nur den notwendigsten. Man reiste nicht. Ich glaube, bis zur Generation meiner Urgroßeltern ist niemand ans Meer gefahren, hat niemand das Meer je gesehen. Das Meer, das gab es gar nicht. Welchen Grund sollte man haben, es zu sehen?«
In dem streckenweise autobiografischen Roman Cosima beschreibt Grazia Deledda, die ebenfalls aus Nuoro stammte und 1926 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, wie die 14-jährige Cosima die Küste erreichte und von einem Felsen herabblickte: »Sie sah ein großes leuchtendes Schwert, das man den Klippen zu Füßen gelegt hatte zum Zeichen, dass die Insel vom Kontinent abgeschnitten war, und so musste es bis in die Ewigkeit bleiben. Es war das Meer, das Cosima zum ersten Mal sah.« Der Kontinent, das ist Italien. Und wenn ein Sarde vom italienischen Festland spricht, nennt er es auch heute nur continente.
Die Sarden, heißt es in einem deutschen Italien-Reiseführer von 1952, seien »kleine dunkle und gut aussehende Menschen, die sich nicht als zu den Italienern gehörig fühlen. Das ›Festland‹, wie sie es nennen, scheint infolge des unabhängigen Geistes der Insel viel weiter entfernt zu sein, als dies tatsächlich der Fall ist.« Und der deutsche Journalist und Reiseberichterstatter Eckart Peterich schrieb wenige Jahre später über die Landschaft: »Das urtümlich Phantastische des Gesteins erzeugte, mit der Kargheit der Pflanzenwelt verbunden, erst Melancholie, dann Verzauberung, Entrückung. Wir fühlten uns vereinsamt und vereinzelt, vom übrigen Europa durch viel mehr als nur die tyrrhenische See getrennt.«
In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert, auch die Sarden sind einen Schritt aus ihrer Isolierung herausgetreten. Sie suchen heute in ihrer überwiegenden Mehrheit als italienische Staatsbürger ihre reichen lokalen Traditionen in einem Europa der Regionen einzubringen. In Italien haben sie als eine von fünf autonomen Regionen (außerdem Sizilien, Aostatal, Trentino-Südtirol und Friaul-Julisch Venetien) größere Möglichkeiten zur Selbstbestimmung als Regionen mit einem Normalstatut, doch tun sie sich schwer, diese zu nutzen. Marcello Fois sagte dazu: »Unser Problem ist, dass wir, historisch gesehen, daran gewöhnt sind, von außen geleitet zu werden. Wir haben Probleme mit der Selbstverwaltung, trotz aller Rhetorik. Wir sind stolz, wir sind tolle Leute, wir sind manchmal auch Verbrecher, wie überall. Das alles ist richtig. Aber historisch, da gab es die Phönizier, die Römer, die Katalanen, die Spanier, die Genuesen, die Pisaner und die Piemontesen. Der Eindruck hat sich festgesetzt, Sardinien war für alle da, aber nicht für die Sarden.« Und noch heute pflegen sie irgendwo in einem Hinterstübchen diese Vorstellung, dass sie nicht Herren ihrer selbst sind. Dabei fühlen sich die Sarden ihrer Insel geradezu physisch verbunden, wenn sie sie verlassen müssen, spüren sie einen Schmerz, und im Ausland plagt sie eine »geologische Sehnsucht« (Giorgio Todde) nach ihrer Heimat.
Ein paar Zahlen und Namen
Sardinien liegt 189 Kilometer vom italienischen Festland entfernt, getrennt durch das Tyrrhenische Meer. Und 184 Kilometer Luftlinie trennen die Mittelmeerinsel von der Küste Afrikas. Sie wird zu 80 Prozent von Hügel und Gebirge bedeckt, die höchste Spitze ist die Punta La Marmora des Gennargentu (1834 Meter). Ebenen, Flüsse und Seen nehmen 18,5 Prozent der Oberfläche ein, das restliche Gebiet gehört zu den vorgelagerten Inseln, unter denen Sant’Antioco die größte ist. Die Regionalhauptstadt Cagliari ist zugleich die größte Stadt mit 164000 Einwohnern; Sassari, die zweitgrößte, hat 120000 Einwohner. Insgesamt gibt es 377 Gemeinden. Politisch teilt sich die autonome Region Sardinien in acht Provinzen: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro, Ogliastra. Zahlreicher sind die »historischen Regionen«, das sind Landschaftsbezeichnungen (siehe Karte Seite 6), die heute noch gebräuchlich sind und auch in vielen Reiseführern auftauchen. So heißt das Land um Nuoro »Barbagia di Nuoro«, das um Fonni »Barbagia Ollolai«, das südlich von Olbia »Baronie«, das zwischen Olbia und Santa Teresa »Gallura«, das an der Nordwestspitze »Nurra«, das zwischen Macomer und Bosa »Planargia«, das um Barumini »Marmilla«, das um Carbonia und Sant’Antioco »Sulcis« oder das um Cagliari »Campidano di Cagliari«, um nur einige zu nennen.
Das offizielle Wappen Sardiniens, ein rotes Kreuz auf weißem Grund und vier »Mohrenköpfe« mit einer Stirnbinde, geht auf ein ehemaliges Hoheitszeichen der Könige Aragons zurück, die im 11./12. Jahrhundert die Herrschaft über die Insel erlangten. Im 19. Jahrhundert wurden die vier Köpfe als Symbole der freien Judikate interpretiert, die Sardinien im frühen Mittelalter regierten und sich dabei den Angriffen von Piraten aus dem islamischen Raum (Sarazenen) erwehren mussten. Die schwarzen Köpfe galten so als Sklaven und die Stirnbinde mutierte zur Augenbinde. Diese Form wurde zunächst von der Sardischen Aktionspartei nach dem Ersten Weltkrieg übernommen und bildete dann die Vorlage für das Wappen der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen autonomen Region. Nach langen Diskussionen korrigierte man schließlich im Jahr 1999 durch ein Regionalgesetz den Irrtum, und die Binden rückten von den Augen wieder auf die Stirn zurück.
Erinnerung und Gegenwart
Ich reise seit fast vierzig Jahren immer wieder nach Sardinien. Oft im Schlepptau meiner Frau, die auf der Insel geboren wurde und hier ihre Kindheit verbracht hat. Eigentlich will sie nicht im Buch erwähnt werden, aber ich möchte mich trotzdem bei ihr und ihrer Familie bedanken, denn ohne sie hätte ich Sardinien nie so intim kennengelernt. Sarden sind sehr zurückhaltend, sie achten besonders auf ihre Privatsphäre und lassen Fremde noch weniger gerne in ihre Angelegenheiten gucken als andere. Ihre Gastfreundschaft ist jedoch sprichwörtlich, und Reisende werden das vielleicht in kleinen Hotels oder Pensionen (Bed & Breakfast) spüren, auch wenn sie nicht das Glück haben, von einer Familie aufgenommen zu werden.
In den vierzig Jahren hat sich viel verändert auf Sardinien. Lastwagen donnern über manche Straßen, der Verkehr staut sich nicht mehr nur um Cagliari, und Einkaufszentren belagern die Städte. Die Insel hat sich in einem Tempo modernisiert, das atemberaubend ist. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, laufen hier mehr als anderswo verschiedene Zeitschichten nebeneinander her. Anders als bei uns zu Hause, wo Gegenwart alles beherrscht, Vergangenheit nur stört und Zukunft sich immer mehr auf die Erfüllung eines Konsumwunsches reduziert. Rückblicke gerieren da oft zur Nostalgie nach einem Gestern, bei dem alles besser war. Das Beispiel Sardinien zeigt deutlich, dass früher nicht alles besser war, ganz im Gegenteil. Es zeigt vor allem, dass es anders war. Wie dieses Anderssein heute noch durchscheint, welche Chancen der Entwicklung genutzt wurden und welche nicht, das ist das Spannende. Und manches, was noch vor vierzig Jahren Alltag war, überlebt heute nur in den schützenden Räumen der Traditionspflege.
Zum Beispiel das Morra-Spiel oder sa murra, wie es auf Sardisch heißt. Das gehörte anfangs für mich zu den Überfahrten mit der Fähre einfach dazu: zwei oder vier Männer – umringt von einer Zuschauergruppe –, die mit ausgestreckter Hand eine Anzahl von Fingern zeigen und sich Zahlen, natürlich in sardischer Sprache, an den Kopf werfen: battoro (vier), nobe (neun), kimbe (fünf), deghe (zehn) usw. Das spielt sich dann wahnsinnig schnell ab, die Teilnehmer müssen dabei die Gesamtzahl der gezeigten Finger erraten. Wem das gelingt, der bekommt einen Punkt. Gewonnen hat der, der als Erster eine festgelegte Punktzahl erreicht (meistens 16 oder 21). Es ist ein uraltes Spiel, das vermutlich aus Ägypten stammt, bereits von Autoren der Antike erwähnt wird und in ähnlicher Form auch auf Korsika, in Spanien (Aragonien) oder in Italien im Trentino vorkommt. Im Mittelalter war es zeitweise verboten, weil es nicht selten im Streit und in handgreiflichen Auseinandersetzungen endete. Im Faschismus wurde Morra als Glücksspiel eingestuft und das demokratische Italien hat das Verbot (für Spiele in der Öffentlichkeit) übernommen, auf Sardinien wurde es dennoch mit stiller Duldung der Behörden weiter praktiziert. Als ein spontanes Spiel vor der Bar oder in der Trattoria (und auf den Fähren) ist es inzwischen verschwunden, dafür gibt es überall auf der Insel Vereinigungen, die die Tradition hochhalten. In Urzulei, einem kleinen Ort der Ogliastra an den Ausläufern des Gennargentu, werden darin seit 1998 sogar sardische Meisterschaften ausgetragen.
Sehnsucht nach »mehr«
Reisende bewegen sich in der Regel auf den Spuren anderer Reisender. Reiseführer geben Wege vor, die bereits eingefahren sind. Und auch Autoren von Reisebüchern folgen den Texten von anderen Autoren. Das ist bei dieser »Gebrauchsanweisung« nicht anders. Sie möchte aber als Reisebuch landeskundliche Untersuchung einfließen lassen und eine Ahnung von einer Humangeografie Sardiniens vermitteln, die es in deutscher Sprache noch nicht gibt. Seine Grundlage ist die journalistische, nicht die wissenschaftliche Recherche. Ohne die vielen anderen Reisenden und Autoren, die in der Literaturliste am Ende genannt werden, hätte ich dieses kleine Buch allerdings nicht schreiben können. Ihre Texte haben mir manchmal die Augen geöffnet für das, was ich immer schon gesehen, aber nie wahrgenommen habe. Viele Gedanken anderer sind also mit eingeflossen, auch da, wo sie nicht als Zitate gekennzeichnet sind. Die Zitate wiederum sind über den Namen des Autors leicht den in der Literaturliste aufgeführten Arbeiten zuzuordnen. Weniger leicht zuzuordnen (und damit zu kontrollieren) sind die Interviews, die ich in den vergangenen Jahrzehnten auf Sardinien geführt habe, als ich mich für Zeitungen oder für den Rundfunk mit Themen dieser faszinierenden Insel auseinandergesetzt habe. Viele Aspekte konnten dabei leider nur gestreift werden, gut informierte Leser werden vielleicht gerade ihren Lieblingsort vermissen oder andere Erfahrungen gemacht haben. Ich habe mich bemüht, ein Gesamtbild zu vermitteln und auch die Schattenseiten nicht auszuklammern, jedoch ist dieses Bild gleichsam von Hand gemalt, durch einen ganz subjektiven, manchmal sogar privaten Blick geprägt, so wie man anderen Personen einen guten Freund vorstellt oder einem Besucher beim Rundgang sein Stadtviertel zeigt. Zu großem Dank bin ich all denjenigen Menschen Sardiniens verpflichtet (wo immer sie leben), denen ich begegnet bin, die sich Zeit genommen haben, mit mir zu reden, und die mich mit ihren Ideen unterstützt und mit ihren Kenntnissen bereichert haben.
Die Erfahrungen eines Einzelnen mögen begrenzt sein, doch sie sind Teil einer Reiselust, die andauern wird, solange Menschen Neugier auf fremde Kulturen und für andere Menschen entwickeln, sie in ihrem Anderssein, Fremdsein ernst nehmen und das Reisen als Bereicherung der persönlichen Kultur verstehen. Solange man auf seinen Reisen aber auch als Botschafter der eigenen Kultur auftritt, die man nicht zu verleugnen braucht. Wer schaulustig und neugierig ist, wer mehr will als nur Sonne und kristallklares Wasser, kurz: wer »Sehnsucht nach mehr« verspürt, den wird Sardinien reich beschenken. Für diese Neugierigen habe ich das Buch geschrieben, um ihnen Wege für eigene Entdeckungen zu öffnen. Die Besserwisser werden vermutlich enttäuscht sein. Macht nichts: Gute Reise auch ihnen!
Henning Klüver, im Frühjahr 2012
Nebel vor Porto Torres – Annäherungen
Es gibt Tage, da zieht Nebel auf und du denkst, das darf doch nicht wahr sein. Da fährt man nach Sardinien, und das Fährschiff kann in den Hafen von Porto Torres nicht einlaufen, weil der Nebel so dick steht wie sonst in Cuxhaven nicht und auch in Mailand schon lange nicht mehr. Wer frühmorgens, etwa im März oder April, kommt, lernt schnell: Sardinien mag eine Sonneninsel sein, aber auch hier dauert der gewiss lange Sommer keine 365 Tage. Und es gibt Tage, da schlägt das Wetter Kapriolen.
Erste Annäherung: mit der Fähre
Die Anreise über das Meer ist immer noch die schönste und auch die älteste. So reisten Menschen bereits in der grauen Vorzeit, als die vielen Nuraghen-Türme auf der Insel noch keine archäologischen Zeugen waren, sondern lebendiger Ausdruck einer großartigen Kultur. Im Augenblick sieht man aber nichts von ihnen, Sardinien liegt im Nebel, so als wolle es seine Geheimnisse nicht preisgeben. Vielleicht ist alles nur ein Traum? Das schwere Fährschiff zittert leicht, weil die Motoren leerlaufen. Und auf dem Deck vor dem Büro des Commissario di bordo, des Zahlmeisters, kommen immer mehr Menschen zusammen, teils mit ihrem Gepäck, weil die Ankunft ja nicht mehr weit sein kann, teils um zu erfahren, wie lange diese Dümpelei eigentlich noch dauern soll. Andere wiederum nützen die Zeit, um in einer der Bars noch einen Cappuccino zu trinken und eine weitere Brioche zu kaufen. Tonio, einer meiner zahlreichen sardischen Verwandten, glaubt, das sei der einzige Grund für die Verspätung. Die Fährgesellschaft wolle nur noch mal schnell die Morgenkasse auffüllen. Gäbe es nicht heute genügend technische Mittel, um auch bei Nebel in einen Hafen einzulaufen? Tonio denkt wie so viele Sarden (und so viele Italiener) realistisch. Sie haben gelernt, dass sich immer irgendjemand auf ihre Kosten bereichern will. Da ist Misstrauen angesagt, wenn plötzlich etwas nicht so klappt, wie es klappen soll. Aber als romantischer Deutscher gefällt mir dieser Nebel und die Vorstellung, dass Sardinien ein Traum sein kann. Ich gehe nach draußen auf das Bootsdeck, schlage den Jackenkragen hoch und atme tief die salzige Morgenluft ein. Möwen rufen und kündigen das Festland an. Man kann sie zwar nicht sehen, der Hafen muss jedoch ganz in der Nähe sein. Irgendwo hinter dem weißen Vorhang, der ganz lebendig flimmert, als sei er mit Glühwürmchen durchsetzt, liegt die Insel mit ihrer weiten Landschaft, ihrer Geschichte und ihren Geschichten. Und jede Reise zu ihr wird zu einem neuen Abenteuer.
Das erste Mal fuhr ich in meiner Studentenzeit mit der Eisenbahnfähre (die so hieß, weil sie von den Ferrovie dello Stato, der staatlichen italienischen Eisenbahngesellschaft betrieben wurde) von Civitavecchia nach Golfo Aranci. Das war in einem September Mitte der Siebzigerjahre, und ich hatte keine Ahnung, dass dieser Überfahrt noch so viele andere folgen würden. Ich staunte, wie die Autos, die diese Fähre transportierte, nicht über eine Rampe in den Bauch des Schiffes fuhren, sondern mit einem Kran und einer netzartigen Vorrichtung an Bord gehievt wurden. Damals rollte ich mich an einem warmen Sommerabend wie so viele andere Passagiere draußen an Deck in meinen Schlafsack, denn das Geld für einen Platz im Schlafsaal zweiter Klasse mit seinen unbequemen Liegesesseln und dem penetranten »Duft« von Schweißfüßen konnte man sich wirklich sparen. Draußen atmete man die mit einem leichten Dieselgeruch (aber der schien uns wie Parfüm) durchsetzte Seeluft, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und blickte in einen Himmel voller Sterne. Vom sanften Auf und Ab der Überfahrt und der leisen Melodie der Maschinen ließ ich mich in den Schlaf wiegen. Irgendwann wachte ich mit Salzgeschmack auf den Lippen auf, es war empfindlich kalt und feucht geworden, und es schien, als hätte sich der Dieselgeruch wie ein öliger Film auf die Planken geschlagen. Ich stand auf, die Dämmerung kroch aus dem Meer, und ganz still tauchte mit ihr steuerbord ein riesiges weißes Ungeheuer aus dem Wasser auf. Mein Gott, was war das denn? Das war die Tavolara, eine im Nordosten Sardiniens vorgelagerte, hoch aufgerichtete Felseninsel. Wie von Geisterhand erwachte das Schiff, die Leute strömten an Deck, man rauchte die erste Zigarette, und über Lautsprecher wurde angekündigt, dass die Bar öffnete und die Fähre bereits Kurs auf Golfo Aranci nähme.
Die Könige der Tavolara
Die 6 Kilometer lange Isola Tavolara, an der man ganz nah vorbeifährt, wenn man das Schiff nach Olbia nimmt, ist der erste Gruß Sardiniens an den Reisenden, der von Osten kommt. Die Tavolara gilt als die Insel des Götterboten Hermes (Isula Hermaea hieß sie in der Antike), weil man gleichsam Flügel braucht, um das über 500 Meter hohe Plateau aus Kalkstein zu erreichen, wo der Bergahorn gegen den aus Nordwest wehenden Mistral kämpft, eine seltene Form des gelben Ochsenauges blüht und Schnabelsturmtaucher wie Wanderfalken nisten. An windgeschützten Landzungen wachsen duftender Rosmarin, Ginster und Oleaster, die kleine Haine bilden können; in Meeresgrotten suchen Mönchsrobben Schutz. Die Insel ist mit ihrem durchsichtigen Wasser ein Paradies, sowohl für leidenschaftliche Taucher als auch für Wanderer. Leider sind echte Wildziegen und Wildhasen heute so gut wie ausgestorben, und die verwilderten Ziegen, die es noch gibt, stammen von einer Herde, die irgendwann von seinem Eigentümer verlassen wurde.
Dante soll angeblich das felsige Eiland als Vorbild für seinen Läuterungsberg in der Göttlichen Komödie (im Fegefeuer) genommen haben. Erste Menschen haben hier vielleicht vor viertausend Jahren Fuß gefasst, doch die Tavolara blieb auch für lange Perioden immer wieder unbesiedelt. Im 19. Jahrhundert wanderte dann die Familie Bertoleoni aus Korsika (nach anderen Quellen aus Genua) hier ein. Nicht fehlen darf deshalb die Geschichte von den »Königen der Tavolara«, von der es mehrere Varianten gibt. Eine lautet so: Als der Savoyer-König Carlo Alberto bei einem Sardinienbesuch 1836 zur Ziegenjagd auf die Tavolara kam, soll ihm ein Bertoleoni-Junge den Gruß seines Vaters ausgerichtet haben: »Der König von Tavolara heißt den König von Sardinien willkommen und wünscht eine gute Jagd.« Carlo Alberto reagierte amüsiert und schenkte angeblich Vater Bertoleoni nach erfolgreicher Jagd die ganze Insel samt dem Ehrentitel »König von Tavolara«. Andere erzählen, er habe das getan, weil die Ziegen »goldene Zähne« hatten (eine Verfärbung des Zahnschmelzes wegen einer besonderen Futterpflanze). Wie auch immer, die Familiengrabstätte der »Könige von Tavolara« ist auf dem klitzekleinen Friedhof des Eilands mit einer Krone geziert. Die Nachfahren der Bertoleoni betreiben heute eines von zwei Restaurants der Insel. Kulturell ist sie ebenfalls interessant: Jeweils Ende Juli findet hier seit mittlerweile zwanzig Jahren ein gut besuchtes Festival mit neuen italienischen und sardischen Filmen statt.
Auf der Tavolara mischen sich aufregende landschaftliche Schönheiten und ein riesiger Bund Geschichten. Die Insel wirkt irgendwie zeitlos, denn wenn man sich die paar Häuser wegdenkt, hat es hier vor drei- oder viertausend Jahren nicht viel anders ausgesehen – typischer könnte Sardinien seine Gäste nicht begrüßen. Ins Bild passt auch, dass ein Teil der Tavolara als militärisches Sperrgebiet der NATO unzugänglich, gleichsam besetzt ist, da sich Sardinien im Laufe seiner Geschichte immer mit irgendwelchen Besatzern arrangieren musste.
Während für den Reisenden aus anderen Ländern die Fähre ein Zubringer ins Abenteuer sein kann, umweht sie für Einheimische nicht selten ein Hauch von Melancholie. Man musste sie früher benutzen, um die Insel zu verlassen. Als Fliegen noch ein Luxus war, stieg man auf die Fähre, um zum Militärdienst zu fahren, zu einer schwierigen Operation in einem Krankenhaus des continente, um anderswo Arbeit zu suchen oder zu einer Prüfung für den Staatsdienst. Heute, sagt der Schriftsteller Salvatore Mannuzzu, könne man das Flugzeug nehmen, aber die Nächte, die man bei der Überfahrt auf dem Meer verbracht habe, »bleiben eine kulturelle Erinnerung«. Sich von der Heimat zu lösen ist für viele Sarden ein schmerzlicher Schritt. Man verlässt den festen, bekannten Boden und begibt sich aufs Meer mit seiner Weite, seiner Leere und den vielen Gefahren einer ungewissen Zukunft. Wenn die Motoren anlaufen, das Schiff anfängt zu vibrieren und die Möwen ihr Abschiedslied singen, dann wächst jedes Mal die Angst, der Abschied könne unwiderruflich der letzte sein – auch wenn ihm noch viele weitere folgen.
Zweite Annäherung: mit dem Flugzeug
Es gibt Tage, die sind wolkenverhangen, und man fällt geradezu von einem Leben in ein anderes. Eben noch dem Mailänder Verkehr entkommen und das Niemandsland des Flughafens Malpensa durchschritten, durchsticht man die letzte Wolkenschicht und fliegt an der Hafenfassade von Cagliari vorbei, sieht die Via Roma mit ihrer langen ernsten Häuserfront und dem abstrus-historistischen Rathaus, streicht über den Stagno di Santa Gilla, die sich weit ausbreitende Westlagune, und setzt auf der Rollbahn vom Flughafen Elmas auf. Wieder ein paar Schritte durch die Schleusen eines Niemandslands und man ist da. Man spürt sogleich, dass hier vieles anders ist, obgleich man das gar nicht so genau benennen kann. Gewiss, hier stehen Palmen, aber es existieren genauso Autobahnzubringer, moderne Häuser, Stadtverkehr, ein Bahnhof für Busse und der staatlichen Eisenbahnen… Vielleicht ist es das Licht, eine Stimmung, der erste Kontakt mit den Menschen. Mit dem Busfahrer am Flughafen etwa, den man fragt, ob man im Bus die Fahrkarte kaufen kann, weil der einzige Automat, den man im Ankunftsgebäude entdeckt hat, streikt. »Salga« (Steigen sie ein), sagt er, »das regeln wir bei der Ankunft!« Und dann fährt man die paar Minuten zum Busbahnhof an der Piazza Matteotti, steigt aus, folgt dem Fahrer und den anderen, die ebenfalls keine Fahrkarte haben, geht durch die vom Geruch nach frittiertem Fett gesäuerte Luft eines McDonald’s, der sich hier eingenistet hat, und landet schließlich vorm Schalter der Busgesellschaft, wo man sich die Karte kauft und gleich wieder wegwerfen kann. Auf der Piazza grüßen mächtige, hundertjährige Feigenbäume den Gast.
Man sollte sich, vom Norden kommend, beim Einchecken für den Flug nach Cagliari einen Fensterplatz auf der rechten Seite geben lassen. Dann hat man, gutes Wetter vorausgesetzt, einen schönen Blick zunächst auf Korsika. Bei der Kontinentalverschiebung im Tertiär (vor gut 65 Millionen Jahren) lösten sich Korsika und Sardinien als ein zusammenhängender Landblock vom europäischen Festland, etwa in der Position des heutigen Südfrankreichs. Auf seinem Weg in den Süden drehte sich die Landmasse um rund 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn und zerbrach schließlich, wobei Korsika und Sardinien getrennt wurden. Beim Flug kann man deutlich die Bocche di Bonifacio erkennen, die Meerenge, welche die beiden Inseln heute trennt. Sie ist wegen schwieriger Strömungsverhältnisse, den vielen Klippen und des oft stürmischen Wetters bei Seeleuten gefürchtet. Viele Schiffe sind hier im Laufe der Jahrhunderte zerschellt, und seit dem Unglück eines Tankers im Jahr 1999 dürfen Schiffe, die umweltgefährdende Substanzen geladen haben, gar nicht mehr passieren.
Geologisch ist die Landmasse Sardiniens also sehr viel älter, als seine heutige Position vermuten lässt. Sie ist auch älter als die italienische Halbinsel und unterscheidet sich von ihr deshalb vollkommen in ihren Stein- und Erdformationen. In vielen Millionen Jahren hat sich das Land gehoben oder gesenkt, wurde vom Meer überflutet und trocknete wieder aus, Vulkane taten sich auf und erloschen wieder, und ein Graben brach im südlichen Teil ein (die heutige Ebene des Campidano). Ablagerungen und Auswaschungen haben vielfältige geologische Schichtungen hervorgebracht. Deshalb heißt es auch, als Gott die Erde schuf, blieben ihm von allen Teilen der Welt noch ein paar Krümel übrig. Er knetete sie zusammen, warf sie ins Mittelmeer und trat mit dem Fuß darauf. So entstand Sardinien. Die Griechen nannten die Insel Hyknusa oder Ichnusa (Sohle), weil ihre Form sie an einen Fußabdruck erinnerte. »Ichnusa« ist heute unter anderem der Name eines einheimischen hellen Lagerbiers, das in Assemini bei Cagliari gebraut wird, inzwischen aber zum niederländischen Großkonzern Heineken gehört. Historiker kennen auch die Zeitschrift Ichnusa, die von Antonio Pigliaru 1949 in Sassari gegründet wurde und um die sich bis zu ihrer Einstellung 1956 die junge Intelligenz der Insel versammelte.
Die Stele von Nora
Die Intelligenz der Antike, Schriftsteller wie Sallust oder Pausanias, erzählen, dass ein gewisser »Sardus«, Sohn des Herkules, zusammen mit einem Volksstamm aus Libyen nach Sardinien eingewandert sei und den alten Namen der Insel von Ichnusa in Sardò verändert habe. Eine Gottheit »Sardus Pater« wurde, wie Sallust berichtet, im antiken Antas (bei Fluminimaggiore) verehrt. In Nora, einer Ruinenstadt bei Pula im Süden Sardiniens, fand man bei Ausgrabungen eine Tafel mit einer phönizischen Inschrift aus dem 9. Jahrhundert. Diese »Stele von Nora« gilt als das älteste schriftliche Dokument im westmediterranen Raum. In Konsonantenschrift kann man auf ihr das Wort b-šrdn lesen, was übersetzt Sardinien bedeutet. Es gibt Wissenschaftler, die vermuten, dass sich der Name der Insel von dem alten Seevolk der Šardana (Scherden) ableitet, die auf Sardinien auch die Nuraghen-Kultur hervorgebracht haben könnten. Doch viele dieser Forschungen sind reine Interpretationsfragen. Die Nebel um den vorgeschichtlichen Verlauf und die Rolle, die dabei sagenhafte Seevölker wie die Scherden im mediterranen Raum gespielt haben könnten, lassen sich nur schwer lüften.
Den Flug über die Insel kann man übrigens ganz gut mit Google Earth simulieren, wenn man »Capo Testa, Sardinien« eingibt und sich dann nach Süden weiterbewegt. Man erkennt schnell, dass die Insel zwar im Unterschied zu Korsika weniger hoch und gebirgig erscheint, aber dennoch zerklüftet, vielfach sogar undurchdringlich wirkt. Von ausgedehnten Wäldern bedeckt und von Schluchten zerrissen, vermittelt dieses Landschaftsbild eine erste Ahnung von den Schwierigkeiten der Menschen vergangener Zeiten, sich außerhalb ihrer Siedlungen zu bewegen. Eroberer besiedelten kaum mehr als die Küstenbereiche, fremde Einflüsse prallten vom Inneren weitgehend ab. Deshalb hat sich hier mit der sardischen Sprache – sa limba sarda – auch eine der ältesten neolateinischen Sprachen erhalten. Linguisten sprechen sogar von drei verschiedenen Sprachen: dem Logudorese im Zentrum und im Westen, dem Campidanese im Süden und dem (allerdings stärker vom Toskanischen und dem Korsischen durchsetzten) Gallurese im Norden mit einer eigenen Dialektform, dem Sassarese. Wer spätabends fliegt, erlebt deshalb Sardinien als eine von Lichtern nur teilweise gesäumte Küste und eine weite stille Dunkelheit, die erst im dicht besiedelten Großraum Cagliari von glitzernden Lichtflecken abgelöst wird.
Sassari, die zweitgrößte Stadt, kann man gut sehen, wenn man vom Raum Mailand kommend nach Alghero fliegt. Dann sollte man sich aber einen Fensterplatz auf der linken Seite geben lassen. Von dem kann man zwischen Korsika und Sardinien die Granitklippen und das Archipel der Maddalena im Osten erkennen. Vom Golfo dell’Asinara und von Porto Torres geht es dann mit Blick auf die Strände der Asinara in einem Bogen über weitgehend flaches oder leicht gewelltes Land, das teils von Buschwerk bedeckt ist, teils auch landwirtschaftlich (etwa durch Weinanbau) genutzt wird. Schließlich fliegt man entlang der Küste, mit Blick auf Sassari im Hintergrund, zum Flughafen Fertilia, wo einen beim Verlassen des tiefgekühlten Flugzeuges wohlige Wärme und ein Gemisch aus würzigem Duft von Macchia und Meer empfängt.
Dritte Annäherung: mit Reisenden anderer Zeiten – von La Marmora bis Maltzan
Via Alberto La Marmora – dieser Straßenname taucht in fast allen sardischen Ortschaften auf. La Marmora gehörte zu einer piemontesischen Offiziersfamilie und diente in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele Jahre als Militärkommandant im Generalsrang auf Sardinien. Ausgebildet wurde er unter Napoleon (der ihn 1813 in Dresden mit dem Orden der Ehrenlegion auszeichnete). Während seiner Studien an der Militärakademie von Fontainebleau belegte er auch mathematische und naturwissenschaftliche Fächer und erwarb sich bald mit Veröffentlichungen etwa über die Küstenformationen Sardiniens früh den Ruf eines Wissenschaftlers. Zu seinen Hauptwerken gehören zwei in französischer Sprache abgefasste Reisebeschreibungen der Insel, in denen er – den Schriften eines Alexander von Humboldt verwandt – natürliche Beobachtungen mit der Geschichte des sardischen Volkes verband. Auf den Spuren dieser Beschreibungen reisten die Sardinienbesucher des 19. Jahrhunderts. Doch es waren wenige, und einige kamen gar nur zufällig.
Am 10. Februar 1868 schiffte sich Heinrich Freiherr von Maltzan zu Wartenberg und Penzlin in Palermo ein, um nach einer 25-stündigen Überfahrt Cagliari zu erreichen, wo er »entzückt vom Anblick dieses herrlichen Golfes« an Land ging. Eigentlich wollte er hier nur umsteigen, um das Schiff nach Tunis zu nehmen, da es von Palermo aus keine Direktverbindung nach Nordafrika gab. Aber das Boot nach Tunis war wenige Stunden vor Maltzans Ankunft in Cagliari abgefahren, und so musste der Freiherr sieben Tage auf die nächste Verbindung warten. Was er in dieser Woche erlebte, beeindruckte ihn so tief, dass er beschloss, auf dem Rückweg von Tunis mehrere Monate auf der Insel zu verbringen. Über seine Erlebnisse berichtet er in seinem Buch Reise auf der Insel Sardinien. Nebst einem Anhang über die phönicischen Inschriften Sardiniens, das ein Jahr später im Verlag der Dyk’schen Buchhandlung Leipzig erschien. »Man möchte glauben, dass diese Insel gar nicht in Europa läge, so wenig kümmert man sich um sie. Namentlich in Deutschland scheint man dieses interessante Stück Erde sehr zu unterschätzen. Dass das Land einige landschaftliche Schönheit besitzt, dass es eine interessante Fauna aufzuweisen hat, und dass sich daselbst große, geheimnisvolle, thurmartige Denkmäler, die Nuraghen, befinden, das wäre so ziemlich Alles, was man in unserem Vaterland von Sardinien wissen dürfte.«
Ende der Leseprobe