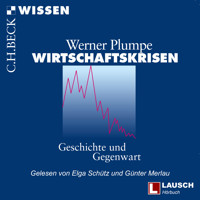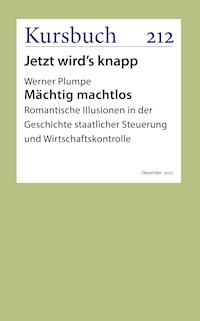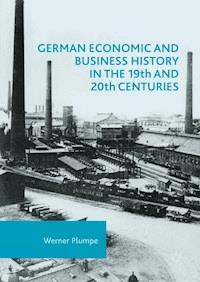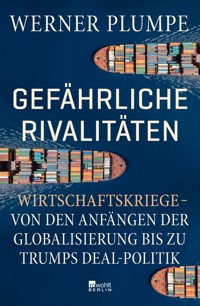
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dass die bislang geltende Weltordnung an ihr Ende gekommen ist, zeigt sich nicht nur an zunehmenden Kriegen und Eskalationen, sondern auch an sich verschärfenden Handelskonflikten – am dramatischsten und weitreichendsten zwischen China und den USA, jüngst aber vor allem mit Russland, der Zuspitzung des globalen «Chipkriegs» oder Donald Trumps radikaler Zollpolitik unter anderem gegen die EU. In einem fesselnden Panorama führt uns Werner Plumpe vor Augen, wie die Geschichte immer schon von wirtschaftlichen Rivalitäten geprägt war, die nicht selten in offene Kriege mündeten – von der Eroberung der Neuen Welt und den Anfängen der Globalisierung über das Zeitalter des Kolonialismus, die Entstehung von Nationalstaaten und die bipolare Weltordnung des Kalten Kriegs bis in die hypervernetzte Welt von heute. Ob Gold, Öl, Baumwolle, Kakao oder Getreide: Die Suche nach lukrativen Rohstoffen zieht sich wie ein Band durch die Jahrhunderte, und immer zeugt sie davon, dass sich ökonomische Interessen auf komplexe Weise mit Fragen nationaler Identität, kulturellen Ideen und machtpolitischen Strategien überlagern. Ein mitreißendes Buch, das uns die globalen Konflikte der Gegenwart und Zukunft verstehen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Werner Plumpe
Gefährliche Rivalitäten
Wirtschaftskriege – von den Anfängen der Globalisierung bis zu Trumps Deal-Politik
Über dieses Buch
Dass die bislang geltende Weltordnung an ihr Ende gekommen ist, zeigt sich nicht nur an zunehmenden Kriegen und Eskalationen, sondern auch an sich verschärfenden Handelskonflikten – am dramatischsten und weitreichendsten zwischen China und den USA, jüngst aber vor allem mit Russland, der Zuspitzung des globalen «Chipkriegs» oder Donald Trumps radikaler Zollpolitik unter anderem gegen die EU. In einem fesselnden Panorama führt uns Werner Plumpe vor Augen, wie die Geschichte immer schon von wirtschaftlichen Rivalitäten geprägt war, die nicht selten in offene Kriege mündeten – von der Eroberung der Neuen Welt und den Anfängen der Globalisierung über das Zeitalter des Kolonialismus, die Entstehung von Nationalstaaten und die bipolare Weltordnung des Kalten Kriegs bis in die hypervernetzte Welt von heute. Ob Gold, Öl, Baumwolle, Kakao oder Getreide: Die Suche nach lukrativen Rohstoffen zieht sich wie ein Band durch die Jahrhunderte, und immer zeugt sie davon, dass sich ökonomische Interessen auf komplexe Weise mit Fragen nationaler Identität, kulturellen Ideen und machtpolitischen Strategien überlagern. Ein mitreißendes Buch, das uns die globalen Konflikte der Gegenwart und Zukunft verstehen lässt.
Vita
Werner Plumpe, geboren 1954 in Bielefeld, ist emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Bis 2012 war er Vorsitzender des Deutschen Historikerverbands und schrieb regelmäßig als Kolumnist für die «Wirtschaftswoche». 2010 erschien «Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart», 2012 «Wie wir reich wurden» (mit Rainer Hank), 2014 «Die Große Depression» (mit Jan-Otmar Hesse und Roman Köster) und 2019 «Das kalte Herz. Kapitalismus: Die Geschichte einer andauernden Revolution». 2014 erhielt Werner Plumpe den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Getty Images
ISBN 978-3-644-02174-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung:Der Wirtschaftskrieg als Schicksal? Kooperation und Konflikt im ökonomischen Wandel
Im Jahr 1601 kaperten portugiesische Seeleute vor der chinesischen Küste unter Berufung auf ihre Monopolrechte im asiatischen Raum ein niederländisches Schiff, töteten fast die gesamte Besatzung und eigneten sich dessen Ladung an. Daraus entwickelte sich ein Handelskrieg, der noch heute aufschlussreich ist. Denn nur wenig später enterte ein Schiff der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) in der Straße von Malakka ein portugiesisches Schiff, dessen Ladung man in Amsterdam vor das Admiralitätsgericht brachte, um sie legal verwerten zu können. Zu ihrer Rechtfertigung legte die VOC ein Rechtsgutachten vor, das das Kapern des Schiffes mit dem Hinweis auf die Freiheit der Meere begründete, die Portugal nicht respektiere. Das wiederum provozierte eine portugiesische Stellungnahme. Nicht nur habe Portugal vom Papst legitimierte Monopolrechte in Asien. Es seien gerade auch die Kosten für die Erschließung und die Sicherung der Handelswege, die eine Monopolstellung rechtfertigten – und diese habe nun einmal Portugal zu tragen.
Die Handelskonkurrenz zwischen den Niederlanden und Portugal wurde schließlich gewaltsam zugunsten der niederländischen Kaufleute entschieden, doch die Problemstellung gilt bis zum heutigen Tag: Rechtfertigen die Kosten der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Ordnung, dass deren Träger die Vorteile dieser Ordnung allein oder zumindest vorrangig für sich in Anspruch nehmen und andere davon ausschließen darf? Oder muss er es hinnehmen, dass andere, obwohl sie für die Kosten nicht aufkommen, nicht nur vom Rahmen dieser Ordnung profitieren, sondern diesen unter Berufung auf die «Freiheit der Meere» sogar mit erheblich geringerem Aufwand nutzen können und sich so große wirtschaftliche Vorteile verschaffen, gerade weil sie die Kosten nicht oder kaum tragen?[1]
Dieser Konflikt, der keine Frage der Moral, sondern Ausdruck eines objektiv existierenden Problems ist, liegt hinter dem Auf und Ab von Wirtschafts- und Handelskriegen, die seither in unterschiedlichen Formen die Welt beschäftigten. Je nachdem, wie dieser Konflikt reguliert oder auch nur wahrgenommen wurde, entwickelten sich Rivalitäten unter Umständen zu produktivem wirtschaftlichen Wettbewerb – oder es kam zu gefährlichen Konfrontationen, speziell dann, wenn sich das Ziel ökonomischen Vorteils mit politischem und militärischem Dominanzstreben verband. Ob die aufgeworfene Frage nach der Nutzung einer Ordnung je grundsätzlich entschieden werden kann, muss offenbleiben. Lehrreich ist indes ein Blick darauf, welche Antworten in den vergangenen Jahrhunderten darauf gegeben wurden. Mit der Straße von Malakka, dem Nadelöhr vor Singapur und Malaysia auf dem Handelsweg von und nach China, spielt die Geschichte von Wirtschaftskriegen heute aktueller denn je an einem Ort, an dem sie sicher nicht begann, wohl aber ihre semantische Rahmung entscheidend provoziert wurde.
Es wäre zweifellos übertrieben, das gegenwärtige Verhältnis der USA zu China mit dem Portugals gegenüber der aufstrebenden niederländischen Handelsflotte zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu vergleichen, aber erhellend ist die Perspektive allemal. Denn der Aufstieg Chinas vollzog sich im Rahmen einer vor allem von den USA garantierten weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, die es chinesischen Anbietern leicht und vor allem kostengünstig ermöglichte, große Teile des Weltmarktes zu erreichen und nach und nach zu dominieren. Die Versuche der Vereinigten Staaten, den chinesischen Aufstieg zu bremsen – auch wenn dies unter Umständen eine Beschädigung der globalen Arbeitsteilung bedeutet –, sind jedenfalls der wesentliche Grund der weltweiten ökonomischen Turbulenzen, die sich seit geraumer Zeit beobachten lassen. Mit dem Ende eines von den USA dominierten Zeitalters der Globalisierung nähert sich die Welt heute einem Zustand des Ordnungsverlustes, der die kommenden Jahre unter ein großes Fragezeichen stellt. Dieser Zustand ist historisch nicht neu. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht wechselten Phasen geregelter und friedlicher ökonomischer Arbeitsteilung mit heftigen Konflikten, die von Momenten des Wirtschaftskrieges bis hin zu gewaltsam ausgetragenen Auseinandersetzungen geprägt waren. In der folgenden Darstellung geht es darum, die historischen Linien dieser «Wellenbewegung» und die Muster nachzuzeichnen, die den Umschlag von Rivalitäten in offenen Konflikt oder in eine zumindest zeitweilige Herausbildung geordneter Kooperationen markierten. Rivalitäten sind der Normalzustand; entscheidend ist, wann sie gefährlich werden und das Potenzial besitzen, die Regeln der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – letztlich zum Nachteil aller – zu zerstören. Dass eine solche Fragestellung angesichts der gegenwärtigen weltweiten Entwicklungen eine besondere Aktualität besitzt, wird niemand bestreiten wollen. Historisches Wissen wird die derzeitigen Konflikte, ja ihre Zuspitzung in der kommenden Zeit nicht aufhalten können, aber es kann die Aufmerksamkeit dafür erhöhen, was eine kurzfristige und unüberlegte Politik anrichten kann.
Der Wirtschaftskrieg, das heißt der Konflikt um Macht und Vorteile im zwischenstaatlichen Handel und bei der Organisation und Strukturierung von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Austauschprozessen, ist ein altes Phänomen. Es genau einzugrenzen, ist gar nicht so einfach, denn klar isolierbar sind Wirtschaftskriege nur in seltenen Fällen. Vielmehr gibt es große Unterschiede bezüglich Art und Ausmaß der jeweiligen Auseinandersetzungen. Das betrifft zum einen die Zahl der beteiligten Akteure, zum anderen geht es in Wirtschaftskriegen zumeist nicht ausschließlich um wirtschaftliche Fragen. Allerdings sind Letztere im Laufe der Jahrhunderte immer wichtiger geworden. In der Gegenwart kommt ökonomischen Gesichtspunkten eine überragende Bedeutung zu, da die wirtschaftlichen Handlungsspielräume der Regierungen in der Regel die politischen durchaus bestimmen.
Das war zwar im Grunde auch in der Vormoderne schon so, doch hat sich der Charakter von Konflikten, nicht zuletzt militärischen Auseinandersetzungen, im Zuge des technologischen Wandels strategisch und taktisch völlig verändert. Während es in der Vormoderne vor allem darum ging, einen exklusiven Zugriff auf Ressourcen, Handelswege und Lieferketten zu erlangen, gewann spätestens zum Ende des 17. Jahrhunderts – explizit formuliert in den Agenden des Merkantilismus – die Stärkung der eigenen Produktionskraft und die Schwächung der Möglichkeiten realer oder potenzieller Gegner an Bedeutung. Handels- und Wirtschaftskriege dienen seither explizit der Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik, die sukzessive in den Vordergrund entsprechender Bemühungen trat.
Es war die so mögliche wirtschaftliche Stärke, die schließlich in den großen Auseinandersetzungen des 18. Jahrhunderts etwa den Ausschlag zugunsten Großbritanniens gab, das schlicht produktiver wirtschaftete als die kontinentaleuropäische Konkurrenz und sich daher – allerdings erst nach jahrzehntelangen Kämpfen – gegen sie durchsetzen konnte. Dabei blieb es nicht stehen. Der Schutz und die Förderung der eigenen «produktiven Kräfte» mit zum Teil durchaus robusten Mitteln änderten sich, nachdem die britische Wirtschaft eine Dominanz erreicht hatte, die die kontinentale Konkurrenz nicht mehr fürchten musste. Die von England weiterhin betriebenen Handels- und Wirtschaftskriege bekamen nun ein anderes Ziel. Es ging nicht mehr um den Schutz der heimischen Wirtschaft, sondern um die Öffnung der globalen Märkte, um die eigene Stärke ausspielen zu können. Der Freihandelsimperialismus war somit auch eine Form des Wirtschaftskrieges, der im Aufbegehren verschiedener Staaten gegen die Überlegenheit Großbritanniens seine Entsprechung fand.
Diese Wechselbeziehung von Öffnung und Abschottung ist seither ein Kennzeichen von Wirtschaftskriegen. Nicht nur die Kriegsführung ist damit umfassend geworden; letztlich treten heute ganze Volkswirtschaften gegeneinander an, wenn es zum offenen Konflikt kommt. Und mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865), der nicht zuletzt ein mit radikalen Mitteln geführter wirtschaftlicher Vernichtungskrieg des überlegenen Nordens gegen die Plantagenwirtschaft der Südstaaten war, ist auch in die Köpfe der verantwortlichen Politiker endgültig vorgedrungen, dass wirtschaftliche Stärke oder Schwäche das eigene politische Gewicht und die Durchsetzbarkeit eigener Interessen sehr schnell beeinflussen. Allein die Kriegskosten mussten das lehren, die die Bevölkerung zudem einer erheblichen protektionistischen, steuerlichen und inflationären Belastung aussetzten.[2] Ökonomischer Strukturwandel nimmt mithin eine eigentümliche Rolle als Konfliktverstärker ein, lange bevor es zu offenen Auseinandersetzungen oder gar Feindseligkeiten kommt. Letztlich muss jede Regierung darauf bedacht sein, die eigene ökonomische Basis auszubauen, oder, wo dies nicht möglich ist, Gegner daran zu hindern, zu stark zu werden.[3]
Das ist kein neues Phänomen, wenngleich sich dessen Ausmaße in den vergangenen Jahrzehnten dauerhaft verschoben haben. Die Belagerung oder gar die Zerstörung von Städten, Häfen und Flotten, die Versklavung von Menschen oder der Raub von Ressourcen, die gezielte Verschlechterung von Münzen, das Blockieren von Handelswegen – all diese aus der älteren Zeit gut bekannten Vorgänge waren stets auch Mittel von Handels- und Wirtschaftskriegen. Diese Konflikte und ihren strukturellen Wandel umfassend nachzuzeichnen, ist unmöglich. Die folgende Darstellung versteht sich daher nicht als eine Art Enzyklopädie der Wirtschaftskriege,[4] sondern als eine Betrachtung herausragender Ereignisse und als Versuch, hinter der Vielzahl dieser Ereignisse und dem damit verbundenen historischen Wandel Muster zu erkennen. Dadurch lassen sich zwar keine zukünftigen Konflikte vorhersagen, doch trägt das Nachvollziehen von Mustern dazu bei, diese Konflikte besser zu verstehen. Zugespitzt könnte man sagen, der Überraschungseffekt von Ereignissen sinkt, wenn die historische Bildung steigt. Man weiß, womit man gegebenenfalls rechnen muss, und kann sich im günstigsten Fall auf die Eventualitäten des historischen Wandels besser einstellen. Mangelndes Wissen über die historischen Entwicklungen ist in jedem Fall ein Nachteil – vielleicht sogar ein Fehler.
Im hier skizzierten Sinne herrscht stets irgendwo Handels- oder Wirtschaftskrieg. Historisch betrachtet, sind deren Formen – streng genommen ist Wirtschaftskrieg das übergeordnete Konzept und der Handelskrieg ein Moment davon – erstaunlich stabil. Es beginnt mit Geheimhaltung, Drohungen und Schikanen, es folgen, ohne dass es eine feste Ordnung gäbe, Blockaden und Beschlagnahmungen, Embargos und Boykotte, Sanktionen, Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse, Piraterie und Kaperei, schließlich auch offene Kriegshandlungen mit dem Ziel, dem Gegner wirtschaftlichen Schaden zuzufügen und dadurch die eigene Position zu verbessern. Diese Vorgänge hatten und haben keinen statischen Charakter, sondern sind sehr wandlungsfähig. Sie hängen nicht nur vom Stand des jeweiligen technischen Wissens ab, sondern lösen stets Gegenreaktionen aus und zwingen daher zu Anpassungsmaßnahmen, die je nach beteiligtem Staat oder beteiligter Obrigkeit sehr unter-schiedlich ausfallen können.
All diese Maßnahmen mögen in der Räson des Staates, der sie ergreift, ihren Sinn haben, sie entsprechen aber nicht automatisch den Interessen der in ihm lebenden Menschen. Denn Wirtschaftskriege schaden keineswegs nur dem Gegner, sondern zumeist ebenso der eigenen Bevölkerung, allen voran den Konsumenten, den Kaufleuten und den Unternehmen. Einerseits werden Güter und Rohstoffe teurer, gegebenenfalls auch physisch knapp, andererseits sind auswärtige Märkte und Kooperationspartner nicht mehr erreichbar. Dies bedingt, dass Wirtschaftskriege nur in extremen Fällen eine konsequent gewählte und durchhaltbare Strategie darstellen. Im Grunde müssen hierfür sehr günstige Bedingungen vorliegen, wie sie für die meisten der potenziellen Konfliktparteien schlicht nicht gelten.
Nur einige große Staaten wie die USA und in absehbarer Zeit wohl auch China können angesichts der eigenen Marktgröße zumindest hoffen, dass Sanktionen, Zölle und andere Maßnahmen des Wirtschaftskrieges vor allem andere treffen und für die eigenen Volkswirtschaften eher folgenlos, ja sogar vorteilhaft sind. Donald Trump sagte es bei seiner zweiten Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten Anfang des Jahres 2025 ganz offen: Die Zölle sollen den amerikanischen Steuerzahler entlasten.[5] Aber das sind Ausnahmefälle, und selbst hier trifft die erhoffte eigene Unverwundbarkeit zumeist nicht zu. Für die meisten Staaten, die in engem, nicht substituierbarem Austausch mit ihren Nachbarn stehen, bergen Wirtschaftskriege ein existenzielles Risiko, denn das Unterbrechen ökonomischer Kooperation kann sehr schnell die Lebensverhältnisse im eigenen Land verschlechtern. Wenn es dennoch zu Wirtschafts- oder Handelskriegen kommt, erscheinen sie eher wie ein Zwangsmittel, das zur unmittelbaren Durchsetzung von Interessen genutzt wird, aber keine dauerhafte Option darstellt.
Spätestens seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind die Vorteile eines nicht beschränkten, grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs allgemein bekannt. Solange man einen solchen Handel für ein Nullsummenspiel hielt, bei dem der eine Akteur das gewinnt, was der andere verliert, war der Wirtschaftskrieg unter Umständen ein geeignetes Mittel. Doch setzte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts, getragen nicht zuletzt von ökonomischen Diskussionen um den offenkundigen Nutzen des Freihandels, die eng mit den Namen von David Hume, Adam Smith oder Anne Robert Jacques Turgot verbunden sind,[6] die Vorstellung durch, dass Kooperation allen Partnern nützt, wenn auch vielleicht nicht in gleichem Ausmaß. Es müssen besondere Gründe vorliegen, dass Maßnahmen des Wirtschaftskrieges mit den ihnen innewohnenden Risiken überhaupt gewählt werden.
Genau in dieser Diskrepanz liegt ein Hauptaugenmerk der folgenden Darstellung. Denn obwohl ökonomisch im strikten Sinne stets nachteilig, treten Wirtschafts- und Handelskriege immer wieder auf. Im Kalkül der beteiligten Staaten spielt mithin der bald einsetzende negative ökonomische Effekt dieser Konflikte eine untergeordnete Rolle oder wird mit Spekulationen auf mittel- und langfristige Wirkungen, auf die dauerhafte Schwächung von Rivalen oder auf die robuste Behauptung der eigenen Führungsposition, wofür temporär auch Kosten in Kauf genommen werden, in den Hintergrund gedrängt. Der politische Blick auf Handelskriege unterscheidet sich insofern von zumeist kurzfristig bestimmten ökonomischen Überlegungen.
Wenn sich Wirtschaftskriege nicht so sehr in ihrer Form unterscheiden, dann tun sie es umso mehr in ihrer Art und Intensität, die stets unmittelbar das politische Umfeld reflektieren. Drei prinzipielle Merkmale lassen sich beobachten. Da ist erstens die zwischenstaatliche Rivalität, die auch mit wirtschaftlichen Mitteln ausgetragen wird. Das zweite Merkmal betrifft das, was wir heute unter dem Stichwort Sanktionen zusammenfassen, also zumindest anfangs einseitig unternommene Schritte, um durch das Verursachen von ökonomischem Schaden politisches Wohlverhalten zu erzwingen. Im strengen Sinne ist das eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts, denn erst seit dem Ersten Weltkrieg ist es üblich geworden, Kriegshandlungen nicht nur militärisch, sondern auch moralisch zu bewerten und gegebenenfalls zu bestrafen. Bei Sanktionen spielt insofern das Ziel eine Rolle, je nach Standpunkt das Gute zu fördern und das Böse zu dämpfen, wobei die Standpunkte nur sehr selten eindeutig sind. Im Vergleich zur Gegenwart ging es in der älteren Staatenkonkurrenz jedoch nicht nur, ja nicht einmal vorrangig, um die Durchsetzung des Guten, sondern um staatliche Selbstbehauptung, die an sich als legitim galt. Das dritte Merkmal schließlich umfasst das alltägliche Konfliktgeschehen, das sich in den unzähligen Nadelstichen äußert, denen Handels- oder Kooperationspartner ausgesetzt sind, angefangen bei Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen über Gesundheitsvorschriften bis hin zu Mobilitätsbarrieren für Menschen und Kapital, die je nach Umständen «pragmatisch» genutzt werden.
Historisch lässt sich keines dieser charakterlichen Merkmale in reiner Ausprägung fassen, stets gehen sie durcheinander.[7] Rein wirtschaftliche Gründe waren es in der Regel nicht, die etwa dazu führten, dass England im 18. Jahrhundert den Weinimport aus Frankreich stark einschränkte, Deutschland im späten 19. Jahrhundert den Zugang zum Berliner Kapitalmarkt für Russland sperrte oder die USA 1940 ein Ölembargo gegen Japan verhängten. In der Regel sind Wirtschaftskriege Mittel zur Austragung von Konflikten, nicht ihre Ursache. Sie sind, wie erwähnt, stets Teil weitergehender Rivalitäten und dienen nicht allein dazu, unmittelbare wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Selbst wenn das Ziel darin besteht, die eigene ökonomische Vorherrschaft zu behaupten oder den Aufstieg der Konkurrenz zu bremsen, geht es um politische Rivalitäten. Aus Sicht von Verbrauchern, Handel und Unternehmen ist es ja keineswegs nachteilig, wenn Güter aus einem anderen Land preiswert und in guter Qualität zur Verfügung stehen. Sie denken nicht in allgemeinen Bilanzen oder gar Länderkonkurrenzen, sondern handeln nach ihren jeweiligen Nutzenerwartungen, die nicht den Machtvorstellungen der eigenen Obrigkeit entsprechen müssen. Wirtschaftskriege sind so gesehen nie zwangsläufig, folgen keiner ökonomischen Rationalität, im Gegenteil. Für Unternehmen ist Wettbewerb, auch wenn sie ihn nicht immer unbedingt mögen, der Normalfall, auf den sie mit Leistungssteigerungen oder Kostensenkungen reagieren, in der Regel aber nicht damit, die Werkstore der Konkurrenz zu blockieren.
Die Tatsache, dass Wirtschaftskriegen immer eine politische Konkurrenz zugrunde liegt, hat sie von Anfang an zum Gegenstand von juristischen Überlegungen gemacht. Schon während der Konflikte zwischen Spanien und Großbritannien im 16. und 17. Jahrhundert um den Handel mit den neu entdeckten Gebieten in Asien und Amerika war zumindest in europäischen Gewässern klar, dass willkürliche Eingriffe wie etwa das Aufbringen von Schiffen und die Beschlagnahmung der Ladung rechtlich inakzeptabel waren und zu größeren militärischen Auseinandersetzungen führen konnten. Das trug zu einer sukzessiven Verrechtlichung der Handelsbeziehungen bei. Legales und legitimes Handeln wurde vorstrukturiert, und der Wirtschaftskrieg war zwar formal als Teil der allgemeinen Kriegsführung akzeptiert, durfte aber nicht willkürlich geführt werden. Der Seeraub zum Beispiel, der während eines Krieges mit staatlicher Lizenz (den sogenannten Kaperbriefen) geradezu legal betrieben werden durfte, war nach Friedensschluss schlichte Piraterie, die entsprechend bestraft wurde.[8]
Seither bemühten sich viele Staaten, den grenzüberschreitenden Handel, der trotz der Regeln des Seehandels in vielen Fällen nicht normiert war, rechtlich genau zu fassen und Verstöße zu benennen und zu sanktionieren. Dadurch wurde im Laufe der Zeit der Raum für «legale» Maßnahmen des Wirtschaftskrieges immer geringer, auch wenn grenzüberschreitendes Wirtschaftsrecht faktisch nicht möglich war, sondern regelkonformes Verhalten nur über Verträge durchgesetzt werden konnte. Das bedeutete nicht, dass die Handlungsbeschränkungen im Konfliktfall stets beachtet worden wären, zumal es ein geschlossenes und umfassendes Völkerrecht bis heute nicht gibt.[9] Doch stieg das Risiko für Wirtschaftskriegsmaßnahmen weiter an, da sie gegebenenfalls rechtlich geahndet werden konnten.
Die Gründung des Völkerbundes 1920, die Verrechtlichung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg etwa mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) sowie die in diesem Rahmen seit den 1950er Jahren stattfindenden Welthandels- und Entwicklungskonferenzen führten zu einer Vereinheitlichung, Vereinfachung und Verbilligung grenzüberschreitender Kooperation. Immer mehr Staaten verpflichteten sich dazu, von Maßnahmen des Wirtschaftskrieges, ja generell von unfairen Handlungen (Währungsmanipulationen, erratischen Zollerhöhungen, Sperren etc.) Abstand zu nehmen und sich einer internationalen Rechtsordnung zu unterwerfen, wie sie schließlich durch die Welthandelsorganisation (WTO) verkörpert wurde. Wirtschaftskriege gelten in diesem Rahmen im Grunde als rechtswidrig; nur in engen Grenzen können Retorsionsmaßnahmen erfolgen, also ein selbst «unfreundlicher, aber völkerrechtskonformer Akt […] als Reaktion»,[10] wenn andere Akteure gegen wichtige gemeinsame Regeln verstoßen, etwa der Nichtdiskriminierung, des fairen Wettbewerbs oder der Respektierung von Eigentum. Grundsätzlich unterliegen alle einschlägigen Maßnahmen einer übergeordneten Schiedsgerichtsbarkeit, die diese sanktionieren kann. Von den historisch bekannten Formen des Wirtschaftskrieges wäre gegenwärtig wohl keine mehr legal. Wenn es überhaupt zu ihnen kommt, dann vor allem, weil anerkannte internationale Gremien Regelverstöße einzelner Staaten festgestellt haben, gegen die mit Sanktionen vorgegangen werden kann. Dies hängt wiederum von kollektiven Beschlüssen ab, die indes sehr selten sind.
Wirtschaftskriegsmaßnahmen ohne völkerrechtlich verbindliche Grundlage kommen dennoch seit dem Zweiten Weltkrieg immer häufiger vor und verlangen, auch wenn es sich um reine Machtpolitik handelt, eine moralische Rechtfertigung – was etwa bei den amerikanischen Maßnahmen gegen China eine ganze Palette von entsprechenden Argumenten provoziert hat (unfaire Praktiken, Missachtung von Eigentumsrechten, Unterdrückung von Minderheiten in Tibet oder Xinjiang). Die Rechtlichkeit von Handelskriegen, ihre Legalität und Legitimität, unterliegt mithin starkem historischem Wandel, allerdings liegt bis heute ein Großteil des zwischenstaatlichen Handels in einer rechtlichen Grauzone, was zur moralischen Verschleierung solcher Kriege maßgeblich beigetragen hat. Ob etwas rechtlich zugelassen ist oder nicht, lässt sich generell schwer entscheiden. Dass es moralisch geboten ist, kann da schon leichter behauptet werden.[11]
All diese Gesichtspunkte führen dazu, dass die Identifikation historischer Wirtschaftskriege nicht einfach ist. Viele Unterscheidungen, die vor allem für ältere Wirtschafts- und Handelskriege durchaus pragmatischen Wert haben, verlieren an Trennschärfe mit der Durchsetzung moderner Wirtschaftsstrukturen, durch welche jeder Krieg, auch der zunächst nicht ökonomisch begründete Konflikt, zwangsläufig deshalb zum Wirtschaftskrieg wird, weil in den Kriegen der Gegenwart die Wirtschaft nicht nur Hilfsmittel, sondern vorrangiges Ziel der Kriegsführung geworden ist. Das soll nicht heißen, dass ökonomische Aspekte nicht bereits früher kriegsentscheidende Bedeutung besaßen, doch blieb diese Bedeutung vor allem auf die Fähigkeit begrenzt, Mittel zur Finanzierung von Rüstung, zur Kriegsführung, zur Anwerbung von Soldaten oder zur Unterstützung von Verbündeten zu gewinnen. Mit der sogenannten Militärischen Revolution des 15. und 16. Jahrhunderts, der Entstehung der modernen Artillerie, der gewaltigen Expansion von Festungsbauten, der Entstehung moderner Kriegsflotten und schließlich der Unterhaltung stehender Heere, nahm dieser Finanzbedarf enorm zu, sodass die Beschaffung finanzieller Ressourcen zur eigentlichen Achillesferse zwischenstaatlicher Konflikte und insofern selbst zum Gegenstand der Staatenkonkurrenz wurde.[12]
Wollte man sich durchsetzen, war es vielleicht sogar wirksamer, dem Gegner wirtschaftlich und finanziell zu schaden, als das Risiko offener militärischer Konflikte einzugehen. Kriege konnten überdies derart eskalieren, dass ihre ökonomischen Folgen unkalkulierbar groß wurden. In dieser Hinsicht lässt sich der Dreißigjährige Krieg mit dem schwedischen Historiker Peter Englund als «Verwüstung Deutschlands» verstehen.[13] Dabei war das ökonomische Desaster nicht einmal primäres Kriegsziel, sondern ergab sich als Folge der Kriegsdauer und der militärischen Konstellation. Der Dreißigjährige Krieg war streng genommen kein Wirtschaftskrieg,[14] führte aber schließlich dazu, dass die deutschen Territorien für lange Zeit als relevanter ökonomischer Faktor ausschieden oder zumindest massiv an Bedeutung verloren.
Das war zweifellos noch die Ausnahme. Selbst der Siebenjährige Krieg des 18. Jahrhunderts, der in der kolonialen Konkurrenz von Frankreich und Großbritannien von Anfang an starke Momente eines Wirtschaftskrieges aufwies, relativ lange dauerte und auf seinen verschiedenen Schauplätzen in Amerika, Europa und Asien erhebliche Verwüstungen anrichtete,[15] wurde von den Zeitgenossen in Deutschland als ein begrenztes Ereignis wahrgenommen, das kaum in den Alltag eingriff, solange jedenfalls die eigene Region nicht selbst zum Kriegsschauplatz wurde.[16] In der Gegenwart, in der Kriegsfähigkeit und ökonomisches Potenzial unmittelbar miteinander korrelieren, ist die Situation eine andere. Wie stark hier die Phänomene verschwimmen, zeigt der aktuelle Konflikt in der Ukraine, der einerseits als militärische Auseinandersetzung auf den ostukrainischen Raum beschränkt ist, gleichzeitig aber Züge eines globalen Wirtschaftskrieges angenommen hat, da etwa die Sanktionsmaßnahmen der westlichen Staaten keineswegs nur Russland direkt, sondern auch seine internationalen Kooperationspartner treffen sollen. Das Ziel ist ganz offenkundig, Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, sodass es den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen kann.
Solange Kriege und Konflikte begrenzt blieben, kann man schlussfolgern, ließen sich auch Wirtschaftskriege, etwa die Englisch-Niederländischen Seekriege des 17. Jahrhunderts, die kolonialen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Großbritannien im 18. Jahrhundert oder die Opiumkriege des 19. Jahrhunderts, gut fassen und abgrenzen. Doch bereits der Amerikanische Bürgerkrieg wurde von den Nordstaaten im modernen Sinne «totalisiert», das heißt, die militärischen Auseinandersetzungen wurden von umfangreichen Maßnahmen ergänzt, die von der Blockade der Ausfuhrhäfen der Südstaaten bis zur gezielten Zerstörung der Infrastruktur und zum Niederbrennen der Landschaft reichten.[17]
Was sich hier andeutete, fand in den «totalen Kriegen» des 20. Jahrhunderts eine geradezu radikale Fortsetzung. Sie reichte bis hin zur gänzlichen Zerstörung des Gegners im Zweiten Weltkrieg, wobei die Wirtschaft selbst zum primären Ziel militärischer Handlungen wurde, da ihre Kapazitäten für die Kriegsfähigkeit der jeweiligen Parteien ausschlaggebende Bedeutung hatten.[18] Zwischen offenem Krieg und Wirtschaftskrieg ist im Zeitalter des «totalen Krieges» also kaum mehr zu unterscheiden, was wiederum nicht heißen soll, dass jeder Konflikt in der Gegenwart diese totalen Züge annimmt. Das war und ist der Fall, wenn die Gegner relativ ebenbürtig sind; bei ungleicher Kräfteverteilung kann es hingegen bei traditionellen Formen der Auseinandersetzung bleiben.
Im 20. Jahrhundert kam allerdings ein neues Moment ins Spiel, eben jenes der moralischen Verpflichtung, das zumindest einem Teil der Wirtschaftskriege seither seinen Stempel aufprägt.[19] Auch hier war der Amerikanische Bürgerkrieg ein Vorläufer, insofern der Krieg nicht mehr allein als legitimes Mittel der staatlichen Interessendurchsetzung begriffen wurde, wie es in der Tradition der europäischen Kriegsführung der Fall war, sondern zugleich als eine Art moralischer Feldzug des Guten gegen das Böse geführt wurde. Erster Höhepunkt dieser neuen Situation war der Friedensschluss von Versailles, in dem Deutschland eine moralische Kriegsschuld akzeptieren musste, die das Land verpflichtet hätte, selbst dann zu zahlen, wenn es den Krieg nicht verloren hätte. Diese «Moralisierung» begünstigt seither eine neue Form des Wirtschaftskrieges, die Sanktionierung von «Schurken». Bereits in der Zwischenkriegszeit verhängte der Völkerbund Sanktionen gegen Italien (wegen des Abessinienkrieges) oder die USA gegen Japan (wegen der Invasion Chinas). Nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja in der Tat auch eine moralische Auseinandersetzung war, kam es dann zu einer großen Fülle von Sanktionen, also Wirtschaftskriegsmaßnahmen, die genau so begründet wurden. Angesichts des atomaren Eskalationsrisikos, durch das offene militärische Konflikte zwischen den Großmächten unwahrscheinlich wurden, waren diese Maßnahmen gelegentlich sogar das Mittel der Wahl.
Im Kalten Krieg reichte diese Art Sanktionierung vom Boykott über Blockaden und die Unterbindung von Technologietransfer bis hin zu Geheimdienstoperationen. Noch die Eskalation des Wettrüstens unter Ronald Reagan wurde mit moralischer Beigabe begründet. Dies richtete sich jedoch keineswegs nur gegen die Sowjetunion und deren Verbündete. Der aus moralischen Gründen ergriffene Wirtschaftskrieg traf selbst eigene vermeintliche Verbündete wie Spanien unter Francisco Franco oder später die Südafrikanische Republik wegen ihrer Apartheidpolitik, vor allem aber politische Gegner wie das iranische Mullahregime oder das kommunistische Nordkorea, um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen. Der moralische Aspekt spielte nun auch bei der öffentlichen Rechtfertigung von Wirtschaftskriegen eine Rolle; gelegentlich waren es die Öffentlichkeiten selbst, die mit moralischer Verve nach ihnen riefen, da eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit «Schurkenstaaten» selbst dann scheinbar nicht mehr zu rechtfertigen war, wenn sie gegenseitige Vorteile versprach. Im gegenwärtigen Ukrainekrieg verschwimmen, wie gesagt, all diese Momente miteinander, wodurch zugleich deutlich wird, dass es eine klare Abgrenzung und Definition von Wirtschaftskriegen weder gibt noch geben kann, weil deren Formen und Gehalte selbst starkem historischem Wandel unterliegen.
Mit dem sich abzeichnenden Großkonflikt zwischen den USA und China tritt das Phänomen der Wirtschaftskriege allerdings noch einmal in eine neue Phase ein. Dieser Konflikt wird im Grunde gar nicht mehr von erkennbaren moralischen Zielen bestimmt, etwa Freiheit versus Parteidiktatur, wenngleich das allgemein so oder ähnlich geäußert wird. Anfänglich spielte noch die Frage eine gewisse Rolle, ob China durch bestimmte Handlungen gegen die auch von ihm akzeptierten Regeln der WTO verstoßen habe. Aber darum geht es mittlerweile kaum noch. Im Verhältnis der USA zu China traten schon seit den 1970er Jahren, als das Land noch zentrale Momente der Mao-Diktatur aufwies, moralische Probleme gegenüber einem Streben nach gegenseitigem Vorteil zurück, wobei das ökonomische Potenzial der Volksrepublik ebenso willkommen war wie die gemeinsame Frontstellung gegen die Sowjetunion. Selbst die Niederschlagung des Protestes auf dem Tiananmen-Platz 1989 führte nicht dazu, dass das sich modernisierende China vom wirtschaftlichen Austausch, der sich nach dem Ende des realen Sozialismus global öffnete, ausgeschlossen worden wäre. Im Gegenteil wurde das Land immer stärker in die Weltwirtschaft einbezogen und avancierte peu à peu zu einem der bedeutendsten Lieferanten von Industriegütern, der umso begehrter war, je mehr er die Welt an den niedrigen Arbeitskosten im eigenen Land teilhaben ließ.
Solange der Aufstieg Chinas die Pax Americana, also die um die Dominanz der USA gruppierte weltwirtschaftliche Arbeitsteilung mit dem Dollar als Leitwährung, nicht infrage stellte, sondern den Strukturwandel der amerikanischen Wirtschaft weg von den «Dinosauriern» der Industrie hin zur digitalen Dienstleistungswirtschaft sogar noch begünstigte, schien eine Kooperation unproblematisch. Doch sobald sich China von der Rolle des Lieferanten emanzipierte, technologisch auf Augenhöhe mitspielen wollte und zugleich eigene globale Strukturen jenseits der amerikanischen Ordnung aufzubauen begann, war es damit vorbei. Das Bemerkenswerte an dem aktuellen Konflikt ist nicht, dass er über die Auseinandersetzung um Taiwan, die Menschenrechtsverstöße gegen die Uiguren und in Tibet oder die Rolle der Parteidiktatur erneut zu einer Art moralischem Konflikt zwischen Gut und Böse stilisiert wird; das ist vor allem öffentliche Meinungsmache. Entscheidend ist, dass es diesmal in der Tat um ökonomische Fragen als Voraussetzung und Bedingung politischer Machtentfaltung geht, um Wachstum, Produktivität und technologische Innovationsfähigkeit, es sich also um einen genuin politischen Konflikt handelt, der im Ergebnis zu dem Zeitpunkt in eine Art Wirtschaftskrieg umschlug, als sich der ökonomische Aufschwung Chinas zu einer ernsthaften Herausforderung der Führungsrolle der USA entwickelt hatte. Das Ökonomische wurde aufgrund seiner Dimension deshalb politisch, weil es die Gewichte und Handlungskapazitäten in der Machtkonkurrenz definitiv zu verschieben drohte.
Gerade daher ist allerdings auch kaum vorstellbar, dass es in diesem Konflikt zu einer schon gar nicht einfachen militärischen Lösung kommt. Eher scheint der Wunsch der Vereinigten Staaten vorstellbar, dass die chinesische Führung Reformen im Land zustimmt, den Charakter der Parteidiktatur aufgibt, sich politisch den USA annähert und schließlich deren Dominanz akzeptiert – doch selbst dann bleibt die große Frage, ob die weiterhin feststellbare ökonomische Gewichtsverlagerung hin zu China durch die USA akzeptiert werden könnte. Es ist wohl davon auszugehen, dass es einen Wettlauf um die technologischen Entwicklungen der Zukunft geben wird, der kompetitiv und nicht kooperativ ausgetragen wird. Damit ist ein Eskalationspotenzial angelegt, das bis in die als Cyberspace bezeichnete virtuelle Realität führt.Wie in der Auseinandersetzung um die beste Ausgangslage bei der Ausbeutung der sogenannten Neuen Welt im 16. Jahrhundert geht es auch heute wieder um die besten Positionen bei der Nutzung der vielversprechenden Zukunftsräume des ökonomischen und technologischen Wandels, die freilich nicht mehr territorial gebunden sind, sondern zunehmend in die digitale Welt der globalen Kommunikation quasi grenzenlos diffundieren. Gerade diese Grenzenlosigkeit, die mit jedem technologischen Schub nicht nur weiter zunimmt, sondern zugleich ökonomische, politische, kulturelle und nicht zuletzt militärische Handlungschancen und -zwänge hervorbringt, macht den Cyberspace zu einer Art Schlachtfeld, auf dem es neben den Versuchen zur Regulierung vor allem darum geht, die eigene technologische Handlungsfähigkeit zu sichern.[20]
Historisch gibt es für den gegenwärtigen Konflikt keine Vorbilder; zumindest technologisch ist dies ein ganz neues Feld. Doch er passt in historisch bekannte Muster, denn Wirtschaftskriege waren und sind ein durchgehendes Phänomen des ökonomisch-historischen Wandels, kein Merkmal einer bestimmten Epoche oder Konstellation, auch wenn diese für ihre konkrete Gestalt jeweils eine große Rolle spielen. Für sie ist maßgeblich, dass ökonomischer Strukturwandel seinen eigenen Regeln folgt und keine Rücksicht auf gegebene Territorialstrukturen und Machtverhältnisse nimmt.[21] Die britische Monarchie unterstützte 1585 die Niederlande in ihrer Auseinandersetzung mit Spanien, nahm davon aber zunehmend Abstand und entwickelte sich schließlich zum Feind, als holländische Flotten den Überseehandel zu dominieren begannen und selbst in englischen Häfen zu gern gesehenen Gästen wurden, die preiswerter und zuverlässiger als englische Anbieter lieferten. Der zunächst geförderte Aufstieg der Niederlande wurde zum Ärgernis, zum Anlass für Wirtschaftskriegshandlungen wie die «Navigationsakte» («Navigation Acts») zur Regulierung von Schifffahrt und Seehandel, ja für offenen Krieg. Durchsetzen konnte sich Großbritannien jedoch erst, als es seine eigene ökonomische Basis durchgreifend verbessert hatte und mit der Industrialisierung des 18. Jahrhunderts völlig neue Handlungsspielräume gewann.
Frankreich unter Ludwig XIV. dominierte in Europa nicht zuletzt wegen der Größe seiner Bevölkerung und des schieren ökonomischen Potenzials des großen Territoriums, sehr zum Missfallen der Nachbarn, nicht zuletzt der Engländer. Doch waren es letztlich nicht die wiederholten offenen und ökonomischen Kriege gegen Frankreich, die die Überlegenheit Großbritanniens begründeten, sondern die große wirtschaftliche Dynamik, die dem Land schließlich auch die Vorherrschaft über das potenziell sehr viel stärkere Kontinentaleuropa Napoleons verschaffte. Die neue globale Ordnung, unter dem Schlagwort Pax Britannica bekannt, schrieb die englische Vorherrschaft fest und ermöglichte die erste Globalisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch machte Großbritannien nun die geradezu paradoxe Erfahrung, dass zumindest wirtschaftlich nicht die Ordnungsmacht vorrangig von der Ordnung profitiert, die sie garantiert, sondern andere Länder, die den für sie im Wesentlichen kostenfreien Rahmen nutzen, um ihre Produktivität zu entfalten.[22]
Ganz ähnlich erging es den USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine internationale Rahmenordnung schufen, die zwar zunächst nur die westliche Hemisphäre umfasste, seit 1990 aber in der Tat global wurde und zu einem Sieg der amerikanischen Vorstellungen von internationaler Kooperation führte. Doch im Rahmen der so ermöglichten Ordnung waren es nicht die Vereinigten Staaten, die am meisten profitierten oder am schnellsten wuchsen. Der Aufstieg Westdeutschlands und Japans, die politisch keine Konkurrenz darstellten und ihre ökonomische Stärke nicht als Waffe gegen die USA richteten, wenngleich das dort manche so empfanden, war noch hinzunehmen, ja schien zum gegenseitigen Vorteil – nicht jedoch der Aufstieg Chinas, den man zu Anfang unterschätzt hatte. Seit der Jahrtausendwende gewann er aber nicht nur an einer Dynamik, die die USA in den Schatten stellte, er war auch mit der Aufrechterhaltung, ja Konsolidierung gegensätzlicher politischer Vorstellungen verbunden. Obwohl der ökonomische Austausch für beide Seiten überaus nützlich war, empfanden die USA die mit ihm verbundene wirtschaftliche Gewichtsverschiebung zugunsten Chinas zunehmend als bedrohlich und reagierten entsprechend. Das führte zu einer erst langsamen, seither aber immer rascheren Auflösung der Pax Americana, hin zu einer neuen Ordnungslosigkeit, in der die Wahrscheinlichkeit für Wirtschaftskriege ebenso sehr zunimmt wie Wachstumsverlust und Wohlfahrtseinbußen absehbar werden.[23]
Konstitutiv hierfür ist die durch den ökonomischen Strukturwandel bedingte, eingangs bereits skizzierte Paradoxie von Ordnung und Rivalität: Alle profitieren von geordneter Kooperation, nur eben nicht in gleicher Weise, sodass sich infolge des Strukturwandels die jeweiligen ökonomischen Handlungsspielräume in politisch relevantem Maße verschieben. Der Versuch, diese Verschiebungen zum eigenen Nutzen zu kontrollieren, ist der eigentliche Kern von Wirtschaftskriegen; hierdurch können aus alltäglichen gefährliche Rivalitäten werden. Selbst einmal fixierte Ordnungen können den Wirtschaftskrieg letztlich nicht verhindern, da sie vom Strukturwandel, der durch sie erst ermöglicht wurde, ja rasch wieder infrage gestellt werden. Wirtschaftskriege sind insofern ein politisches, kein ökonomisches Dauerproblem, auf das verschiedene Antworten möglich sind.
In diesem Buch soll jene Vielfalt an Antworten historisch beleuchtet werden, um auf dieser Basis Überlegungen für die Gegenwart anzustellen. Dabei geht es weder, wie bereits betont, um eine Aufzählung aller größeren Konflikte noch darum, einzelne spektakuläre Fälle vergleichend nebeneinanderzustellen. Zwar wäre es reizvoll, eine Reihe herausragender Ereignisse auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Blick zu nehmen, jedoch würde dabei letztlich die Perspektive des historischen Wandels verblassen. In dieser Fokussierung unterscheiden sich die folgenden Ausführungen von anderen verdienstvollen Studien zu Wirtschaftskriegen.[24]
Es gibt keinen roten Faden, mit dem sich Wirtschaftskriege aneinanderreihen lassen, aber die Ereignisse greifen dennoch ineinander. Der Wandel und seine Bedeutung werden erst in einer zusammenhängenden Betrachtung deutlich, die sich zwangsläufig nicht auf Wirtschaftskriege beschränken kann, sondern auch Zeiten berücksichtigen muss, in denen diese weniger ausgeprägt waren oder ganz in den Hintergrund traten: Das Wesen von Wirtschaftskriegen wird häufig erst klar, wenn sie mit friedvolleren Zeiten in Beziehung gesetzt werden. Die hier verfolgte These lautet, dass es gerade die relativ friedlichen Zeiten sind, in denen die rasche wirtschaftliche Entwicklung den Keim für neue Konflikte und Auseinandersetzungen legt, während andererseits Phasen von Wirtschaftskriegen Zustände der Ordnungslosigkeit herbeiführen, die schließlich als so drückend empfunden werden, dass der Ruf nach Ordnung lauter und schließlich auch wirkungsvoller wird. Statische Konstellationen stellen so gesehen eine Ausnahme dar.
Geordnet ist die Argumentation in diesem Buch durch drei Grundannahmen, von denen die erste die empirische Unabgrenzbarkeit des Problems betrifft. Die Beschränkung auf neuzeitliche Wirtschaftskriege seit dem 16. Jahrhundert hat den Vorteil, einen in sich strukturierungsfähigen Gegenstand zu konstituieren, wenngleich dem arbiträre Entscheidungen zugrunde liegen. Zweitens geht es um den Wandel in Art und Intensität der Konflikte im historischen Verlauf, wobei dieser durchaus mehr ist als die bloße Chronologie der Ereignisse. Wie bereits erwähnt, spielen historische Erfahrungen eine nicht zu unterschätzende Rolle gerade für die gewählte Form der Auseinandersetzung, auch wenn die jeweiligen Charakteristika durchaus ihre eigene Wertigkeit besitzen. Dies führt zur dritten Grundannahme, dass es ein erkennbares Muster gibt, nach dem sich Wirtschaftskriege beurteilen und historisch einordnen lassen und das man als unauflösliche Paradoxie von Ordnung und Rivalität bezeichnen könnte. Diese Paradoxie ist das eigentliche dynamische Moment, das den historischen Wandel treibt und ihn trotz wechselnder Formen durchweg begleitet.
Den Anfang bilden Überlegungen zur Konkurrenz zwischen Spanien und Portugal einerseits, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich andererseits (Kapitel 1), die durch die harte maritime Konkurrenz zwischen Großbritannien und den Niederlanden abgelöst wurden (Kapitel 2). Hier setzte sich Großbritannien unter Einsatz so ziemlich aller denkbaren Mittel durch, nur um danach in eine umso heftigere Konkurrenz mit Frankreich einzutreten (Kapitel 3), die vom Spanischen Erbfolgekrieg bis zum Ende der Napoleonischen Kriege (Kapitel 4) dauerte. Der eigenen ökonomischen Stärke verdankte Großbritannien nicht nur den siegreichen Ausgang dieser langen Auseinandersetzung, sondern zugleich eine Dominanz, mit der es eine internationale Freihandelsordnung errichten konnte, die auch in anderen Teilen der Welt robust durchgesetzt wurde (Kapitel 6 und 7). Einzig die jungen Vereinigten Staaten von Amerika konnten sich dem entziehen, und zwar wiederum durch robuste Mittel eines eher passiven, protektiven Wirtschaftskrieges (Kapitel 5).
Der Erste Weltkrieg brachte diese Ordnung zu Fall, die keine adäquate Folgeordnung fand. Die sogenannte Zwischenkriegszeit versank vielmehr in einem ordnungslosen Zustand,[25] der von zahlreichen Wirtschaftskriegen geprägt war, was schließlich in den Zweiten Weltkrieg führte, der der Ordnungslosigkeit ein Ende setzte (Kapitel 8). Er mündete nicht nur in der Niederlage der «Störenfriede» Deutschland und Japan – man sah nun den Aufstieg der USA als einziger Macht, die die Kraft und, anders als nach 1918, auch den Willen besaß, eine internationale Ordnung der friedlichen Kooperation energisch durchzusetzen und die gerade in Europa traditionellen Konflikte zu befrieden. Das geschah zwar um den Preis der Spaltung der Welt in Ost und West, doch der Erfolg der Pax Americana im Westen war derart durchschlagend, dass mit dem Untergang des realen Sozialismus und der Etablierung der Welthandelsorganisation erstmals so etwas wie eine globale, auf Freihandel und Kooperation setzende Weltwirtschaftsordnung möglich schien, ein Zeitalter ohne Wirtschaftskriege (Kapitel 9). Doch im Ergebnis brachte die Globalisierung unter amerikanischer Hegemonie nicht etwa harmonische Kooperation mit sich, sondern die Rückkehr heftiger wirtschaftlicher Auseinandersetzungen (Kapitel 10). Die Pax Americana scheint damit an ihr Ende gekommen zu sein.
Diese Darstellung ist, das muss kaum betont werden, aus einer europäischen, genauer einer deutschen Perspektive geschrieben. Der Hinweis ist zunächst trivial – jeder historische Text ist durch die Perspektive des Verfassers geprägt (und der Versuch, eine eurozentrische Sicht der Dinge vermeiden zu wollen, kann mittlerweile als sicherer Ausweis von Eurozentrismus gelesen werden). Eine europäische, deutsche Perspektive einzunehmen bedeutet nicht notwendig, die Gewichte in der Darstellung falsch zu setzen. In der jüngeren Wirtschaftsgeschichte gibt es zahlreiche gute Gründe, sich vor allem mit Entwicklungen in Europa und davon ausgehend in den USA auseinanderzusetzen, denn hier lag nicht nur der regionale Schwerpunkt des neueren ökonomischen Strukturwandels, hier hatten auch die Hauptakteure wirtschaftlicher Konflikte ihren Platz. Das heißt nicht, dass andere globale Regionen vernachlässigt werden können oder sollen, nur werden sie aus der hier eingenommenen Perspektive thematisiert, wobei selbst die sich gegenwärtig abzeichnende Verlagerung der großen Konflikte in den Pazifik und in den Nahen und Mittleren Osten weiterhin von der Dominanz oder zumindest dem prägenden Einfluss westlicher Akteure getragen wird. Die Auswahl von Kriegen und Konflikten, die in den folgenden Kapiteln zum Gegenstand werden, ist also durch diesen europäischen Blick beschränkt, doch führt das, so zumindest die begründete Vermutung, nicht zu einer systematischen Verzerrung der Ergebnisse. Selbst aktuelle Globalgeschichten des wirtschaftlichen Strukturwandels kennen schließlich vor allem den «globalen Norden» als «Täter» und sehen in den Staaten der südlichen Hemisphäre vor allem «Opfer» einer nördlichen Hegemonie. Damit bestätigen sie die Perspektive, die sie zu überwinden beanspruchen.[26]
Kapitel 1Die Anfänge: Spanien und die Neue Welt
Koloniale Expansion
Den Anfang eines historischen Phänomens zu bestimmen, hat immer etwas Willkürliches. Stets gibt es Ereignisse, die auf einen älteren Ursprung dessen hinweisen, mit dem man eine Geschichte beginnen lässt, und so ist es nicht das Ereignis selbst, das den Unterschied macht, sondern die Begründung, die man für dessen Auswahl als plausibel betrachtet. Schon in der Antike lassen sich Auseinandersetzungen finden, die die Züge eines Handelskrieges trugen, etwa im 5. und 4. Jahrhundert v.Chr. die Konflikte um die Sicherung der Getreideversorgung Athens oder den ausbeuterischen Zugriff auf die Silbervorkommen von Laureion sowie die Kriege zwischen Karthago und Rom im 3. und 2. Jahrhundert v.Chr.[27] Auch die Formen, von der Blockade über die Piraterie, die Zerstörung von Hafenanlagen oder die Verwüstung wirtschaftlich wichtiger Landstriche bis hin zur Versklavung großer Bevölkerungsgruppen, sind aus der Antike gut bekannt.[28] Wenn die Betrachtungen dieser Darstellung trotzdem erst mit der europäischen Expansion seit dem späten 15. Jahrhundert einsetzen, so nicht deshalb, weil hier bestimmte Phänomene erstmals beobachtet werden können, sondern weil wir es seit dieser Zeit mit Wirtschaftskriegen zu tun haben, die im Kern auf zwischenstaatliche Auseinandersetzungen zurückgehen, also in gewisser Weise moderne Staatlichkeit voraussetzen, zu deren Entstehung sie in nicht geringer Weise beitrugen.[29]
Die Anfänge dieser Auseinandersetzung hatten in vieler Hinsicht noch vormoderne Züge. Es waren ja nicht die Königreiche Spanien oder Portugal, die seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts gezielt ihr Territorium zu erweitern suchten, sondern mehr oder weniger privilegierte Exkursionen einzelner Seefahrer. Seit der Unterbrechung der Handelswege im Kontext der osmanischen Eroberung Konstantinopels 1453 hatten sie zunächst das Ziel, einen politisch sichereren Seeweg nach Indien zu eröffnen, mit dem man auch die hohen Kosten des Landtransports über die Levante sparen wollte. Portugiesische See- und Kaufleute besaßen hier geografische Vorteile, verfügten aber zugleich über Schiffbaukenntnisse und nautisches Wissen,[30] das ihnen einen erheblichen Vorsprung bei der Seefahrt entlang der afrikanischen Westküste Richtung Süden ermöglichte. Jede dieser Reisen diente dazu, das vorhandene maritime und kartografische Potenzial zu erweitern, das nebenher systematisch vor jeder möglichen Konkurrenz geheim gehalten wurde.[31] Mit der Zeit wurden Stützpunkte in Nord- und Westafrika errichtet, die wiederum als Ausgangspunkt für weiterführende Erkundungsfahrten genutzt werden konnten.[32] Es war eine dieser Reisen, von Christoph Kolumbus unternommen, die zur «Entdeckung» von Amerika führte. Den spanischen Seeleuten kam das Land, auch wenn man es fälschlicherweise zunächst für Indien hielt beziehungsweise so bezeichnete, wie eine Welt voller Reichtümer vor, und da sie scheinbar herrenlos war, meinte man, sie sich ohne Weiteres aneignen zu können.
So entstanden nach und nach portugiesische und spanische Stützpunkte sowie schließlich auch Niederlassungen, die sich in der Karibik und in Mittelamerika sowie entlang der afrikanischen Westküste bis zum Kap der Guten Hoffnung fanden, darüber hinaus an der südafrikanischen Ostküste, sodann in Indien, schließlich in Indonesien, China und Japan. Portugiesische See- und Kaufleute landeten auf dem Weg ins südliche Afrika auch in Brasilien. Doch bestand an diesem Land, von dem man kaum etwas wusste, kein eigenständiges Interesse; es diente lediglich als Etappe und nautische Station auf dem Weg der Umsegelung der Südspitze Afrikas. Die Portugiesen setzten nicht unbedingt auf gewaltsames Eindringen in den jeweiligen Regionen, was ihnen aufgrund der geringen Stärke der Expeditionsflotten auch kaum möglich gewesen wäre. Man suchte lieber die Kooperation mit einheimischen Gruppen, war im Zweifelsfall aber zugleich zu Konflikten inklusive gewaltsamen Vorgehens bereit.
Das Motiv dieser Reisen[33] bestand langfristig darin, einen Seeweg nach Indien zu finden, um wo immer möglich den Gewürzhandel in die Hand zu bekommen und zu monopolisieren. In der europäischen Tradition gab es keinen freien Handel, sondern jedes Handelsgeschäft bedurfte einer Privilegierung durch die jeweils zuständige Obrigkeit, und so bemühten sich die portugiesischen Kaufleute von dem Zeitpunkt an, als klar war, dass ein gewinnbringender Handelsweg gefunden war, um die nötigen Privilegien und Monopolrechte. Nach beharrlichen Interventionen beim Papst, der als Stellvertreter Christi auch für die neu entdeckten Gebiete, die noch keiner europäischen Obrigkeit untertan waren, die formale Statthalterschaft besaß, erhielten sie entsprechende Rechtstitel, was 1455 in der Bulle Romanus Pontifex festgehalten wurde. Von da an hatten die Portugiesen eine Art Afrikamonopol inne, das sie eifersüchtig verteidigten.
Mittel- und Südamerika fielen Spanien nach den Entdeckungsreisen von Kolumbus, Magellan und anderen insofern fast zufällig und kostenlos in die Hände. Der Norden des amerikanischen Kontinents blieb lange von eher geringem Interesse. Erst später, als See- und Kaufleute aus Großbritannien und den Niederlanden auftauchten, wurde auch hier die spanische Präsenz deutlich erweitert. Die Neue Welt wurde auf diese Weise seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts faktisch zweigeteilt, und zwar in einen portugiesischen Osten und einen spanischen Westen, wobei der jederzeit drohende Streit zwischen den Seeleuten beider Länder schließlich vertraglich beigelegt wurde – durch verschiedene päpstliche Schiedssprüche und Verträge, wie den von Alcáçovas im Jahr 1479, Tordesillas 1494 und Saragossa 1529. Damit war der Handel in und mit der außereuropäischen Welt ein Monopol der Königreiche Portugal und Kastilien-Aragón. Allen anderen Mächten und privaten Kaufleuten waren dortige Aktivitäten verboten; sie wurden als Akte der Piraterie und des Rechtsbruchs angesehen und gewaltsam bekämpft.[34]
Der Traum vom Eldorado
Die ersten nautischen Innovationen sowie die anschließenden Erkundungsreisen waren zwar auch von Gewinnerwartungen der Königshäuser getragen, aber diese Reisen selbst trugen noch keine staatlichen Züge. Dazu war ihr Ausmaß viel zu beschränkt, zugleich ihr Ziel viel zu unbestimmt, denn vor den «Entdeckungen», die mit der Erkundung der afrikanischen Westküste und des Kaps der Guten Hoffnung, der Landung von Kolumbus in der Karibik 1492 und Magellans Weltumsegelung von 1519 bis 1522 ihre Höhepunkte hatten, war überhaupt nicht klar, welche Folgen die Abenteuer der ersten «Entdecker» haben würden. Erst als sich herausstellte, dass diese Exkursionen durchaus Erfolg haben, dass ertragreiche Handelswege erschlossen und gewinnbringende Geschäfte dauerhaft ermöglicht werden konnten, bemühten sich Spanien und Portugal frühzeitig um eine Art obrigkeitliche Legitimation.
Die spätere Forschung, namentlich die des Soziologen Immanuel Wallerstein, hat in den Folgen dieser Reisen, die in der Tat grundstürzend waren, auch deren Intention gesehen, so als hätten es die ersten «Entdecker» auf genau die Ausplünderung Amerikas abgesehen, die sie zumindest in vielen Fällen erreichten.[35] Doch nichts könnte der Wahrheit ferner liegen. Aus den Folgen einer Handlung, die gut ausgeht, deren vermeintliche Motive abzuleiten, ist so verbreitet wie unzutreffend.[36] Dass die notorisch negative Handelsbilanz Europas mit Asien – dadurch der ständige Abfluss von Edelmetall nach Asien zur Finanzierung der umfangreichen europäischen Wareneinfuhr von dort – nach der Erschöpfung der mitteleuropäischen Silberquellen einen Heißhunger nach Edelmetallen mit sich brachte, ist ebenso unstrittig wie die Tatsache, dass dieses Verlangen zugleich die jeweiligen Obrigkeiten beeinflusste, die Entdeckungsreisen zu finanzieren.[37] Doch waren das zunächst nichts mehr als Hoffnungen, vielleicht Erwartungen, mit denen kaum sicher kalkuliert werden konnte.
Mit der spanischen und portugiesischen Expansion in Mittel- und Südamerika sowie im Indischen Ozean im 15. und 16. Jahrhundert schienen sich diese Hoffnungen zu erfüllen, und das Blatt wendete sich vollkommen. Die Eroberungen erfolgten noch ganz archaisch: Man hielt die entdeckten Gebiete entweder für herrenlos oder unchristlich, was ungefähr auf das Gleiche hinauslief, und fühlte sich daher berechtigt, mit Gewalt etwaige Widerstände der Bevölkerung zu brechen und sich die Schätze und Ressourcen dieser Gebiete anzueignen oder andernfalls Handelsverträge zu schließen, die sehr im eigenen Interesse waren. Diesen gewaltsamen Expansionsprozess hat der Historiker Wolfgang Reinhard detailliert beschrieben, ebenso wie den Umstand, dass die kleinen Gruppen europäischer Seefahrer zumindest in Asien kaum dazu in der Lage waren, sich gewaltsam durchzusetzen, sondern stets auf die Kooperation heimischer Herrscher angewiesen waren, die sie zumeist geschickt zu nutzen wussten.[38]
So kam es zu unterschiedlichen Mustern der Durchdringung, die von Willkür und Gewalt im neu entdeckten Amerika bis hin zu eher vorsichtiger und diplomatischer Expansion in den asiatischen Territorien reichte, auch wenn dort, wo es notwendig und erfolgreich schien, vor Gewalt keineswegs zurückgeschreckt wurde.[39]
Manche Territorien, ihre Einwohner und Schätze wurden in der Tat auch als schlichte Beuteobjekte gesehen und entsprechend behandelt. Doch die Notwendigkeit, Handels- und Militärstützpunkte zu errichten und dauerhaft zu erhalten, sowie die beschwerlichen und langwierigen Seewege zwangen faktisch zur Kooperation, die vor allem dann unausweichlich wurde, wenn es nicht nur um Beute, sondern um den Aufbau mittel- und langfristiger Handelsbeziehungen ging. Die Entstehung regelrechter Kolonien erfolgte insbesondere dort, wo es um andauernde Edelmetallgewinnung und den Ausbau einer am europäischen Bedarf orientierten Plantagenwirtschaft ging. Gerade in letzterem Fall ließ sich auf die Erfahrungen venezianischer und Genueser Kaufleute zurückgreifen, die derartige Strukturen bereits im Schwarzmeergebiet, auf Zypern oder Ägypten aufgebaut hatten.[40]
Dabei kam es zu bemerkenswerten Unterschieden zwischen den portugiesischen und spanischen Vorgehensweisen. Während es die Kaufleute aus Portugal vor allem auf ein Gewürzmonopol abgesehen hatten, das angesichts der hohen europäischen Gewürzpreise außerordentlich lukrativ war, favorisierten die Spanier die Edelmetallgewinnung, begannen aber auch mit dem Aufbau einer Plantagenwirtschaft, etwa für Mais, Kartoffeln und Farbstoffe,[41]