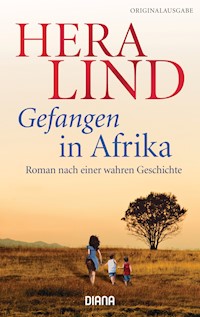
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Frau, die in Afrika durch die Hölle geht
Ihre Kindheit ist die Hölle – die Nachkriegszeit prägt Gerti Bruns, die kaum Chancen auf Bildung hat. Mit dreizehn flieht sie aus ihrem Elternhaus, wird jedoch als unbezahltes Dienstmädchen wieder ausgenutzt. Eine erneute Flucht führt sie scheinbar ins Paradies: Der gut aussehende Leo Wolf bietet ihr endlich ein Leben in Sicherheit und Wohlstand. Doch dann geht Leo ins politisch brisante Südwestafrika, wo Apartheid herrscht und Bürgerkrieg droht. Und er gibt keine Ruhe, bis Gerti endlich bereit ist, ihm mit den beiden Söhnen zu folgen. So gerät sie in die größte Falle ihres Lebens, der Gerti wieder nur durch Flucht entkommen kann – aber nicht ohne ihre Söhne! Wird die Familie je nach Deutschland zurückkehren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hera Lind
Gefangen in Afrika
Roman nach einer wahren Geschichte
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Vorbemerkung
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.
Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 12/2012
Copyright © 2012 by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung | t.mutzenbach design, München
Covermotive | plainpicture/Kitao; shutterstock
Satz und eBook | Greiner & Reichel, Köln
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-08605-3V007
www.diana-verlag.dewww.penguinrandomhouse.de
Für Bernd und Thomas
1
Nebenan wurde das Bett frisch bezogen. Ich hörte das gestärkte Laken knistern, als es von fachkundigen Frauenhänden glatt gestrichen wurde. Neugierig schielte ich um die Ecke: Flinke, geübte Finger schlugen es um die Matratze.
»Na, Frau Wolf? Wollen Sie mir helfen?«
Frau Ursula, die nette Hausbesorgerin, schaute sich schelmisch nach mir um.
»Ja, gern!« Unauffällig ließ ich die Zigarettenschachtel in meiner Hosentasche verschwinden und streckte schon die Hände aus.
»Aber nicht doch!« Frau Ursula grinste über das ganze Gesicht. »Sie sind doch zur Erholung da und nicht zum Arbeiten!«
»Aber das bisschen Bettenbeziehen …« Ich spürte, wie ich rot wurde, weil ich auf sie hereingefallen war.
»Frau Wölfchen, Frau Wölfchen!« Ursula stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte tadelnd den Kopf. »Jetzt sind Sie gerade mal zwei Wochen hier und haben höchstens ein Pfund zugenommen. Der Chefarzt reißt mir den Kopf ab, wenn ich Sie hier arbeiten lasse!«
Gegen die robuste Hausbesorgerin kam ich mir klein und winzig vor. Sie wog mindestens doppelt so viel wie ich.
»Wer … ähm … ich meine, welche neue Patientin kommt denn hier rein?« Ich sah mich neugierig nach einem neuen Namensschild um.
»Keine Ahnung«, sagte Frau Ursula und schüttelte energisch die Kissen auf. »Ich bin ja nur fürs Grobe da! Eure Seelenklempner wissen da sicher mehr!«
»J. Bruns«, las ich. Bis heute Morgen hatte Lilli Jacob hier gewohnt, eine lustige dunkelhaarige Frau in meinem Alter, mit der ich viel Spaß gehabt hatte. Obwohl wir Ende vierzig waren, hatten wir uns gefühlt wie im Mädcheninternat, wenn wir nach dem Lichtlöschen am Abend noch in die Raucherecke geschlüpft waren und im Morgenrock halbe Nächte verquasselt hatten. Hier im Rehazentrum wurden müde Krieger wieder aufgepäppelt, gestrandete Fische wieder ins Leben spendende Nass zurückgeworfen und traumatisierte Seelen getröstet. Meine Kurfreundin Lilli war erst vor einer Stunde als »gesund und normalgewichtig« entlassen worden. Natürlich hatten wir uns versprochen, in Kontakt zu bleiben, aber eine merkwürdige Leere, ein Sehnen nach Zweisamkeit hatten von mir Besitz ergriffen. Hier stand ich nun mutterseelenallein und hatte noch mindestens acht Kurwochen vor mir. Draußen war es kalt und grau, der dichte Tannenwald voll ungeschmückter Weihnachtsbäume wiegte sich tapfer im Dezemberwind. Diesmal würde ich Weihnachten nicht bei meinen Söhnen verbringen, und das brach mir fast das Herz. Professor Lenz hatte mir ein »Erschöpfungssyndrom« bescheinigt, das mit Unterernährung, Schlaflosigkeit, Panikattacken und nervöser Unruhe einherging. Wir schrieben das Jahr 1987, und ich stand mit achtundvierzig rechnerisch in der Mitte meines Lebens, war aber körperlich und seelisch bereits komplett am Ende. Mein Blick irrte durch das leere Zimmer, glitt über die blank gewienerten Fußböden, das Waschbecken, das noch keine Spuren menschlicher Anwesenheit aufwies, den Schrank mit den fünf Holzbügeln, an denen noch keine Kleider hingen, und das Nachtkästchen, auf dem kein Schmöker mit Eselsohren lag. Lilli und ich hatten uns unsere Bücher ausgeliehen und uns im Wintergarten der Kurklinik oft gegenseitig unsere Lieblingsstellen vorgelesen. Wir hatten unsere Ängste und Sorgen miteinander geteilt und am Ende meist zusammen gelacht. Wir kannten alle unsere Geheimnisse und waren dicke Freundinnen geworden. Hoffentlich würde »J. Bruns« keine moralinsaure alte Jungfer mit einem nervösen Magenleiden sein, die humorlos auf ihre Mittagsruhe pochte und abends genervt an die Wand klopfte, wenn ich meine Lieblingsmusik hörte. In den vier Wochen, die ich nun hier war, hatte ich zum ersten Mal seit Langem so etwas wie Leichtigkeit und Übermut gefühlt, so ein Prickeln, als könnte das Leben doch noch die ein oder andere schöne Überraschung für mich bereithalten.
Wer auch immer »J. Bruns« sein mochte: Wir würden hoffentlich eine Menge Spaß miteinander haben.
2
Als ich im Sommer 1939 geboren wurde, brach gerade der Zweite Weltkrieg aus. Das vorletzte armselige Gehöft kurz vor dem Steinbruch war mein Elternhaus. Es war ein winziges, windschiefes Häuschen in einem vergessenen Schwarzwaldtal, das mein Großvater noch selbst gebaut hatte. Es maß fünfundfünfzig Quadratmeter, besaß kein fließend Wasser, und die verwinkelte Wohnküche war so klein, dass ich keinen Platz am Tisch hatte und auf einer Kiste unter der Stiege sitzen musste. Über eine Hühnerleiter kletterte man in die zwei Kammern im Obergeschoss. Hier hauste meine Tante, die Schwester meines Vaters. Sie war eine alte Jungfer, nichts wert und darum eine Schande für uns. Wir Kinder durften nicht mit ihr sprechen, und wenn wir es heimlich doch taten, gab es Schläge.
Die ärmliche Ortschaft hieß Glatten und lag am Flüsschen Glatt, das mal plätschernd, mal rauschend unsere Einöde durchzog. Sie hatte achthundertfünfzig Einwohner, die mehr schlecht als recht ihr Dasein fristeten. Sommers wie winters schufteten sie, ohne nach rechts und links zu schauen. Es gab keine Alternative: entweder überleben oder verhungern. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, in welch bitterer Armut und Kälte ich aufgewachsen bin. Und mit Kälte meine ich nicht nur die frostigen Temperaturen innerhalb unserer unbeheizten, feuchten Mauern. Mit Kälte meine ich Lieblosigkeit, Schläge, Hunger und Angst. Angst vor meinen eigenen Eltern. Mein Gitterbett stand in ihrem düsteren Schlafzimmer, in dem sie sich nicht mehr berührten. Meine Eltern stritten und schrien sich an, manchmal schlug mein Vater meine Mutter, während die Gitterstäbe unheimliche Schatten auf die grauen Wände warfen und draußen der Sturm heulte.
Mein Großvater, ein einfacher Straßenwart, hatte nach dem Ersten Weltkrieg alle verwertbaren Steine und Balken zusammengetragen und daraus mithilfe von Lehm und Stroh mein Elternhaus zusammengeschustert. Die kalten Steinfußböden waren mit Sand ausgestreut; erst als mein Vater heiratete, legte er Linoleum und Fliesen in die kargen Räume. Gegen einen Stromanschluss hatte sich mein Vater immer vehement gewehrt. Das sei ihm zu teuer, doch schließlich konnte ihn die Angestellte vom Elektrizitätswerk doch überzeugen: »Sonst lebst du ja wie im Mittelalter, Gottlieb! Deine Karoline wird bestimmt lieber mit einem elektrischen Bügeleisen arbeiten als mit dem mit glühenden Kohlen gefüllten Ding hier! Schau, du hast schon wieder einen schwarzen Fleck auf dem Hemd!«
Verärgert hatte sich Gottlieb den durchgeschwitzten Hemdkragen, der schon zweimal gewendet und hundertmal geflickt worden war, vom Hals gerissen und ihn seiner Frau hingeworfen. Karoline war froh, dass sie dafür keine Kopfnuss von ihm bekam.
Wie oft war ein mühsam gewaschenes Hemd, ein von Hand gestärkter Kragen, ein bretthartes kaltes Bettlaken, das tagelang in der Stube zum Trocknen gehangen hatte, im letzten Moment durch die Kohle verdorben worden! Dann brach meine Mutter in bittere Tränen aus und musste mit der schweren körperlichen Arbeit von vorn beginnen. Wäschewaschen bedeutete, die Wäsche in Trog oder Sack zum Waschhaus ins Dorf zu schleppen, sich auf der Holztrommel die Finger wund zu scheuern, sich die Schrunden und Blasen an den Händen entweder mit heißem Wasser zu verbrühen oder mit eiskaltem Schwemmwasser blau zu frieren, die nasse Wäsche die vier Kilometer zu uns ins Tal zurückzuschleppen und sie dann dort in der winzigen Wohnstube aufzuhängen. Sobald wir Kinder laufen konnten, mussten wir mit zum Waschhaus. Ich sehe uns drei noch den Handkarren mit Schmutzwäsche ins Dorf hinunterziehen. Die zusammengeknoteten, ausgebeulten Bettlaken sahen aus wie dicke Eisbären mit Ohren. Sie thronten im Handwagen, sie durften fahren, aber ich musste barfuß nebenher laufen. Als Erstes musste der große Waschkessel beheizt werden. Wir hatten auf dem Hinweg bereits Brennholz gesammelt, so viel unsere kleinen Hände tragen konnten. Die Mutter steckte es in die Ofenklappe und stocherte mit dem Schürhaken, bis endlich die Flamme unter dem Kessel züngelte. In der Zwischenzeit musste die fleckige, stark verschmutzte Wäsche eingeweicht werden. Träge schwamm sie in der kalten Brühe und wurde dann auf einem großen Brett mit Kernseife geschrubbt. Die Hände meiner Mutter waren keine zärtlichen Hände mit gepflegten Fingern, die nach Mami und Handcreme, nach Wärme und Trost dufteten. Sondern grobknochig und schmutzverkrustet – Hände, die nur zum Arbeiten und Schlagen da waren. Die nötigen zwei Mark für das Waschmittel hatte meine Mutter oft nicht dabei. Dann versuchten wir, die Wäsche mit kalter Asche zu waschen, ein Unterfangen, das die Wäsche oft mehr verschmutzte, als sie zu säubern. In solchen Momenten schlug Mutters Hand noch schneller zu als sonst, und wir hüteten uns, sie zu reizen.
Kochte das Wasser im Kessel, wuchteten wir mithilfe von langen Stöcken die Wäsche hinein. Der beißende Geruch nach Seifenlauge schießt mir noch heute in die Nase. Die Mutter trug einen dunkelblauen Kittel mit lila Blümchen, ihr stand der Schweiß auf der Stirn, während sie mit aller Kraft mit dem Holzstampfer im kochend heißen Bottich herumrührte und sich Schweißgestank unter den Laugengestank mischte. Die Wände des Waschhauses waren feucht, die Fenster beschlagen, sodass wir durch den heißen Dunst bald völlig durchnässt waren. Wie Walfischfänger zogen wir die Wäsche schließlich an langen Stöcken aus dem Kochwasser, ließen sie in eine bereitstehende Zinkwanne mit kaltem Wasser fallen und spülten die Seifenlauge so gut wie möglich aus. Dann hievten wir die tropfnasse, schwere Wäsche mit vereinten Kräften in eine Wringe, wo wir Kinder dann den einen Hebel drehten, während Mutter auf der anderen Seite in die Gegenrichtung drehte. Die kleinen blauen Äderchen an der Schläfe meiner Schwester Sieglinde schwollen an, so sehr drückten und pressten wir. War der letzte Tropfen Wasser aus der Wäsche gewrungen, begann das Wäscherecken. Mutter stand auf der einen Seite des Lakens, wir auf der anderen. Unsere Hände umklammerten je einen Zipfel, und dann hieß es ziehen, bis die Mutter zufriedengestellt war und wir die Wäsche falteten. Wir gingen ein paar Schritte aufeinander zu, sie nahm unsere Zipfel, wir bückten uns rasch und griffen nach dem Lakenschnitt, damit das frisch gewaschene Leinen nicht auf den schmutzigen nassen Lehmboden hing. Dann begann die Prozedur wieder von vorn, bis alle Wäschestücke zusammengefaltet auf einem Haufen lagen. Wir trugen sie zum Handkarren und zogen ihn wieder den kilometerlangen Waldweg hinauf zu unserem Häuschen. Dort wurde die Wäsche in der Stube ausgebreitet, oder, wenn das Wetter günstig war, über eine Stange vor das Haus gehängt. Und wehe, wenn uns Kindern einmal etwas aus der Hand fiel! Wehe, wenn der Wind eines der Teile wieder von der Stange wehte! Wehe, wenn etwas auf den lehmigen Boden fiel! Dann sauste der Teppichklopfer auf unseren nackten Po, der für uns Kinder stets sichtbar in Reichweite stand.
Spätabends wurde dann im Schein der Küchenlampe, die wir erst seit Kurzem hatten, Wäsche geflickt. Das Stopfen der großen Löcher in den Socken war das Schlimmste. Wehe, wenn unsere kleinen Hände nicht das gewünschte Muster über dem Stopfpilz zustande brachten und sich ein Garnknubbel über der Ferse bildete! Schließlich musste Vater in diesen Socken zwölf Stunden am Tag arbeiten. Wenn uns die Kunst des Stopfens nicht gelang, gab es von der Mutter Kopfnüsse, harte Schläge mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und in den Nacken. Fielen uns Kindern bei der mühsamen Arbeit die Augen zu, wurden wir davon auf unsanfte Weise wieder geweckt.
Meine Mutter Karoline war vom Leben enttäuscht. Die Geburten ihrer beiden Töchter waren die Hölle gewesen, es hatte ihr beide Male fast den Leib zerrissen. Ich weiß noch, wie ich im Gitterbett stand, an einem nassen Zuckertuch lutschte und zusah, wie sie morgens ihre inneren Organe, die keinen Halt mehr in ihrem ausgeleierten Bauch fanden, mithilfe enger kratziger Bandagen fest zusammenzurrte, mit schmerzverzerrtem Gesicht und voller Selbstverachtung. Ich wagte es schon als Kleinkind nicht, Bedürfnisse anzumelden. Ich hatte keine. Auf der Welt sein bedeutete schuften, hungern, leiden und dulden. Stillhalten und bloß nicht aufmucken. Am besten, man erregte keinerlei Aufmerksamkeit.
Meine Geburt war die zweite große Enttäuschung für Gottlieb gewesen: wieder nur ein Mädchen. Und dann auch noch so ein winziger, dunkeläugiger, dürrer Wurm, über und über mit schwarzen Haaren bedeckt! Ein Kind, mit dem man als einfacher Arbeiter keinen Staat machen konnte. Bettelleute waren wir, die von der Hand in den Mund lebten. Im Tal der Ausgestoßenen in der Steinbruchsiedlung.
Mein Vater, Gottlieb Franz, war das jüngste von sechzehn Kindern. Die Geschwister empfanden ihn als überflüssigen Esser. Solange er die Mutterbrust bekam, war er ihnen egal, aber als er groß genug war, mit am Tisch zu sitzen, versteckten sie seinen Holzlöffel. Tagelang bekam der kleine Gottlieb nichts zu essen. Seine Eltern vermissten ihn irgendwann und befahlen den Geschwistern, den Anderthalbjährigen zu suchen. Sie fanden ihn in einem Winkel des Heuschobers, ausgetrocknet und kraftlos im Stroh. Sie hielten ihn für tot, aber als er sich regte, wurde er an den Tisch getragen und gefüttert. Die Geschwister mussten hungern, bis der Kleine wieder zu Kräften gekommen war.
Er hatte das Haus, das sein Vater zusammengeschustert hatte, geerbt. Dafür musste er seine fünfzehn Geschwister auszahlen. Für sechs Pfennige die Stunde verdingte er sich in der ortsansässigen Rasierklingenfabrik. Auch meine Mutter hatte sich dort bis zur Geburt von Sieglinde, meiner vier Jahre älteren Schwester, krumm geschuftet, um die Schulden an Schwägerinnen und Schwäger abzuarbeiten. Die Geburt ihrer Töchter erlöste Karoline vom Alltag in der Fabrik, von den verächtlichen Blicken der Vorarbeiterin, stürzte sie aber in ein anderes, wesentlich härteres Schicksal: Das Schicksal einer Mutter, die ihre Kinder nicht lieben, nicht ernähren, nicht aufblühen lassen kann. Sicher liebte sie uns, Sieglinde und mich, aber auf ihre Art. Zeigen konnte sie es nur mit einem gequälten Lächeln, dann und wann. Ansonsten wurde ihr Rücken noch krummer, ihr Gesicht noch abweisender, und sie selbst unnahbarer als je zuvor: für ihren Mann und für uns Kinder gleichermaßen.
Um ihr Überleben zu sichern, bauten meine Eltern sich eine kleine Landwirtschaft auf, die neben der Fabrikarbeit und dem Haushalt auch noch bewältigt werden musste.
Mit uns unter einem Dach hausten in Scheune und Stall eine Kuh, zwei Ziegen, acht Hennen, ein Gockel und ein Schwein. Alles Mäuler und Schnäbel, die gestopft werden mussten, mit Nahrung, die wir uns vom Munde absparen mussten. Wir hungerten während des Krieges und auch noch Jahre danach, ganz einfach weil wir es gar nicht anders kannten. Das quälende nagende Hungergefühl war während meiner gesamten Kindheit gegenwärtig, es wurde zur fixen Idee. Ständig malte ich mir aus, wie ich es anstellen könnte, auf allen vieren unbeobachtet zum Schweinetrog zu kriechen und die Kartoffelschalen und Brotrinden darin heimlich aufzuessen. Aber ich hätte Schläge dafür bekommen, harte kalte Schläge mit dem Gürtel oder dem Schürhaken, auf das nackte Gesäß, und das stand dann letztlich nicht dafür. An den beißenden Hunger konnte ich mich eher gewöhnen als an die Schläge, die eine zusätzliche Demütigung bedeuteten.
Meine Mutter fühlte sich im hintersten Winkel unseres Tals von der Welt isoliert. Sie hätte ins Dorf gehen können, die vier Kilometer am Fluss entlang über den Waldweg nach Glatten, aber was sollte sie da? Zu kaufen gab es nichts – nur knapp rationierte Lebensmittelmarken –, und verspotten lassen musste sie sich sonntags sowieso.
Der Hohn und Spott der übrigen Dorfbewohner, der uns entgegenschlug, wenn wir armen Bauern in unseren zerschlissenen, notdürftig zusammengeflickten Nachkriegsfähnchen zur Kirche gingen – ausgezehrt und apatisch mein Vater, das Gesicht unter einem schwarzen Hut versteckt meine Mutter und barfuß wir Kinder –, hallt mir noch heute in den Ohren.
3
Als draußen Schritte über den Flur hallten, spähte ich neugierig auf den Gang hinaus. Wenn das nicht »J. Bruns« war! Hoffentlich war die Neue nett! Ich sah blank geputzte Halbschuhe, die sich im Linoleum spiegelten, und dachte: Das ist ja ein Mann! Ein schmaler, hochgewachsener Mann mit kurzen dunkelbraunen Haaren, Jeans und Lederjacke hielt eine halb gefüllte Reisetasche in der Hand und blieb zögernd vor der Nachbartür stehen.
Suchend sah er sich um. Er wirkte wie alle Menschen, die Neuland betreten: unschlüssig und ein kleines bisschen verlegen.
»Ja, hier sind Sie richtig, Herr Bruns!« Die Nachtschwester eilte mit quietschenden Gummischuhen herbei und öffnete einladend die Tür. »Bitte schön, Herr Bruns. Ich hoffe, das Zimmer gefällt Ihnen!«
»Ja, danke«, hörte ich den Mann mit einer angenehm ruhigen Stimme sagen. »Es ist sehr hübsch und sauber.« Er schien ein genügsamer Typ zu sein, denn Luxussuiten waren unsere Kemenaten wirklich nicht. Praktisch, quadratisch, weiß und steril, aber was das Wichtigste war: ruhig. Hier draußen am Waldrand sagten sich buchstäblich Fuchs und Hase Gute Nacht, und die nächste Großstadt mit ihren Blechlawinen, klingelnden Straßenbahnen, aufdringlichen Leuchtreklamen und den gestressten Menschenmassen war meilenweit weg. Auch mein Reutlingen. Kurz bekam ich heftige Sehnsucht nach meinen beiden Jungs. Aber Bernd und Thomas waren bei meiner Freundin Gitta und ihrem Mann Walter in besten Händen. Ich wusste, ich musste das hier durchstehen, um wieder zu Kräften zu kommen, denn sonst würde ich über kurz oder lang wieder zusammenklappen.
»Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass Sie hier von lauter weiblichen Kurgästen umgeben sind«, hörte ich die Nachtschwester sagen, während sie geräuschvoll das Fenster öffnete. Die kühle, klare Nachtluft schien bis in mein Zimmer zu dringen. »Der Männertrakt wird über die Weihnachtsfeiertage renoviert.«
»Oh, das ist mir egal.« Der Mann warf seinen Koffer auf das Bett, und ich hörte ihn mit langen Schritten auf und ab gehen. Wahrscheinlich räumte er seine Siebensachen ein. Ich stellte mir vor, wie er ein Buch auf den Nachttisch legte, sein Rasierzeug auf die gläserne Ablage über dem Waschbecken und die Lederjacke auf einen der hölzernen Bügel im Schrank hängte.
»Wenn Sie was brauchen, bitte einfach klingeln!« Die Nachtschwester war schon wieder unterwegs ins Schwesternzimmer, wo sie unsere Tablettenrationen und Diätpläne zusammenstellte.
Ich ließ mich auf mein Bett plumpsen. Aha, ein Mann also! War das nun gut oder schlecht? Eine neue Freundin, mit der ich abends auf dem Bett sitzen und plaudern konnte, wäre mir am liebsten gewesen, und ich musste mich erst mal an den Gedanken gewöhnen, eine Art »Fremdkörper« auf unserem Flur zu haben. Sollte ich ihm das kleine Adventsgesteck bringen, das ich für meine neue Nachbarin gebastelt hatte? Eine rote Kerze auf frischem Tannengrün, verziert mit kleinen roten Schleifen und einem kleinen Gipsengel? Auf einmal kam es mir kitschig vor.
Das Fenster wurde wieder geschlossen, bald darauf wurde es still.
Ich kaute an meinem Daumennagel. Eigentlich war jetzt Zeit für meine heimliche Abendzigarette.
»J. Bruns« legte sich jetzt bestimmt schlafen. Vielleicht hieß er Joachim. Oder Jochen. J wie Jedermann. Sicherlich war er müde und erschöpft von der Anreise, auch er hatte ziemlich dünn ausgesehen. Alle, die hier ankamen, waren ausgelaugt und ausgebrannt, hatten schwere Krankheiten hinter sich oder große Sorgen und Nöte zu überwinden.
Ich schnappte mir meine Zigarettenpackung und huschte an seinem Zimmer vorbei, unter dessen Tür ein fahler Lichtschein zu sehen war. Gemütlicher Kerzenschein war das sicherlich nicht.
Der Raucherraum befand sich in einer abgetrennten Ecke des Wintergartens. Seufzend ließ ich mich dort in einen Sessel fallen, zog den Rauch tief in die Lunge und hing meinen Gedanken nach, bis mir ein kühler Luftzug sagte, dass die Tür aufgeschoben worden war. Hinter dem Zigarettenqualm erkannte ich Jedermann, der sich fast schüchtern hereinschob.
»Entschuldigung«, sagte er verlegen. »Ich wollte nicht stören.«
Er störte doch nicht! Wobei denn?!
»Wenn Sie rauchen wollen, ist das der einzige Ort, wo es erlaubt ist«, hörte ich mich sagen. Jedermann schob sich nun ganz durch die Tür. Er lächelte mir zu, die ich da rauchend und fröstelnd im roten Morgenrock neben der Stehlampe hockte. Mit angezogenen Knien, die ich mit den Armen umschlang, als wollte ich mich gegen etwas schützen. Und auf einmal fühlte ich wieder dieses Prickeln.
»Ich rauche nicht, aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleibe ich einen Moment.«
Jedermann streckte mir die Hand hin, und sie fühlte sich kühl und trocken an. »Jürgen Bruns. Ich bin gerade aus Göttingen angekommen.«
Jürgen also. Er sah wirklich gut aus: Ernste graue Augen blickten aus einem schmalen Gesicht, die Nase war gerade geschnitten, der Mund wirkte besonnen. Seine Kleidung war das, was man »gepflegt« nennt, und er roch schwach nach einem herben Aftershave. Das genaue Gegenteil von einem lauten Platzhirsch. Insgeheim atmete ich erleichtert auf. Er war ganz anders als Leo.
»Gerti Wolf«, sagte ich. »Aber hier nennen mich alle Wölfchen, weil der Name Wolf nicht so richtig zu mir passt!«
Wolf, das passte zu Leo, meinem Ex-Mann. Leo Wolf war ein gefährliches Raubtier und ich das Schaf, das er damals in seine Fänge bekommen hatte. Nur der gemeinsame Name verband uns noch. Plötzlich spürte ich, wie eine lächerliche Röte über meinen Hals kroch. Das war ja wohl mehr als peinlich! Was ging den großen Braunen mit dem blanken Schuh mein Spitzname an? Vielleicht glaubte er, ich wollte mich gleich bei ihm anbiedern? Hastig hüllte ich mich in eine neue Rauchschwade, damit er mein verlegenes Gesicht nicht sehen konnte. Aber zu meiner Erleichterung lächelte Jürgen Bruns, wobei ein Grübchen in seiner rechten Wange erschien. Er pflückte ein gebatiktes Kissen vom Stuhl und ließ sich langbeinig darauf nieder: »Wahrscheinlich sind Sie ein zäher kleiner Wolf, der sich ganz schön durchbeißen musste im Leben!«
Da hatte er weiß Gott nicht unrecht.
In dem Sommer, in dem ich gerade fünf geworden war, hockten wir Mädchen auf dem voll beladenen Leiterwagen, der ächzend den Waldweg hinaufrumpelte. Unter unseren stelzendünnen braun gebrannten Beinen pikste uns unsere bescheidene Ernte von den Feldern weiter unten hinter dem Dorf, die mein Vater gepachtet hatte. Es waren die unfruchtbarsten, abschüssigsten und steinigsten Felder weit und breit, sodass mein Vater sie sich gerade noch leisten konnte. Unsere Kuh Liesel schleppte die Last schnaubend über Geröll und Wurzelwerk. Vorn auf dem Kutschbock hockte zusammengesunken der Vater, vielleicht war er in einen Sekundenschlaf gefallen. Er war immer müde, konnte im Stehen schlafen und, wie die Mutter höhnte, sogar im Gehen. Hatte er seine großen glasigen Augen geschlossen, sah er aus wie ein alter knorriger Baum. Die Mutter ging mit einem Stock in der Hand neben der Kuh her und schlug auf ihr mit Kot verklebtes Hinterteil, sobald sie ihr zu langsam wurde. Dann schlug die Kuh mit dem Schwanz, und ein Pulk schillernder Schmeißfliegen flog auf.
Am Wegesrand wiegten sich die Birken und Schlehen, und ich sah blinzelnd in die Sonne und sog den Sommertag gierig in mich auf. Die Vögel zwitscherten übermütig, während der eiskalte Bach talwärts sprudelte und versuchte, sie mit seinem Glucksen zu übertönen. Meine Muskeln und Knochen schmerzten von der Feldarbeit, denn wir waren um vier Uhr früh aufgestanden und zu unseren handtuchschmalen Feldern gefahren, hatten nicht ein Hälmchen, nicht ein vertrocknetes Äpfelchen, keine runzelige Schlehe und keine erdverkrustete Mohrrübe übersehen. Wir hatten uns Brennnesseln in den Mund gestopft und Beeren und zur Mittagszeit altbackenes Brot in Wasser eingeweicht und an den säuerlichen Krusten gelutscht, bis sie ganz süß schmeckten. Mittlerweile waren unsere mageren Ärmchen zerkratzt, die Knie blutig, unsere Finger voller Blasen und die Schultern verbrannt, aber dies war ein köstlicher Moment: Ausruhen durften wir uns, wenn auch nur für die halbe Stunde des Rückweges.
»Gottlieb! Wach doch auf! Wir sind an der Kreuzung! Das Mistvieh will nicht bergauf!«
Meine Mutter rammte dem schlafenden Vater den Stock in die Seite, und der schrak hoch und zog die Zügel an. Geradeaus ging es ins nächste Tal, rechts bergauf zu unserer Arme-Leute-Siedlung.
»Steh, Liesel, steh!« Mit einem Ruck hielt der Leiterwagen, und auch wir Mädchen wurden unsanft aus unseren Tagträumen gerissen. An dieser Stelle mussten wir immer abspringen und schieben helfen.
Der Vater sprang ab und humpelte um den Wagen herum, um uns herunterzuhelfen. Zuerst war meine Schwester Sieglinde an der Reihe. Die Neunjährige stand auf und ließ sich in die ausgebreiteten Arme des Vaters fallen – einer der wenigen Momente in unserer Kindheit, wo so etwas geschah. Ich war auch schon aufgestanden und zum hinteren Ende des Wagens gelaufen, um mich jauchzend in die väterlichen Arme zu werfen, als sich die Kuh Liesel plötzlich mit ungeahnter Kraft ins Geschirr warf. Ich höre noch heute das knirschende Ächzen der Deichsel und sehe den Staub aufwirbeln: Wie ein Pfeil flog ich durch die Luft und knallte mit dem Kopf auf die Pflastersteine. Sofort verlor ich die Besinnung. Die Kuh floh panisch mitsamt dem Wagen querfeldein, und mein Vater rannte ihr nach, um weitere Katastrophen zu verhindern.
Meine Mutter musste mich Ohnmächtige den ganzen weiten Weg bis nach Hause tragen. Sie wusste nicht, ob ich noch lebte oder tot war. In der Steinbruchsiedlung hingen die Leute neugierig in den Fenstern oder lehnten sich über ihren Gartenzaun:
»Na, Karoline? Hat sie schlappgemacht?«
»Tja. Einen Arzt haben wir nicht in Glatten!«
»Am besten, du legst die ins Bett, die Kleine wird schon wieder!«
»Wie alt ist sie jetzt? Fünf? Wenn sie heiratet, ist alles wieder gut!«
Keiner der Nachbarn half meiner Mutter. Keiner bot an, sie ins nächste Kreiskrankenhaus zu bringen. Alle glotzten und sparten nicht mit gönnerhaften Ratschlägen.
»Am nächsten Dienstag kommt die Krankenschwester wieder ins Tal der Vergessenen. Dann schicken wir sie bei dir vorbei!«
»Heile, heile Segen, drei Tage Regen!«
»Da hast du einen Esser weniger, sei doch froh!«
»Was lässt du die Kinder auch auf dem Leiterwagen fahren! Sie haben doch Beine, können doch laufen!«
Unter Gespött und Gefeixe kam meine Mutter schließlich erschöpft in unserer Behausung an und legte mich in mein Gitterbett. Ja, mit fünf Jahren war ich so klein, dass ich dort immer noch hineinpasste. Drei Tage lang war ich ohnmächtig, und meine Eltern standen unbeschreibliche Ängste um mich aus. Dann kam die Krankenschwester.
»Wenn sie nach drei Tagen immer noch nicht aufgewacht ist, wird sie sterben«, sagte sie mit Kennerblick und rührte Zucker in ihren Kaffee.
»Und wenn … doch?« Panik schnürte meiner Mutter die Kehle zu.
»Dann gib ihr was zu essen!« Kopfschüttelnd machte sich die Krankenschwester davon. Wie konnte man nur so begriffsstutzig sein? Wenn ein Balg aus der Ohnmacht erwacht, hat’s halt Hunger.
Tatsächlich musste ich ins Leben zurück, zurück hinter die grünen Gitterstäbe im Schlafzimmer meiner Eltern.
Das war der einzige Moment, in dem ich sah, wie sie sich alle umarmten. Sie sprangen auf, rannten in die Küche, die Mutter im weiten Flanellnachthemd, der Vater im gerippten Unterhemd, und bereiteten mir ein Festmahl, bestehend aus Mehlsuppe mit Rosinen. Der Duft nach süßer Milch, vermischt mit ihrem strengen Schweißgeruch, steht mir noch heute in der Nase.
Kaum war die riesige Beule an meinem Hinterkopf abgeschwollen, musste ich wieder mit aufs Feld. Es war die kurze Zeit der Ernte, bevor der erste Herbststurm an den Zweigen unserer Obstbäume rüttelte, und der unbarmherzig lange Winter vor der Tür stand, in dem es nichts zu ernten gab.
Natürlich durfte ich nicht mehr auf dem Leiterwagen mitfahren und wollte das auch gar nicht. Noch heute leide ich unter Höhenangst, und der kalte Angstschweiß steht mir auf der Stirn, wenn ich ein Flugzeug besteigen muss.
»Und? Mussten Sie?«
Jürgen Bruns beugte sich leise vor und sah mir ins Gesicht. Ich hatte inzwischen drei weitere Zigaretten geraucht, mit zitternden Fingern drückte ich gerade den letzten Stummel im Aschenbecher aus.
Wie lange hatten wir hier schon gesessen? Es war bestimmt schon Mitternacht.
»Ja«, versuchte ich ein harmloses Lachen, »allerdings.« Mein riskantester Flug war ein Langstreckenflug von Kapstadt nach Frankfurt, und zwar mit gefälschten Papieren. Dieser Flug war eine Flucht. Eine panische, kopflose Flucht mit meinen Söhnen, aus einem Land, in dem ich keine Rechte besaß, aus einem Land, in dem ich in Todesgefahr schwebte, aus einem Land, in dem mein ärgster Feind auf mich lauerte: Leo Wolf, der Vater meiner Kinder und mein damaliger Mann.
Ich war nicht sicher, ob und wann ich das Jürgen Bruns alles erzählen würde. Aber ich merkte gleich, dass er ein guter Zuhörer war, der aufrichtig Anteil nahm an meinem Schicksal. Eine angenehme Wärme stieg in mir auf. Ich, die ich immer fröstelte, sobald die Temperatur unter fünfundzwanzig Grad sank, ich, die ich mich nachts an meine drei Wärmflaschen klammerte, um überhaupt einschlafen zu können, ich, die ich keine fünfzig Kilo wog und nicht ein Gramm Fett zum Verbrennen hatte, ich notorische Raucherin, die sich anders nicht beruhigen konnte, fror in Gegenwart dieses Mannes nicht.
Auf Anhieb fasste ich Vertrauen zu ihm und erzählte ihm von meiner schweren Kindheit. Von der harten Feldarbeit, dem ständigen Hunger.
»Sind Sie deswegen heute noch so dünn?«
Jürgen Bruns ließ seinen Blick besorgt über mich gleiten, und schon wieder schoss mir die Röte ins Gesicht.
»Ich war mein Leben lang eine halbe Portion«, entgegnete ich verlegen. Spätestens jetzt würde Jürgen Bruns bemerken, dass ich so gut wie keinen Busen hatte. Für so einen Luxus wie einen runden weiblichen Busen hatte mein Körper keine Reserven gehabt. Ich konnte froh sein, eine Größe von 1,57 Metern erreicht zu haben. Meine kurzen schwarzen Haare unterstrichen meinen knabenhaften Typ. Bald würde Jürgen Bruns jegliches Interesse an mir verlieren.
»Es ist weit nach Mitternacht.« Jürgen Bruns stand auf und streckte seine langen Glieder. »Danke, dass Sie mir gleich am ersten Abend so viel über sich erzählt haben.«
»Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Sie sind sicherlich todmüde nach der langen Anreise!«
»Das stimmt«, sagte er lächelnd und hielt mir die Tür auf. »Und ich muss ehrlich sagen, als ich feststellen musste, dass wir keinen Fernseher auf dem Zimmer haben, war ich fürs Erste schon enttäuscht. Aber jetzt …« Er ließ mich galant vorgehen und löschte das Licht im Raucherzimmer. »…haben Sie meinen ersten Abend spannender gestaltet, als ich das je zu hoffen gewagt hätte!«
»Sie nehmen mich auf den Arm.« Mit hochroten Ohren stiefelte ich neben ihm über den schummrigen Gang.
»Was praktisch ein Leichtes wäre«, sagte Jürgen Bruns grinsend. »Aber das würde ich natürlich nie wagen.«
Die Nachtschwester saß in ihrem Glaskasten und beugte sich über ein Kreuzworträtsel. Sie schien uns gar nicht zu bemerken. Ein Hauch von Verbotenem, eine Spur von nächtlichem Abenteuer kribbelte in meinem Bauch. Vielleicht wollte sie auch nichts merken. Sie gönnte uns Patienten unsere Bekanntschaften, und vielleicht gönnte sie mir nun auch diesen kleinen Flirt.
»Aber nun haben Sie noch gar nichts von sich erzählt«, flüsterte ich fast schuldbewusst, als wir vor Jürgen Bruns’ Türe stehen blieben.
»Dazu haben wir ja noch alle Zeit der Welt«, gab er zurück. Er streifte meinen Arm. »Gute Nacht, kleine Wolfsfrau.«
Mit diesen Worten verschwand er in seinem Zimmer.
Ich schlich nach nebenan in meines. Vor dem Spiegel über dem Waschbecken blieb ich stehen und betrachtete mich mit den Augen, mit denen er mich sehen musste. Ich war regelrecht ausgemergelt. Nie im Leben würde er etwas an mir finden. Kopfschüttelnd ging ich ins Bett.
Dort legte ich das Ohr an die Wand und lauschte. Schlief er schon? Las er noch? War er in Gedanken noch bei mir? Oder suchte er gerade nach Möglichkeiten, mir in Zukunft aus dem Weg zu gehen? Er konnte einfach sagen, dass ihn mein Zigarettenqualm störe. Dass er ein anderes Zimmer wünsche. Dass er Ruhe brauche. Dabei wünschte ich mir nichts sehnlicher, ihm weiter aus meinem Leben erzählen zu dürfen.
4
Meine Schwester schlief lange Zeit allein in der kalten Abstellkammer unter der Stiege, in der auch sämtliche Vorräte aufbewahrt wurden. Erst als ich fünf Jahre alt war, durfte ich meinen Strohsack im Gitterbett verlassen und mit ihr die schmale Pritsche teilen. Wir zerrten an der dünnen Wolldecke, die nicht mal für eine von uns reichte. Trotzdem fühlte ich mich bei ihr geborgen. In den Regalen standen Dörrobst und die Gläser mit dem Eingemachten, die Johannisbeer- und Stachelbeermarmelade von unseren Sträuchern im Vorgarten, die ohne Zucker eingekocht wurde, denn Zucker war nach dem Krieg Mangelware. Daher war die Marmelade immer von einer pelzigen Schimmelschicht bedeckt, aber wir aßen sie trotzdem. Die wenigen Dosen mit Dörrfleisch, die meine Mutter dort hortete, waren für besondere Anlässe wie den Besuch des Pfarrers oder der Krankenschwester reserviert. Auch der selbst gekelterte Most in ein paar klebrigen Flaschen, auf denen stets Fliegen herumkrabbelten, blieb seltenen Festen vorbehalten. Nie im Leben hätten wir gewagt, davon zu naschen. Wir Kinder bekamen einmal in der Woche ein Glas Saft, und zwar sonntagmorgens vor der Kirche. Wahrscheinlich hoffte meine Mutter, dass wir davon kurzfristig rote Wangen und ein gesundes Aussehen bekommen würden.
In der Vorratskammer roch es modrig, und vor dem vergitterten Fenster sah man Wolkenfetzen und ein paar Fichtenzweige, die sich im Winde bogen. Ab sechs Uhr morgens knatterten draußen Lastwagen vorbei, die Sand und Dreck aufwirbelten und unser Häuschen in eine gelbliche Staubwolke hüllten, von der wir husten mussten. Auf dem Hinweg waren die Lastwagen leer, heulten aber im zweiten Gang bergauf. Auf dem Rückweg waren sie mit Felsbrocken und Geröll beladen.
Meine Schwester musste mich vor der Schule in den Kindergarten bringen, schließlich war ich vier Jahre jünger als sie. Schon die Siebenjährige zerrte mich Dreijährige bereits am frühen Morgen über den dunklen Waldweg in Richtung Dorf. Die Mutter wollte mich aus dem Weg haben, und wenn wir nicht um halb sieben aus dem Haus waren, prügelte sie uns hinaus. Der Kindergarten war evangelisch, die Schule meiner Schwester hingegen streng katholisch. Dort wurde sie jeden Morgen von der Lehrerin vor dem Rest der Klasse verprügelt: Weil sie mich in einen gottlosen Kindergarten gebracht hatte. Da mussten Zeichen gesetzt werden. Wenn das jeder machen wollte, wären wir bald ein Volk von Heiden. Und so hatte meine Schwester jeden Morgen die Wahl: Entweder die Mutter zog ihr eines mit dem Schürhaken über, wenn sie sich weigerte, mich lästigen Klotz am Bein mitzunehmen. Oder aber die Lehrerin gab ihr zehn Schläge mit dem Lineal auf die offene Hand. Die Klasse musste laut mitzählen. Verachtung für die asozialen Heiden aus der Steinbruchsiedlung schwang in so mancher Schülerstimme mit. Schließlich kamen viele reiche Bauernkinder noch aus der Nazischmiede: hart wie Kruppstahl, dumm wie Stroh.
Als ich vier Jahre alt war, begriff ich, dass es eine Frage der Taktik war, um die Schläge und den Spott herumzukommen. Ich bat meine Schwester, mich einfach an einer einsamen Stelle unten am Bach zurückzulassen, bis ihre Schule aus war, und mich dann wieder mit nach Hause zu nehmen. Zu Hause habe ich dann meiner Mutter von den Spielen und Liedern im Kindergarten erzählt. So haben wir uns zwei Jahre lang vor den Schlägen gerettet.
Tag für Tag saß ich vier Stunden lang auf einem Stein und schaute in die wechselnden Strömungen der Glatt. Ich warf Steinchen hinein und ließ meine kindlichen Fantasien mit den Wellen ziehen. Es gibt wohl kaum ein Kind auf der Welt, das sich so viel mit einem Bach zu erzählen gehabt hat. Und das so viele Steine zu Freunden hatte.
»Was ist? Kommen Sie nicht mit auf unsere Winterwanderung?« Jürgen Bruns hatte an meine Zimmertür geklopft und lehnte nun abmarschbereit im Türrahmen. Er hatte eine Pudelmütze auf und hielt Lederhandschuhe in den Händen.
»Nein, leider. Ich darf noch nicht.« In dicken Socken und Jogginghosen saß ich im Schneidersitz auf dem Bett und hörte Musik.
»Sie dürfen nicht? Waren Sie ein unartiges Mädchen?« Um seine Mundwinkel zuckte es, als er mich schelmisch ansah. »Dabei habe ich mich schon so auf die Fortsetzung Ihrer Lebensgeschichte gefreut! Was mache ich jetzt ohne Sie in dieser Einöde?«
Ich bekam wieder dieses Kribbeln. »Professor Lenz sagt, ich sei noch zu schwach.«
»Sie sind zu schwach, um … spazieren zu gehen?« Fassungslos nahm Jürgen Bruns die Mütze ab, weil ihm offensichtlich heiß geworden war.
»Na ja, ich bin vor zwei Wochen in Ohnmacht gefallen …« Betreten schaute ich auf den flauschigen rosa Bettvorleger. »Und jetzt muss ich erst mal ein bestimmtes Gewicht erreichen, sagt Professor Lenz. Sonst kann er es nicht verantworten.« Meine Stimme wurde piepsig.
»Und da rauchen Sie wie ein Schlot!« Jürgen Bruns klopfte mit seinen Lederhandschuhen in die hohle Hand, so als wollte er mich dafür verhauen.
»Das ist mein einziges Laster, Ehrenwort!« Ich schlug die Augen nieder und versuchte ein schelmisches Grinsen. »Ohne mein Nikotin hätte ich so manche Lebenskrise nicht überstanden.«
»Sie brauchen etwas ganz anderes als Beruhigungs-Drogen.« Jürgen Bruns machte einen Schritt vorwärts und stand in meinem Zimmer. Sein Blick fiel auf das von mir gebastelte kleine Weihnachtsgesteck.
»Das ist entzückend! Selbst gemacht?« Er griff mit seinen langen schmalen Fingern danach und drehte es bewundernd hin und her.
»Also eigentlich …« Ich schluckte trocken. »Eigentlich habe ich es für Sie gemacht.«
Schon wieder errötete ich verlegen und hatte das dringende Bedürfnis nach einer Zigarette.
»Für mich?« Verwirrt deutete Jürgen Bruns auf seine Brust. »Wie komme ich denn dazu? Ich meine, für mich hat noch nie jemand was gebastelt, und das hier ist … einfach vollkommen!«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Er musste ja nicht wissen, dass ich es bereits vor seiner Ankunft für meine nächste Zimmernachbarin gemacht hatte, die nun ein Zimmernachbar war.
»Ich wollte Ihnen eine Freude machen«, sagte ich leise.
»Das haben Sie, und was für eine!« Jürgen Bruns beugte sich zu mir herunter und streifte mit dem Handrücken meine Wange. »Dann werde ich jetzt mal alleine durch den Wald stapfen. Und dabei an Sie denken.«
Er drehte sich um und zog die Tür hinter sich zu. Mein Blick irrlichterte zum Tisch. Das Geschenk! Er hatte das Geschenk stehen lassen! Was hatte das zu bedeuten? Hohle Worte? Oder wollte er einen Grund haben, wiederzukommen?
Ich warf mich rücklings aufs Bett und schloss die Augen.
Weihnachten in meiner Kindheit: Meine Mutter, fein gemacht, so gut es eben ging, stapfte mit Sieglinde und mir zur Weihnachtsfeier im Kindergarten. Dort kam der Nikolaus, ein furchterregender Mann mit weißem Bart, begleitet von wunderschönen Engeln in weißen Kleidern und mit goldenen Flügeln. Für jeden von uns hatte er ein kleines Geschenk dabei, das er geheimnisvoll aus seinem Sack zog.
Ich klammerte mich ängstlich an Mutters Rocksaum, bevor ich es wagte, mit gesenktem Blick zwei Schritte vorzutreten und es in Empfang zu nehmen.
Es war ein liebevoll gebasteltes Gesteck mit einer roten Kerze, und an den kleinen grünen Zweigen waren winzige Holzfigürchen befestigt. Die durfte ich behalten! Es waren meine ersten Spielsachen, und ich fühlte mich wie im Märchen. Wir saßen im Kreis und sangen zur Gitarre wunderschöne Lieder, die von Frieden und Freude, von klingelnden Glöckchen und vom Christkind handelten. Ein riesiger Weihnachtsbaum mit bunten Kugeln und glitzernden Lichtern stand mitten im Raum. Unsere staunenden Kinderaugen müssen mit den Kerzen um die Wette geleuchtet haben. Unter dem Baum stand eine raffiniert beleuchtete Krippenlandschaft, über der ein Stern blinkte, und prächtig ausstaffierte Gestalten bestaunten das Jesuskind. Plötzlich begriff ich, dass dieses Jesuskind genau so arm war wie wir. Es hatte auch nichts anzuziehen und keine Schuhe an den winzigen Füßchen, obwohl doch Winter war. Wahrscheinlich hätte es sich über eine warme Decke und Söckchen mehr gefreut als über Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ansonsten interessierte ich mich sehr für den riesigen Teller mit Gebäck und Schokolade: Die Köstlichkeiten waren mit buntem Zuckerguss verziert, daneben lagen pralle Mandarinen, Nüsse und glänzende, pausbäckige Äpfel. Ich konnte kaum fassen, dass ich dort tatsächlich einmal hineingreifen durfte. Jedes Kind bekam ein kleines Säckchen an einer Kordel und durfte es mitsamt duftenden Zimtsternen, Vanillekipferln, Nüssen und Mandarinen nach Hause tragen. Ich hütete meines wie einen Schatz und steckte immer wieder mit geschlossenen Augen die Nase hinein: so himmlisch musste es im Paradies duften! Aber wie kam man da nur hin? Seit der Sache mit Eva, die aus Neugierde und Übermut einen verbotenen Apfel vom Baum gepflückt hatte, mussten wir alle in diesem irdischen Jammertal leben, schuften, frieren, hungern und darben. Manchmal hatte ich schon einen ziemlichen Zorn auf diese Eva. Warum hat der eigentlich niemand den Apfel aus der Hand geschlagen und ihr ordentlich mit dem Schürhaken den Hintern verdroschen? Dann wäre uns viel erspart geblieben.
Meinen Vater haben wir damals bestürmt, doch auch zu Hause so ein Weihnachten zu feiern: »Nur ein kleines bisschen feierlich, bitte, bitte, lieber Vater! Nur eine Kerze oder zwei, und vielleicht ein Lied, ein paar Holzfigürchen und einen Baum, bitte, Vater, einen Baum!«
»Ihr seht wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht!«
»Und Kekse, Mutter, bitte, nur ein paar kleine selbst gebackene Kekse!«
»Woher soll ich denn das Geld für die Zutaten nehmen? Butter und Eier könnten wir uns ja noch vom Munde absparen, aber wisst ihr, was Mehl, Zucker und Backpulver kosten?«
Nein. Wir wussten nur, dass andere Kinder das alles hatten und wir nicht.
Der Vater hockte in seinem blauen Fabrikdrillich erschöpft am Tisch. Doch als er unsere Kostbarkeiten bestaunte, kam so etwas wie Leben in das versteinerte Gesicht. Seine abgearbeiteten, verschwielten Hände drehten die Figürchen hin und her, und sein Blick ging in die Ferne. Ein Jahr später trauten wir Kinder unseren Augen kaum: In der Stube hing ein winziges Tannenbäumchen von der Decke, und darunter stand eine alte Apfelsinenkiste, die er eigenhändig zum Stall umfunktioniert hatte. Drei selbst geschnitzte Holzpüppchen stellten Maria, Josef und das Jesuskind dar. Wir konnten es nicht fassen, dass das Christkind auch zu uns in die Arme-Leute-Siedlung gekommen war, ins vorletzte Haus des vergessenen Tales. Wir knieten staunend und betend davor. Nach Weihnachten war die ganze Pracht wie von Zauberhand wieder verschwunden, aber zuverlässig zum vierundzwanzigsten Dezember tauchte sie jedes Jahr wieder auf. Und jedes Mal hatte das Wunder noch an Pracht dazugewonnen: Da waren noch mehr Püppchen, die Hirten darstellten, da hatte das Jesuskind ein Bettchen aus Stroh, eine winzige Decke. Maria war nun in ein blaues Gewand gekleidet, Josef rauchte Pfeife, aus Kastanien waren Schäfchen geworden, und an den Apfelsinenkistenwänden klebten Tapetenreste. Sogar eine Küche mit Öfchen, Pfännchen, Töpfchen und Schüsselchen war vorhanden! Nun konnten wir dem Jesuskind mit Brotkrümeln und Wasser ein Süppchen kochen. Dass mein Vater auch weiche Züge besaß, hat er nicht nur mit dieser Krippe bewiesen.
Als ich in die zweite Klasse ging, hatte uns die Lehrerin als Hausaufgabe gegeben, einen Eulenspiegel aus Buntpapierstückchen zu kleben. Natürlich hätten wir das auch aus alten Zeitungen machen können. Im Plumpsklo auf dem Hof gab es genug davon. Man konnte aber auch dieses wunderbare Lack- und Buntpapier kaufen, für 20 Pfennige ein Heft mit sechs verschiedenfarbigen Blättern. Hinten Spucke drauf, und die Papierfitzelchen klebten dort, wo man sie haben wollte. Ich wollte, wollte, wollte einmal auch haben, was die anderen Kinder hatten!
Deshalb schlich ich nach der Schule in die Küche und zog mit zitternden Fingern die Schublade auf, in der mein Vater seine Kupfermünzen für sein wöchentliches Bier aufbewahrte. Ein einziges Bier gönnte er sich, am Samstagabend in der Dorfkneipe, in der er immer abseitssaß, weil er nicht dazugehörte, aber wo man ihn immerhin duldete. Auf dieses eine Bier freute er sich die ganze Woche.
Mich hastig umschauend stellte ich sicher, dass die Mutter gerade im Stall beschäftigt und der Vater noch nicht von der Fabrik zurück war. Dann nahm ich die Pfennigmünzen in meine schmutzige kleine Kinderhand und rannte so schnell mich meine Beinchen trugen zurück ins Dorf. Im dortigen Schreibwarenladen erstand ich ebenfalls so ein wunderbares Buntpapierheftchen. Ich würde den schönsten Till Eulenspiegel der ganzen Klasse kleben, aus Hunderten von sorgfältig ausgerissenen Papierfitzelchen, in allen Farben des Orients! Das würde mir endlich einen Zweier einbringen, das Lächeln der Lehrerin, und vielleicht sogar ein Lob der Mutter!
Aufgeregt kam ich ein zweites Mal heim, der Vater beugte sich schon über die Suppe, brockte altes Brot hinein und schlürfte sie anschließend in sich hinein. Arglos zeigte ich ihm das Buntpapierheftchen, blätterte stolz die sechs verschiedenen Farben vor ihm auf: Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau und Schwarz. Vielleicht würde sogar noch etwas übrig bleiben, als Tapete für die Weihnachtskrippe!
Vaters Blick wurde starr, und der hölzerne Suppenlöffel fiel auf den Tisch.
»Wo hast du das Geld dafür her?«
Die Mutter, die am Herd hantierte, drehte sich entsetzt um, und ihr entfuhr ein ungläubiges Schnauben. Sie wischte sich die Hände an der Kittelschürze ab und griff nach dem Kochlöffel.
Mit einem Mal wurde mir kläglich bewusst, dass ich etwas Unrechtes getan hatte. Ich hatte gestohlen!
Dafür würde es jetzt eine fürchterliche Tracht Prügel geben. Doch ich war mehr als nur bereit, die verdiente Strafe über mich ergehen zu lassen, Hauptsache, ich durfte das bunte Heftchen behalten!
»Aus der Küchenschublade«, sagte ich tapfer und versteckte das Heft schützend hinter meinem Rücken. Sollte er mich ruhig schlagen, aber das Buntpapier durfte dabei nicht beschädigt werden!
Zu meiner Überraschung schlug mich Vater jedoch nicht. Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er sagte: »Schau, Kleines, zwanzig Pfennig sind für unsereinen eine Menge Geld! Weißt du, wie viel ich pro Stunde in der Fabrik bekomme?«
Ich schluckte. »Sechs Pfennig«, sagte ich mit belegter Stimme und drohte mich auf einmal an dem Heftchen zu verbrennen.
»Wie viele Stunden muss ich also für dein Heftchen arbeiten?«
»Zwei?«
»Fast vier«, sagte der Vater. Er nahm meine Hände und sah mich eindringlich an. »Und schau mal, wie verfallen unser Häuschen ist. Die Tür schließt nicht mehr richtig, beim Fenster fehlt eine Scheibe, und der kalte Wind pfeift herein, die Stiege ist morsch, der Putz im Schlafzimmer rieselt aufs Bett, und die Mama hat seit fünf Jahren immer nur denselben Kittel an.«
Meine Mutter wandte sich abrupt ab und ich sah, wie sie sich über dem Suppentopf die Augen wischte.
»Was willst du jetzt mit dem Heftchen machen?«
Meine Finger ließen das ersehnte Heft los, und es fiel auf das fleckige Wachstuch neben die Brotbrocken und die Suppe.
»Vorsicht!«, sagte der Vater, und ein winziges Lächeln erhellte seine Züge. »Wenn es schmutzig wird, nimmt es die Verkäuferin nicht mehr zurück.«
Meine Eltern weinten beide, als ich das Heftchen vorsichtig an mich nahm, es unter meine Schürze steckte und mich erneut barfuß auf den Weg ins Dorf machte.
Ich rannte wie von der Tarantel gestochen zum Laden und war unendlich erleichtert, als die Verkäuferin es mir wieder abnahm. Eine Stunde später lagen die Kupferpfennige wieder in der Schublade.
Noch am selben Abend brachte mir der Vater zum Trost alte Pappe aus der Fabrik mit. Die zerrissen wir gemeinsam und klebten damit einen graubraunen Eulenspiegel zusammen. Seine mageren Hände arbeiteten gewissenhaft. Die Mutter spendierte etwas Sirup als Klebstoff. Sie putzte sich mit dem Kittelzipfel die Nase, weil ihr bei unserem Anblick die Tränen kamen. »Sind doch Kinder, Gottlieb«, sagte sie, während sie sich abwandte. »Sind doch Kinder!«
Am nächsten Abend brachte der Vater einen alten Karton mit, den wir mit ein paar Kohlestrichen zu einem Mühle-Spielbrett umfunktionierten. Meine Mutter stellte uns aus hellen und dunklen Knöpfen die nötigen Spielfiguren zusammen, und dann spielten wir Mühle. Der Vater saß geduldig auf seinem Schemel und zeigte uns die Spielzüge. Als ich zum ersten Mal durch Zufall eine Mühle zusammenbrachte, riss ich jubelnd die Arme hoch, schnappte meinem Vater einen Knopf weg, und er lachte zahnlos. »Sind doch Kinder«, sagte er zu meiner Mutter Karoline, die am Herd stand.
An diesem Samstag kaufte sich der Vater kein Bier, sondern meiner Schwester und mir am Sonntag nach der Messe je eine Kugel Eis. Es war das erste Eis meines Lebens.
5
»Na, wie war die Wanderung?«
Erwartungsvoll hielt ich der Gruppe, die gerade durchgefroren über den Garten hereinkam, die große Tür des Wintergartens auf. Natürlich hatte ich wieder rauchend in meinem Glaskasten gehockt und die Minuten gezählt, bis es endlich Mittagszeit war.
Mein Herz begann sofort zu klopfen, als ich Jürgen Bruns sah, der so ziemlich als Letzter eintrudelte. Er schien sich angeregt mit der blassen blonden Angelika, einer eher stillen Mitpatientin zu unterhalten, die fürchterlichen Stress mit ihrem Mann hatte. Während dieser Kur wollte sie über eine eventuelle Scheidung nachdenken. Sofort spürte ich einen schmerzhaften Stich.
»Oh, es war klasse, wir haben einen Schneemann gebaut und eine wilde Schneeballschlacht gemacht.« Lachend klopften sich die Spaziergänger den Matsch von den Schuhen. »Schade, dass du nicht dabei warst, Gerti.«
»Du wärst erfroren vor Kälte!«
Der laute Georg konnte es nicht lassen, mich ständig vor den anderen anzubaggern. »Dich hätte ich gern mal eingeseift …« Grinsend verpasste er mir einen Knuff und ging händereibend Richtung Speisesaal: »Das riecht ja verdammt lecker, was gibt es denn …?«
Meine Augen suchten die von Jürgen Bruns, und als er meinen Blick erwiderte, wusste ich, dass ich mir wegen Angelika keine Sorgen zu machen brauchte.
»Wir haben Sie vermisst«, sagte er leise und streifte wie zufällig meine Schulter, als er sich bückte, um seine Schuhe auszuziehen.
»Ich Sie auch«, hörte ich mich antworten. Sofort wurde ich wieder rot. Tatsächlich hatte ich in seiner Abwesenheit gefühlte zwanzig Zigaretten geraucht und die Sekunden gezählt, bis er wiederkam.
»Ich bin schon mal im Speisesaal. Soll ich euch einen Platz frei halten?« Angelika schien auch wieder richtig Appetit zu haben.
»Ja, warum nicht?« Fragend sah ich Jürgen Bruns an. »Gehen Sie essen?« Ich selbst hatte das eigentlich gar nicht vorgehabt. Ich bekam einfach nichts runter.
»Also wenn ich neben Ihnen sitzen darf?«
»Ja, klar, also, ähm … gern!« Ich stammelte wie eine Dreizehnjährige. Was war nur mit mir los? Allein schon beim Gedanken an Schweinefleisch mit Sahnesauce, Kartoffeln und Möhren drehte sich mir der Magen um. Aber man konnte ja mal eine Ausnahme machen.
»Gibt es hier eine feste Sitzordnung?« Jürgen Bruns lief erwartungsvoll neben mir her.
»Ja, aber die kann man ändern.«
»Ich bitte darum. Aber zu meinen Gunsten! Ich gehe nur noch kurz Hände waschen. Und Ihr Weihnachtsgeschenk hole ich dann nach dem Essen ab!«
Er hatte es also nicht vergessen. Er suchte wirklich nach einem Grund, mich noch mal auf meinem Zimmer zu besuchen!
Mein Herz tanzte Tango, als ich mich an den Tisch setzte, als hätte ich einen Bärenhunger. Unschuldig schaute ich in die Runde.
»Du, Gerti, der hat ein Auge auf dich geworfen«, sagte Angelika lächelnd, als sie mir den Brotkorb reichte. »Und gute Manieren hat der! Wahrscheinlich pinkelt der sogar im Sitzen! – Butter?«
Butter und Sahne haben wir damals auch selbst gemacht, nach dem Krieg. Von der Milch, die unsere Liesel hergab, mussten wir den größten Teil an einer Sammelstelle abliefern. Wer das nicht tat, riskierte Kopf und Kragen. Aus dem bisschen, das wir selbst behalten durften, machte meine Mutter Sahne, und wir mussten ihr dabei wie immer helfen. Das war sogar spannend: Unsere Zentrifuge wurde von Hand bedient. Man drehte an einer Kurbel, und die Milch schlug Blasen, bis dicke klumpige Sahne aus der einen Zentrifugenform quoll und entrahmte Milch aus der anderen. Davon wurde Buttermilch gemacht. Die klebrigen Sahnebrocken sammelte unsere Mutter in einem Steinkrug, der so lange stehen blieb, bis sie angedickt war und Mutter davon Butter machen konnte. Auch das war wieder eine langwierige Kurbelarbeit, und als Butter konnte man das Ergebnis dieser Bemühungen letztlich nicht verwenden. Das Ganze war ja so ranzig! Aber es diente der Mutter als Koch- und Bratfett.
Manchmal verirrten sich Flüchtlinge in unser abgelegenes Tal, in unsere Siedlung der Ausgestoßenen. Dann stellte ich fest, dass es noch schlimmere Armut gab. Ihre Augen waren groß und glasig, ihre ausgezehrten Gesichter apathisch und leer. Sie sahen aus wie der leibhaftige Tod. Wir Kinder fürchteten uns und versteckten uns unter der Stiege, wenn sie bei uns bettelten. Die Mutter gab ihnen immer etwas, eine halbe Tasse Malzkaffee, einen Brocken Brot, einen Schöpfer wässriger Suppe, einen Klumpen Fett. Bei den reichen Bauern hätten sie nichts bekommen, berichteten sie. Alle hätten ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen, der letzte hätte ihnen höhnisch den Weg in die Arme-Leute-Siedlung gewiesen: »Sechs Kilometer bergauf, immer am Fluss entlang. Da wohnen euresgleichen, zu denen könnt ihr euch gesellen.«
Nie haben die Landwirte mit den großen Bauernhöfen weiter unten im Tal mit irgendwas ausgeholfen. Im Gegenteil, wir mussten noch denen aushelfen, auf ihren Feldern, damit wir Linsen und Ähren lesen durften. Dabei fand meine Mutter einmal eine Feige, die vor Ameisen nur so wimmelte. Die hat sie an der Kittelschürze abgewischt und dann zwischen Sieglinde und mir geteilt. Wir Kinder haben uns darauf gestürzt und mit geschlossenen Augen den süßen Geschmack genossen. Zucker war ja Mangelware, etwas Süßes gab es bei uns nicht.
Meine Schwester Sieglinde hatte eine Schulfreundin, Renate, deren Eltern reiche Bauern waren. Wenn sie sich manchmal von der Arbeit davonstahl und zum Spielen zu Renate lief, schlich ich hinterher, denn diese Leute hatten jeden Tag frisch gebackenen Kuchen und Platten voll belegter Butterbrote auf dem Tisch. Dann wartete ich stundenlang am Gartenzaun vor ihrem mit Silbertannen umfriedeten Grundstück und warf begehrliche Blicke auf den Gartentisch, auf dem sich Bleche mit frischem Pflaumenkuchen bogen. Ich sah Renate und Sieglinde am Tisch sitzen und mit Puppen spielen, sie fütterten sie mit Kuchenkrümeln und flößten ihren porzellanenen Mündern Kakao ein. Der Hund bekam schließlich, was die Puppen nicht schluckten.
Der Hunger rumorte in meinen Eingeweiden, und schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen. Einmal sackte ich einfach vor ihrem Gartentor zusammen. Als Renates Eltern mich Elendshäufchen sahen, schickten sie auch Sieglinde fort. Wir sollten heimgehen, hier gäbe es nichts zu erbetteln. Die Dorfkrankenschwester, die zufällig an diesem Tag in der Nähe war, wurde von den Bauersleuten zur Beruhigung ihres Gewissens gerufen. Sie waren schließlich anständige Christen, die sich nichts zuschulden kommen ließen. Sie nahm mich an die Hand und brachte mich zu meinen Eltern zurück. Obwohl ich inzwischen sieben oder acht war, sah ich aus wie eine Vierjährige. Die Krankenschwester erklärte meinen Eltern, dass dies ein Zeichen chronischer Unterernährung sei, und verordnete mir zwei Wochen Bettruhe und Aufbaukost.
Daraufhin bot mein Vater den reichen Bauern seine Dienste an, um Essen für mich zu organisieren. Er wollte nichts geschenkt haben, er wollte dafür arbeiten.
Sie schickten ihn auf die Felder und in ihre Ställe und Scheunen zum Rattenfangen. Ja, mein Vater hat für mich Ratten gefangen. Sonst wäre ich wahrscheinlich verhungert. Für jeden Schwanz zwanzig Pfennig, das war der Deal. Mein Vater kroch auf allen vieren im Dreck herum und fing die Ratten mit bloßen Händen. Als er das nötige Geld zusammenhatte, kaufte er beim Schrotthändler Mäusefallen und stellte sie bei den reichen Bauern auf.
Nach einigen Hundert toten Ratten bekam mein Vater das für mich so wichtige Essen.
Ich durfte zwei Wochen lang zurück in mein grün gestrichenes Gitterbett, zurück auf meinen Strohsack, und wurde einer Art Gänsemast unterzogen: nicht bewegen, nicht laufen und nichts tragen, dafür dreimal täglich etwas essen. Der Vater legte ein Holzbrett über die Gitterstäbe, das war mein Tablett. Täglich bekam ich ein Glas Saft. Zwei ganze Wochen lang. Anschließend war die paradiesische Zeit vorbei, und der Vater fing keine Ratten mehr.
Sieglinde wurde von Renate nie wieder eingeladen, und zuerst war sie sehr böse auf mich, aber dann sah sie ein, dass ich nichts dafür konnte. Unsere Namen wurden mit Zorn und Verachtung erwähnt, wir waren die Bettelkinder aus der Steinbruchsiedlung, kein Umgang für die Bauernkinder. Statt eines Schulbrots steckte uns unsere Mutter eine Handvoll getrockneter Schlehen in die Schürzentasche. Warfen wir in der Pause einen hungrigen Blick auf das dick belegte Wurstbrot eines Bauernkindes, wandte sich dieses verächtlich ab: Zigeunerkind, Bettelkind, Hungerleidermädchen.
Sonntags auf dem Weg zur Kirche holten wir immer Oma Bärbel ab, eine alte, zahnlose Frau aus der Nachbarschaft. Sie war schon fast blind und hätte den Weg allein nicht geschafft. Eines Tages, wir gingen gerade zur Ostermesse, fiel mir etwas Ungewöhnliches an Oma Bärbel auf.
»Warum ist dein Gesangbuch heute so dick, Oma Bärbel?« Neugierig schaute ich auf das abgegriffene, in Kunstleder eingebundene Gebetbuch, das sich heute so merkwürdig wölbte. Vielleicht hatte sie ein Butterbrot für uns dabei? Oder ein Osterei?





























