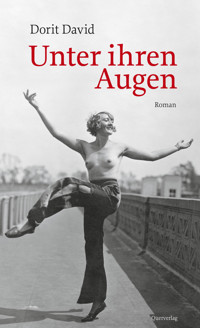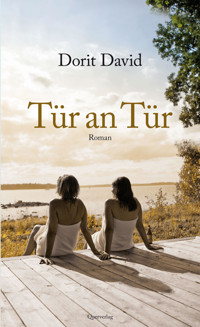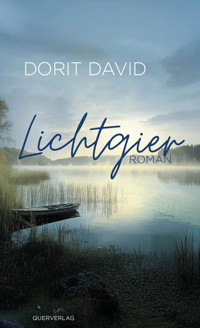Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Laetitia eines Tages die Stimme ihrer Mutter im Autoradio hört, stellt sie mit Erschrecken fest, genau diese Stimme geerbt zu haben. Sie beschließt, mit dem Reden aufzuhören. Zum Glück weiß sich die spröde Gebärdensprachdolmetscherin auch ohne Worte gut durchs Leben zu schlagen. Ein paar Wochen später jedoch liegt ihre Mutter Hanna im Koma. Unfähig, sie zu berühren, steht Laetitia am Krankenbett und wird zum Innehalten gezwungen. Zeitgleich verschwindet ihr fünfzehnjähriger Sohn Eric. Die allein erziehende Mutter Laetitia, deren Maxime es von jeher war, ohne Rücksicht auf Verluste geradeaus zu schauen, stößt nun an ihre emotionalen Grenzen. Mit Hilfe von Mabel, ihrer neuen lebenslustigen Kollegin, beginnt sie nicht nur ihre Stimme wiederzufinden. Allmählich wird Laetitia klar: Es sind die ungesagten Botschaften und die Geheimnisse aus Hannas Vergangenheit, die wie stille Post das Leben ihrer Familie durchziehen. Diese Post muss endlich geöffnet werden, und Laetitia wird mit einem Thema konfrontiert, das wie ein roter Faden drei Generationen miteinander verbindet: Flucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Erste Auflage der Printausgabe September 2012
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von Harry Kerr (getty images).
ISBN 978-3-89656-532-7
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH und Salzgeber & Co. Medien GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de - www.salzgeber.de
Widmung
„Nichts ist wahrer als das, was man nicht vergessen kann …“
S. Celibidache
Es ist ein Schnee gefallen
Und ist es doch nit Zeit
Man wirft mich mit den Ballen
Der Weg ist mir verschneit.
Mein Haus hat keinen Giebel
Es ist mir worden alt
Zerbrochen sind die Riegel
Mein Stüblein ist mir kalt.
Ach Lieb, laß dich’s erbarmen
Daß ich so elend bin
Und schleuß mich in dein Arme!
So fährt der Winter hin.
Ambraser Liederbuch, 1582
Prolog
Januar 1945
Es sah aus wie ein Schaufenster. Ein Schaufenster aus Eis. Nur dass sie nicht senkrecht davor, sondern mit beiden Beinen direkt auf der Glasscheibe stand. Das vierjährige Mädchen stand aber keineswegs auf einem Schaufenster. Was es dafür hielt, war nichts anderes als ein Stück der Eisfläche des Haffs, durch die es hindurchsehen konnte. An den Rändern war die Scheibe vom Schnee freigeweht worden und gerade so dick wie ihr Kinderstiefel. Das Mädchen blickte fasziniert auf etwas, das es unter den Füßen sah. Das Wundervollste daran und der Grund, warum sie so verzaubert auf das Eis schaute, obwohl die Großen laut und wiederholt ihren Namen durch den Nebel riefen, war: Unter dem Eis befand sich eine Kutsche. Sogar die Pferde konnte sie genau erkennen. Die Tiere schienen in vollem Galopp zu sein.
Das Mädchen bückte sich und wischte mit seiner rot gefrorenen Hand den harschen Schnee beiseite. Die Mitte des hölzernen Hinterrades der Kutsche lag dicht unter dem Eis und ragte ein wenig vor, so dass sich ein kleiner Hügel auf der Oberfläche gebildet hatte. Er sah aus wie ein großes Bonbon und passte genau in die hohle Hand. Das Mädchen bückte sich und leckte. Salzig. Die Zunge klebte fest; es tat weh. Schnell zog das Mädchen sie ein. Es hockte so dicht vor dem Eis, dass es auch den Metallbeschlag genau erkennen konnte. Wie ein goldener Ring umfasste er das Hinterrad. Das Kind glaubte fest daran, dass es Gold war. Was sollte es denn sonst sein? Erst als ein dumpfes Brummen durch die Wolken drang und die Rufe der Großen sich überschlugen, löste sich das Mädchen von dem Anblick, nahm Anlauf und schlitterte den Stimmen hinterher.
Es ist ein Schnee gefallen
Februar 2007
Laetitia hörte an jenem Tage mit dem Sprechen auf, als sie über einen Regionalfunksender beim Autofahren auf der E28 feststellte, dass sie haargenau die Stimme ihrer Mutter geerbt hatte. Die Konferenz war anstrengend gewesen; sie hatte übermäßig lange gedolmetscht. Fünf Stunden im Wechsel mit einem Kollegen und von einigen Pausen unterbrochen, aber dennoch zogen bereits Vorboten beginnender Kopfschmerzen langsam ihren Hinterkopf hinauf. Laetitias Unterbauch krampfte, und zu ihrem Verdruss wurde sie durch ihre Blutung überrascht. Fluchend löste sie die Hand vom Lenkrad, fingerte im Handschuhfach nach der Pappschachtel mit den abgestoßenen Kanten und befreite geschickt die letzte von zwei Tabletten aus der Verpackung. In diesem Moment geschah es, dass der Radiosprecher unvermittelt die Gewinnerin eines Preisrätsels in der Leitung hatte. Laetitia horchte überrascht auf, weil sie meinte, sich selbst zu hören. Die Tablette sprang ihr aus den Fingern, fiel auf den Boden und rollte unter dem Sitz.
„Stockentenschießen!“, tönte ihre Stimme, die nicht ihre war, durch den Kleinbus. Danach ein Lachen.
„Das ist goldrichtig! Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!“ Dann wieder dieses Lachen. Es klang scheppernd und verzerrt durch die Telefonverbindung, aber es war dennoch nicht zu leugnen: ihr Lachen. Laetitias Hände hielten wie gelähmt das Lenkrad umfasst, während sie weiterlauschte.
„Und Sie kommen aus … ?“
„Aus Ebermünde. Aus Ebermünde komme ich“, hörte Laetitia die Stimme im Radio sagen und gleich darauf die Erwiderung des Moderators: „Dann ist Ebermünde jetzt um eine glückliche Gewinnerin reicher. Haben Sie denn eine Idee, was Sie mit dem Geld anstellen werden?“
„Ich weiß nicht genau“, lachte die Stimme hysterisch und verschluckte sich dabei. „Ich hab ja alles, was ich brauch, ich glaub, ich werde wohl mal meinen Enkel fragen müssen.“
„Na, dann ist Ebermünde jetzt auch um einen glücklichen Enkel reicher, Frau Klänger, wie heißt er denn, wenn ich fragen darf?“
Laetitia schaltete ab. Schnell, noch bevor die Stimme, die ihrer Mutter Hanna gehörte, den Namen ihres Sohnes preisgeben konnte. Eric.
Der Überraschungsmoment, der Laetitia zunächst erschreckte, als sie meinte, ihre eigene Stimme zu hören, hätte sie an diesem Tage beinahe das Leben gekostet.
Ein roter VW – ein Ausscherer – war direkt vor ihr zwischen den beiden Lastern aufgetaucht, die sie linker Hand zu überholen angesetzt hatte. Panisch trat sie auf das Bremspedal, um nicht aufzufahren, und nur der Geistesgegenwart des hinter ihr bremsenden Porschefahrers war es zu verdanken, dass ein Unfall ausblieb. Ein durchdringendes Hupen zeugte von dem Schreck, den sie durch ihr panisches Manöver kaskadenartig nach hinten weitergegeben hatte. Zu allem Überfluss hob Laetitia beide Hände gleichzeitig vom Lenkrad in die Luft und modulierte spontan ein Sorry, indem sie die rechte Hand hektisch über den Handrücken der Linken rieb, was bei dem Fahrer nur ein verständnisloses Kopfschütteln auslöste. Schnell packte sie wieder das Lenkrad, blinkte kurz und ließ den aufgebrachten Mann vorbeiziehen. Er hatte die Geste ihrer Hand nicht verstanden und sie selbst konnte sich ebenso wenig erklären, weshalb ihr in dieser heiklen Situation ausgerechnet die Gebärdensprache unter die Finger gekommen war. Rein gar nichts konnte sie sich in diesem Moment erklären. Stattdessen hielt sie weiter das Lenkrad umfasst. Es war ihr, als bestünde die Luft aus Glas, als schaute sie durch eine meterdicke Schaufensterscheibe. Und wenn sie in diesem Moment überhaupt in der Lage gewesen wäre, irgendetwas aus dem Gegenwärtigen zu erkennen, so waren es die Augen des jungen Mannes gewesen, der sich zu einem abschätzenden Blick für die hagere Mittdreißigerin herabgelassen hatte, die noch immer halb erstarrt ihr Lenkrad umfasst hielt, nur weil sie eben zum ersten Mal in ihrem Leben festgestellt hatte, dass ein hörbarer Teil ihres Körpers identisch mit dem ihrer Mutter war.
Es grenzte an ein Wunder, dass Laetitia ihre Zweizimmerwohnug in Ebermünde an jenem Abend heil erreichte. Hätte man sie gefragt, wie, so hätte sie sich nicht erinnern können. Aber es fragte sie niemand und so blieb es auch unbemerkt, dass sie an jenem Tage mit dem Sprechen aufgehört hatte.
Hanna war eine rundliche Frau und lebte am Rande von Ebermünde nahe einem Ausläufer des Niedermünder Kanals, den man auch Alte Furt nannte. Ein Weiher, wie sie ihn gerne titulierte, weil er fast zugewachsen war. Laetitia und ihre Mutter Hanna verbanden einerseits ein Leben in der gleichen Stadt ebenso wie die geteilte Fürsorge für Laetitias Sohn Eric. Und doch gab es andererseits nichts in Laetitias Leben, dem sie ständig und stärker auswich als dem Beisammensein mit ihrer Mutter. Eine ungezügelte Verachtung flammte auf, sobald sie länger als ein paar Stunden in Hannas Nähe war. Wenn sie ihre Mutter besuchte, verspürte sie sofort den Drang, sich ins Auto zu setzen und loszufahren, zumeist unter dem Vorwand, etwas Dringendes erledigen oder ungestört mit jemandem telefonieren zu müssen. Und Hanna nahm es hin. In ihrer leiblichen Fülle wirkte sie, als könnte ihr nichts wirklich etwas anhaben. Doch selbst die Massigkeit ihrer Mutter war Laetitia zu viel. Sie hatte zwar hin und wieder versucht, darüber nachzugrübeln, ob es einen Grund für die vehemente Ablehnung des Fetts ihrer Mutter gab, aber sie fand einfach nichts. Keine Erklärung. Nur ein Bild war da, das sich in ihr festgesetzt hatte, das aber so gleichermaßen unlogisch wie bizarr war, dass sie aufgehört hatte, sich weiter darin zu vertiefen.
Auf jenem Bild war ihre Mutter Hanna abgebildet, die ihr in all ihrer Massigkeit entgegenwuchs. Dies tat ihre Mutter aus einem einzigen Grunde: Sie konnte Laetitia nicht gehenlassen. Da Hanna aber nie genau wusste, wo sich ihre unstete Tochter gerade aufhielt, wuchs sie eben einfach in alle möglichen Richtungen.
Als es dennoch geschah, dass Laetitia mit knapp zwanzig, mager, aber ausgewachsen und ihre Mutter um zwei Kopflängen überragend, endgültig aus dem Haus ging, begann Hanna, was ihr an Höhe nicht mehr möglich war, langsam durch leibliche Breite auszugleichen. Und jedes Mal, wenn Laetitia sie damals in Ebermünde besucht hatte, erschien sie ihr mächtiger und massiger als je zuvor.
Früher war Hanna eine Frau gewesen, der viele Männer nachstellten. Aber niemand war geblieben, niemand schien gut genug. Die dauernden Wechsel hatten Laetitia lediglich eine temporäre Stiefschwester eingebracht, mit der sie sich nicht allzu gut verstand. Und auch wenn Hanna damals schlank gewesen war, so hatte sie sich in ihrem Wesen schon immer überbordend gezeigt. Jeglichen Bewegungsspielraum ihrer Tochter hatte sie frühzeitig durch ihre eigene innere Fülle zunichtegemacht. Vermutlich hatte sie ihre Liebhaber damals eher verdrängt als verlassen, höhnte Laetitia, seufzte und klopfte auf das Lenkrad.
Wie auch immer, eines blieb: Unaufhaltsam und bis zum heutigen Tag überwältigte sie das Gefühl, ihre Mutter suchte den zwischen sich und ihrer Tochter liegenden Raum durch Fettzuwachs zu verringern.
Dass diese Fantasien nicht der Norm entsprachen und nichts mit der Realität zu tun hatten, ahnte Laetitia und sie beobachtete natürlich auch, dass Hanna nicht imstande war, auch nur einen Krümel Brot wegzuwerfen. Die Fettleibigkeit ihrer Mutter auf sich zu beziehen, war narzisstisch, das wusste sie. Und dennoch tat sie es.
Als Eric fünf wurde, war sie sogar zurückgekommen nach Ebermünde, heimgekehrt, wie Hanna freudig ausgerufen hatte. Doch die Freude war einseitig geblieben. Für Laetitia war die Rückkehr damals nur das kleinere von zwei Übeln gewesen.
Obwohl sie unentwegt auf die Straße starrte, verpasste sie an diesem Tage beinahe die Ausfahrt nach Ebermünde.
In der Wohnung schlug ihr die abgestandene Luft entgegen. Sie hatte vergessen, die Fenster auf Kippe zu stellen. Eric schlief bei Hanna. Das hatten sie im Vorfeld geregelt. Den folgenden Tag wäre Laetitia wegen eines Auftrages unterwegs und heute war sie einfach zu müde. Es war ihr nur lieb. Der Widerwille, ihre Stimme zu gebrauchen, wog schwer.
Natürlich konnte sie es sich nicht leisten, das Dolmetschen auf diesem Festival aufgrund einer launischen Unpässlichkeit abzusagen. Sie ließ die Tasche in den Flur fallen, ging ins Bad und stellte sich vor den Spiegel. Einatmen, Ausatmen. Gequält versuchte sie ihrem Atem einen zarten Summton beizugeben. Abgesehen von dem rauen Gefühl im Hals, dessen leichten Schmerz sie in der Lage gewesen wäre zu ignorieren, war da nichts, was es hätte verhindern sollen. Doch schon im Ansatz des Tönens sabotierte eine aufsteigende Übelkeit jegliche Stimmfärbung. Laetitia schüttelte den Kopf. Was zum Teufel bedeutete das? Mit leiser Furcht studierte sie ihr Gesicht, als hätte sie Angst, weitere Anzeichen einer Ähnlichkeit mit Hanna an sich zu entdecken. Da war nichts. Noch einmal versuchte sie zu sprechen, aber lediglich der Unwille kroch ihr die Magengegend hinauf und die unterschwellige Übelkeit war schneller als jedes Wort. Sie setzte sich auf den Wannenrand und atmete noch einmal tief durch. Eine merkwürdige Schwäche hatte sie befallen. Eine Schwäche, die über Kopfschmerz und Erkältungsanzeichen hinausging. Etwas in ihr wollte partout nicht und sie musste es akzeptieren.
Selbst ohne Navigation hätte sie das Gebäude gefunden. Es handelte sich um ein Freizeitheim. Ein flacher, grauer Betonbau mit breiter Glasfront, dessen Fenstersimse dicht mit grauweißem Taubenkot übertüncht waren. Es wirkte wie eine kunstvolle Patina. Laetitia kurbelte das Lenkrad herum und bog um die Ecke. Ziel erreicht. Sie schaltete das Navi ab. Der Parkplatz vor dem Gebäude war wie leergefegt; überhaupt wirkte der gesamte Vorplatz mit dem angrenzenden Gebäude seltsam verlassen. In der Mail hatte gestanden, dass sie ab elf Uhr in einer Mehrzweckhalle eintreffen solle. Noch einmal warf sie einen Blick auf das Datum. Alles stimmte. Die Vorgespräche mit dem Veranstalter waren ziemlich konfus und chaotisch verlaufen. Falls jetzt doch etwas schiefgehen sollte, lag das nicht in ihrer Hand.
Laetitias Blick streifte den Stauraum des Bullys. Der Schlafsack von Eric war in die hintere Ecke der Ladefläche gerollt. Am Samstag würde sie Eric zu ihrer Stiefschwester Thea bringen. Sie war damit Erics Wunsch nachgekommen, denn Thea hatte ihn eingeladen, ein gemütliches Wochenende mit ihr und Calla, ihrer Tochter, in Holtenhagen zu verbringen. Gemütlich!, spottete Laetitia innerlich, ein lauschiger Februartrip aufs Land! Das konnte nur von Thea kommen. Erics Schlafsack wirkte wie eine grünschwarze, pralle Wurst und verursachte einen unangenehmen Vorgeschmack auf das kommende Wochenende. Vielleicht müsste er mal entrollt und gelüftet werden, aber Eric war so etwas egal. Mit knapp fünfzehn hat man andere Sorgen.
Sie schaute auf die Uhr, stieg aus und verriegelte den Wagen. Noch drei Minuten blieben ihr für eine Zigarette. Der Wind fegte ein Gemisch aus Schotter und kleinen Eisklumpen über den Gehweg. Ihr Übersetzungsauftrag hatte sich als viel kleiner erwiesen, als zu vermuten gewesen war. Nichts von Bedeutung. Die gesammelte Fachliteratur über Theater, die sie sich am Nachmittag zuvor noch eingebläut hatte, hätte sie sich schenken können. Und über das aufgeplusterte Gehabe eines Herrn Busse auf ihrem AB musste sie jetzt noch grinsen. „Theaterauftritt von internationaler Bedeutung.“ Letztlich war das hier eine einstündige Kinderveranstaltung auf einem netten kleinen Festival mit dem Namen „Grenzgänger“. Das Gastspiel eines deutschen Produzenten, das in Japan einen Preis erhalten hatte. Deutsche, in Asien prämiert, spielten für Hörende und Gehörlose ein Stück, das wiederum von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen übersetzt wurde. Mindestens drei Grenzgänge waren darin enthalten. Daher also absolut förderungswürdig. Ihr Grinsen wurde noch breiter. Das Stück, das sie zu übersetzen hatte, war zeitlich gesehen die letzte Vorführung im Rahmen des gesamten Festivals. Ein Spiel am Rande für Randgruppen. Das Stück wurde von einem Duo aus Göttingen aufgeführt, trug den Titel „Puschel und Spreizborst“ und erzählte die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Wildschwein aus dem Tannwald und einer großstädtischen Pudeldame.
Die etwa dreißigköpfige Gruppe des integrativen Kindergartens konnte Laetitia gleich ausmachen. Mit einem kräftigen Tritt stieß sie die schwere, stahlummantelte Glastür des Heimes auf. Stickig warme Luft umfing sie.
Von Weitem sah sie Ansammlungen älterer Kinder und zwei Jugendliche in Rollis. Die Wärme stand wie eine Wand im Raum und wurde nur leidlich durch die fuchtelnden Bewegungen rennender Kinder verquirlt. In der rechten Ecke sah Laetitia einen etwa neunjährigen Blondschopf, der mit drei gleichaltrigen Mädchen eine hitzige Diskussion mit den Händen führte. Noch weiter hinten tranken ein paar dunkelhäutige Kinder Tee mit einer Erzieherin. Kurz vor der doppelflügeligen Tür mit den zwei großen Papphänden, auf deren Fingerspitzen das Wort „Theatereingang“ prangte, war eine weitere Ansammlung von Kindern. Und dicht an der Fensterfront leckte ein kleines Mädchen in sich versunken an einer großen Scheibe. Laetitias Blick schweifte wieder zurück zu der Kleingruppe um den Blondschopf, hielt inne und belauschte den Jungen ein wenig mit den Augen. Sie lächelte. Von Drachen und Piraten hatte in der Stückbeschreibung nichts gestanden.
Dies war eine andere Welt. Manchmal tauchte Laetitia gerne in sie ein. Gerade weil sie so nonkonform war. Frei von den gewohnten, akustisch dichten Unterhaltungen. Hier konnte sie von Weitem alles mithören, konnte aber genauso die Augen schließen, ohne einem dicht gewebten Wortgeflecht ausgesetzt zu sein. Lediglich die verstreuten Lacher, das Schnaufen oder das unscharf artikulierte Tönen unterbrachen diese Stille. Heute leider nicht. Mehrere Kinder tobten kreischend durch die Halle, dicht gefolgt von zwei jubelnden Gehörlosen. Rollstühle brummten an ihr vorbei. Hinterdrein ein Mädchen mit einem Stock. Boden und Stock in einem fortwährenden Klopfkonzert begriffen.
Laetitia stieß sich von der Wand ab, um der rothaarigen, Tee ausschenkenden Frau entgegenzugehen, als unvermittelt jemand nach ihrer Hand griff. Sie schaute nach unten. Die Fensterscheibenleckerin. Das kleine Mädchen sah sie aufmerksam an und hob fragend die Augenbrauen. Wer bist du? Laetitia hockte sich zu ihr und zeichnete ihre Namensgebärde in die Luft. Das kleine Mädchen gebärdete freudig zurück. Es hätte Anna heißen können, vermutete Laetitia. Genau wusste sie es nicht, denn das Mädchen benutzte jene, nur sie betreffende symbolische Handbewegung, die nichts mit dem üblichen Fingeralphabet gemein hatte.
„Kannst du auch schon fingern?“, fragte sie mit den Händen zurück. Das Mädchen lächelte, nickte, tat aber nichts dergleichen. Stattdessen schaute sie Laetitia weiter erwartungsvoll an und hob noch einmal fragend die Augenbrauen. Laetitia nickte und wiederholte langsam ihren eigenen Namen mithilfe des Fingeralphabetes. Das Mädchen schaute wieder und lächelte. Dann packte es Laetitia bei der Hand und zog sie mit sich in den hinteren Teil des Saales. Die Rothaarige hob den Kopf.
„Ach, Sie sind sicher die Dolmetscherin?“
Laetitia nickte.
„Ich auch. Mabel, Mabel heiße ich und bin die Zweite im Bunde!“ Ihr Lächeln war sehr einnehmend und erinnerte Laetitia an etwas Lichtes und Weißes, das sie nicht so schnell in Worte fassen konnte.
„Wenn Sie nichts dagegen haben, können wir uns auch duzen.“ Wieder nickte Laetitia.
„Wie heißt du?“, fragte die Rothaarige, während das gehörlose Mädchen unentwegt an Laetitias Hand zerrte. „Ach, entschuldige!“, gebärdete Mabel der Kleinen zu. „Hab dich vergessen! Du wolltest etwas sagen?“
Und noch bevor Laetitia ihr zuvorkommen konnte, hatte die vermeintliche Anna Laetitias Namensgebärde bereits in die Luft gezaubert.
„Du hast dir meinen Namen gemerkt?“, gebärdete Laetitia und mimte Staunen.
Das Mädchen strahlte und hüpfte davon.
„Wie heißt sie?“, fragte Laetitia mit den Händen.
„Hanna Florenzia“, erwiderte Mabel schlicht. Bei Hanna zuckte Laetitia unmerklich zusammen und plötzlich war die Luft vor ihren Augen voller Hände. Mindestens zehn wedelten gleichzeitig vor ihrem Gesicht herum. „Halt! Zu laut! Hört auf! Los, rein mit euch!“ Mabel schickte eine rigorose Handbewegung in die aufgeregte Kinderschar und das Rudel tobte los.
„Wollen wir reden?“
„Halsentzündung. Tut weh. Geht nicht“, gebärdete Laetitia.
„Kein Problem! Mir ist es einerlei.“ Mabel lächelte wieder ihr besonderes Lächeln. Irgendetwas aus Stein, dachte Laetitia, antik und weiß. Ein Tempel vielleicht. Versonnen schaute sie ihr lange ins Gesicht.
„Wenigstens einen Vorteil, den wir haben, was?“, fragte Mabel und stupste sie an der Schulter.
„Was?“ Kurz war sie irritiert, fühlte sich ertappt und riss sich von Mabels Anblick los. Ihr unsteter Blick suchte im Raum nach einem Fixpunkt und eine leichte Röte schoss ihr in die Wangen.
„Falls du auf Herrn Busse, unseren Herrn Auftraggeber, hoffst, der kommt nicht mehr. Ich habe jetzt die Order bekommen, dir alles Weitere zu erklären.“
Laetitia nickte und lachte erleichtert auf. Erschrocken stellte sie fest, dass kein Ton dabei herauskam.
Die Feuertaufe gelang. Laetitia hatte einen Platz, von dem aus sie die Bühne ebenso gut wie den Zuschauerraum einsehen konnte. Mabel stand etwas weiter entfernt in der gegenüberliegenden Ecke des Theatersaales. Wir sind nichts anderes als Lautsprecherboxen, zwei ähnlich aussehende Teile einer Anlage, dachte Laetitia. Aber Mabel, wie sie da so stand, hatte etwas von einer kleinen, beruhigenden Sonne. Sogar die Kinder in ihrer Nähe wirkten friedlicher.
Das Licht im Saal fuhr herunter und die Vorstellung begann. Laetitia bündelte ihre Konzentration, was ihr nicht leichtfiel, denn Mabels Anblick regte sie auf eine ungewohnte Weise auf, mehr, als sie sich eingestehen wollte. Entschlossen sammelte sie sich, wandte den Kopf und vertiefte sich in das Bühnengeschehen.
Die Eigennamen der beiden Protagonisten „Spreizborst und Puschel“ hätte sie buchstabieren können. Doch beflügelt durch die eigenartige Energie, die Mabels Lächeln immer neu in ihr erzeugte, entschied sie sich kurzerhand um. Es war eine prickelnde Leichtigkeit, die sie so elektrisierte, dass sie, statt zu fingern, spontan ein völlig neues Synonym erfand. Die Pudeldame Puschel betitelte sie mit „Hundewolle“ und das Wildschwein „Spreizborst“ nannte sie „Harte Waschbürste“. Einige Kinder kreischten laut auf und Mabel tat nichts weiter, als darüber zu lächeln.
Und so wie es begonnen hatte, setzte sich das Spektakel fort. Laetitia kämpfte sich durch einen Urwald aus Fantasiebegriffen, Floskeln und Wendungen, wurde aber in den Pausen, in denen Mabel übernahm, durch die komisch köstliche Darstellung der beiden Schauspieler entschädigt. Nach fünfzig Minuten war sie schweißgebadet und wenn man sie gebeten hätte, das Stück zusammenzufassen, sie hätte es nicht vermocht. Ohne Zusammenhang rauschten ihr noch immer die Bilder durch den Kopf, dass ihr schwindelig davon war. Mabel winkte ihr zu, kämpfte sich durch die Menge an sie heran und lachte. Lachte und lachte, als wollte sie gar nicht mehr aufhören. Und es war, als könnte genau dieses Lachen alles Harte, was sich all die Jahre in Laetitias Leben festgesetzt hatte, wegspülen, wenn sie es nur immer wieder und wieder hören würde.
Die Vorstellung war vorüber und Laetitia verschwitzt und glücklich.
Sie liebte dieses vollständige Eintauchen in eine einzige Sache, liebte den Moment der Übersetzung, in dem sie nur noch Medium und ihr ganzer Leib ausschließlich auf das Eine ausgerichtet war: den Kontakt herzustellen, Strom fließen zu lassen, um zwei Pole miteinander zu verbinden. Plötzlich blitzte ein Bild zwischen ihre Gedanken. Mabels Lachen. Es erinnerte sie an eine Säule. Eine antike Säule, auf deren oberem Ende ein Tableau thronte. Und in diesem Tableau spielte die Sonne mit ihrem Widerschein. Mabels Lächeln war wie Mittagslicht in einer kreideweißen Schale, stabil und unerschütterlich.
„Herrlich, Laetitia! Dir müsste man den Originalitätspreis verleihen für neue Wortschöpfungen.“ Mabel stürzte voller Überschwang mit weit geöffneten Armen auf sie zu. Nur noch drei Schritte, dann wäre sie bei ihr und würde ihr um den Hals fallen. Laetitia wankte. Die Säule kippte. Das Lachen wurde größer und drohte über ihr auszuschwappen. Ruckartig wich sie mit einem Seitenschritt aus. Mabel bemerkte es, hielt inne und verwandelte die Umarmung in ein Schulterklopfen. Laetitia atmete auf. So sehr sie es auch liebte, die Barrieren lautsprachlicher Verständigung aufzulösen, so sehr scheute sie den leibhaftigen Kontakt. Sie hatte sich in ihrer Jugend damit abgefunden, ihn zu umgehen, wann immer es ihr möglich war.
Lange Zeit, zu lange, wie ihr schien, hatte sie nichts unversucht gelassen. Bei Gernot zum Beispiel, Erics leiblichem Vater, ihrem ersten und einzigen Mann, den sie viel zu schnell in ihr Leben und in ihr Bett gelassen hatte, weil sie meinte, es wäre an der Zeit. Sie hatte sich angestrengt, hatte gemeint, dass Nähe und Begehren etwas wären, was man lernen könne. Aber immer fehlte diesen Berührungen ein entscheidendes Moment. Es fiel ihr schwer einzugrenzen, worin es bestand. Ein scheues Etwas in ihr zog sich entschieden zurück und mied das Licht, sobald ihr jemand zu nahe kam. Die wenigen Berührungen, auf die sie sich in ihrem Leben eingelassen hatte, waren immer von einem ionisierten Spannungsfeld umgeben, wie ein abstoßendes Luftpolster zwischen zwei Hautoberflächen. Ein Sicherheitsgebiet. Eine Pufferzone. Selbst bei Eric war das so. Bei Weitem nicht so stark wie bei anderen Menschen, aber spürbar.
Und so seltsam es schien, sie hatte sich aus genau jenem Grund für diesen Beruf entschieden. Auch wenn sie es damals nicht gleich begriffen hatte: Diese Menschen bewegten sie. Es berührte sie, wenn sie sah, wie Kinder aus ihrer Gehörlosigkeit hinausstrebten, wie sie jenseits ihrer Isolation sein wollten und es nicht konnten.
Bei ihr war es andersherum. Laetitia konnte, aber sie wollte es nicht. Diese Kinder waren ähnlich verloren wie sie; deren Einsamkeit besaß nur das entgegengesetzte Vorzeichen.
„Hast du nachher noch Zeit für einen Kaffee?“, fragte Mabel und blinzelte auffordernd.
„Kommt drauf an“, gebärdete Laetitia, „was nachher heißt.“
Langsam kroch die Erschöpfung in ihr hoch.
„Ich arbeite bis zwei“, sagte Mabel. „Danach hätte ich Zeit. Der Veranstalter bezahlt einen Teil deiner Unterkunft. Wir laufen hier unter Künstler!“ Mabel hob die Augenbrauen und lachte. „Warst du schon in deinem Zimmer?“
Laetitia schüttelte den Kopf. Eigentlich wollte sie zurück nach Ebermünde, aber Mabels Sonnenenergie begann sie allmählich zu verschlingen.
„Geh doch einfach mal hin. Schau dir an, wo du schläfst, und dann treffen wir uns am Marktplatz im Schokostübchen. Um drei, zum Kakao?“
„Lieber Kaffee“, gebärdete Laetitia. „Ich schlafe sonst ein.“
„Wunderbar! Dann verprassen wir die Spesen am Tresen.“
Und schon war Mabel mit einem Haufen Kinder am Ausgang, wo drei Kleintransporter mit der Aufschrift „Taubenschlag“ auf sie warteten und den Kinderpulk stückweise verschluckten. Laetitia schaute, ob sie Hanna Florenzia ausmachen konnte. Doch so sehr sie auch suchte, sie fand das Mädchen nicht.
Laetitia hatte sich die Unterkunft nicht mehr angesehen, sondern war im Auto einem Vierzigminutenschlaf zum Opfer gefallen, aus dem sie mit eisigen Händen und mit einem gewaltigen Hunger erwachte. Das hastig zwischen die Zähne geschobene Baguette und die Suche nach einem Parkplatz am Markt hatten ihr kaum noch Zeit gelassen, irgendetwas anderes zu tun. Mabel saß bereits strahlend am Tisch, als sie etwas verspätet das Café betrat.
„Hallo!“
Laetitia winkte dezent zurück. Diese Frau war ein Überfall aus Heiterkeit und ihr Gemütszustand schien genauso aus jeder ihrer Poren zu dringen, wie das rötliche Kraushaar aus ihrem Kopf wucherte. Und wie sie so da saß, wirkte sie auf Laetitia wie ein kleines Kraftwerk, das imstande war, ununterbrochen und bioenergetisch gute Laune zu produzieren. Zum ersten Mal nach langer Zeit fühlte sie sich unbeschwert.
„Was hältst du davon, wenn ich spreche und du gebärdest?“
„Okay.“
Mabel winkte der Kellnerin zu und orderte einen Kakao für sich.
„Und du? Kaffee?“
Und während Laetitia noch ausgiebig die Getränkekarte studierte, warf Mabel dazwischen: „Du würdest dir etwas entgehen lassen, wenn du nicht wenigstens eine der Spezialitäten hier ausprobieren tätest! Das Stübchen ist einzigartig!“
Keine zehn Minuten später hatte sich Laetitia für einen Milchkaffee entschieden und trank ihn in großen Schlucken. Warm und ölig rann er die Kehle hinunter. Ihre klammen Finger erwärmten sich an der zwiebelmustrigen Porzellanhaut und wurden weich. Es war das exotischste Getränk, das sie seit Jahren probiert hatte. Ein Gemisch aus zimtigem Milchgeschmack, vermischt mit einem Hauch Kaffee und Koriander, und ein orientalisches Gewürzmäntelchen aus Feuer heizte ihre Stimmbänder kräftig ein. Kurz war sie versucht, einen Ton herauszubringen. Doch kaum, dass sie auch nur daran dachte, zog das ihr bekannte, beengende Gefühl den Hals hinauf.
„Möchtest du vielleicht doch lieber etwas anderes?“, fragte Mabel besorgt. Sie hatte in ihrer Empathie den aufkommenden Würgereiz in Laetitias Gesicht wahrgenommen. Laetitia schüttelte den Kopf.
„Alles okay, es ist nur mein Hals.“
„Weißt du was? Ich fühle mich während des gesamten Festivals wie auf einen Sockel gestellt“, fuhr Mabel fort. „Ich meine, wer bezahlt uns denn sonst noch die ganzen Extras wie hier. Niemand. EU-Förderung ist klasse! Und niemand guckt mich schräg an, nur weil ich die Hände in der Luft habe. Im Gegenteil, hier nennt man so was ein ästhetisches Stilmittel!“ Sie gestikulierte theatralisch. „Na, ja, Künstler sind dem Mainstream ja meistens voraus, sagt man. Ich finde es erniedrigend, heimlich gebärden zu müssen. Alle Einrichtungen, die ich kenne, stecken in ihrer oralen Phase fest.“ Sie lachte trocken auf.
Laetitia nickte. Dieser ewiger Kampf um die Gebärde. Sie war ihn genauso leid. Aber wenigstens hatte man in den letzten Jahren dem Staat einen Paragrafen abgerungen, der die Gebärdensprache allen anderen gleichstellte. Aber dennoch, die Pro-Oralisten waren nicht unterzukriegen. Sie bildeten eine harte Front gegen alle, die mit ihren Händen sprachen, sie forschten an künstlichen Ohren herum und kämpften für das Lippenlesen. Was den eifrigen Vorreitern für Fortschritt dabei entging, war die Poesie.
Um wie vieles feiner, um wie viele Nuancen melodischer die Gebärde war. Eine blasslila, kleinblütige Blume, die Gefahr lief, überrollt zu werden. Und eines Tages tauchten wandernde Botaniker auf, rätselten über das umständliche Gebilde, forschten lange herum und machten ein herkömmliches Stiefmütterchen daraus.
Mabel hatte recht. Wären fahrende Künstler gekommen, so hätten sie das Pflänzchen nicht angerührt, sie hätten gestaunt und ein Lied darüber erfunden, sonst nichts.
Die beiden Frauen schwiegen. Mabel schaute versonnen über die Spitzen der Pappeln, die wie spartanische Wächter entlang der kopfsteingepflasterten Straße standen. Laetitia nutzte die Zeit, ihre Mimik zu studieren. Dann löste Mabel unvermittelt ihren Blick von den Bäumen und schaute ihr mitten ins Gesicht.
„Auch wenn ich Gefahr laufe, dich zu langweilen“, hob sie an. „Aber es interessiert mich ebenso brennend wie alle.“ Ihre grauen Augen ruhten weiter auf Laetitia, als erwarteten sie eine Erlaubnis für die Frage. Laetitia hingegen zeigte keine Reaktion außer einem misstrauischen Blinzeln. Aber Mabel lächelte weiter ihr Tableaulächeln und schließlich hob Laetitia ihre Augenbrauen, öffnete die Handinnenflächen und fragte: „Was?“
„Ich möchte wissen, wie du das geworden bist, was du bist.“
Ein leichter Stromschlag durchzuckte sie.
„Dolmetscherin?“
„Was sonst?“, fragten Mabels Augen.
„Das kann ich nicht in drei Sätzen formulieren.“ Sie wollte das Thema am liebsten umgehen.
„Macht nichts, ich habe Zeit. Mich erwartet gerade niemand.“ Mabel lachte. Überrascht schaute Laetitia auf. Sie hätte ihr einen ganzen Stall von Kindern samt Ehemann zugetraut.
„Meine Familie ist mein Beruf“, erwiderte Mabel. „Erzähl und lass dir Zeit. Ich brenne vor Neugier!“
Das Licht der hereinscheinenden Nachmittagssonne fiel auf Mabels kupfernes Haar und ließ es lodern. Laetitia war so verzaubert von dem Sonnenschauspiel, dass sie sich dazu hinreißen ließ zu erzählen, wie sie fast ihre Lehre als Fotolaborantin in der ehemaligen DDR geschmissen und es dann doch nicht getan hatte. Wie sie ihr Abi nachgeholt und schließlich Ebermünde verlassen hatte. Ihre Hände berichteten Mabel von dem Tag, an dem sie zurückkehrte und sich zum ersten Mal in dem winzigen Büro ihrer Mutter mit einem gehörlosen Jungen die Zeit vertrieben hatte. Sie ließ auch nicht aus zu erzählen, wie schwer es ihr damals nach ihrer Ausbildung zur Dolmetscherin gefallen war, dass Menschen ins Spiel kamen.
Mabel hob ungläubig die Augenbrauen: „Menschen ins Spiel?“ Laetitia nickte abwesend. Natürlich hatte sie immer gewusst, dass sie es später mit Menschen zu tun haben würde, erwiderte sie und irgendwann habe sie sich darauf einlassen können, dass sie für die Dauer der Übersetzung eben ihre eigene Identität aufgeben musste.
Mabel lachte.
„Ich komme mit dem Bild, eine Übersetzungsmaschine zu sein, ziemlich gut klar!“
Laetitia lehnte sich zurück, nickte und schwieg, während sie nach draußen blickte, dorthin, wo die nackten Säulenpappeln aussahen, als wären sie mit Reif überzogen. Es war nur das Licht. Ja, Mabel hat recht, dachte sie, es war schon ein irres Gefühl, für die Dauer der Arbeit so absorbiert zu sein, dass man alle anderen Gedanken völlig ausblendete.
Sie wandte sich Mabel zu.
„Es ist ein Bombenjob, nur …“, gebärdete sie und geriet ins Stocken.
Mabel neigte den Kopf. „Was?“
„Mein Hals.“
Mabel lächelte ihre Bedenken fort. „So was geht doch vorbei, oder nicht?“
Laetitia zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was es ist.“ Woraufhin Mabel ernst wurde und nachdenklich über sie hinwegschaute.
„Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt deswegen“, sagte sie. Das war alles. Dann ließ sie sich in ihren Stuhl zurücksinken, schmunzelte, bestellte einen dritten Kakao und wechselte das Thema.
Es war Laetitia nur lieb. Sie lehnte sich ebenfalls zurück und hörte Mabel zu. Und während sich ihre Anspannung langsam löste, war ihr, als schaukelte ihre Seele mit den Pappeln im Wind.
Mabel war, wie sie erzählte, ein neugieriges Kind gewesen; hervorgegangen aus der brüchigen Beziehung ihrer gehörlosen Mutter mit einem Hörenden. Es hatte nicht lange gehalten. Sie durfte bei ihrer Mutter bleiben; dem Vater war es nur recht gewesen. Allein schon die Schwangerschaft hatte ihn überrumpelt, aber ihre Mutter wollte das Kind. Mabel wurde geboren. Ab und an ging der Vater später mit ihr Eis essen. Das war alles. Mabel schwieg lange, nachdem sie erzählt hatte, und schaute durch das Fenster nach draußen. Traurig sah sie aus, selbst wenn das Echo ihres Lächelns noch immer in ihren Zügen lag.
„Hast du Geschwister?“, fragte Mabel plötzlich.
„So halb und halb. Nichts Echtes“, erwiderte sie und dachte mit gemischten Gefühlen an ihre Stiefschwester Thea, die sie in einer Woche sehen müsste.
Sie tut mir gut, diese Mabel. Ein flüchtiger Gedanke streifte ihre Seele. Laetitia beobachtete versunken die Kringel in ihrem Becher. Weich und hell war der Kaffee wie Mabels Lächeln. Verlockend war alles wie der unvermittelt aufsteigende Gedanke an mehr, wobei sie nicht zu sagen gewusst hätte, worin dieses „Mehr“ eigentlich bestand.
In Mabels Tasche klingelte ein Handy. Sie griff hastig hinein, warf einen unwilligen Blick auf das Display und drückte den Anrufer weg. Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, der schnell verflog, als sie sich Laetitia wieder zuwandte.
„Falls du Probleme mit Aufträgen bekommst, und du wirst sie bekommen wegen deiner Stimme, musst du mir versprechen, dich bei mir zu melden. Ich könnte erst mal für dich das Voicen übernehmen. Vorausgesetzt, ich kann es einrichten. Du kannst dich aber gerne auch einfach so melden.“ Überrascht schaute Laetitia auf, weil sie sah, dass Mabel Anstalten zum Aufbruch machte und dem Kellner zuwinkte. „Es tut mit leid, Laetitia, ich muss los, aber wir wären ein gutes Team. Das hab ich im Urin.“ Sie zwinkerte zum Abschied und verschwand, nachdem sie alles bezahlt hatte, durch die Tür des kleinen Cafés wie eine Abendsonne, die im Zeitraffer unterging.
Ihre Unterkunft war leicht zu finden. Der Name der Pension „Bei Schröters“ klang schroff und die Außenfassade wirkte spießig. Der Kern des Hauses aber war angenehm. Wände und Decken waren von unbehandeltem Holz verkleidet und kleine, bunte Flickenteppiche lagen überall verstreut herum. Ihr Zimmer befand sich gleich im Erdgeschoss hinter der dritten Tür links.
„Herrzlich Wilkomen bei Schröters.“ Ein Schild, bunt bemalt mit gekneteter Schrift, baumelte freihängend im Flur und bewegte sich mit jedem Luftzug. Es spricht für die Wirtsleute, dass sie es so belassen haben, dachte Laetitia. Enkel wahrscheinlich. Sie betrat ihr Zimmer und bedauerte sofort die Jahreszeit. Durch das rechte Fenster würde im Sommer die Abendsonne ihr spätes Licht hereinwerfen. Mit einem Male fühlte sie sich wieder sehr jung und verträumt wie Hanna Florenzia vor der Fensterscheibe. Seufzend warf sie sich auf die Matratze, ohne das Bettzeug aufzuschlagen. Hätte ihre Mutter sie damals dabei erwischt, mit Schuhen auf dem Bett, einen Aufstand hätte es gegeben. Aber eine auf Ordnung und Sauberkeit bedachte Köchin, die als Krippenerzieherin aushalf, nur um ständig wie ein Satellit in der Nähe ihrer Tochter zu bleiben, konnte nicht anders.
Laetitia schob die Erinnerung an Hanna beiseite, schloss die Lider und überließ sich dem Schein der Laterne. Rote Lichtameisen krabbelten über ihre Netzhaut und blitzten flammend auf. Sie entspannte ihre Augäpfel und stellte sich vor, in einem roten Meer aus Feuersplittern zu treiben. Ohne Anfang und Ende, ohne Horizont und Ufer. Der Tag glitt an ihr vorüber, Spreizborst und Puschel säumten ihre Erinnerung und ein kleines Lachen ohne Ton perlte auf wie Tausende winzige Luftblasen unter Wasser.
Spreizborst und Puschel. Wie kam man auf solche Namen? Sie räkelte sich in die weiche Matratze unter ihrem Rücken, bis die letzten Reste Anspannung wie eine alte Haut von ihr abfielen.
Eric, was er jetzt wohl tat? Gebeugt über seinen ausklappbaren Tisch sitzen? Zeichnend, völlig versunken in eine seiner schrägen Comicfiguren? Eric spielte nicht am Computer oder Fußball. Eric zeichnete. Manchmal tagelang. Das letzte Mal, als sie einen Blick über seine Schulter riskierte, skizzierte er an mehreren Wesen, die er „Schrumpfschläuche“ genannt hatte, und sie musste lachen über das Wort. Was selten vorkam. Sie hatte sehr laut gelacht und es war ihr damals überhaupt noch nicht aufgefallen, dass sie dabei wie ihre Mutter geklungen haben sollte. Sie konnte einfach nicht aufhören, sich über dieses komische Wort zu amüsieren. Aber Eric meinte, diese Bezeichnung gäbe es wirklich.
Das Bild von Eric verschwand wieder und wurde von Mabels Gesicht abgelöst. Eine leise Sehnsucht nach ihrer Wärme kam auf. Die Erinnerung an Mabel war wohlig und ein Lächeln schlich sich über ihr Gesicht. Und während ihre Hände zueinanderfanden wie zwei tagsüber voneinander getrennte Wesen, wurde Laetitia schläfrig. Eine schob sich über die andere.
Um ihre Hände war sie immer sehr besorgt. Sie waren ihr Kapital. Sie gebärdete zwar auch mit ihrer Mimik und dem Rest ihres Körpers, doch die Hände waren ihr so kostbar wie anderen Menschen das Augenlicht oder die Stimme. Laetitia drehte sich auf die Seite und sank in einen leichten Schlaf.
Unvermittelt schreckte sie auf. Wie lange sie eingenickt war, konnte sie nicht sagen, nur dass der Schein der Straßenlaterne sich verändert hatte. Eine der beiden Glühbirnen flackerte und die andere war ausgefallen. Es mochten Sekunden, maximal Minuten seit ihrem Kurzschlaf vergangen sein. Laetitia fuhr kerzengerade in die Höhe und atmete tief ein. Du hättest nicht einschlafen dürfen, flüsterte es in ihr. Sie versuchte ihre Panik zu zügeln, aber ihre Gedanken raunten etwas anderes. Heftig schüttelte sie den Kopf, um den aufkeimenden Albtraum zu verscheuchen. Einer ihrer Zugträume war wieder im Anmarsch. Sie hasste ihn, diesen ewig gleichen Traum, der sie überall aufsuchte, wenn etwas schön zu werden begann. Zugträume.
Seit sie denken und sich erinnern konnte, zerschnitten diese Träume ihren ruhigen Schlaf, raubten ihr die Nerven und machten, dass sie gehetzt und schweißnass erwachte. Sie fürchtete die stetig wiederkehrenden Bilder, in denen sie diesen Zügen hinterherrannte. Mitunter waren die Szenarien normal, meist aber absurd. Aber eines einte sie alle. Laetitia schaffte es nie, auch nur einen Zug zu erreichen, und so sehr sie sich auch beeilen mochte, sie sah immer und immer wieder nur die Rücklichter des letzten Waggons, der sich in der Dunkelheit verlor. Manchmal hinderten sie Naturkatastrophen, Flutwellen oder Erdrutsche daran, aufzuspringen, manchmal nur das Gespräch mit einem Passanten. Und immer war sie getrieben. Nie reichte die Zeit. Nie.
Dieses Mal hatte eine schwarze, steife Paste, die wie Tierkot aussah, am Geländer der Überführung geklebt, während der Boden überfroren und mit Glatteis bedeckt war. Der Zug war von einem Pferdegespann gezogen worden und in Schlangenlinien in das Dunkel getaumelt.
Sie setzte sich auf die Bettkante, schüttelte sich und stand auf. Aber die Stimmung blieb an ihr haften und kaum, dass Laetitia sich erhoben hatte, ärgerte sie sich, nicht am selben Abend nach Ebermünde zurückgefahren zu sein. Fast schon war sie versucht, das ausschweifende Treffen mit Mabel zu bereuen.
Sich wälzend, von einer Seite auf die andere, brachte sie die Nacht mühsam hinter sich, und als sie nach einem üppigen Frühstück, das sie ohne Appetit herunterzwängte, endlich hinter dem Steuer ihres Bullys saß, tat es ihr leid um das Geld, das die Unterbringung gekostet haben musste. Selbst wenn es nicht das eigene, sondern EU-Mittel gewesen waren.
Die Woche verlief wie immer. Am Mittwoch kam Eric zurück und verbrachte die restlichen Tage bei ihr. Sie versuchte, mit ihm über Zettel zu kommunizieren, was er nur unwillig hinnahm. Hin und wieder äugte ihr Sohn misstrauisch auf ihren Schal, als würde er ihr die Halsentzündung nicht abnehmen. Und als am Freitag der Bully nicht anspringen wollte, mit dem sie ihn auf das Gehöft ihrer Stiefschwester fahren wollte, winkte er ab und sagte: „Ich schaff das schon allein. Gib mir das Geld für die Fahrkarte. Ich ruf Tante Thea an, dass sie mich abholt.“
Ist das wirklich okay?, schrieb sie auf einen ihrer kleinen quadratischen Zettel, die sie jetzt immer parat hatte.
„Klar. Ich bin alt genug. Du kannst mir ja dein Navi um den Hals hängen, wenn du Angst hast.“
Sie lächelte gezwungen.
Okay, schrieb sie. Ich komme am Samstagabend und wir fahren dann Sonntagvormittag zurück, bis dahin ist das Auto wieder fit. Dann gab sie ihm Geld, ging ins Netz und druckte Eric eine Zugverbindung aus.
Rottig! Rottig war das treffende Wort für den Zustand dieses Hofes, dachte Laetitia zum wiederholten Mal, als sie Samstag am frühen Abend die letzte Einfahrt zum Gehöft nahm. Es war auch der passende Ausdruck für das, in ihren Augen, heruntergekommene Leben ihrer Stiefschwester, die hier die Überreste vergangener, wohlhabender Zeiten aufbrauchte.
Galanthea. Eigentlich Galatea. Aber ebenso wie dieser Name zu einem feudalen Spitznamen mutiert war, mutierte ihr Hof in die entgegengesetzte Richtung.
Galanthea und ihr Mäusemann Vincent, der neben ihr wie ein Schatten wirkte, hatten beide die gleiche Aura wie ihr Trümmergrundstück. Sogar der ihnen anhaftende Geruch verriet, wenn sie nur nah genug an Laetitia vorübergingen, ihr eigentliches Wesen, das unter einer Makulatur verborgen schien. Obgleich Galanthea durchaus Wert auf ihr Äußeres legte, sich schminkte, die Haare färbte und zweimal die Woche badete, wirkte sie im tiefsten Innern vernachlässigt, genauso wie es der Hof tat, für den sie nur das Nötigste an Aufwand betrieb, um ihn vor dem endgültigen Verfall zu bewahren. Und wenn dieser leicht gärige Duft an ihr vorüberzog, dann verachtete Laetitia ihre Stiefschwester Galanthea dafür, in einer ähnlichen Weise, wie sie auch das Fett ihrer Mutter verachtete.
Es war ein kurzer Geruch, der sich in diesen flüchtigen Momenten in Laetitias Leben einmischte, der Geruch eines Daseins, welches sie auf unfreiwillige Art mit Thea verband. Dieser, dazumal mittelfristig angeheirateten Stiefschwester. Hanna und Theas Vater hatten längst nichts mehr miteinander zu schaffen und Laetitia war damals wie heute froh darum.
Umso schwieriger gestaltete es sich für sie, als sich ihr Sohn Eric und Theas Tochter Calla anzufreunden schienen. Mit Widerwillen beobachtete Laetitia damals die beiden, zwischen denen es keine blutsverwandschaftlichen Bande gab. Einige Jahre war es schon her, da hatte sie Eric für ein paar Tage auf dem Hof zurücklassen müssen, weil sich keine andere Möglichkeit bot, ihn unterzubringen. Sie hatte einen gut bezahlten Auftrag in der Nähe nicht ausschlagen können. Der Kindergarten war geschlossen worden wegen Lausbefall und Hanna war krank gewesen. Theas Hof hatte nur eine verlockende halbe Autostunde entfernt gelegen. Dass Laetitia damals mit dieser übereilten Entscheidung, Eric in Theas Obhut zu geben, die unangenehmen Bande zwischen sich und Galanthea nur noch enger zurren würde, war ihr nicht in den Sinn gekommen.
Sie seufzte und nahm den Abzweig in Richtung Holtenhagen. Wie dem auch sei, Eric musste abgeholt werden.
Schon von Weitem sah sie die beiden. Eric stand neben dem halb heruntergetretenen Zaun im abgestorbenen Gras der ungemähten Wiese und Calla dicht daneben. In der rasch aufkommenden Dämmerung verschmolzen ihre Konturen zu einem engen Schatten. Seit sie sich kannten, klebten sie förmlich aneinander. Sie hätten Geschwister, sie hätten sogar zweieiige Zwillinge sein können, so gut verstanden sie sich. Das Mädchen hatte die Lässigkeit ihrer Mutter Thea mit der Milch aufgesogen. Sie war hübsch. Nicht zu bestreiten. Sie war sogar eine Schönheit. Eine Art Lolita-Natur, die sich schon abzuzeichnen begann, als sie knapp sechs Jahre alt gewesen war. Und was Laetitia zu einer stillen Weißglut brachte, war der Umstand, dass Calla diese Nachlässigkeit sogar ausgesprochen gut zu Gesicht stand. Eric unterlag diesem Charme sehr. Mit seinen Blicken hing er an ihrem hübschen Oval mit dem kräftigen welligen Haar und den geschwungenen Lippen, die herrliche Grübchen bilden konnten, und Laetitia fühlte sich beschämt, wenn sie sich dabei ertappte, ihren eigenen Sohn zu beobachten. Eric gab sich sehr ungeniert in seiner Zuwendung und Calla genoss es in vollen Zügen. Nur ein einziges Mal hatte er vor geraumer Zeit traurig gefragt: „Mama? Du magst Calla nicht, oder?“ Und sie hatte sich herauslaviert mit einer Antwort, die ihn nicht befriedigt, aber auch nicht zu einer neuen Frage verleitet hatte: „Ich mag es nicht, wie sie isst. Das ist alles, Eric, und das habe ich ihr auch gesagt.“
Laetitia ging die Außentreppe zum Gästezimmer hinauf, das Thea immer für sie bereithielt, und öffnete das kleine verkeilte Dachfenster, um zu lüften. Draußen war es bereits dunkel, aber sie hörte, dass die beiden Kinder ihren Bully in Beschlag genommen hatten. Dann knipste sie das Licht im Zimmer an. Sie trat in das Badezimmer und betätigte die Wandlampe. Die kleine Strippe, die zum Ziehen des Schalters gedacht war, baumelte nicht herunter, sondern war sorgfältig um das zinkfarbene Rohr gewunden, das in die Lampe mündete. Ungeduldig wickelte sie mit einer fingerfertigen Bewegung das Strippchen ab und zog daran. Es passierte nichts. Schließlich entdeckte sie rechts neben der Tür im Bad einen weiteren Kippschalter, und weil im übrigen Badezimmer keine andere Lampe auszumachen war, schien er zu der notdürftig über den Spiegel montierten Leuchte zu gehören. Ärgerlich schlug sie auf das Plastik. Als wiederum nichts geschah, zog sie ungeduldig erneut an der Kordel. Zu ihrer Überraschung flackerte die Lampe plötzlich mit einem dumpfen Plopp auf und verlosch. Schlagartig war es dunkel, als hätte jemand alles mit Tinte überschüttet.
Selbst durch die geöffnete Dachluke drang nichts als Schwärze herein. Sie war kühl und auch die Geräusche der beiden Jugundlichen im Auto schienen von der plötzlichen Finsternis verschluckt worden zu sein.
Die Dunkelheit umklammerte Laetitia wie Stahl; nur das Rauschen ihres Blutes nahm sie wahr. Sie spürte eine weiche Erschütterung in sich, wie sie ein zusammenfallendes Kartenhaus verursacht oder der Widerhall einer Detonation, der gedämpft wurde durch viele Zeitschichten. Leise und endgültig wie das Plopp der Lampe. Und ebenso wie in der Pension Schröters fühlte sie sich klein und jung. Dieses Mal aber packte sie die Angst. Furcht sprang sie an. Wie eine Katze ein Kleinkind. Unverhältnismäßig groß. Laetitia schüttelte sich, atmete tief ein und machte sich ruckartig von der plötzlichen Beklemmung los.
Nur ein Kurzschluss, nichts weiter, beruhigte sie sich. Unsicher ging sie aus dem Badezimmer zurück in die Stube, nestelte ihr Feuerzeug heraus und zog die zerdrückte Packung American Spirit aus ihrer Hosentasche. Fahrig suchte sie im spärlichen Schein der glimmenden Zigarette nach einer Kerze. Galanthea war wie ein Hamster und irgendwo hier in der Gästeetage würde sicher etwas versteckt sein. Unter dem Bett fand sie nur ein paar Kronkorken und ein benutztes Tempo. Hustend vom Staub, der sich über das Jahr angesammelt hatte, nahm sie sich die Anrichte vor. Es dauerte nicht lange und sie wurde fündig. Auf einer Untertasse im oberen Regal des Schrankes haftete ein Kerzenstummel. Und während sie mit der Zigarette im Mundwinkel und der Kerze in der linken Hand ihre Tasche öffnete, fiel ein wenig Glut auf den Sessel und brannte ein kleines Loch hinein. Das macht den Kohl hier auch nicht mehr fett, dachte sie.
Das Licht kam nicht zurück. Auch draußen blieb es dunkel. Wären nicht hier und da vereinzelt dünne, weiße Rauchfäden aus den Schornsteinen gekrochen und hätten nicht nach und nach ein paar flackrige Lichtpunkte hinter den Fensterbänken weit entfernter Häuser auf- und abgetanzt, so hätte die kleine Ortschaft Holtenhagen den Eindruck vermittelt, in einen komatösen Tiefschlaf gefallen zu sein. Laetitia trat dicht ans Fenster heran. Fast wirkte das Dörfchen wie in eine jenseitige Zeit versetzt. Ihr Blick irrte im Halbdunkel umher. Erneut überkam sie ein Schwindel und sie musste sich hinsetzen, so unvermittelt war die Kraft aus ihren Armen geglitten. Sie fühlten sich an, als hätte jemand Fäden durchtrennt. Auch die Beine sackten ihr weg, während sie auf die Bettkante zusteuerte. Eine bleierne Schwere legte sich auf Laetitias Schultern. Zwang sie in die Waagerechte. Den Rest ihrer Zigarette drückte sie auf einem der Kronkorken unter dem Bett aus. Mein Kreislauf, dachte sie, ich sollte das Rauchen lassen. Und während sie es dachte, pulsierte von der Mitte ihres Bauches ausgehend langsam ein Nichts in ihren Leib hinein, ein Nichts, das der Schwärze vor ihrem Fenster gleichkam. Sie hatte an jenem Tag vor einer Woche nicht nur aufgehört zu sprechen, sie hatte auch aufgehört zu bluten.
Eine Stunde lag Laetitia in diesem Zustand neben ihrer halb ausgepackten Tasche auf dem Bett. Merkwürdigerweise war sie nicht traurig darüber. Die Kerze brannte herunter und ihre Augen begannen sich an das Dunkel zu gewöhnen. Die eben noch kurz aufgeblitzte Angst und die kindliche Orientierungslosigkeit hatten sie schnell verlassen. Sie fühlte nichts Bestimmtes. Außer vielleicht der Überraschung über ihren Zustand. Explosionsartig war sie von etwas getroffen worden, nachdem die kleine Lampe und mit ihr das ganze Dorf verloschen war. Laetitia wartete. Auf das kommende Licht, darauf, dass die Nachtspeicheröfen endlich anspringen würden und die Wärme zurück in ihre Gliedmaßen strömte. Winterschlaf in Holtenhagen. Und vielleicht hätte Laetitia die Müdigkeit übermannt, wenn nicht Eric durch die kleine Tür gestürzt gekommen wäre und gerufen hätte: „Mama, Oma hat angerufen und sie hat mir endlich verraten, weshalb sie die ganze Woche so krass drauf war. Stell dir vor, sie hat bei einem Gewinnspiel fünfhundert Euro gewonnen!“
„Mhmmhm.“ Ein Räuspern entfuhr ihr und erinnerte sie unliebsam an das Radioerlebnis an jenem Nachmittag auf der E28. Benommen richtete Laetitia sich auf.
„Und weißt du, was sie damit machen wird?“
Träge schüttelte sie den Kopf.
„Sie kauft Eric und mir ein Pferd!“ Jetzt erst bemerkte Laetitia hinter ihm die zweite Silhouette. Calla, Theas Tochter, lehnte lässig im Türrahmen und ihr Schatten machte die beiden Kinder wieder zu einer einzigen Gestalt. Mit einem schnaufenden Ausatmer fiel Laetitia auf die Matratze zurück. Wunschträume von Teenies, dachte sie, Hanna käme niemals auf den Gedanken, ihrem Enkel oder ihrer Stiefenkelin ein Pferd zu kaufen. Calla lebte trotz ihres Alters einfach zu sehr in ihren Träumen, wie vernachlässigte Kinder es eben tun. Hanna war viel zu sparsam und zu misstrauisch. Nicht umsonst hatte ihre Mutter eine Woche mit der frohen Botschaft hinter dem Berg gehalten. Erst wenn das Geld auf ihrem Konto war, rief sie an. So war sie eben.
Laetitia hörte Eric kichern. „Alles klar, Mama?“
Als ihm seine Mutter nicht antwortete, zog Calla ihn sanft zurück nach draußen.
„Hast du nicht mal gesagt, sie braucht immer ein paar Stunden, wenn sie von deiner Oma zurückkommt?“
Laetitia ahnte nur, wie er resigniert mit den Schultern zuckte, und hörte ihn antworten: „Sie war doch gar nicht bei Oma.“
„Vielleicht hat sie ja auch gerade ihre Tage.“
„Ihre was?“
„Oder wie sagt ihr dazu?“
„Ach so … das.“
Eric war es unangenehm. Laetitia hörte es daran, dass er die Tür zu heftig zuzog. Dann folgte das Poltern sich rasch entfernender Schritte auf der Außentreppe. Wie Flüchtende, dachte Laetitia und schlief ein.
Galantheas Lamento unten im Hof riss sie aus einem Albtraum. Sie fuhr auf. Ihre Stiefschwester erregte sich laut. Das Hofschwein Willibald, ein gezähmter Keiler, war wohl durch den kaputten Zaun geschlüpft, um sich über die Abfalleimer herzumachen, die bestimmt schon seit Tagen ungeleert vor der Haustür standen. Die Dinge brauchen eben Zeit, pflegte Thea zu sagen und meinte damit nichts anderes, als dass sie momentan keinen Grund sähe, die zehn Meter zur Haupttonne zurückzulegen, und stellte lieber einen weiteren Kübel hinaus. Außerdem wäre es kalt, fügte sie für gewöhnlich im Winter hinzu und lächelte gelassen. Das Zeug friere ja und stinke nicht. Nun hatte sie den Salat. Vermischt mit Mullbinden, Zigarettenstummeln und Kartoffelschalen. Und mitten drin Willibald. Laetitia grinste bei der Vorstellung ihrer über die Abfälle gebeugten Stiefschwester.
Ob ihr der eigene säuerliche Geruch eigentlich bewusst war? Laetitia rieb sich Stirn und Augen. Draußen fluchte Galanthea noch lauter. Es störte sie nicht. Dieses Lamento war besser als der immer gleiche, sie ständig aufs Neue heimsuchende Traum. Wo waren die Kinder? Unten hatte Thea aufgehört zu fluchen. Nur das Klappern im Dunkeln verriet, dass sie die Müllreste einsammelte. Dann war es still. Erst als Laetitia in der offenen Tür ihrer kleinen Kammer stand und die eisige Nachtluft über das Gesicht strich, als sie den Mund öffnen und nach Eric rufen wollte, spürte sie: Auch jetzt würde kein Laut ihre Kehle verlassen, kein Wort, kein Ruf, kein Satz, kein Summen. „Stockentenschießen“, echote es noch immer in ihrem Kopf. Nichts mehr, rein gar nichts wollte ihren Körper verlassen, was Laetitia auch nur im Entferntesten an ihre Mutter erinnerte.
Eine Stunde später, sie hatte die Tasche ausgepackt, die schweißnasse Unterwäsche gewechselt und das Bett bezogen, hörte sie vertraute Stimmen durch die Wände dringen. Die Kinder waren unten bei Thea in der Küche. Laetitia zündete sich eine Zigarette an, genoss den Rauch und horchte in sich hinein. Nichts passierte. Ihr Kreislauf blieb stabil. Der tiefe Lungenzug tat gut.
Es gab nichts Vergleichbares. Einer ihrer Kollegen, ein strikter Nichtraucher, hatte einmal in ihrem Beisein großspurig zitiert, dass alle Raucher nur inhalieren, um zu atmen, und insgeheim gab sie ihm recht. Der Rauch einer frisch angesteckten Zigarette machte ihr auf eine sehr sanfte Art bewusst, wo die Lungen begannen und wo sie endeten. Sie spürte sich von innen. Ein körperloses Streicheln. Ein Prickeln, ein schmerzfreies Brennen. Sonst spürte sie sich nicht so.