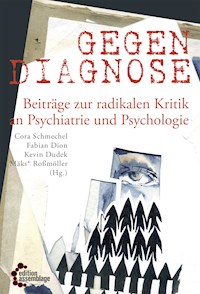
Gegendiagnose E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition assemblage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: get well soon
- Sprache: Deutsch
Mit den Neuauflagen der Krankheitskataloge ICD und DSM werden die Grenzen dessen ausgedehnt, was als psychisch krank gilt. Formulierten in den 1960/70er Jahren noch außerparlamentarische Linke und ihr verbundene Psychiater_innen eine radikale Kritik an der Institution Psychiatrie, wurde im Anschluss daran die Kritik hauptsächlich von Betroffenen getragen und in die Praxis übersetzt. Heute findet Psychiatriekritik selbst im bürgerlichen Mainstream statt. Diese reibt sich allerdings lediglich an den aktuell in den Katalog aufgenommenen Diagnosen und den Interessen der Pharma-Industrie. Eine radikale Gesellschafts- und Machtkritik, wie sie die Alte und Neue Antipsychiatrie enthält, lässt sie jedoch vermissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cora Schmechel, Fabian Dion, Kevin Dudek, Mäks* Roßmöller (Hg.)
Gegendiagnose
Die Reihe Get well soon. Psycho_Gesundheitspolitik im Kapitalismus entstand aus dem Bedauern über den Platz, den eine radikale Kritik an den Institutionen und Disziplinen Psychiatrie und Psychologie aktuell einnimmt. Das Thema Antipsychia-trie wird wieder zurück in den Kanon emanzipativer Politik gebracht und inhaltlich aktualisiert. Es ist notwendig, sich mit der Reformierung des psychiatrischen Systems auseinanderzusetzen und die Kritik dem aktuellen Zustand anzupassen, entsprechend auch auf die Kategorien von mentaler Gesundheit_Krankheit schon außerhalb der Anstalt auszuweiten. Zudem wird ein Raum geschaffen, um in Abgrenzung zum verkürzten Mainstream-Diskurs, welcher vorrangig eine skrupellose Pharma-Industrie am Werke sieht, radikal die gesellschaftliche Funktion des psychiatrisch-psychologischen Systems zu beleuchten und dabei auch die Leerstellen der bisherigen Antipsychiatrie zu füllen. Daher beschäftigt sich diese Reihe vor allem mit Fragen des Zusammenwirkens psychiatrisch_psychologischer Konzepte mit rassistischen, sexistischen und ökonomischen Unterdrückungsverhältnissen und ihren Wirkungsweisen im neoliberalen Gesundheitssystem.
Cora Schmechel, Fabian Dion, Kevin Dudek, Mäks* Roßmöller (Hg.):
Gegendiagnose
Beiträge zur radikalen Kritik an Psychologie und Psychiatrie
Get well soon. Psycho_Gesundheitspolitik im Kapitalismus. Band 1
© 2015 by edition assemblage
Postfach 27 46
D-48014 Münster
[email protected] | www.edition-assemblage.de
Umschlag: Rina Rosentreter
Digitalsatz: Zeilenwert GmbH | zeilenwert.de
Digitalvertrieb: Libreka GmbH | info.libreka.de
ISBN ePub: 978-3-96042-811-4
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Crazyshit. Zur Notwendigkeit und Aktualität linker Psychiatriekritik Nina U.
Einleitung der Herausgeber_innen Cora Schmechel/Fabian Dion/Kevin Dudek/Mäks* Roßmöller
I. Analysen zur Funktion der psychiatrischen Institution
Inklusiv und repressiv. Zur Herrschaftsförmigkeit der reformierten Psychiatrie Stephan Weigand
Diagnose: Gesellschaftlich unbrauchbar mit Aussicht auf Heilung. Analyse und Kritik der heutigen Psychiatrie in ihrer Parteilichkeit für die herrschenden bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse Sohvi Nurinkurinen/Lukaš Lulu
Psychopathologisierung und Rassismus in Deutschland. Eine feministische Perspektive Esther Mader
»Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient …« Zu rechtswidrigen Gründen und Verfahren bei ›psychologischen Gutachten‹ bei Erwerbslosen Anne Allex
II. Kritik an konkreten Diagnosen und Konzepten
Entstehung und Funktion der Diagnose »Abhängigkeitssyndrom« im Kapitalismus aus kritisch-psychologischer Sicht Daniel Sanin
Diagnosen von Gewicht. Innerfamiliäre Folgen der Ermordung meiner als ›lebensunwert‹ diagnostizierten Urgroßmutter Andreas Hechler
Trauma-Konzepte im Spannungsfeld zwischen psychischer Störung und gesellschaftspolitischer Anerkennung Catalina Körner
Zur Ver_rückung von Sichtweisen. Weiblichkeit* und Pathologisierung im Kontext queer-feministischer psychologischer Auseinandersetzungen Fiona Kalkstein/Sera Dittel
»Die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral.« Eine feministische Irrfahrt ins Reich der Verhaltenstherapie Christiane Carri und Heidrun Waldschrat
III. Kritik der Psychiatriekritik
Das Trilemma der Depathologisierung Mai-Anh Boger
Der AK Psychiatriekritik – wider die psychiatrische Macht AK Psychiatriekritik
»Nazi, werde schleunigst Arzt. Sonst holt der auch Dich!« Zur Shoahrelativierung in der Antipsychiatrie Kevin Dudek
Kein Ausgang. Zum komplementären Verhältnis von Diagnose und Inklusion Lars Distelhorst
Autor_innen
Endnoten
Crazyshit. Zur Notwendigkeit und Aktualität linker Psychiatriekritik
Nina U.
Gegendiagnose, das bedeutet dem vorherrschenden Diskurs um psychiatrische Diagnosen und Psychiatrie etwas entgegenzusetzen, ihn mitzuprägen, zu ändern. Zu dieser diskursiven Einmischung gehört neben der Prägung einer anderen Sprache, einer Sprache der Verrücktheit, auch die subversive Aneignung der vorherrschenden Sprache. Der Sammelband stellt eine Gegendiagnose. Eine Einschätzung, die differenziert und radikal den Blick auf das richtet, was psychiatrische Diagnosen verschleiern, nämlich die gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Die Kritik an psychiatrischen Diagnosen bildet sowohl den Ausgangspunkt für eine grundlegende Kritik an der Institution Psychiatrie als auch an sozialpsychiatrischen ambulanten Strukturen. Dies ist hochaktuell, denn jedes Jahr kommen immer mehr Menschen mit dem psychiatrischen System in Berührung. Dieser Kontakt ist häufig von Gewalt geprägt, so steigt zum Beispiel die Zahl der Zwangseinweisungen seit Jahren kontinuierlich an. Mit dem Erscheinen des DSM-V als neue Ausgabe eines der einflussreichsten Diagnosemanuale wurden viele Diagnosen insofern ausgeweitet, als sie nun sehr viel schneller als bisher vergeben werden können. Dafür wurden die Kriterien, welche erfüllt werden müssen, um bestimmte Diagnosen vergeben zu können, in vielen Fällen herabgesetzt. Mit der Kritik daran ist Diagnosenkritik im weitesten Sinne auch in der Tagespresse angekommen. Doch die Diskussion ist von psychiatrischen Sichtweisen geprägt und macht einen Bogen um grundlegende kritische Fragen. Die Beiträge im Sammelband setzen genau hier an und stellen eine Gegendiagnose, indem sie die grundlegenden Wahrheitsannahmen der Psychiatrie hinterfragen und deren gesellschaftliche Verortung offenlegen. Die Diagnosenkritik, welche hier geübt wird, ist eine Kritik an der psychiatrischen Sprache, an Praxen der Einordnung von Menschen in psychiatrische Schubladen und sie ist Teil einer grundlegenden Kritik am psychiatrischen System. Um die Grundlagen dieser Kritik zu begreifen, ist es zunächst wichtig zu betrachten, was psychiatrische Diagnosen sind und von welcher formalen Grundlage aus sie wirken. Diagnosen sind zunächst Klassifikationseinheiten. Sie sind Kategorien, die festlegen, welches Verhalten und Erleben als gestört und damit psychisch krank gilt. Die diagnostische Praxis ist eine Praxis der Normierung und sie hat weitreichende reale Konsequenzen, die von der Finanzierung psychiatrischer Leistungen über Stigmatisierungserfahrungen bis hin zu Zwangspsychiatrisierungen reichen.
Zunächst zeigt sich die Wirkmächtigkeit psychiatrischer Diagnosen auf der trockenen Ebene von Gesetzen, also durch ihre gesetzliche Verankerung. Wenn Menschen in der BRD in psychischen Krisen_Zuständen1 mit dem Gesundheitssystem und im Speziellen mit dem sozialpsychiatrischen System in Berührung kommen, also Leistungen aus dem psychosozialen Versorgungssystem beziehen, sind Diagnosen die Voraussetzung für eine Finanzierung. Denn die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nur dann die Behandlungskosten, wenn von professioneller Seite psychiatrische Diagnosen vergeben werden. Dies bedeutet: psychologische und ärztliche Psychotherapeut_innen sowie Psychiater_innen weisen Personen psychiatrische Kategorien sprich Diagnosen zu. Im fünften Teil des Sozialgesetzbuches wird in §295 die »Abrechnung ärztlicher Leistungen« geregelt (vgl. Bundesministerium der Justiz 1988). Die Vergabe von Diagnosen entsprechend des Diagnosenkatalogs ICD-10 wird darin als verpflichtend für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen sowie für die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen festgelegt. Es fällt auf, dass in der gesetzlichen Grundlage nicht im Besonderen auf psychiatrische Diagnosen eingegangen wird. Körperliche Krankheiten wie auch psychische Krisen_Zustände werden hier gemeinsam abgehandelt. Dies hat seine Verankerung im 1998 in Kraft getretenen Psychotherapeutengesetz, in welchem psychische Krisen_Zustände in ihrer Einordnung entsprechend den diagnostischen Kategorien des ICD-Klassifikationssystems als »Störungen mit Krankheitswert« gefasst werden (vgl. Bundesministerium der Justiz 1998). Angesichts eines Systems, in welchem Nicht-Funktionieren nur dann legitim ist, wenn Personen als krank gelten, scheint dies in sich logisch. Aber das bedeutet nicht, dass dieses System richtig und hinzunehmen ist. Die Sprache psychiatrischer Diagnosen ist eine medizinische und die Medizin beschäftigt sich vornehmlich mit dem isolierten Körper, nicht mit der Gesellschaft. Hierdurch werden vermeintliche Fakten geschaffen, welche weitreichend und wirkmächtig sind und Vorstellungen sowie Diskurse bestimmen: psychische Krisen_Zustände sind so Sache der Medizin und damit der Heilkunde. Darin steckt zum einen die grundlegende Annahme der Notwendigkeit einer Änderung dieser Zustände durch Behandlung von außen, zum anderen eine Versperrung des Blicks auf die gesellschaftliche Eingebundenheit dieser Krisen_Zustände. Diese Verschleierung der Gesellschaftlichkeit psychischer Krisen_Zustände findet außerdem auf der Ebene der konkreten Formulierung diagnostischer Kategorien statt. Moderne Diagnosekataloge sind deskriptiv2 formuliert. Es werden detaillierte, beschreibende Symptomlisten formuliert, wobei eine festgelegte Anzahl der Symptome erfüllt sein müssen, um die jeweilige Diagnose vergeben zu können. Dadurch entfallen formal ätiologische Annahmen,3 also Annahmen bezüglich der Ursachen. Jedoch wird durch die kategoriale Formulierung und dem Fokus auf die dekontextualisierte Person das Individuum die einzig verfügbare Einheit für Zuschreibungen bezüglich der Ursachen von psychischen Krisen_Zuständen. Individuelle biografische Bezüge spielen keine Rolle und auch verschiedene gesellschaftliche Diskriminierungserfahrungen wie Sexismus- und/oder Rassismuserfahrungen finden keine Beachtung. Was als alleiniger Referenzpunkt bleibt, ist der Körper. Es entsteht der Anschein, als würden psychische Krisen_Zustände gleich Infektionskrankheiten ausbrechen. Psychische Symptome seien Ausdruck einer körperlichen Krankheit, einer Krankheit des Gehirns, und könnten mit diagnostischen Mitteln bloßgelegt werden. Damit wird ein Bild klar abgrenzbarer psychischer Krankheiten/Krankheitsbilder geschaffen. Dies verleugnet jedoch den Konstruktcharakter psychiatrischer Diagnosen. Denn psychiatrische Diagnosen sind Konstrukte, Festlegungen, die keine raum-zeitliche Stabilität aufweisen und auch auf die jeweils kategorisierten Personen nur mehr oder weniger passen und niemals deren gesamtes Erleben erfassen. Auch wenn dieser Konstruktcharakter in der psychiatrischen Literatur teils eingeräumt wird (vgl. Hoff 2005), die Formulierung und der Aufbau diagnostischer Manuale sprechen eine andere Sprache und wirken in die sozialpsychiatrische Praxis sowie in den Alltagsdiskurs hinein. Infolgedessen wird beispielsweise von den »Depressiven« gesprochen, wie von einer scheinbar einheitlichen Personengruppe. Personen werden in ihrer Gesamtheit einer Kategorie zugeordnet, scheinen in ihrem Sein in der jeweiligen Schublade aufzugehen, Hintergründe und Kontext werden abgeschnitten, unsichtbar.
Eine linke Perspektive, die Gesellschaft und damit Kapitalismus, Sexismus, Rassismus und andere gesellschaftliche Machtverhältnisse verändern möchte, kann mit der Wirkmacht psychiatrischer Diagnosen, deren Eindringen in die Alltagssprache und der Referenz auf den Körper als ursächliche Einheit für psychische Krisen_Zustände nicht einverstanden sein. Linke Kritik an psychiatrischen Diagnosen muss neben dem Aufdecken der grundsätzlichen Gesellschaftlichkeit psychischer Krisen_Zustände weitere Bezüge aufzeigen. Diagnostische Kategorien als Konstrukte enthalten gesellschaftliche Normen und sind in ihrer Formulierung sowie Vergabepraxis auch Ausdruck von Machtverhältnissen. Diagnosen wie beispielsweise die der »Geschlechtsidentitätsstörung«4reproduzieren und naturalisieren die bestehende binäre Geschlechterlogik und sind aus einer linken, emanzipatorischen Perspektive nicht hinnehmbar. Das psychiatrische System in der BRD wie auch in den USA ist weiß und männlich dominiert. Autor_innen aus dem US-amerikanischen Raum kritisieren den Rassismus in der diagnostischen Praxis. Beispielsweise werden schwarze und weiße US-Amerikaner_innen häufig sehr unterschiedlich diagnostiziert. Schwarze männlich sozialisierte Personen bekommen zum Beispiel sehr viel häufiger die Diagnose Schizophrenie zugewiesen (vgl. Whaley 1998, Williams/ Neighbors/Jackson 2003), welche gesellschaftlich in besonderem Ausmaß Stigmatisierungen nach sich zieht und im Sprachgebrauch fast synonym mit Bedrohlichkeit gesetzt wird (vgl. Finzen/Benz/Hoffmann-Richter 2001). All diese Kritikpunkte sind seit Jahren bekannt und die Tatsache, wie wenig Öffentlichkeit es für diese Themen gibt, spricht Bände.
Mit dem Erscheinen des DSM-V im Mai 2013 brach nun eine Welle der Kritik los, die sowohl in psychiatrischer Literatur als auch der Tagespresse weite Kreise zog. Diagnosenkritik war plötzlich mainstream und wurde von bekannten Psychiater_innen wie Allen Frances, bekannt durch seine Mitarbeit an der Vorgängerversion des DSM-V, angeführt. Die Debatten ziehen sich bis heute hin und werden zwischen psychiatrischen und psychiatriekritischen Kritiker_innen vehement geführt (vgl. West 2014, Frances 2014). Das DSM-V ist neben dem ICD das meistverwendete Diagnosemanual für Praxis und Wissenschaft. Es wird von der Amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie herausgegeben und beeinflusst auch die Weiterentwicklung des ICD-Manuals, welches stets einige Jahre nach dem DSM in neuer Fassung erscheint. Um eine Diagnose vergeben zu können, muss jeweils eine bestimmte Mindestanzahl von Symptomen einer die »Störung« beschreibenden Symptomliste als erfüllt angesehen werden. Im neuen DSM sind nun bei vielen Diagnosen diese Kriterien herabgesetzt worden. Diese Diagnosen können nun also sehr viel schneller vergeben werden. Beispielsweise ist bei der Diagnose ADHS5 das Erstmanifestationsalter, also das Alter bis zu welchem die Symptome erstmals aufgetreten sein müssen, um die Diagnose vergeben zu können, von sieben auf zwölf Jahre heraufgesetzt. Ähnlich verhält es sich bei der Diagnose der Major Depression, also einer depressiven Episode. Dass nun bereits zwei Wochen nach dem Tod einer nahestehenden Person Trauer als Depression eingestuft werden kann, hat zu einem Aufschrei auch in der psychiatrischen Presse geführt. Dieses ist wohl das prominenteste Beispiel, aber auch an der Einführung neuer Diagnosen wie der Disruptive Mood Dysregulation Disorder, welche Wutausbrüche bei Kindern als Störung klassifiziert, wird Kritik geübt. Die psychiatrische Kritik stört sich am Aufweichen der Diagnosekriterien und warnt vor einer »Diagnose-Epidemie« (vgl. Bühring 2013). »Belastungen und Lebenskrisen« würden zu »psychischen Erkrankungen« (vgl. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 2013) erklärt, was wissenschaftlich nicht fundiert sei. Psychiatrische Diagnosen als Krankheitskategorien seien Ausdruck eines medizinischen Versorgungsbedarfs. Da Krankheiten stets mit Störungen von Organfunktionen einhergehen würden, sei diese Ausweitung nicht haltbar. Dies ignoriert völlig, dass auch andere psychiatrische Diagnosekategorien nicht biologisch ursächlich fundiert sind. Die psychiatrische Kritik am DSM-V bezieht sich somit auf die Verwischung der Grenze zwischen angenommenen richtigen Kranken und eigentlich Gesunden. Was psychiatrische Kreise stört, ist das indirekte Eingestehen des pragmatischen Charakters psychiatrischer Kategorien im DSM-V. Das erklärte Ziel der Forschungen im Rahmen der Herausgabe des DSM, biologische Ursachen psychischer Krisen_Zustände zu belegen, ist gescheitert. Mit der Ausweitung der Diagnosekategorien wird quasi eingeräumt, dass diagnostische Kategorien als Grundlage für eine Kostenerstattung und Krankschreibung dienen und nicht als Krankheitskategorien im Sinne körperlicher Krankheiten verstanden werden können. Der Aufschrei in psychiatrischen Kreisen kann auch als Angst einer Zunft gedeutet werden, deren Legitimation auf der Annahme natürlich gegebener Krankheiten und ihres krankheitsspezifischen Wissens um diese basiert.
Wenn im DSM-V Trauer nach 2 Wochen als krank eingeordnet werden kann, wird die distinkte Trennung zwischen krank und gesund ad absurdum geführt. Es ist logisch, dass eine psychiatrische Perspektive, deren Ziel ja in der Schärfung dieser Trennung liegt, dies kritisiert. Auch aus linker Perspektive ist die Ausweitung diagnostischer Kategorien kritisch zu sehen. Diese verschärft den Eindruck, immer mehr Menschen seien psychisch »krank«, anstatt gesellschaftliche Verhältnisse in den Fokus zu rücken. Linke Kritik darf natürlich nicht übersehen, dass es bei vielen Menschen einen realen Bedarf an Unterstützung gibt. Sie muss jedoch Fragen danach stellen, wie diese Unterstützungsgewährung gesellschaftlich begründet wird, warum professionelles Wissen im Gegensatz zu Erfahrungswissen als legitim gilt und welche gesellschaftlichen Missstände durch psychiatrische Praxen verschleiert werden. Es gilt einen emanzipatorischen Umgang mit psychischen Krisen_Zuständen und Alternativen der Unterstützung aufzuzeigen und zu schaffen.
Der vorliegende Sammelband trägt dazu einen wichtigen Teil bei, indem die Sprachlosigkeit durch ein Sprechen ersetzt wird, welches nicht die bestehenden Machtverhältnisse und Wahrheitsannahmen reproduziert und damit weiterträgt. Die Beiträge des Sammelbandes benennen klar den Konstruktcharakter psychiatrischer Diagnosen sowie die gesellschaftliche Kontextualität psychischer Krisen_Zustände. Sie zeigen alternative Ideen zum Umgang mit psychischen Krisen_Zuständen, hinterfragen aber auch die Annahme, diese seien in jedem Fall behandlungswürdig. Sie fordern einen Raum für Verrücktheit ein und betonen die Wichtigkeit einer grundsätzlichen Existenzberechtigung dieser. Die Herausforderung, welche es darstellt eine Gegenposition zum herrschenden Diskurs zu entwickeln, wird in diesem Sammelband angenommen. Die fundierten und kreativen Beiträge zeigen die Bandbreite aktueller linker Psychiatriekritik und schaffen es so die Wichtigkeit dieser zu belegen.
Quellenverzeichnis
American Psychiatric Association 2014: DSM: History of the Manual. URL: http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm-history-of-the-manual (Zugriff am 10.04.2015).
Bundesministerium der Justiz 1988: SGB V. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__295.html (Zugriff am 10.04.2015).
Bundesministerium der Justiz 1998: PsychThG. URL: http://www.gesetze-im-inter-net.de/psychthg/ (Zugriff am 10.04.2015).
Bühring, Petra 2013: Psychische Erkrankungen: BPtK kritisiert Aufweichen der Diagnosekriterien im neuen DSM-V. In: Deutsches Ärzteblatt. URL: http://www.aerzteblatt.de/ar-chiv/140879/Psychische-Erkrankungen-BPtK-kritisiert-Aufweichen-der-Diagnosekriterien-im-neuen-DSM-V (Zugriff am 10.04.2015).
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 2013: Wann wird seelisches Leiden zur Krankheit? Zur Diskussion um das angekündigte Diagnosesystem DSM-V. URL: http://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/download/pdf/stellungnahmen/2013/DG-PPN-Stellungnahme_DSM-5_Final.pdf (Zugriff am 10.04.2015).
Finzen, Asmus/Benz, Dominik/Hoffmann-Richter, Ulrike 2001: Die Schizophrenie im »Spiegel« – oder ist der Krankheitsbegriff der Schizophrenie noch zu halten? In: Psychiatrische Praxis 28(8), S. 365-367.
Frances, Allen 2014: Finding a Middle Ground Between Psychiatry and Anti-Psychiatry. In: Huffington Post. URL: http://www.huffingtonpost.com/allen-frances/finding-a-middle-ground-between-psychiatry-and-anti-psychiatry_b_6010890.html (Zugriff am 10.04.2015).
Hoff, P[…] 2005: Psychiatric diagnosis today – necessary tool or stigmatisation? In: Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 156, S. 4-12.
West, Corinna 2014: Allen Frances – Civil War or Propaganda Battle? URL: http://www.madinamerica.com/2014/10/allen-frances-civil-war-propaganda-battle/ (Zugriff am 10.04.2015).
Whaley, Arthur L. 1998: Cross-Cultural Persepective on Paranoia: A Focus on the Black American Experience. In: Psychiatric Quarterly 69(4), S. 325-343.
Williams, David R./Neighbors, Harold W./Jackson, James S. 2003: Racial/ ethnic discrimination and health: findings from community studies. In: Am J Public Health 93(2), S. 200-208. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447717/ (Zugriff am 10.04.2015).
Einleitung der Herausgeber_innen
Cora Schmechel/Fabian Dion/Kevin Dudek/Mäks* Roßmöller
Psychiatriekritik scheint heutzutage, wie Nina U. in ihrem Vorwort schreibt, wieder en vogue und selbst im bürgerlichen Mainstream angekommen zu sein. Die »Diskussion«, konstatiert sie, »ist [jedoch] von psychiatrischen Sichtweisen geprägt und macht einen Bogen um grundlegende kritische Fragen.« Denn die Kritik von Allen Frances & Co. reibt sich lediglich an den aktuell in den DSM-Katalog aufgenommenen Diagnosen und den Interessen der Pharma-Industrie – vermissen lässt sie eine grundsätzliche Gesellschaftskritik, wie sie noch die Alte und Neue Antipsychiatrie enthält.
Auch im linksradikalen Kanon hat die Kritik an der Institution Psychiatrie in den vergangenen Jahrzehnten ihren Platz eingebüßt, was sich nicht zuletzt im linken Alltag anhand von Verweisen auf die Notwendigkeit professioneller Hilfe in Krisensituationen oder von einer Sanktionierung befremdlicher Verhaltensweisen als ›psycho‹ oder ›krank‹ bemerken lässt. Weil Teile der damaligen antipsychiatrischen Forderungen seit den 1970er Jahren im Zuge der Reformierung der psychiatrischen Verwahranstalten in niedrigschwelligere Formen wie die Sozialpsychiatrie als umgesetzt erscheinen, kommt eine heutige Kritik wie aus der Zeit gefallen daher.
Nichtsdestotrotz ist weiterhin richtig, dass eine antipsychiatrische Kritik nicht allein bei der Einweisung in die Psychiatrie stehen bleiben darf und stärkeres Gewicht auf die den Diagnosen zu Grunde liegenden Konzepte von Normalität und psychischer Gesundheit legen muss. Sollte sich daher eine anti-psychiatrische Kritik nicht ebenso als kritisch gegenüber der Disziplin der Psychologie verstehen? Wie müsste eine Kritik an Psychologie und Psychiatrie beschaffen sein, die an die Wurzel geht und nicht in die Falle der Alten Antipsychiatrie tappt; die also weder die Betroffenen als revolutionäre Subjekte stilisiert und deren konkretes Leiden negiert noch in starre Gut_Böse/Täter_Opfer-Schemata verfällt, welche der Realität selten gerecht werden und Betroffene schnell paternalistisch in die Unmündigkeit delegieren? Kann überhaupt von der Gruppe der Betroffenen gesprochen werden, oder reproduziert dies nicht altbekannte, weiße Androzentrismen und verdeckt die Verwobenheit psychiatrisch-psychologischer Konzepte mit dem gegebenen Herrschaftsstrukturen? Dies waren einige der Fragen, welche uns dazu veranlassten, im Frühjahr 2013 dieses Projekt ins Leben zu rufen.
Ausgehend von diesen Fragen soll der vorliegende Sammelband zum einen – und in Abgrenzung zum bürgerlichen Mainstreamdiskurs à la Allen Frances – eine grundsätzliche Kritik an psychiatrischen Diagnosen aktualisieren, die nicht erst die derzeitigen Auswüchse in Form der Neuauflage des DSM als kritikwürdig begreift, und die gesellschaftlichen Voraussetzungen psychiatrischer Diagnosen adäquat hinterfragen. Zum anderen soll er für ein Thema sensibilisieren, das von der linken Gesellschaftskritik in der jüngeren Vergangenheit aus dem Blick geraten ist, gleichsam aber auch die psychiatriekritische Bewegung einer Kritik unterziehen.
Gezielt gesucht haben wir unter anderem nach Beiträgen, welche sich mit dem Rassismus im psychiatrisch-psychologischen System befassen, einem Aspekt, den sowohl die klassische wie auch die kritische feministische Psychiatriekritik zumeist übersehen. Auch für uns war es schwierig hierzu Beiträge zu erhalten, weshalb wir (potentielle) Autor_innen zu diesem Thema besonders ermutigen möchten, sich bezüglich der von einigen von uns geplanten Buchreihe Get well soon. Reihe zu Psycho_Gesundheitspolitik im Kapitalismus gern bei uns zu melden. Denn der vorliegende Band soll der Auftakt einer Verlagsreihe sein: Im Laufe der Arbeit entstand die Idee, eine kontinuierliche Reihe zum Thema im Programm der edition assemblage zu etablieren, um es nicht bei einem einmaligen Input zu belassen, sondern ein stetiges Forum zur Weiterentwicklung der Debatte zu etablieren.
Aufbau dieses Bandes
Durch die gemeinsame bewegungspolitische Zusammenarbeit in der Vergangenheit in losem Kontakt miteinander stehend, haben wir uns nach und nach als Herausgeber_innengruppe zusammengefunden. Während der Arbeit hat sich dann herauskristallisiert, dass wir über eine ähnliche Stoßrichtung der institutionellen und disziplinären Kritik hinaus inhaltlich keine gemeinsame programmatische Linie vertreten. Dieser Pluralismus, den wir innerhalb unserer Herausgeber_innengruppe repräsentieren, hat sich nicht zuletzt in der Auswahl der hier veröffentlichten Beiträge niedergeschlagen und dazu geführt, dass die gewählten Ansätze und politischen Konsequenzen der Beiträge teils im Widerspruch zueinander stehen. Was der Band damit zumindest in seiner Gesamtheit abzubilden vermag, ist ein Schlaglicht auf den Stand der derzeitigen linksradikalen antipsychiatrischen Theoriebildung zu werfen.
Dieses Mosaik in thematische Blöcke einzuteilen, ist uns deshalb nicht leicht gefallen und stellt für uns einen Akt der Pauschalisierung dar, der zwar publikationstechnisch notwendig ist, jedoch oft der Spannweite der Beiträge nicht in Gänze gerecht wird. Wir haben uns schließlich für eine Dreiteilung entschieden, welche die Beiträge danach sortiert, wogegen sich die jeweilige Kritik primär richtet: (I.) gegen die Institution und Disziplin Psychiatrie und Psychologie und deren gesamtgesellschaftliche Funktion, (II.) gegen konkrete Diagnosen, Konzepte und Praxisformen sowie (III.) gegen die Psychiatrie- und Psychologiekritik als solche.
Den Auftakt im ersten Block der Analysen zur Funktion der psychiatrischen Institution bildet Stephan Weigands Aufsatz »Inklusiv und repressiv. Zur Herrschaftsförmigkeit der reformierten Psychiatrie«. Er macht darin eine empirisch orientierte Bestandsaufnahme der heutigen psychiatrischen Versorgungsstruktur und stellt sie in den Kontext der dafür verantwortlichen bundesrepublikanischen Psychiatriereform der 1970er Jahre. Hierbei arbeitet er die Unterschiede zur vor der Reform existierenden Anstaltspsychiatrie heraus und geht besonders auf den flexibilisierten, an die neoliberale Gesellschaft angepassten Herrschaftscharakter der heutigen Psychiatrie ein. Vor diesem Hintergrund erklärt sich schließlich auch das Paradox, warum das alte Anstaltssystem zwar abgeschafft wurde, die heutigen Einrichtungen jedoch zahlenmäßig dominieren, oder warum trotz Inklusion die Zahl der Zwangseinweisungen kontinuierlich ansteigt.
In »Diagnose: Gesellschaftlich unbrauchbar mit Aussicht auf Heilung« entwickeln Sohvi Nurinkurinen und Lukaš Lulu – wie ihr Untertitel anzeigt – eine »Analyse und Kritik der heutigen Psychiatrie in ihrer Parteilichkeit für die herrschenden bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse«. Dafür erläutern sie, wie die im DSM oder in der ICD gelisteten psychiatrischen Diagnosen grundsätzlich zustande kommen, kritisieren sie, auf welchen theoretischen Annahmen die zwei am weitesten verbreiteten Behandlungsmethoden der Pharmako- und Verhaltenstherapie fußen, und verwerfen sie die Vorstellung von Lohnarbeit als Garantin eines glücklichen und psychisch gesunden Lebens. Welches staatliche Interesse in der Wiederherstellung dieser Form von ›Gesundheit‹ steckt, zeigen die Autor_innen im letzten Teil ihres Beitrags.
Esther Mader gibt in »Psychopathologisierung und Rassismus in Deutschland. Eine feministische Perspektive« einen Überblick über die historische und funktionale Verwobenheit der psychiatrischen Disziplin mit Kolonialismus und Rassismus und wirft einen rassismus-kritischen Blick auf die aktuelle Versorgungslandschaft in Deutschland. Sie plädiert dafür, sich kritisch mit der Dominanz des weißen Diagnosesystems in Forschung und Praxis auseinanderzusetzen und verschiedene, auf Rassismus basierende Diskriminierungserfahrungen anzuerkennen, wie das abschließende Interview mit zwei Women of Color verdeutlicht, die von ihren beruflichen Erfahrungen in der psychosozialen Beratung berichten.
Dass die Diskussionen um das DSM in viele Bereiche der Gesellschaft hineinreichen und nicht ohne Wirkungen bleiben, veranschaulicht Anne Allex ´ Beitrag »›Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient …‹ Zu rechtswidrigen Gründen und Verfahren bei ›psychologischen Gutachten‹ bei Erwerbslosen«. Der juristisch informierte Text beschreibt anhand von Fallbeispielen die seit einigen Jahren übliche Praxis von Jobcentern, die Erwerbslosigkeit von ALG II-Bezieher_innen mittels psychologischer Gutachten feststellen zu lassen. Die Autorin macht deutlich, dass es sich hierbei um ein stigmatisierendes Instrument handelt, das nicht zuletzt das widerständige Verhalten von Erwerbslosen pathologisiert, und gibt praktische Ratschläge zur Selbsthilfe.
Der zweite Block zur Kritik an konkreten Diagnosen und Konzepten wird eröffnet von Daniel Sanins Analyse der »Entstehung und Funktion der Diagnose ›Abhängigkeitssyndrom‹ im Kapitalismus aus kritisch-psychologischer Sicht«, in der er den ›Sucht‹-Diskurs historisch entlang der Entstehung der kapitalistischen Moderne nachvollzieht und verdeutlicht, dass die Diagnose – eingespannt in ein Dispositiv der Selbst- und Fremdkontrolle – heutzutage auf alle Verhaltensweisen ausgedehnt werden kann und damit potentiell über allen Menschen schwebt. Angesichts einer rigiden staatlichen Drogenpolitik wäre ein sachlicherer Umgang mit ›Sucht‹ nötig, weil diese nur innerhalb ihres gesellschaftlichen Kontextes verstanden werden kann.
Welche persönliche und gesellschaftliche Dimension die nationalsozialistische Vernichtung psychiatrisierter Menschen noch heute hat, beschreibt Andreas Hechler in seinem Beitrag »Diagnosen von Gewicht. Innerfamiliäre Folgen der Ermordung meiner als ›lebensunwert‹ diagnostizierten Urgroßmutter«, in dem er einen Einblick in die Krankengeschichte seiner im Zuge der ›Aktion T4‹ in Hadamar getöteten Urgroßmutter gewährt und den (für bundesdeutsche Verhältnisse eher untypischen) Umgang mit ihrer Ermordung innerhalb seiner Familie rekonstruiert. Er zieht eine Linie von den Spuren des Gestern zum Heute und erklärt, dass das Tabuisieren der NS-›Euthanasie‹-Opfer im engen Zusammenhang mit einem gesamtgesellschaftlichen Ableismus steht, diskutiert Gründe, die die Identifizierung mit dieser Opfergruppe erschweren, und plädiert für Empathie mit den Opfern und ein Engagement gegen Ableismus heutzutage.
In »Trauma-Konzepte im Spannungsfeld zwischen psychischer Störung und gesellschaftspolitischer Anerkennung« stellt Catalina Körner »Einige Gedanken zur Problematik von ›Opferschaft‹ am Beispiel des Diskurses um ›Kollektive Deutsche Kriegstraumata‹« an. Sie verfolgt dabei die Entstehung der Diagnose der ›Posttraumatischen Belastungsstörung‹, die erst im Zuge der Rückkehr von US-amerikanischen Vietnamkriegssoldaten im DSM anerkannt wurde, und diskutiert sie im aktuellen Kontext der geschichtsrevisionistischen Umdeutung der deutschen Kriegsschuld. Nicht allein an diesem Beispiel wird deutlich, dass eine individualisierte Sicht auf den Umgang mit erlebter Gewalt, wie sie im DSM stattfindet, die Täterschaft und gesellschaftlichen Machtverhältnisse notwendig unwidersprochen lässt.
Fiona Kalkstein und Sera Dittel kritisieren in ihrem Aufsatz »Zur Ver_rückung von Sichtweisen: Weiblichkeit* und Pathologisierung im Kontext queer-feministischer psychologischer Auseinandersetzungen« die immanenten Hetero-und Cis-Sexismen und Weiblichkeitsabwertungen in der psychologischen Theorie und Praxis, diskutieren Klassiker_innen der feministischen Psychiatriekritik und machen Ansätze aus der Kritischen und aus der feministischen Psychologie produktiv. Ausgehend von der klassischen Frauentherapie argumentieren sie für die Integration queerfeministischer Ansätze in der Psychotherapie, um den gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die vom DSM ausgeblendet werden, Rechnung zu tragen.
In »›Die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral.‹ Eine feministische Irrfahrt ins Reich der Verhaltenstherapie« überführen Christiane Carri und Heidrun Waldschrat die verhaltenstherapeutischen Strategien zur Behandlung einer ›Borderline-Persönlichkeitsstörung‹ der Parteilichkeit für die herrschenden Verhältnisse, indem sie potentielle Therapieerlebnisse mit den Ansprüchen psychologischer und philosophischer Theorien konfrontieren. Thematisiert werden dabei unter anderem ein unhinterfragtes Therapeut_in-Patient_in-Verhältnis, die Pathologisierung von Homosexualität, die Psychologisierung abweichenden Verhaltens und der Sexismus innerhalb des therapeutischen Settings.
Im letzten Block, der unter dem Titel Kritik der Psychiatriekritik läuft, üben die Autor_innen eine konstruktive Kritik an der bestehenden Psychiatriekritik.
Im eröffnenden Aufsatz »Das Trilemma der Depathologisierung« arbeitet Mai-Anh Boger die je eigenen Widersprüche heraus, mit denen eine Bewegung wie die antipsychiatrische grundsätzlich konfrontiert ist, will sie den herrschaftlichen Diskurs überwinden. Sie liefert dabei ein tieferes Verständnis dafür, wie eine Kritik des pathologisierenden Diskurses aussehen kann, die das reale Leid der Menschen nicht verleugnet oder deren Wunsch nach Teilhabe an einem bürgerlichen Leben rundweg ablehnt.
Eine Dokumentation der politischen Arbeit des Berliner AK Psychiatriekritik namens »Der AK Psychiatriekritik – wider die psychiatrische Macht« gibt in ihrem Hauptteil einen Einblick in die internen Debatten der Gruppe zur Frage der Betroffenheit. Dabei geht es um Möglichkeiten und Grenzen eines erweiterten Begriffs von Betroffenheit, der die Inanspruchnahme psychologisch-psychiatrischer Hilfsangebote weder moralisch kritisiert noch deren institutionelle Zwänge verharmlost. Welche Konsequenzen ein erweiterter Betroffenheits-Begriff für die Arbeit als politische Gruppe aber auch für den Umgang mit Krisensituationen innerhalb der linksradikalen Szene nach sich zieht, ist ebenfalls Gegenstand der hier abgebildeten Diskussion.
Dass sich die antipsychiatrische Bewegung nicht selten antisemitischer und shoahrelativierender Argumentationsmuster bedient, dokumentiert der daran anschließende Beitrag »›Nazi, werde schleunigst Arzt. Sonst holt der auch Dich!‹ Zur Shoarelativierung in der Antipsychiatrie« von Kevin Dudek. Sowohl auf basisaktivistischer als auch auf politisch hochrangiger Ebene trifft man innerhalb der Antipsychiatrie auf Verschwörungstheorien, wonach die Psychiatrie für die nationalsozialistische Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden verantwortlich sei, auf Kontinuitätsbehauptungen, Gleichsetzungen oder Vergleiche mit der Hexenverfolgung. Statt die Ursachen für die Zumutungen der Psychiatrie im NS zu suchen und damit eine besondere Form des Geschichtsrevisionismus zu betreiben, plädiert der Autor für eine Analyse, die – eingedenk der nationalsozialistischen Massenvernichtung – das Heute fokussiert.
Den Abschluss bildet Lars Distelhorst, der in seinem Beitrag »Kein Ausgang. Zum komplementären Verhältnis von Diagnose und Inklusion« die Konzepte von Inklusion und Pathologisierung hinterfragt und mit dem poststrukturalistischen – und in diesem Fall auch bürgerlichen – Vor-Urteil aufräumt, dass die Menschen durch das neue DSM einfach nur stärker als bisher ausgegrenzt würden. Stattdessen kann er unter Einbeziehung der postfordistischen Produktionsbedingungen aufzeigen, wie Inklusion und Pathologisierung Hand in Hand gehen und die Menschen für die veränderten ökonomischen Anforderungen nutzbar machen: Die Pathologisierung, indem sie die Schwelle des ›Krankhaften‹ heruntersetzt und entdramatisiert; die Inklusion, indem sie an das frühzeitig entdeckte ›Krankhafte‹ andockt und es in die Produktion einspeist.
Danksagung
Wir möchten uns an dieser Stelle sowohl bei allen siebzehn Autor_innen als auch bei allen Lektor_innen – darunter Mo Winter, Christian Küpper, Rosch, Conni* Krämer, Anne Roth, Catalina Körner und Lukas Engelmann – für die kollegiale Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken! Besonderer Dank gebührt außerdem allen solidarischen Kritiker_innen und (anonymen) Begleiter_innen des Projekts, die uns entweder von Anfang an oder zu bestimmten Zeitpunkten in ideeller, handwerklicher oder finanzieller Hinsicht unterstützt haben – darunter Ulrike Klöppel, Kristin Witte, Chris ›Brudi‹ Kurbjuhn, Sebastian Friedrich, Rina Rosentreter, ABqueer e.V. und die Berliner Asten. Ohne den anfänglichen Zuspruch und die kontinuierliche Unterstützung von Willi Bischof und den Mitarbeiter_innen des Verlags edition assemblage wäre dieser Band nicht zu Stande gekommen. Nicht zuletzt freuen wir uns über Anregungen und Kritik zum Buch sowie Interesse für die geplante Buchreihe und hoffen auf eine konstruktive und stetige Weiterentwicklung der Debatte(n), die voranzutreiben unser Wunsch war.
Kontakt: [email protected]
Berlin, April 2015
I. Analysen zur Funktion der psychiatrischen Institution
Inklusiv und repressiv. Zur Herrschaftsförmigkeit der reformierten Psychiatrie
Stephan Weigand
Die einst deutlich hörbare Stimme der Antipsychiatrie ist weitgehend verstummt. Die Psychiatrie hat sich in der Mitte der Gesellschaft etabliert. Immer mehr Menschen befinden sich in psychiatrischer Behandlung. Auch in der linken Szene wird schnell dazu geraten, sich in Krisen ›professionelle Hilfe‹ zu suchen oder sich ›freiwillig‹ in eine Klinik zu begeben. Welche Veränderungen seit der Psychiatriereform stattgefunden haben und wie das psychiatrische System heute aussieht, soll in meinem Beitrag beleuchtet werden. Wie erklärt sich etwa, dass die Psychiatriereform zwar die Anstalten verkleinert hat, die Gesamtzahl der psychiatrischen Institutionen aber stark angewachsen ist? Wie ist es zu verstehen, dass die modernisierte Psychiatrie einerseits auf Inklusion und Partizipation setzt, andererseits die Zahl der erzwungenen Einweisungen seit Jahren ansteigt? Und kann diese janusköpfige Psychiatrie im Zusammenhang mit der postfordistischen Wandlung des Kapitalismus verstanden werden? Im ersten Teil des Beitrags skizziere ich die Dimensionen der heutigen Psychiatrie, indem ich einen Überblick über die zentralen psychiatrischen Sektoren von den stationären Settings über den Wohn- und Arbeitsbereich hin zu den politischen und administrativen Strukturen gebe. Im zweiten Teil des Artikels konfrontiere ich das psychiatrische System mit grundlegenden Kritiken. Dabei unternehme ich den Versuch ältere Analysen der Gemeindepsychiatrie wieder ins Bewusstsein zu bringen und mit einem kapitalismuskritischen Ansatz zu verbinden. Ziel ist es einen Beitrag zum Verständnis der heutigen Psychiatrie in ihren verschiedenen Facetten zu leisten und mögliche Ursachen für die Transformation des psychiatrischen Systems zu beleuchten.
Gegen menschenunwürdige Zustände – von der postnazistischen Anstalt zur Psychiatriereform
Während in westlichen Staaten wie der USA und Großbritannien bereits ab Mitte der 1950er Jahre Reformen des psychiatrischen Systems eingeleitet wurden,1 beanspruchte die Großanstalt mit Hunderten bis Tausenden Insass_innen in der BRD auch weit über das Ende des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms hinaus einen Alleinvertretungsanspruch. Als totale Institution2 konnte sie sozial, geografisch und partiell auch rechtlich außerhalb der zumindest formal demokratisierten deutschen Gesellschaft fortbestehen. Abgeschottet entzog sie sich dem (zivil-)gesellschaftlichen Zugriff und kam vor allem der Aufgabe nach auffällig Gewordene auszusondern, zu verwahren und zu bändigen, weniger aber sie zu therapieren. Die Insass_innen wurden nicht als eigenständige Individuen aufgefasst, als ›Verrückte‹ standen sie jenseits bürgerlicher Subjektivität. Der Einsatz von Zwang und willkürlicher Gewalt seitens des Klinikpersonals bedurfte kaum einer individuellen Begründung, »Erniedrigung, Demütigung und Willkür [waren] die Regel« (Basaglia 1971: 146). Ein Drittel der psychiatrischen Betten war von sogenannten chronisch psychisch Kranken länger als zehn Jahre belegt, ein weiteres Viertel länger als zwei Jahre (vgl. Deutscher Bundestag 1975: 7). Oft war die Psychiatrie für sie der einzige Lebensort, dem noch dazu jeglicher persönlicher Freiraum abging – in Schlafräumen waren häufig mehr als zehn Betten aufgestellt. Innerhalb des Klinikpersonals herrschte eine sehr rigide, arztzentrierte Hierarchie. Neben den Kliniken bestanden noch sogenannte Heime und Anstalten für geistig Behinderte und chronisch psychisch Kranke. Ambulant praktizierten etwa 1.000 niedergelassene Nervenärzt_innen. Erst ab Mitte der 1960er Jahre wurden die Zustände in einzelnen Kliniken skandalisiert und erste psychiatriekritische Positionen in der Öffentlichkeit artikuliert. In der Folge der 68er-Bewegung wurden schließlich bisher weitgehend unhinterfragte Institutionen des Fordismus – Fabrik, Schule, Heim, Kleinfamilie – kritisiert und Gegenmodelle wie Kollektivbetriebe, Kinderläden etc. entwickelt. In diesem Zuge wurden auch die antipsychiatrischen Theorien von u.a. Ronald D. Laing, David Cooper und Michel Foucault vermehrt rezipiert.
Im April 1970 fand in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf der von Klaus Dörner initiierte Kongress »Rückkehr der psychisch Kranken in die Gesellschaft?« statt, der als Geburtsstunde der sozialpsychiatrischen Bewegung in Deutschland gilt. Der Kongress kam laut Dörner zu einem Zeitpunkt, »an dem die rein antiautoritäre Phase der Studentenbewegung ihrem Ende zuging bzw. überging in ein größeres Fachengagement der Studenten« (Dörner 1972: 83). Im Anschluss an den von der Pharma-Firma Thomae finanzierten, an psychiatrische Professionelle und den akademischen Nachwuchs gerichtete Kongress bildete sich der Mannheimer Kreis, aus dem die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) hervorging. Die häufig von der Studierendenbewegung beeinflussten oder ihr entstammenden Professionellen trafen auf ein politisches Klima, das offen für humanistisch inspirierte Veränderungen war, wie etwa die 1969 verabschiedete Strafrechtsreform anzeigt, in deren Zuge u.a. die Zuchthausstrafe abgeschafft wurde.
Auf Antrag der CDU-Bundestagsfraktion wurde eine Expert_innenkommission eingesetzt, die 1975 den 430-seitigen »Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland« und damit die sogenannte Psychiatrie-Enquête ablieferte. Mitglieder der Enquête-Kommission waren ausschließlich Professionelle, vor allem Psychiater_innen und Vertreter_innen von Landesministerien. Einer der Vordenker_innen der Psychiatriereform, Karl Peter Kisker, sah das wesentliche sozialpsychiatrische Moment darin, »der Möglichkeit menschlichen Verirrens mit der Möglichkeit menschlichen Einspannens [zu begegnen], dem Aussatz mit dem Einsatz« (Kisker 1966/67, zit. n. Hoffmann-Richter 1995: 19). Dieses sozialpsychiatrische Konzept der Integration und Aktivierung wurde mit der Enquête politisch-administrativ ausformuliert, die Enthospitalisierung und Integration in die Kommune erschien als neue Perspektive im Umgang mit den psychiatrisierten Subjekten. Bereits im Zwischenbericht der Kommission wurde konstatiert, »daß eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müssen« (Deutscher Bundestag 1973: 23). Die Kommission plädierte dafür, die Sonderstellung der Psychiatrie aufzulösen, da
die psychiatrische Krankenversorgung grundsätzlich ein Teil der allgemeinen Medizin ist. Demgemäß muß das System der psychiatrischen Versorgung in das bestehende System der allgemeinen Gesundheitsvorsorge und -fürsorge integriert werden. Dem seelisch Kranken muß prinzipiell mit dem gleichen Wege wie dem körperlich Kranken optimale Hilfe unter Anwendung aller Möglichkeiten ärztlichen, psychologischen und sozialen Wissens gewährleistet werden (Deutscher Bundestag 1973: 12).
Die Psychiatrie sollte aus dem gesellschaftlichen Off in die Gemeinde getragen werden. Ziel war es, eine ambulante und gemeindenahe Versorgung aufzubauen, um die Nutzer_innen möglichst nicht aus ihrem sozialen Umfeld auszugliedern. Der in der Kommunalverwaltung gebräuchliche, aber auch utopisch-religiös aufgeladene, Begriff der Gemeinde wurde von der Enquête pragmatisch-technizistisch als in ›Standardversorgungsgebiete‹ aufgeteilter ›Versorgungsraum‹ ausbuchstabiert (vgl. Zurek 1991: 236ff.). Konkrete Forderungen waren dementsprechend die bundesweite Installation einheitlicher Planungsregionen für die psychiatrische Versorgung, die Verkleinerung und Umstrukturierung der großen psychiatrischen Krankenhäuser, die Etablierung von sozialpsychiatrischen Beratungsdiensten, Tageskliniken und Werkstätten zur beruflichen Eingliederung, die Förderung von Selbsthilfegruppen, die Differenzierung des psychiatrischen Fachgebietes (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerontopsychiatrie etc.) und die Koordination aller Versorgungsdienste, um sogenannte Fehlplatzierungen als »verhängnisvolle Folge des planlosen Nebeneinanderher-Arbeitens nahezu aller Dienste« (Deutscher Bundestag 1975: 11) zu vermeiden. Laut Enquête würden zudem mindestens ein Drittel aller Bürger_innen einmal in ihrem Leben ›psychisch krank‹, weshalb Aufklärung und Prävention gefördert werden sollten. Familien-, Erziehungs- und weitere Beratungsstellen sollten als Vorfeld der psychiatrischen Dienste fungieren. In den Jahren und Jahrzehnten nach der Enquête kam es zu einem Umbau des psychiatrischen Systems in der Bundesrepublik, zunächst in Form von Modellprogrammen und weiter ausgreifend im Anschluss an das 1986 verabschiedete »Gesetz zur Verbesserung der ambulanten und teilstationären Versorgung psychisch Kranker«. Eine effektive Umstrukturierung des Systems zugunsten vermehrter außerklinischer Lösungen fand in vielen Gegenden und in den östlichen Bundesländern erst in den 1990er Jahren statt. Seitdem überwiegt die Darstellung, dass durch die initiierte Psychiatrie-Enquête bereits vieles erreicht worden sei, wenn es auch noch einiges zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung zu tun gäbe. Exemplarisch dafür steht eine Aussage der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen), die 2001 zwar feststellte, »dass wir von einem flächendeckend hohen Niveau in der Versorgung noch weit entfernt sind«, aber unterstrich: »Die Psychiatrie-Enquête vor nunmehr 25 Jahren war ein Meilenstein in der Geschichte der Reformbewegung der psychiatrischen Versorgung. Seither hat die Psychiatrie durchgreifende Veränderungen erlebt. […] Wir haben allen Grund, auf das bisher Erreichte stolz zu sein.« (Fischer 2001: 18ff.) Durch die Reform sei es zu einer Emanzipation der Psychiatrie-Betroffenen vom Objektstatus zum selbstbestimmten Subjekt gekommen, Empowerment sei an die Stelle von Entmündigung getreten.
Ein positiver Bezug auf die Psychiatrie-Enquête ist heutzutage Konsens in Fachkreisen und der allgemeinen Öffentlichkeit. Sowohl konservative Psychiater_innen als auch kritisch-reformerisch auftretende Betroffene und Angehörige können sich auf die Ziele der Enquête einigen. Ein latentes Unbehagen an der Psychiatrie zeigt sich in der Skandalisierung von Einzelfällen3 und einer Angst vor der Ausweitung der Diagnosen, wie sie etwa anlässlich der Veröffentlichung des DSM-V zu beobachten war. Jenseits dieses sich mitunter verschwörungstheoretisch artikulierenden Unbehagens4 ist in Deutschland kaum noch öffentliche Kritik an den psychiatrischen Strukturen wahrnehmbar. In den Jahren nach Veröffentlichung des Enquête-Berichts war eine radikale Kritik an der Psychiatrie noch weit stärker artikuliert worden. Darauf werde ich später zurückkommen. Zunächst sollen die Grundstrukturen des psychiatrischen Systems dargestellt werden, die sich infolge der Psychiatriereform bis heute herausgebildet haben.
Klinik, Heim, Maßregelvollzug: in der Psychiatrie
Die vor der Psychiatriereform dominierenden, mehr oder weniger isoliert arbeitenden Großanstalten wurden in den letzten Jahrzehnten bautechnisch modernisiert und verkleinert; zahlreiche psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern entstanden. In jeder Region ist mittlerweile eine Klinik beauftragt, den gesetzlichen Versorgungsauftrag – die Pflichtversorgung – sicherzustellen. Derzeit existieren in Deutschland etwa 219 psychiatrische Kliniken und 232 psychiatrische Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern. Dazu kommen noch 199 psychosomatische und 174 kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken bzw. Fachabteilungen. Insgesamt umfassen diese Einrichtungen mehr als 79.000 Betten – in den 1970er Jahren waren es etwa 99.000 psychiatrische Betten in Westdeutschland (vgl. Arbeitsgruppe Psychiatrie der Obersten Landesgesundheitsbehörden 2012: 3ff., Deutscher Bundestag 1975: 2). Anders als früher sind die Kliniken heutzutage vorwiegend für die Akutbehandlung zuständig, längerfristige Aufenthalte sollen vermieden werden. Da parallel zur moderat gesunkenen Bettenzahl die durchschnittliche Liegezeit von etwa 180 auf 20 bis 40 Tage stark reduziert wurde, ist die Gesamtzahl der ›Fälle‹ – also der in den Kliniken aufgenommenen Menschen – nicht gesunken. Seit 1994 hat die Fallzahl sogar um ca. 46% zugenommen. Zugleich ist die Wiederaufnahmerate gestiegen, also die Rate mehrfacher Klinikaufenthalte pro Person: hier zeigt sich der vielbeklagte ›Drehtüreffekt‹ (vgl. Schneider/Falkai/ Maier 2011: 3ff.). Die Zahl der Zwangseinweisungen ist zwischen 2000 und 2011 von jährlich über 90.000 auf über 130.000, nach anderen Quellen sogar auf über 230.000 gestiegen – in anderen europäischen Ländern werden relativ zur Bevölkerung weitaus weniger Menschen eingewiesen.5 Anträge auf Einweisungen werden von den Gerichten in 99% der Fälle positiv beschieden. Überdurchschnittlich häufig eingewiesen werden Menschen aus niedrigen sozialen Schichten, alte Menschen und Personen mit einer sogenannten Behinderung (vgl. Joeres 2011) – auch Migrant_innen werden häufiger eingewiesen (vgl. Machleidt et al. 2007, Hoffmann 2009).
Im Zuge der Psychiatriereform wurden die Kliniken infrastrukturell und fachlich modernisiert und nach Bevölkerungsgruppen und Diagnosen ausdifferenzierte Behandlungsformen geschaffen. Multidisziplinäre Teams entstanden, vermehrt wurden sozialarbeiterische und psychologisch-therapeutische Techniken in den klinischen Prozess einbezogen. Zudem wurden Gesetze und Fachstandards zur Regulierung der Zwangsbehandlung geschaffen, weiterhin wurde jedoch häufig Zwang angewandt. Neben zahlreichen Fixierungen, erzwungenen Begutachtungen, vermitteltem oder direktem Zwang zur Einnahme von Psychopharmaka existieren weitere offen gewaltförmige Therapieformen fort. Dazu zählt etwa die Elektrokrampftherapie, die in den letzten Jahren wieder rehabilitiert wurde und auch von Sozialpsychiater_innen, wie z.B. Klaus Dörner, nicht generell abgelehnt wird (vgl. Wagner-Nagy 2012, Lehmann 1988).
Jenseits der stationären Psychiatrien, die über die Krankenversicherungsbeiträge finanziert werden, werden Psychiatrisierte auch in eigenen Heimen für ›seelische Behinderte‹ stationär untergebracht. 2010 waren davon ca. 49.000 Menschen (2000: ca. 37.000, 1972: ca. 36.000) betroffen (vgl. Arbeitsgruppe Psychiatrie der Obersten Landesgesundheitsbehörden 2012: 30). Zudem werden immer mehr Menschen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen, in Obdachlosen- oder Pflegeheime abgeschoben, wo kein therapeutisches Angebot bereitsteht, sondern eine reine Medikamentierung und Verwahrung betrieben wird. Meist haben diese Menschen bereits mehrfache Klinikaufenthalte hinter sich, werden als ›austherapiert‹ oder ›systemsprengend‹ abgestempelt und für Jahre oder Jahrzehnte ohne weitergehende Perspektive im Heim untergebracht. Allein für Berlin werden mehr als 5.000 Heimverwahrte mit einer psychiatrischen Diagnose geschätzt (vgl. Vock et al. 2007: 84). In einem Zeitungsbericht konstatierte ein Berliner Chefarzt 2013: »Inzwischen leben in diesen Heimen mehr Menschen als damals [vor der Psychiatrieform, S.W.] in den großen Anstalten …« (Tramitz 2013)
Zudem findet eine Psychiatrisierung der Delinquenz statt: immer mehr Menschen, die Straftaten begangen haben, aber vor Gericht aufgrund einer ›psychischen Krankheit‹ für schuldunfähig erklärt wurden, werden in den sogenannten Maßregelvollzug eingewiesen. Dort werden sie oft für viele Jahre unter widrigsten Bedingungen eingesperrt und müssen sich einem besonders autoritären psychiatrischen Regime mit sehr hohem Psychopharmaka-Zwang, häufigen Zwangsfixierungen und starken sozialen Reglementierungen unterwerfen. Selbst leichtere Delikte wie Diebstahl oder Fahren ohne Führerschein können mittlerweile zu einer Einweisung in den Maßregelvollzug führen – entsprechend hat sich die Zahl der dort Untergebrachten in den letzten 20 Jahren beinahe verdreifacht.6
Wohnen – Leben – Arbeiten: die Psychiatrie in der Gemeinde
Ein großes Anliegen der Psychiatriereform war, wie beschrieben, die sogenannte Wiedereingliederung der Psychiatrisierten nach dem Klinikaufenthalt – entsprechend wurden Versorgungsstrukturen geschaffen, die als Brücke zwischen dem Klinikaufenthalt und einer Existenz als als autonomer, möglichst lohnarbeitender Bürger_in dienen sollen. Direkt an die Kliniken angebunden wurden die Tageskliniken, die der Anschlussbehandlung oder der Vermeidung eines stationären Aufenthaltes dienen. Ihre Zahl ist so sehr angestiegen, dass mittlerweile auf vier psychiatrisch-stationäre Betten ein Platz in der teil-stationären Tagesklinik entfällt (vgl. Arbeitsgruppe Psychiatrie der Obersten Landesgesundheitsbehörden 2007: 37).
Neu geschaffen wurde infolge der Psychiatriereform ein großer gemeindepsychiatrischer Bereich, der im Vergleich zu den Tageskliniken weniger medizinisch-therapeutisch, mehr betreuend und sozialarbeiterisch ausgerichtet ist. Die Angebote werden meist von gemeinnützigen, in Wohlfahrtsverbänden organisierten Vereinen, zum Teil aber auch von privatwirtschaftlich orientierten Trägern, durchgeführt. Diese Form der sogenannten Eingliederungshilfe wird größtenteils über die Sozialhilfe finanziert, insofern die betreffende Person kein eigenes Vermögen aufbringen kann. Eine zentrale Säule ist hier der Bereich ›Hilfe zum Wohnen‹. In Berlin etwa wurden zwischen 1993 und 2001 2.500 Klinikbetten abgebaut und gleichzeitig 2.800 Plätze im Wohnbereich etabliert – mittlerweile wurden noch zahlreiche weitere Wohnplätze geschaffen (vgl. Vock et al. 2007: 16, 41). Neben dem Wohnbereich wurden Angebote im Bereich Hilfen bei der Tagesstrukturierung, Beratung und Kontaktstiftung etabliert. Entsprechend bieten Kontakt- und Beratungsstellen (KBSen) und Tagesstätten Gruppen- und Sportangebote, Ausflüge, Selbsthilfegruppen und beratende Einzelgespräche an. Die KBSen stehen prinzipiell allen Interessierten offen und sollen entsprechend des gemeindepsychiatrischen Konzeptes auch den Dialog und die Kontaktfindung mit Nicht-Psychiatrisierten ermöglichen – in der Regel finden sich dort dennoch vorwiegend oder ausschließlich Psychiatriebetroffene ein. Die KBS-Klient_innen werden oft auch gezielt an weitere Einrichtungen wie Sucht-, Schuldner- oder Familienberatungsstellen weitervermittelt.
Laut Studien nehmen mindestens 75% der befragten gemeindepsychiatrischen Klient_innen Psychopharmaka ein (vgl. Russo 2012: 126). Oft ist die Medikamenteneinnahme Voraussetzung, um das entsprechende Angebot zu erhalten. Klient_innen, die sich verweigern, wird mit Rauswurf gedroht. Auch jenseits des Drucks Psychopharmaka einzunehmen, werden die Betroffenen mehr oder weniger eng sozialarbeiterisch kontrolliert und, vermittelt durch Rehabilitationspläne, Hausordnungen und Einzelkontakte, starken normativen Anforderungen hinsichtlich Tagesstruktur, Habitus und Hygiene unterworfen. Wichtiges Ziel ist dabei die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, die durch Gutachten verschiedener Institutionen, darunter Jobcenter, Krankenkassen und Rentenversicherungen, geprüft werden kann. Je nach Diagnose stehen den Betroffenen verschiedene Arbeitsmöglichkeiten zur Auswahl: von Beschäftigungstagesstätten über stundenweisen Zuverdienst und Werkstätten für behinderte Menschen hin zu Integrationsfirmen. Allein die Zahl der Personen, die mit einer psychiatrischen Diagnose in Werkstätten tätig sind, ist zwischen 2005 und 2010 von ca. 32.000 auf ca. 43.000 gestiegen (vgl. Arbeitsgruppe Psychiatrie der Obersten Landesgesundheitsbehörden 2012: 40). Mit dem Integrationsfachdienst besteht eine eigene Einrichtung, welche gezielt die sogenannte Teilhabe von Menschen mit ›körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen‹ am Arbeitsmarkt unterstützen soll. Auch die Politik fordert verstärkt die berufliche Integration, exemplarisch etwa die Landesgesundheitsministerien in einem gemeinsamen Statement: »Das Prinzip Rehabilitation vor Rente wird bei psychisch kranken Menschen eindeutig nicht umgesetzt. […] Ziel muss es sein, die Frühverrentungen zu vermindern.« (Arbeitsgruppe Psychiatrie der Obersten Landesgesundheitsbehörden 2007: 48) Dennoch schaffen viele nicht mehr die Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt oder beantragen nach einer längeren Phase der Krankschreibung Erwerbsunfähigkeitsrente – häufig massiv gedrängt von den Krankenkassen oder den Jobcentern, welche die aus ihrer Sicht kostenintensive Klientel an die Rentenversicherung weiterreichen. Im Jahr 2011 waren 41% der frühzeitigen Verrentungen durch eine psychiatrische Diagnose begründet (24% im Jahr 2000). Damit gelten psychische Ursachen derzeit als Hauptgrund für Frühverrentung (vgl. Deutsches Ärzteblatt 2013).
Gesetzliche Betreuung und ambulante Versorgung: die Psychiatrie zu Hause
Viele der Personen, die im gemeindepsychiatrischen Bereich eingetaktet oder in Heimen untergebracht sind, stehen unter einer gesetzlichen Betreuung. Dieses juristische Instrument wurde 1992 eingeführt und hat das bis dahin bestehende Vormundschaftsmodell abgelöst – laut Bundesregierung wurde dadurch Entmündigung zugunsten von Schutz, Fürsorge und größtmöglicher Selbstbestimmung überwunden (vgl. Bundesministerium der Justiz 2013: 4). De facto steigt die Zahl der Betreuungen seit Jahren stark an; von 1995 bis 2008 hat sie sich in etwa verdoppelt, sodass heute etwa 1,3 Millionen Betreuungen eingerichtet sind.7 Nach meiner Schätzung stehen davon mindestens 300.000 Menschen aufgrund einer psychiatrischen Diagnose unter Betreuung und müssen massive Eingriffe in ihre Autonomie hinnehmen. Je nach Aufgabenkreis der Betreuung sind keine eigenständigen Vertragsabschlüsse mehr möglich bis hin zur Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf die Betreuer_innen – also des juristischen Wegs, über den Betreuer_innen klinische Zwangseinweisungen und -behandlungen einleiten können. Die Berufsbetreuer_innen haben dabei sehr selten direkten Kontakt mit den Betreuten, im Durchschnitt einmal pro Quartal. In dringenden Situationen sind sie oft nicht erreichbar. Zudem besteht ein doppeltes Jedermensch-Recht: jede_r Bürger_in kann Gesetzliche_r Betreuer_in werden, da eine besondere berufliche Ausbildung nicht verlangt wird. Zugleich kann jede_r Bürger_in für jede_n andere_n eine Betreuung bei Gericht anregen. Letzteres wird neben Ämtern vor allem von Angehörigen, Nachbar_innen und Wohnungsbaugesellschaften genutzt.
Die Zahl der niedergelassenen Psychiater_innen hat sich seit den 1970er Jahren verfünffacht auf mehr als 5.000, die etwa zwei Millionen ›Fälle‹ pro Quartal behandeln (vgl. Schneider/Falkai/Maier 2011: 42f.). Die Psychiater_innen sind – neben den Hausärzt_innen – eine wichtige Anlaufstelle für den Eintritt in das psychiatrische System, sie übernehmen quasi eine Filterrolle und sind oft auch für Einweisungen in die Klinik verantwortlich. Psychiater_innen werden aus ihrer Sicht mit einer relativ geringen Pauschale pro Person vergütet, sodass sie kaum Zeit für Gespräche einräumen, sondern sich vorwiegend auf die Vergabe der Psychopharmaka konzentrieren. Das entspricht ihrer Qualifikation: nach dem Medizinstudium absolvieren Psychiater_innen eine Facharztausbildung und sind auch organisatorisch in die ärztlichen Berufsverbände eingebunden. Medikamente werden von ihnen in der Regel als unverzichtbar und als unbedingte Voraussetzung für einen weiteren Behandlungsprozess legitimiert, viele Psychiater_innen machen sie sogar für eine ›Humanisierung der Psychiatrie‹ verantwortlich: »Die sozialpsychiatrischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte basieren auf der Wirksamkeit der Psychopharmaka.« (Möller/Laux/Kapfhammer 2005: 468) Die Erfindung der Depotspritze, über die Psychopharmaka einige Wochen im Körper verbleiben, machte die quasi lückenlose Kontrolle der Medikamenteneinnahme auch bei Menschen möglich, die sich außerhalb stationärer Settings bewegen. Entsprechend stark ist die Anzahl der verordneten Medikamente gestiegen; Matthias Seibt spricht von einer Vervierfachung der Verschreibungen seit der Psychiatrie-Enquête (vgl. Seibt 2000). Insbesondere der Anstieg der Neuroleptika-Vergabe bei Kindern und Jugendlichen mit Steigerungsraten von 40% innerhalb der letzten Jahre ist auffällig und hat auch für Schlagzeilen in der bürgerlichen Presse gesorgt.8
Neben den Psychiater_innen behandeln ca. 15.000 bis 20.000 ambulante Psychotherapeut_innen etwa 500.000 Personen pro Quartal – 1975 waren es noch ca. 1.500 Therapeut_innen. Menschen mit sogenannten ›schweren psychischen Störungen‹ werden allerdings meist von den Therapeut_innen abgelehnt und Angehörige der Unterschichten haben kaum Zugang zur ambulanten Psychotherapie, sodass es sich vorwiegend um ein mittelschichtsorientiertes Angebot handelt (vgl. Bühring 2001, Deutscher Bundestag 1975: 6).
Psychiatrische Gremien und Sozialpsychiatrischer Dienst: die Psychiatrie wird gemanagt
Angestoßen durch die Psychiatrie-Enquête wurden von den Kommunen flächendeckend Sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet, die bei den Gesundheitsämtern angesiedelt sind. Zu ihren Aufgaben gehören die aufsuchende Krisenintervention,9 die auf den Einzelfall bezogene Steuerung der jeweiligen Maßnahmen und die Begutachtung, auch im Auftrag weiterer Ämter, wie etwa der JobCenter und der Rentenversicherung. Zudem reguliert der Sozialpsychiatrische Dienst (SpD) gemeinsam mit dem Sozialamt im Rahmen des sogenannten Fallmanagements die Vergabe von Leistungen im Anschluss an Klinikaufenthalte, koordiniert also die Zuweisungen der Betroffenen im gemeindepsychiatrischen Bereich und kontrolliert deren Entwicklung anhand eines zeitlich durchgetakteten Behandlungsplans. Ursprünglich war der SpD als niedrigschwellige, primär beratende Anlaufstelle für die gesamte Bevölkerung gedacht. Tatsächlich hat er sich jedoch zu einer staatlichen Agentur10 entwickelt, die einerseits die ›Klient_innen‹ durch das (gemeinde-)psychiatrische System delegiert, andererseits abweichendes Verhalten außerhalb der psychiatrischen Versorgung registriert und umfassend dokumentiert. Meist reagiert der SpD hierauf mit Kontrolle und Repression. Nicht umsonst gehört zu seinen Befugnissen die Veranlassung von Zwangseinweisungen. Gerade in Zeiten niedrigen Personalstands bei der öffentlichen Verwaltung und damit verringerter Ressourcen der Ämter sich beratend dem ›Einzelfall‹ zuzuwenden, wird von dieser Option rege Gebrauch gemacht.
Immer wieder wird von reformorientierten Versorgungsforscher_innen die Sektorierung des deutschen Systems beklagt, die aufgrund der zahlreichen Akteure und der zersplitterten Finanzierung durch verschiedene Kostenträger, von Krankenkassen über die Rentenversicherung hin zum Jugend- und Sozialamt, besonders hohe Abstimmung erfordere. Jenseits der individuellen Behandlungsplanung existieren daher zahlreiche Strukturen zur Planung der administrativen und der Angebotsebene. Die hochverdichtete Gremienlandschaft zeigt die Dimensionen des psychiatrischen Feldes mitsamt seiner ausdifferenzierten Teilbereiche und angrenzenden Gebiete an – aber auch die politischen und fachlichen Koordinierungsleistungen, die zu erbringen sind in einer Gesellschaft, in der zunächst jede Einrichtung konkurrenzförmig nur für sich selbst arbeitet. Allein in Berlin arbeiten mehr als 200 psychiatrische Gremien. Die Spannbreite reicht von den Psychiatriekoordinator_innen der Bezirke, welche die gemeindepsychiatrische Versorgung steuern, über Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften, in denen alle Versorgungsakteure zusammenarbeiten sollen, hin zu den Psychiatriebeiräten der Bezirke und des Landes, welche die jeweiligen gesundheitspolitischen Entscheidungsträger_innen beraten. Die Gremien überwachen sowohl die Inanspruchnahme und Finanzierung der Angebote als auch die Frage, ob Bedarf an weiteren Angeboten besteht und gegebenenfalls neuartige Angebotstypen für bestimmte identifizierte Bevölkerungsgruppen (etwa Migrant_innen, Wohnungslose, Schwangere in Krisensituationen) geschaffen werden sollten. In die Gremien sind mittlerweile häufig im Sinne des sogenannten Trialogs einzelne ›politikfähige‹ Vertreter_innen von Betroffenen- und Angehörigenverbänden einbezogen; sie stehen allerdings einer Überzahl an Professionellen gegenüber und müssen sich zudem der Eigenlogik von planerisch-gestaltenden Institutionen im bestehenden System fügen.
Kontrolle – Zwang – Bürokratie: gegen die neue Psychiatrie
Dem sozialpsychiatrischen Reformprojekt wurde vor allem in den 1980ern mit grundsätzlicher Kritik begegnet. Psychiatriekritiker_innen zeigten sich teils enttäuscht, dass statt eines gesellschaftlichen ein medizinischer Krankheitsbegriff fortgeschrieben und anstelle von Selbstorganisation der Betroffenen die Professionellen-Herrschaft prolongiert worden sei. Die Gemeindenähe sei lediglich technokratisch – anhand statistischer Kennzahlen zur durchschnittlichen Entfernung von Wohnsitz und Einrichtung – umgesetzt worden. Die von der Psychiatriereform ventilierte Fiktion der Gemeinde als heilendem sozialen Netzwerk und autonomem Lebensraum widerspreche der tatsächlich stattfindenden Vereinzelung und dem Zerfall der nachbarschaftlichen Beziehungen (vgl. Zurek 1991: 244f.). Betont wurde insbesondere der Kontrollaspekt der reformierten Psychiatrie. So schrieb die Blaue Karawane Bremen, die seit 1985 mit künstlerischen Aktionen für die Auflösung der Kliniken eintrat:
Die sogenannte gemeindenahe Psychiatrie mit ihrem komplexen Versorgungssystem mit Heimen und sozialpsychiatrischen Diensten hatte nicht den mündigen psychisch kranken Bürger geschaffen und auch nicht die Strukturen, die dazu verhelfen könnten; sie hatte eher weitergreifende Instrumente der Reglementierung geschaffen im Sinne des alten Auftrags der Psychiatrie – aber jetzt moderner, eleganter, nutzbarer. (Die Blaue Karawane o.J.)
Auch das Forum Anti-Psychiatrischer Initiativen hielt fest: »Gemeindenahe Psychiatrie führt zur totalen Kontrolle der Betroffenen, zur Psychiatrisierung der Gesellschaft und erwiesenermaßen zum Anstieg von Zwangsunterbringungen.« (Forum Anti-Psychiatrischer Initiativen 1990) Heiner Keupp, damals noch kritischer Sozialpsychologe, führte die ausgeweiteten Kontrolltendenzen auf eine falsche Prioritätensetzung der Psychiatriereform in Deutschland zurück, die im Gegensatz zu Italien nie auf eine Überwindung der Anstalt hingewirkt hätte. Lag in Deutschland der Akzent auf der Installation einer gemeindebezogenen Versorgung von oben, wurde in Italien ein prinzipieller Reformansatz umgesetzt, der sich die Auflösung aller psychiatrischen Kliniken zum Ziel setzte und »verhindern sollte, die Logik der Anstalt ins Territorium zu transportieren« (Battiston/Bonn/Borghi 1983: 243). Die hiesige Bewegung hat sich laut Keupp nur für eine bessere Versorgung, nicht aber für die Befreiung der Betroffenen eingesetzt:
Es wurde versucht, den Versorgungspol der Psychiatrie zu stärken und dadurch den Kontrollplan zurückzudrängen. Der Doppelcharakter von Hilfe und Kontrolle, der für die Psychiatrie von Beginn an konstitutiv ist, konnte dadurch nicht außer Kraft gesetzt werden. Umso weniger Ressourcen für eine angemessene Versorgung verfügbar sind, desto deutlicher zeichnet sich wieder die häßliche Fratze der Kontrolle ab. (Keupp 1987)
Entsprechend bilanzierte Keupp, dass die Anstalt gestärkt aus dem Modernisierungsprozess hervorgegangen sei. Von anderen Autor_innen wurde der bereits angedeutete Zusammenhang einer entfalteten psychiatrischen Angebotsstruktur und erhöhten Zahl von Zwangseinweisungen – ebenso wie gestiegener Psychopharmaka-Vergabe – kritisiert. Durch die zahlreichen ambulanten und beratenden Einrichtungen würden mehr Menschen diagnostiziert und in das System einbezogen: »Die Schwelle zur Psychiatrisierung sinkt.« (Lehmann 1989) In der Kritik stand auch, dass in den neuartigen Versorgungsstrukturen keine tatsächliche Unterstützung, sondern vor allem eine paternalistische Behandlung und Verwahrung der Nutzer_innen geleistet würde. Hans Luger, Mitarbeiter des antipsychiatrischen Projektes KommRum, verwies darüber hinaus auch auf die autoritäre Binnenstruktur und die bürokratische Verfasstheit der Gemeindepsychiatrie. Diese liege meist in der Hand des Öffentlichen Gesundheitsdienstes oder freier Träger der Wohlfahrtspflege:
Die ›psychosoziale Versorgung‹ ist eine eigene fiktive Welt aus ›Betten‹ und ›Plätzen‹, aus Tagessätzen und Paragraphen, aus Akten, Anträgen, Bewilligungen, Berichten, aus politischen Strategien und Bündnissen, aus Gremien und Mauscheleien auf den Fluren. Die konkrete Wirklichkeit derer, ›für die‹ das alles geschaffen wird, […] ist herausgefiltert, weggekürzt. (Luger 1990: 117f.)
Aus der Rationalisierung und Bürokratisierung ergäbe sich für die Betroffenen ein Mangel an einem konkreten Gegenüber, an dem sich Konflikte austragen ließen, und damit eine subtile Entmündigung und politische Passivierung der Betroffenen. Gerade die vielen engagierten und verständigen Mitarbeiter_innen, »die halt leider nicht anders können«, lähmten potenziellen Widerstand:
Das ist das Heimtückische an diesen bürokratischen Hürden: Es ist kein persönlicher Feind mehr sichtbar, kein Unterdrücker, den man wenigstens noch hassen könnte, wie etwa sadistische Ärzte oder Pfleger […] Das persönliche Gefühl der Ohnmacht entwickelt sich entlang der Sachzwänge. (ebd.: 119)
Viele der oben genannten Kritikpunkte sind in den »Thesen zur Abschaffung und Überwindung der Psychiatrie« der Bundesarbeitsgemeinschaft Soziales und Gesundheit der Grünen gebündelt, die unter Mitwirkung von Vertreter_innen der antipsychiatrischen Bewegung entstanden. Auch hier wird eine Stärkung der Klinik konstatiert, da »sie durch gemeindenahe Einrichtungen den Druck der Lagerathmosphäre mindern konnte [und] weil sie nun inmitten einer Vielzahl sozialpsychiatrischer Institutionen mit ihrer Drehtür den Rhythmus des Kreislaufs der Irren bestimmen kann« (Die Grünen 1984: 5). Das neue psychiatrische System sei damit gefährlicher als zuvor, denn es »ist flexibel, hochselektiv, undurchsichtig. Es funktioniert als Frühwarnsystem von Krisen, ohne daß es frühzeitig hilft« (ebd.: 5f.). Die Sozialpsychiatrie habe statt leicht zugänglicher Dienstleistungen für Menschen in Not spezialisierte, expertengeleitete, entmündigende und entpolitisierende Institutionen etabliert. Statt Wohnungen würden Therapeutische Wohngemeinschaften geschaffen: »Sozialpsychiatrische Institutionen übernehmen die Probleme der Leute und verwalten sie, statt daß sie eine Öffentlichkeit dafür schaffen und die Gemeinde zur Auseinandersetzung zwingen.« (ebd.: 6) So radikal und treffend die versammelte Kritik erscheint, waren sich die angeführten Kritiker_innen mit ihren Gegner_innen aus den Reihen der Psychiatriereform doch meist einig, auf Bürger- oder Menschenrechte zu pochen und Teilhabemöglichkeiten – wenn auch unterschiedlich ausbuchstabiert – einzufordern. Die Grünen etwa forderten »Erwerbsmöglichkeiten in kooperativ organisierten Projekten sowie in ›normalen‹ Lohnarbeitsverhältnissen«. Den »Herrschaftscharakter psychiatrisch-therapeutischer Hilfen« wollten sie ausgerechnet damit angehen, indem die »Vorhaltepflicht für therapeutische und betreuende Dienste […] bei der Kommune zu liegen« (ebd.: 8) habe. Ob damit wirklich die versprochene Abschaffung und Überwindung der Psychiatrie erreicht worden wäre?
Viele Facetten dieser aus den 1980er Jahren stammenden Kritik sind heute, nicht zuletzt aufgrund des Schwindens der antipsychiatrischen Bewegung und der allgemeinen Schwäche der Linken, kaum noch vernehmbar. Die wenigen verbliebenen antipsychiatrischen Initiativen beschränken sich meist auf die moralische Skandalisierung der unmittelbar evidenten Repression und des Zwangs in der Klinik in Form von Einweisung, Medikamentierung und Fixierung. Den Wandel der Versorgungslandschaft und des gesellschaftlichen Kontextes thematisieren sie kaum. Wie aber lässt sich das psychiatrische System heute, knapp 40 Jahre nach der Enquête, adäquat kritisieren?
Psychiatrie heute: viele Eingänge, kein Ausgang?
Die Psychiatrie in Deutschland hat sich seit den 1970er Jahren nach Fachgebieten und Behandlungsformen ausdifferenziert, die Zahl der psychiatrischen Institutionen hat sich mehr als verdoppelt. Zahlreiche kleinere, an bestimmte Diagnosen, Zielgruppen, Lebenswelten angepasste Einrichtungen sind entstanden: anstelle einer De- fand eine Transinstitutionalisierung statt. Die nun ins allgemeine Gesundheitswesen integrierte Klinik bleibt im Zentrum des Systems, wird aber zur Akutpsychiatrie transformiert und soll primär der Krisenintervention dienen: die ›Kranken‹ werden nicht mehr zeitlebens weggesperrt, sondern sollen ›aktiv mitwirken‹ an ihrer eigenen, möglichst schnellen ›Genesung‹, indem sie den Prozess der medizinisch-diagnostischen (Selbst-) Verdinglichung widerspruchslos akzeptieren. Die Drohung des psychiatrischen Souveräns mit dem jederzeit abrufbaren klinischen Ausnahmezustand – Einweisung, Fixierung, bloßer Zwang – schwebt über allen Betroffenen des psychiatrischen und psychosozialen Systems. Aufgrund der klinischen Liegezeiten findet die dauerhafte Verwahrung der Aussortierten und Unnützen nun vorwiegend in Heimen inner- und außerhalb des eigentlichen psychiatrischen Gebietes oder in der Forensik statt. Zugleich hat sich die Gemeindepsychiatrie für die Klient_innen zur Psychiatriegemeinde mit meist langen Betreuungszeiten entwickelt. Trotz der kontinuierlichen Schaffung neuer, angeblich klientenzentrierter Leistungstypen – Betreutes Einzelwohnen für Autist_innen hier, Krisenintervention bei schwangeren Migrant_innen dort – wirkt sie normierend, hospitalisierend und paternalistisch: »[E]ine Transformation der Umstände der Entmündigung [hat sich] vollzogen, von der entrechtlichten zur verrechtlichten, auf einem Vertragsabschluß beruhenden Entmündigung.« (Hellerich 1988: 59) Der Sozialpsychiatrische Dienst registriert als staatlich-psychiatrisches Auge und Ohr präventiv Abweichungen und steuert mit weiteren Behörden und Gremien den gemeindepsychiatrischen Sektor; die gesetzlichen Betreuer_innen verwalten die Psychiatrisierten, die nicht mehr gesellschaftsfähig sind. Vorwiegend für sogenannte leichte und mittelschwere Fälle wird eine sich ausweitende Palette von ambulanten Psychotherapien angeboten, die sanfte psychologische Anpassung verheißen. Zugleich wurden auch die stationären psychiatrischen Settings durch die Anstellung von Therapeut_innen zunehmend psychologisiert, das heißt ein psychiatrischer Zugriff auf zuvor private Emotionen und Verhaltensweisen erschlossen. Aus dem Wunsch nach Alleinsein wird nun eine pathologische, zu behebende Kontaktschwäche, aus Nicht-Mitmachen eine manifeste, zu therapierende Hemmung etc. Franco Basaglia kritisiert diesen therapeutischen Prozess als »politische[n] Akt der Integration, insofern als er versucht, eine bestehende Krise – regressiv – wieder zurechtzubiegen, indem er letztlich das hinnehmen lässt, was die Krise überhaupt erst verursacht hat« (Basaglia 1971: 138). Nicht zuletzt aufgrund der quantitativen und qualitativen Ausweitung der psychiatrischen Diagnosen schreitet die Medikalisierung der Gesellschaft11 hin zur Bedarfsmedikation für alle voran. Gefühlszustände, die im Fordismus noch als normal galten, werden »als ›krank‹ und ›behandlungsbedürftig‹ einem umfassenden pharmazeutisch-therapeutischen Normalisierungsregime« (Graefe 2011) unterworfen. Die Pharmakolisierung bedeutet dabei die »absolute Verdinglichung des Patienten, die krasseste Form der Behandlung einer Sache« (Hellerich 1988: 65) – Symptome werden nicht erfasst, um sie zu verstehen, sondern allein, um sie chemisch zu beseitigen.
Entsprechend der Forderung der Enquête, den Blick »von den Kranken auf die viel größere Zahl der Gesunden und möglicherweise Gefährdeten [zu] richten und […] vom Einzelindividuum […] auf ganze Gruppen und Bevölkerungsteile, bis hin auf die Gesellschaft als Ganzes« (Deutscher Bundestag 1975: 385), wurde ein neuartiges psychiatrisch-therapeutisches Präventionsregime erschaffen. Zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung hätten im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige ›psychische Krankheit‹, verlautbaren Politik und Gesundheitswesen unisono. Staatlicherseits werden daher – neben den schon erwähnten Sozialpsychiatrischen Diensten und vorgelagerten Beratungsstellen – Kampagnen unter dem Motto ›Vorbeugen statt heilen‹ aufgelegt. Tatsächlich geht es weniger um eine vorbeugende Verbesserung der Lebensumstände, sondern mehr um das Registrieren einer Prä-Devianz. Schon ›Anzeichen einer Störung‹ können zu sozialpsychiatrischen Begutachtungen und weiteren Eingriffen führen, die von einer Antragsstellung der Betroffenen unabhängig sind: Prävention erhält damit den Status einer »Zuführungsfunktion zum vorhandenen Versorgungssystem« (Reichel 1983: 99). Diagnosenspezifische Kompetenznetze schulen Hausärzt_innen, Altenpfleger_innen, Lehrer_innen und Betriebsräte und animieren sie, Auffällige in Früherkennungszentren zu überweisen. Durch Hirnforschung und Humangenetik weitet sich Prävention auf Potentialitäten aus, die angeblich im Körper jeder Einzelnen schlummern können. Die Psychiatrie ist damit aus dem gesellschaftlichen Schattendasein der alten Anstalt getreten, zu Teilen enttabuisiert und weit in die soziale und geografische Mitte gerückt, und zwar »vom Paradigma der Internierung zum allgemeinen Interventionismus« (Castel 1983: 308). Anstatt einer Minderheit von ›Verrückten‹ steht die ganze Bevölkerung, segregiert in einzelne Risikopopulationen, im Fokus. Zusätzlich zu dem ärztlich dominierten Panoptikum der Klinik und des Heims hat sich ein multiinstitutionelles und interdisziplinäres Kontrollregime entwickelt, das in den gemeindepsychiatrisch durchdrungenen Sozialraum – den Stadtteil, die Nachbarschaft, den Betrieb und die Familie – ausgreift. Wenn es auch vorwiegend Sozialarbeiter_innen, (Haus-)Ärzt_innen und Pädagog_innen sind, die für die Frühregistrierung und die Nachsorge zuständig sind, so kann doch jede_r Bürger_in zur potentiellen psychiatrischen Zuträger_in werden – sei es durch eine Mail an den Sozialpsychiatrischen Dienst, durch die Anregung einer Betreuung oder einen Anruf bei der Polizei.
Auch auf der Ebene der psychiatrischen Strukturen selbst hat eine scheinbare Öffnung stattgefunden: unter den Schlagwörtern des Trialogs und der Partizipation werden Betroffene und Angehörige in Gremien einbezogen, sogenannte Patientenorientierung gilt als »zentraler Unternehmenswert« (Kohler 2013) und Inklusion wird »große volkswirtschaftliche Bedeutung« (Wagner 2013) beigemessen. Betroffene werden als Genesungsbegleiter_innen in manchen Kliniken angestellt als Vorbild für jene, die krisenbedingt von der Norm abfallen und, wie es eine Sozialpsychiaterin formuliert, zum »tieferen Verständnis für […] psychische Krankheit« (Amering 2013). Sie dienen damit lediglich als kostengünstiges Add-On, an den psychiatrischen Strukturen und Zielen ändert sich nichts Grundlegendes. Eine Opposition gegen ein solchermaßen integratives System, das sich sogar kompatible Teile des Wissens und der Erfahrungen Betroffener zu eigen macht, fällt offenbar schwer. So stellt sich die früher mitunter radikale Selbsthilfe-Bewegung stark entpolitisiert dar, weite Teile sind – gefördert durch die Reformpsychiatrie und die Pharma-Industrie – in nach Diagnosen spezifizierten und professionell angeleiteten Gruppen geendet.
Der massiv erweiterte Anspruch der reformierten Psychiatrie ›abgestimmte Versorgungspfade‹ zu bahnen und ›Versorgungslücken‹ zu vermeiden, bildet sich nirgends so deutlich ab wie in der häufig gebrauchten Metapher des psychiatrischen Netzes, durch das niemand fallen soll. Gerhard Mutz schreibt dazu: »[D]ie Kontrollinstanzen werden verlängert und das Netz der sozialen Kontrolle erweist sich als engmaschiger, da es bereits in alltäglichen Lebensbereichen wirksam wird, die bisher durch die Ideologie der Normalität vor staatlichen Kontrollmaßnahmen relativ geschützt waren.« (Mutz 1983: 263f.) Die Kontrollfunktionen wurden so verfeinert, dass die geschmeidigen psychiatrischen Strukturen eine »enge Verbindung mit dem sozialen Leben der Devianten« (Hellerich 1985: 161, zit. n. Balz/Bräunling/Walther 2002: 4) eingehen. Die Konsequenzen für Betroffene in der Gemeindepsychiatrie beschreibt Hannelore Klafki: »Einmal im psychosozialen Netz gefangen, gibt es so für die meisten Menschen kein Entkommen mehr. Was ursprünglich ein Netz von Hilfeangeboten sein sollte, erweist sich auf Dauer als ein Netz, in dem Betroffene hängen bleiben.« (Klafki 2003) Das psychiatrische Netz umfasst gerade durch seine Sektorierung vielschichtige, aufeinander abgestimmte Komponenten, ganze Behandlungsketten, die je nach Subjekt und Lebenslage auf Freiwilligkeit oder Zwang, ambulante oder stationäre Settings, kurze oder lange Verweildauer angelegt sind. Integrative Maßnahmen der Gemeindepsychiatrie, die sogenannte





























