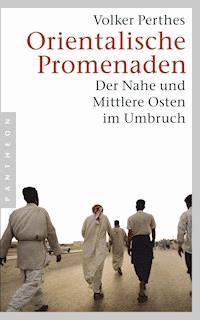5,99 €
5,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Nahostexperte Volker Perthes analysiert faktenreich Chancen und Probleme, Geschichte und Zukunft der arabischen Staaten.
Das E-Book Geheime Gärten wird angeboten von Siedler Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
geschichte,ebooks,afrika,regionalstudie,politik,wirtschaft,arabien,nordafrika,transformation,naherosten,konflikt,naher osten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Vorwort
Erster Teil - Der Nahe und Mittlere Osten erfindet sich neu
Elemente des Wandels Einleitung und Übersicht
Die arabische Welt und der Nahe Osten Neue Spielregeln, alte Politik?
Pragmatische Nationalstaaten
Copyright
Buch
Von außen betrachtet, erscheint die arabische Welt einerseits bedrohlich, andererseits eigentümlich statisch. Doch die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens wie Nordafrikas befinden sich in einer historischen Umbruchphase, auch wenn der arabisch-israelische Friedensprozess zu stagnieren scheint. Der Krieg um Kuwait wie der Friedensprozess im Nahen Osten haben die Beziehungen der Länder zueinander in Bewegung gebracht; es gibt neue weltwirtschaftliche Herausforderungen und Integrationsversuche, die die Region vor völlig neue Fragen stellen. Der Autor untersucht die Faktoren des Wandels in den wichtigsten arabischen Staaten. Er fragt dabei nach den Chancen der wirtschaftlichen wie der politischen Erneuerung. Fraglich bleibt, ob die neue Führungsgeneration in der Lage sein wird, innergesellschaftliche und zwischenstaatliche Konflikte erfolgreicher zu bewältigen als vorangegangene Generationen. Die Frage von Krieg und Frieden bleibt nicht nur nach außen hin virulent.
Autor
Volker Perthes, geboren 1958 in Homburg, Niederrhein, ist der Nahost-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. Der promovierte und habilitierte Politologe lehrte in Duisburg, Beirut, München und Berlin und ist ein viel gefragter Kommentator der Entwicklungen im Nahen Osten und in der arabischen Welt. Nach zahlreichen Veröffentlichungen zu Themen der Region erschien unter seiner Herausgeberschaft zuletzt das Buch »Deutsche Nahostpolitik: Interessen und Optionen« (2001).
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Erzwungene Erneuerung?
Der Untertitel dieses Buches - »die neue arabische Welt« - ist seit dem Irakkrieg von 2003 viel aktueller geworden, als er es ein Jahr zuvor zu sein schien, als die »Geheimen Gärten« in ihrer ersten Auflage auf den Markt kamen. Mehr denn je wird heute von Erneuerung, Reform oder Neuordnung der arabischen Staaten und Gesellschaften gesprochen, nicht zuletzt von amerikanischer Seite. Zu Beginn des Jahres 2004 war in Washington amtlich geworden, dass die offizielle Begründung des Irakkriegs durch die US-Administration - die angebliche Existenz einsatzfähiger irakischer Massenvernichtungswaffen - unkorrekt gewesen war. Selbst Außenminister Colin Powell gab in einem Interview zu, dass er nicht wisse, ob er zur Invasion in den Irak geraten hätte, wenn die Geheimdienste ihm damals, vor dem Krieg, gesagt hätten, was der oberste amerikanische Waffeninspekteur, David Kay, zum Abschluss seiner Tätigkeit feststellte: dass es die vermuteten Waffenbestände eben nicht gebe.1 Der Irakkrieg, so Powell und andere führende amerikanische Politiker, sei deshalb aber nicht falsch gewesen, schließlich sei der irakische Diktator gestürzt. Man redet zwar nicht mehr, wie vor dem Krieg, von Dominoeffekten - davon dass, wenn nur das Regime in Bagdad zu Fall gebracht wird, auch alle anderen Steine im Nahen und Mittleren Osten in eine bessere Ordnung fallen. Aber man hat ganz offenbar erkannt, dass es im Kampf gegen Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen nicht reicht, unfreundliche Regime militärisch zu bedrohen oder zu entfernen, dass vielmehr strukturelle Probleme angegangen werden müssen. US-Präsident George W. Bush hat dazu eine »Greater Middle East Initiative« angekündigt, mit der politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen in der arabischen Welt und anderen Staaten des weiteren Mittleren Ostens unterstützt werden sollen. Gleichzeitig neigen amerikanische Entscheidungsträger dazu, eine Reihe von bemerkenswerten Entwicklungen in der Region allein als Ergebnis ihres erfolgreichen Feldzugs zu betrachten - und dabei sowohl die nicht so erfolgreichen Resultate ihrer Besatzungspolitik im Irak, wie auch jene strukturellen, langfristig wirkenden Grundlagen der Erneuerung in der arabischen Welt zu übersehen, von denen dieses Buch in weiten Teilen handelt. Was also hat der Krieg tatsächlich ausgelöst? Und welche weiteren Entwicklungen regionaler Bedeutung sind darüber hinaus in den Staaten der arabischen Welt und des Nahen Ostens zu vermerken?
Eine geopolitische Revolution
Es steht außer Frage, dass der Irakkrieg und der Zusammenbruch des Regimes von Saddam Husein ein geopolitisches, möglicherweise auch ein politisches und sozio-kulturelles Erdbeben in der Region ausgelöst haben. Welthistorisch mag dieses Beben auf der gleichen Ebene einzuordnen sein wie der Fall der Berliner Mauer. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch: Der Sturz der ehemaligen kommunistischen Systeme wurde von den Völkern dieser Länder selbst herbeigeführt; das Regime in Bagdad wurde mit Hilfe amerikanischer Panzer von außen gestürzt. Man kann heute noch nicht beantworten, was dies für die politisch-kulturelle oder politisch-psychologische Entwicklung des Irak und der Region bedeutet. Man kann aber sicher sagen, dass es ein enorm wichtiger Faktor ist: Das Gefühl, sich nicht selbst befreit und nicht selbst grundlegende politische Veränderungen herbeigeführt zu haben, sondern diese Veränderungen von außen oktroyiert bekommen zu haben, wird zweifellos Auswirkungen auf die Haltung breiter Teile dieser Gesellschaften zum Staat, zur Politik, vielleicht auch zur Religion, und sicher auch zu den Beziehungen mit dem westlichen Ausland haben.
Mit Blick auf die geopolitischen Verhältnisse ist schon leichter zu sagen, was der Irakkrieg für die Region bedeutet, sind die unmittelbaren Ergebnisse doch relativ klar: Waren die USA bisher eine Macht, die im Nahen und Mittleren Osten Präsenz zeigte, so sind sie jetzt der stärkste Akteur vor Ort. Viele Gedankenspiele, die Politikwissenschaftler und Strategen vor allem in Form von Kräftevergleichen angestellt haben, in Statistiken etwa, über die Zahl irakischer und iranischer Raketen oder über die Balance von Panzern und Flugzeugen in den Arsenalen Syriens, Israels, Jordaniens und Ägyptens, sind weniger wichtig geworden, weil jetzt eine Militärmacht vorhanden ist, die alle anderen an militärischer und wirtschaftlicher Kraft weit übertrifft. »Unser Verhältnis zum Irak«, so wurde ein syrischer Funktionär zitiert, »ist heute nur noch ein Teil unserer bilateralen Beziehungen zu den USA.« Und in diesen Beziehungen sind die Kräfteverhältnisse eindeutig. Während die USA zum stärksten regionalen Spieler geworden sind, ist für die einzelnen regionalen Akteure die Situation eine grundsätzlich andere als vor dem Irakkrieg. Iran und auch Syrien fühlen sich von amerikanischen Basen oder amerikanischen Verbündeten eingekreist. Dies hat innenpolitische Auswirkungen, zumindest aber führt es zu neuen Debatten - etwa die auch von iranischen Konservativen mitgeführte Diskussion über die bilateralen Beziehungen zu den USA - und Unsicherheiten. Saudi-Arabien steht vor der Perspektive, seine regional-strategische Rolle einzubüßen. Schließlich haben die Amerikaner den größten Teil ihrer Truppen aus Saudi-Arabien abgezogen und einige Berater der Bush-Regierung haben zudem deutlich gemacht, dass sie in Saudi-Arabien weniger einen Partner als ein Problem, wenn nicht gar einen Feind sehen. Auch wenn das saudische Öl seine Bedeutung noch lange behalten wird, wird Riad an strategischer Bedeutung für die USA verlieren, wenn der Irak im amerikanischen Orbit verbleibt, sich stabilisiert und seine Ölproduktion mittelfristig und mit Hilfe amerikanischer Investitionen auf das zwei- bis dreifache der Vorkriegskapazitäten erhöht. Saudi-Arabien wäre dann nicht mehr der einzige wichtige prowestliche und verlässliche Ölproduzent, der im Zweifelsfall Produktionsausfälle anderer Staaten ausgleichen kann.
Auch Ägypten sieht, dass seine Führungsrolle in der Region ernsthaft beeinträchtigt ist. Bis vor kurzem reichte sein Einfluss noch bis an den Golf. Heute nimmt das Land eine nützliche Rolle ein, die sich auf die engere regionale Umgebung konzentriert, vor allem auf den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern. Am Golf oder im Irak hat der Einfluss hingegen nachgelassen. Auch die Arabische Liga, die ja im Wesentlichen ein ägyptisches Politikinstrument ist, hat weiter an Bedeutung verloren. Neue Konstellationen sind entstanden, und es wird deutlich, dass plötzlich so genannte »arabische Gipfel« zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten nur noch selektiv die Führer bestimmter arabischer Länder zusammenbringen, oder Außenministerkonferenzen nach anderen Kriterien als dem der Zugehörigkeit der Arabischen Liga einberufen werden - etwa Außenministerkonferenzen zwischen den Nachbarstaaten des Irak, zu denen dann auch die Türkei und Iran gehören, aber weder Ägypten noch die Maghrebstaaten. Ein von Kairo angestoßenes gemeinsames Arbeitspapier über die »Wiederbelebung der arabischen Zusammenarbeit und der Arabischen Liga«, das die Außenminister Ägyptens, Saudi-Arabiens und Syriens nach einem Treffen im August vorlegten,2 zeigt die Sorge dieser drei Staaten, die die Politik der Arabischen Liga in den neunziger Jahren dominierten, um die Zukunft der gesamtarabischen Institutionen.
Tatsächlich ist der Veränderungsdruck, unter dem die arabische Welt spätestens seit Beginn der 90er Jahre steht, mit dem Fall des Regimes in Bagdad spürbar gewachsen. In fast allen arabischen Ländern wurde plötzlich diskutiert, ob man nicht innenpolitisch nachziehen müsse, nachdem man den schnellen Zusammenbruch dieses Regimes erlebt hat, von dem die arabischen Führer und zum Teil auch die arabische Öffentlichkeit dachten, dass es Widerstand leisten und nicht wie ein Kartenhaus zusammenbrechen würde. Dies hat in manchen Ländern Fragen nach der eigenen innenpolitischen Konstitution aufgeworfen, die bisher noch unbeantwortet geblieben sind, aber alle auf die Notwendigkeit von politisch-institutionellen Reformen verweisen.
Was aber kann dazu beitragen diesen Veränderungsdruck tatsächlich in politisch-strukturelle Veränderungen umzusetzen? Der wissenschaftlich-analytische Blick muss sich auf zwei Ebenen richten.
Zum einen gilt es, die sozio-politischen und sozio-ökonomischen Entwicklungen in den einzelnen Ländern zu beachten. Dazu gehört das Heranwachsen einer neuen Generation in allen Ländern, die, wenn sich an den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen nicht rasch Wesentliches ändert, relativ chancenlos aus den Schulen und Universitäten hervorgeht. Dies wird im ersten Teil dieses Buchs ausführlich analysiert. Über viele der Phänomene, die dort behandelt werden - den ineffektiven Umgang mit dem Ölreichtum, die Probleme des Bildungssystems oder die autoritären Herrschaftsverhältnisse - sprechen mittlerweile auch zwei viel diskutierte Reports zur »menschlichen Entwicklung« in der arabischen Welt, die von kritischen arabischen Autoren unter der Ägide des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen verfasst wurden.3 Die zweite Ebene ist die der regionalen Politik. Hier wird die Frage, ob der gegenwärtige Reformdruck zu echten Reformen führt, vor allem davon beeinflusst werden, ob die amerikanische Besatzungsmacht, vielleicht auch die internationale Gemeinschaft, das »Experiment Irak« erfolgreich zu Ende bringen. Mindestens genauso wichtig bleibt jedoch, und dies übersieht amerikanische Politik allzu häufig, der Konflikt und der Friedensprozess zwischen Arabern und Israelis. Wenn es hier keine Fortschritte gibt, ist mit einer regionalen Erneuerung, die sich auf Demokratie und Reform gründet, auf kurze Zeit nicht zu rechnen.
Der Irak nach Saddam Husein
Der rasche Zusammenbruch des irakischen Regimes hätte eigentlich niemanden erstaunen sollen. Das Irak-Kapitel dieses Buches ist ein historisches geworden, das die politischen Verhältnisse unter Saddam Husein beschreibt. Es zeigt dabei, wie sehr das gestürzte Regime sich auf zwei Elemente stützte: auf enorme Repression oder Angst, wie Kanaan Makiya es genannt hat,4 und auf Patronage, also auf Parallelstrukturen, die sich durch Staat und Gesellschaft zogen und wichtige Elemente der Gesellschaft direkt mit der Schaltzentrale im Präsidentenpalast verbanden.5 Die eigentlichen Institutionen - auch in Huseins Irak gab es ein Parlament, eine Regierung und Ministerien - haben ohne ihre Parallelisierung durch Patronage und die Repressionsdrohung gegen diejenigen, die sich dem Willen der Macht widersetzten, nicht wirklich selbstständig funktioniert. Insofern sind diese Strukturen sehr schnell zusammengebrochen, als das Zentrum - Saddam Husein und seine Entourage - und die Befehlsstränge vom Zentrum in die Gesellschaft beschädigt waren. Das erleichterte den Sieg der amerikanisch-britischen Koalitionstruppen, stellte sie aber gleichzeitig vor ein Problem, mit dem die Kriegsplaner nicht gerechnet hatten. Anstatt nämlich eine geordnetes System zu übernehmen, erlebten sie den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und begünstigten dies auch noch durch eigene grobe Fehler.
Die amerikanisch geführte Zivilverwaltung des Irak (CPA) unter Paul Bremer hat viele der Fehler, die sie in den Monaten der Besatzung gemacht hat, als solche erkannt - darunter ganz vorn die Auflösung der gesamten Armee, die einige hunderttausend kampferprobte Soldaten in die Arbeitslosigkeit und sicherlich einige hundert in den bewaffneten Widerstand getrieben hat. Intern begann man ab Herbst 2003 in Kreisen des US-Militärs mittlerweile von »descending consent«, von abnehmender Zustimmung zur Besatzungsherrschaft, zu sprechen. Nicht, dass die meisten Iraker und Irakerinnen einen raschen Abzug der amerikanischen und alliierten Truppen wollten. Nur eine Minderheit war bereit, mit Guerillaaktionen gegen die amerikanischen, britischen oder andere alliierte Truppen zu kämpfen oder das Land zu terrorisieren, um die amerikanisch geführte Besatzungsmacht zu zermürben. Viele Iraker befürchteten auch, vermutlich zu Recht, dass ein Abzug der Amerikaner zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen führen würde. Die Verbitterung so vieler Iraker bezog sich eher auf die Praktiken der Besatzungsmacht als auf ihre Anwesenheit. Man verstand nicht, dass eine Industriemacht wie die USA über Monate nicht in der Lage war, die Elektrizitätsversorgung zu sichern und sah darin nicht selten eine bewusste Missachtung irakischer Bedürfnisse. »Ist dir aufgefallen,« fragte mich Anfang 2004 der ehemalige irakische UN-Botschafter, Muhammad al-Duri, »dass es in den Vierteln Bagdads, in denen die Stromversorgung funktioniert, auch fast keinen Widerstand gegen die Amerikaner gibt?«
Vor allem aber nahmen selbstbewusste Iraker den USA die »Zerschlagung staatlicher Strukturen und Symbole« übel, nicht zuletzt der Armee, die von der Mehrheit als Repräsentant nationaler Einheit, nicht als Agentur des alten Regimes gesehen wurde. Man kritisierte zudem, dass die amerikanische Armee zwar für ihre eigene Sicherheit Sorge trug, aber nicht ausreichend für die der irakischen Bevölkerung: Die Mordrate in Bagdad, um eine gruselige Statistik zu zitieren, lag im Jahr nach dem amerikanischen Einmarsch um das zweibis dreifache höher als in Washington.6
Zwar wuchs allem Anschein nach das Vertrauen der Bürger in die neue, von der Besatzungsmacht geschaffene und trainierte irakische Polizei. Was lokale Beobachter dem US-Militär jedoch vorwarfen, war, dass die neuen Polizisten als Kanonenfutter in die Auseinandersetzung mit terroristischen Gruppen geschickt würden. Das Fehlen von öffentlicher Sicherheit, schrieb Abd al-Latif Ali al-Miyah, ein Geschichtsprofessor an der Mustansariyya-Universität in Bagdad in einer Einschätzung der Lage im besetzten Irak, stelle die größte Sorge der irakischen Bevölkerung dar; es gebe zu viele Waffen, zu viele Milizen, zu viele Liquidationen, und die Besatzungsbehörden kümmerten sich nicht genug um die Wiederherstellung staatlicher Institutionen. Nicht wenige seiner Landsleute betrachteten deshalb Bemühungen zur Demokratisierung des Landes als »Luxus«.7 Miyah, ein Menschenrechtsaktivist, der die Husein-Diktatur überlebt hatte, sah das anders. Er warb auf zahlreichen Veranstaltungen und mit einer neu gegründeten Menschenrechtsorganisation für einen neuen, demokratischen Irak und legte sich dabei sowohl mit der Besatzungsmacht wie mit Anhängern des alten Regimes an. An einem Morgen im Januar 2004, auf dem Weg zur Arbeit, stoppten ihn acht vermummte Männer, zogen ihn aus dem Auto und exekutierten ihn.
Unabhängig von aller Kritik am Krieg und an den fadenscheinigen Begründungen, mit denen die Invasion gerechtfertigt wurde, stellt der Sturz des Husein-Regimes eine Befreiung dar. Am deutlichsten zeigte sich das im raschen Entstehen einer lebhaften Zivilgesellschaft - hunderter kleinerer und größerer Bürgergruppen, Zeitungen und Initiativen, die Gruppen eine Stimme gaben, die unter Saddam Husein keine hatten. Menschenrechte, die Aufarbeitung der Vergangenheit, und die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am »neuen« Irak standen dabei im Vordergrund. Die für Sommer 2004 in Aussicht gestellte Übergabe der Souveränität an eine wie auch immer bestimmte irakische Regierung löste eine Art Rückkehr der Politik aus: Nicht alles, was in diesem Zusammenhang stattfand, war erfreulich. Man konnte aber erleben, wie diverse politische und soziale Akteure im Irak begannen, sich im Schatten von Gewalt und Terror für das politische Spiel in einem in die Unabhängigkeit zurück entlassenen Irak zu positionieren - und im Streit miteinander wie mit der Besatzungsmacht das Gesicht eines neuen Irak zu prägen.
Dazu gehört, dass das Fehlen glaubwürdiger politischer Führungsgestalten religiöse Autoritäten zu einer Art Ersatzführern gemacht hatte. Dies gilt für alle Teile der Gesellschaft mit Ausnahme des kurdischen, wo die beiden großen Parteien, die KDP Masoud Barzanis und die PUK Jalal Talabanis, sich seit langem etabliert haben - erst im Kampf gegen das Husein-Regime, dann als Regierungsparteien der unter internationalem Schutz faktisch autonomen kurdischen Region. Im Rest des Landes wurde unter der Diktatur Saddam Huseins jegliche unabhängige politische Regung unterdrückt; Opposition organisierte sich entweder in kleinen klandestinen und immer wieder blutig dezimierten Gruppen oder im Exil. Nach dem Sturz des Regimes kamen deshalb neben tribalen Führern, deren Legitimation oft sehr zweifelhaft ist, vor allem schiitische und sunnitische Geistliche in die Rolle autoritativer Vertreter gesellschaftlicher Gruppeninteressen. In der schiitischen Bevölkerungsgruppe wurde Ayatollah Ali Sistani zur mit Abstand glaubwürdigsten und einflussreichsten Referenzperson. Bei den Sunniten ordneten sich die Dinge nicht so schnell; einzelne Imame bekannter Moscheen in Bagdad versuchten aber, sich als Sprecher für sunnitische Belange zu etablieren.
Diese Entwicklung begünstigte einen Trend zur Konfessionalisierung der Politik. Sistani galt dabei eben als Vertreter »der Schiiten«, obwohl schiitische Iraker und Irakerinnen sich ja keinesfalls sämtlich und in erster Linie über ihre konfessionielle Zugehörigkeit definieren. Die meisten Iraker verstehen sich, so man Umfragen trauen darf, tatsächlich als Iraker und zusätzlich auch als Araber oder Kurde, Sunnit, Schiit oder Christ. Unter sunnitischen Politikern begannen einige öffentlich in Frage zu stellen, dass die Schiiten tatsächlich eine Mehrheit in der Bevölkerung bildeten. Manche verwiesen sogar darauf, dass die Sunniten schon immer regiert hätten, der Irak also eigentlich ein sunnitisches Land sei.
In engem Zusammenhang mit dieser Neuformierung der innenpolitischen Landschaft standen zwei politische Konfliktthemen, deren Signifikanz auch über die irakischen Grenzen hinausreichte: die Frage, wie ein Übergangsparlament zu bestimmen sein würde, und die, wie föderal der neue Irak verfasst sein sollte. So akzeptieren die wichtigsten irakischen Gruppen zwar den Begriff »Föderalismus«, ließen dessen Inhalt aber ungeklärt, weil eine Klärung zu viel Konfliktstoff enthalten hätte. Die größte schiitische Partei erklärt etwa, sie sei sehr wohl für föderale Strukturen; Details aber könnten erst von einer gewählten verfassungsgebenden Versammlung bestimmt werden - in der man entscheidenden Einfluss, wenn nicht eine Mehrheit zu haben hoffe. Die großen kurdischen Parteien forderten und fordern einen föderal strukturierten Irak, denken dabei aber in erster Linie an ein weitgehend autonomes »Bundesland« Kurdistan, das zumindest die drei Provinzen Arbil, Sulaymania und Dohuk umfassen würde. Sunnitisch-arabische Politiker dachten entweder an eine Regelung, bei der alle 18 irakischen Provinzen gleichberechtigt zu Einheiten eines föderativen Staates erklären würden, oder lehnten föderale Lösungen ganz ab. In jedem Fall wollen sie keine kurdische Großprovinz, die, so ein Sprecher der sunnitischen »Shura«, einen ersten Schritt zur Teilung des Irak darstellen würde.
Tatsächlich wird die territoriale Einheit des Irak sich langfristig wohl nur mit einer föderalen Struktur bewahren lassen: Der Irak in seiner heutigen Form wird, so scheint es, föderal sein, oder wird nicht sein. Eine Rückkehr zum Zentralismus würde früher oder später zur Abspaltung der kurdischen Gebiete oder zu neuer Unterdrückung und Bürgerkrieg führen. Sinnvollerweise sollte dies ein Föderalismus werden, der gewachsene Zusammenhänge wie die der mehrheitlich kurdischen Provinzen im Norden des Landes berücksichtigt, sich aber gleichwohl auf gegebene administrative Strukturen, nicht auf ethnische Grenzen - und Abgrenzungen - gründet. Eine ethnische Grenzziehung zwischen irakischen Provinzen ist faktisch auch gar nicht möglich; die Hauptstadt Bagdad etwa ist zwar in ihrer großen Mehrheit arabisch, gleichzeitig aber auch die größte »kurdische« Stadt des Irak. Wichtig, um einen solchen Föderalismus mit Leben zu füllen, ist zudem, dass gerade kurdische Politiker sich nicht in erster Linie um ihre Provinz sorgen, sondern in Bagdad mitbestimmen: Dass der Irak, der eines der wichtigsten arabischen Länder bleiben wird, in der ersten Regierung nach Saddam Husein international wie auch in der Arabischen Liga von einem kurdischen Außenminister vertreten wurde, war ein gutes Zeichen für die Entwicklungsmöglichkeiten politischer Kultur im Irak und, vielleicht, in der arabischen Welt.
Die Auseinandersetzung um das Verfahren zur Wahl oder Auswahl eines Übergangsparlaments war ebenfalls von weiter reichender Bedeutung für die politische Kultur des Irak. Dabei trat die Besatzungsbehörde ursprünglich für ein einigermaßen kompliziertes, indirektes Auswahlverfahren ein, das ihr einen gewissen Einfluss auf die Zusammensetzung der Volksvertretung ermöglicht hätte. Zu ihrem Gegenspieler wurde Ayatollah Ali Sistani, dem es gelang, große Menschenmengen für seine Forderung nach allgemeinen und direkten Wahlen zu mobilisieren. Natürlich ging es bei dem Streit nicht nur um Verfahren oder Prinzipien, sondern wesentlich darum, wer und welche politischen Kräfte letztlich das Sagen in einer solchen Versammlung haben würden.
Der amerikanische Zivilverwalter im Irak, Paul Bremer, hatte durchaus einige gute Gründe für seine Skepsis gegen allzu rasche Wahlen, namentlich die instabile Lage und den Mangel an demokratischen Erfahrungen im Irak. Die Ironie der Situation lag jedoch darin, dass viele Iraker gerade die Amerikaner für die Instabilität verantwortlich machten, und dass sie, vielleicht auf Grund der mangelnden Demokratieerfahrung, Demokratie auch ganz simpel verstehen wollten - als das Recht, ihre Regierung selbst zu wählen. Angespornt, diese Recht auch einzufordern, wurden sie ausgerechnet von einem schiitischen Religionsgelehrten und von anderen Akteuren, die die USA herausforderten, indem sie deren politischen Diskurs übernahmen: Halte man, so fragen diese, die Iraker etwa für unfähig, selbst über ihr Schicksal zu bestimmen? Er, so ließ Ayatollah Sistani verlauten, habe die Forderung nach Wahlen übrigens nicht im Koran gefunden - sondern in einem Lehrbuch für Demokratie. Der Geistliche, dies galt es auch in Nachbarländern zu verstehen, hatte ganz offensichtlich verstanden, dass sich mit Theologie allein kein Staat machen lässt.
Nichts Neues im Nahen Osten?
Natürlich weiß auch die US-Regierung, dass die Eroberung Bagdads für eine Befriedung und Neuordnung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens nicht ausreicht. Der zentrale Konflikt der Region bleibt der arabisch-israelische und insbesondere der zwischen Israelis und Palästinensern. Die Auseinandersetzungen in Israel und den besetzten Gebieten verschärften sich seit der Wahl Ariel Sharons zum israelischen Ministerpräsidenten und erreichten 2002, mit wiederholten und zunehmend zerstörerischen israelischen Militäroperationen in palästinensischen Städten und einer wachsenden Zahl blutiger Selbstmordanschläge in Israel, ein zuvor nicht erreichtes Maß an Gewalt. Erst 2003 trat eine gewisse Beruhigung ein. Die palästinensische Führung und auch die ägyptische Regierung versuchten wiederholt, die radikalen Kräfte zu einem Waffenstillstand, mindestens jedoch zu einem Verzicht auf Anschläge auf israelische Zivilisten zu bewegen. Das gelang nie vollständig; aber auch bei diesen Gruppen - vor allem die islamistische Hamas und der kleine »Islamische Jihad« - begann man über Alternativen zum bewaffneten Kampf nachzudenken. Dazu kam die Hoffnung, dass mit dem Irakkrieg auch ein »Fenster der Gelegenheit« für den Nahen Osten geöffnet worden sei - und sei es nur, weil die Vereinigten Staaten ihre Macht in einer Weise demonstriert hatten, dass weder die Palästinenser und andere arabische Staaten noch Israel ernsthaften amerikanischen Druck, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und friedensgefährdende Aktivitäten zu unterlassen, ignorieren dürften.
Wer erwartet hatte, dass die US-Regierung diese Chance nutzen und sich nun vordringlich um eine Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts kümmern würde, sah sich getrogen. Die internationale Gemeinschaft in Form des so genannten »Quartetts« - USA, EU, Russland und Vereinte Nationen - legte einen Fahrplan zum Frieden im Nahen Osten vor, die so genannte road map, die deutlich erklärte, dass bis zum Jahr 2005 ein lebensfähiger palästinensischer Staat entstehen solle. Dies war zweifellos ein Fortschritt, und der internationale Druck reichte weit genug, um die palästinensische Autorität und die israelische Regierung zur Annahme des Plans zu bewegen, der beiden Seiten recht klare Verpflichtungen auferlegte: Israel, dessen Regierung dem Plan nur mit Einschränkungen zustimmte, sollte sich in einer ersten Phase etwa neu gebaute Siedlungen und Siedlungsaußenposten in den besetzten Gebieten räumen und seine Truppen dorthin zurückziehen, wo sie im Herbst 2000, vor dem Beginn der zweiten Intifada, standen; die Palästinenser sollten neben inneren Reformen vor allem die radikalen Organisationen entwaffnen. Doch Letzteres fand genauso wenig statt wie die verlangten israelischen Rückzüge. Vertreter des amerikanischen Außenministeriums kritisierten von Zeit zu Zeit die mangelnde Bereitschaft von Palästinensern und Israelis, der road map zu folgen. Sie ließen aber gleichzeitig durchblicken, dass ein intensives Engagement Washingtons, insbesondere Druck auf den Verbündeten Israel, zumindest im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 2004 nicht zu erwarten sei.
Wenn die Bedingungen für ein Zurück zum Friedensprozess sich dennoch graduell verbesserten, so liegt das an Entwicklungen in Israel und den palästinensischen Gebieten selbst. Beide Gesellschaften, die israelische wie die palästinensische, sind erschöpft, beide sehnen sich nach Normalität und Ruhe. Trotz Hass und gegenseitigem Misstrauen hat es auf beiden Seiten politische Entwicklungen gegeben, die zumindest auf mittlere Frist bedeutend sind. So wurden auf palästinensischer Seite nicht zuletzt unter europäischem Druck wesentliche Reformen durchgeführt, die eine »bessere Regierungsführung« garantieren sollen - vor allem das staatliche Finanzwesen wurde in Ordnung gebracht. Natürlich können solche Reformen ihren Sinn erst entfalten, wenn es auch einen Staat gibt, der zu regieren ist. Dies steht noch aus. Die Reformen sind gleichwohl wichtig: Sie verbessern die Chancen, einen lebensfähigen und legitimen Staat zu errichten, und sie haben der Palästinensischen Autorität eine neue internationale Akzeptanz verschafft, die sich auch in der Bereitschaft der US-Regierung zeigt, erstmals direkte finanzielle Zuschüsse an die palästinensische Regierung zu zahlen. Selbst Israel nahm die Überweisungen von Zolleinnahmen an die palästinensischen Behörden wieder auf.
Immer noch herrscht die paradoxe Situation, dass die Mehrheit beider Gesellschaften eine recht genaue Vorstellung von den Ergebnissen einer friedlichen Regelung hat, dass beide Seiten aber bezweifeln, dass die jeweils andere Seite überhaupt friedensfähig oder friedensbereit ist. Die von beiden Seiten erwartete Regelung beinhaltet zwei nebeneinander existierende Staaten, eine politische Teilung Jerusalems, eine Auflösung oder Übergabe der meisten jüdischen Siedlungen, einen begrenzten Gebietsaustausch und eine Regelung der Flüchtlingsfrage, die faktisch kaum eine Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge nach Israel beinhalten wird - die meisten palästinensischen Flüchtlinge sind sich dessen durchaus bewusst.
Auf dieser Grundlage bewegten sich auch die Initiatoren der so genannten »Genfer Intitiative« - eine Gruppe israelischer Politiker und Akademiker unter der Führung von Yossi Beilin und Yasser Abed Rabbo, zweier ehemaliger Minister und erfahrener Teilnehmer offizieller und inoffizieller israelisch-palästinensischer Verhandlungen. Die Gruppe erarbeitete in den Monaten nach dem Irakkrieg ein Abkommen oder richtiger, die Blaupause eines israelisch-palästinensischen Endstatusabkommens, das detaillierte Regelungen und Karten für die wichtigsten Streitpunkte enthielt: Jerusalem, die Zukunft der Siedlungen, Gebietsaustausch und Grenzziehung sowie die Flüchtlingsfrage.8 Selbstverständlich konnte ein solcher Text ein völkerrechtliches Abkommen nicht ersetzen; die Teilnehmer der Gespräche hatten schließlich kein offizielles Mandat. Insbesondere in Israel wurden die Mitglieder der Initiative deshalb auch heftig kritisiert; die Vorwürfe gegen Beilin reichten von der Anmaßung einer Rolle, die ihm nicht zustehe, bis hin zum Landesverrat. Die palästinensische Führung ließ eine sehr verhaltene Unterstützung erkennen, aber auch Yasir Arafat ließ sich nicht gern die Fäden aus der Hand nehmen. Tatsächlich hatten die Mitglieder der Initiative auch nicht behauptet, anstelle ihrer Regierungen verhandelt oder ein offizielles Abkommen geschlossen zu haben: Sie sahen sich, richtigerweise, als Vertreter der Zivilgesellschaften; sie wollten angesichts der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Führungsmannschaften, die Blockade des Friedensprozesses zu durchbrechen, ein Signal setzen und vor allem der Öffentlichkeit - der internationalen und der ihrer beiden Gesellschaften - deutlich machen, dass es auf beiden Seiten ernsthafte Partner gibt und dass nach wie vor realistische Möglichkeiten zur Konfliktlösung existieren. Dass die sehr konkreten Aussagen des »Genfer Abkommens« sich weitgehend an Präsident Clintons Vermittlungsvorschlag vom Dezember 2000 und den Ergebnissen der Taba-Verhandlungen vom Januar 2001 orientierten, die im Israel-Palästina Kapitel dieses Buches beschrieben werden, war nur natürlich. Wer eine beidseitig akzeptable Regelung erreichen will, wird an dem acquis dieser Vorschläge nicht vorbeikommen: dem Nebeneinander der Staaten Israel und Palästina, der Aufteilung Jerusalems, dem Abzug der Siedler und dem weitgehenden Verzicht auf die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge in das Staatsgebiet Israels.
Die israelische Regierung unter Ariel Sharon reagierte ablehnend und unverhältnismäßig scharf auf das »Genfer Abkommen«. So ließ der israelische Außenminister etwa den Schweizer Botschafter einbestellen, um dagegen zu protestieren, dass die Schweiz sich mit ihrer Unterstützung für die Initiative in »Israels innere Angelegenheiten eingemischt« habe. Die Schärfe des Protests mag als Ausdruck von Nervosität verstanden werden. Auch bei vielen der Israelis, die Sharon Anfang 2003 wiedergewählt hatten, wuchs die Erkenntnis, dass anhaltender militärischer Druck, die fortgesetzte Verarmung und Demütigung der palästinensischen Bevölkerung, die Zerstörung von Infrastruktur und von jenen quasi-staatlichen Strukturen, die von der Palästinensischen Autorität noch übrig waren, Israel weder Frieden noch Sicherheit brachten. Sharon selbst konnte kein Interesse daran haben, dass in dieser Situation der Eindruck entstehen würde, nicht er und seine Regierung, sondern nur eine Gruppe von Oppositionspolitikern und deren palästinensische Partner könnten Israel einen politischen Weg aus der Krise weisen.
Tatsächlich hatten auch bei Sharon und seinen Leuten im Likud erstaunliche, ja für israelische Politik fast revolutionäre politische Entwicklungen begonnen. Im Frühjahr 2003 nämlich bezeichnete mit Ariel Sharon erstmals ein Likud-Regierungschef die Herrschaft Israels über die Westbank und den Gazastreifen als »Okkupation«. Sharon sagte gleichzeitig, dass diese Besetzung »nicht gut für Israel« sei und dass das Land geteilt werden müsse.9 Dies war vor allem deshalb bemerkenswert, weil hier ein Likud-Ministerpräsident anerkannte, dass die Basis des Konflikts eine territoriale ist. In den folgenden Monaten verwiesen zudem einige von Sharons Freunden immer mal wieder auf den demographischen Faktor, darauf also, dass Israels Regierung in wenigen Jahren über eine nicht-jüdische Mehrheit herrschen werde, wenn Israel nicht in der Lage sei, sich von den Palästinensern zu trennen.
Sharon begann also, wie früher vor allem Politiker der Arbeitspartei, die »Trennung« von den Palästinensern auf seine Agenda zu setzen. Nur suchte er nicht die einvernehmliche Trennung durch eine Friedensvertrag - wie die Initiatoren des »Genfer Abkommens« sie vorzeichneten -, sondern eine territoriale Teilung zu Israels bzw. zu Sharons eigenen Bedingungen. In diesem Kontext steht der Bau der befestigten Trenn- oder Sperranlage, den die israelische Regierung seit Sommer 2003 vorantrieb - der Mauer, wie Palästinenser und andere Gegner der Anlage sagen, weil diese über Kilometer tatsächlich aus bis zu acht Meter hohen Mauerelementen besteht und auch sonst - mit einer Breite von 60 bis 100 Metern, der Kombination aus Stacheldraht, Wachtürmen, Gräben und Fahrstreifen für Militärfahrzeuge in vieler Hinsicht den Sperranlagen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ähnelt. In Ost-Jerusalem verläuft die Mauer quer durch arabische Wohngebiete. Die palästinensische Stadt Qalqiliya wurde im Wortsinn eingemauert; nur ein israelisch kontrollierter Ausgang für Personen und Warenverkehr und zwei Übergänge für Bauern, die zu ihren Feldern wollen, bieten Wege nach außen. Insgesamt fanden Tausende von Palästinensern ihre Häuser, Dörfer oder Felder plötzlich auf der »israelischen« Seite des Zauns - in einem Sperrgebiet, das nur mit Sondergenehmigungen des israelischen Militärs zu betreten war.
Israelis reden nicht von einer Mauer, sondern lieber vom Sicherheitszaun, und verweisen darauf, dass es sich um eine Schutzanlage gegen das Eindringen von Terroristen handele. Tatsächlich lässt jeder neue terroristische Anschlag in Israel die Zustimmung der israelischen Bevölkerung zu einer wie auch immer gearteten Sperranlage ansteigen - und die Frage in den Hintergrund rücken, ob hier nicht Sicherheitsargumente genutzt wurden, um Landraub und Annexion zu legitimieren: Die Anlage, soweit sie bis jetzt gebaut ist, verläuft schließlich nicht auf israelischem Territorium und nicht entlang der »grünen Linie« zwischen Israel und den 1967 besetzten Gebieten, sondern reicht teilweise mehrere Kilometer in palästinensisches Gebiet hinein.10 Deshalb richtete sich europäische und internationale Kritik auch nicht auf den Bau der Mauer als solcher - sondern ausschließlich auf deren Verlauf.
Tatsächlich nahm die Sperranlage die Ziehung einer Grenzlinie unilateral vorweg: Sie bestätigte das Prinzip der territorialen Trennung - was Israels Siedlerbewegung und die Ultrarechten verstörte, die sahen, dass eine solchen Abgrenzung zumindest einen Teil der Siedlungen jenseits der Grenze lassen würde -, und sie entsprach dem Handlungsprinzip Sharons, keine verhandelte, sondern eine einseitig bestimmte Lösung zu suchen. Demselben Prinzip entsprach auch eine Ankündigung, mit der Sharon die israelische und die internationale Öffentlichkeit Anfang 2004 überraschte. Er werde nämlich, erklärte der Ministerpräsident, die meisten oder alle Siedlungen im Gazastreifen räumen lassen; die Siedlungen würden vom Gazastreifen »in israelisches Territorium verlegt«. Er gehe davon aus, dass keine Juden im Gazastreifen verbleiben würden.11
Während die palästinensische Autonomieregierung überrascht war und wohl auch ihre eigene Schwäche verspürte - sah es doch so aus, als müsse Israels Ministerpräsident nach dreieinhalb Jahren Intifada Verhandlungen über den Fortgang des israelisch-palästinensischen Verhältnisses allenfalls noch mit seiner eigenen Partei und mit den israelischen Siedlern führen - bemühten ihre Vertreter sich gleichwohl, ähnlich wie UN-Generalsekretär Annan und andere internationalen Beobachter, Sharons Ankündigung als Schritt in die richtige Richtung zu werten. Wenn Israel sich aus dem Gazastreifen zurückziehe, so der palästinensische Ministerpräsident Ahmad Qurei, würden die Palästinenser dies nicht behindern; zum Frieden gehöre allerdings, dass Israel auch die Siedlungen in der Westbank räume. Viele Kommentatoren auf palästinensischer und arabischer, einige auf israelischer Seite, waren kritischer. Sie merkten an, dass es Sharon wohl nur um eine Art Frontbegradigung ginge, um die Aufgabe einiger Siedlungen mit einigen Tausend Siedlern im Gazastreifen, um desto mehr an großen Teilen der Westbank und den dort errichteten Siedlungen festzuhalten. Das mag tatsächlich so sein. Nur sollte man eben nicht übersehen, wie sehr die Bereitschaft zur Aufgabe einiger Siedlungen, die er selbst noch Monate früher für unantastbar erklärt hatte, für Sharon und seine Partei eine historische Korrektur darstellte: den Einriss einer ideologischen Mauer gewissermaßen, die Sharon, der sich gern als Vater der Siedlerbewegung bezeichnen lässt, in früheren Jahren selbst errichtet hatte. Die Bedeutung von Sharons Ankündigung liegt aber vor allem darin, dass sie es fast unabhängig davon, wieweit er selbst sie durchführen wird, späteren israelischen Regierungen erleichtern dürfte, ein beidseitig akzeptables Friedensabkommen auszuhandeln und die Besatzung tatsächlich zu beenden. Die Grundlagen einer friedlichen Regelung des Nahostkonflikts sind so offensichtlich auch durch mehrjährige gewaltsame Auseinandersetzungen nicht verändert worden.
Bewegung in der arabischen Welt
Wie im Nahen Osten, so sollte man auch mit Blick auf die arabische Welt im Ganzen vorsichtig sein, bestimmte politische oder gesellschaftliche Veränderungen in einen direkten, kausalen Zusammenhang mit dem Irakkrieg zu stellen. Für manch amerikanischen Beobachter etwa war klar, dass die offensichtlichen Bemühungen des syrischen Präsidenten Bashar al-Asad, den Friedensprozess mit Israel wiederaufzunehmen, oder die Ankündigung des libyschen Revolutionsführers Muammar al-Qadhafi, auf alle Massenvernichtungswaffen verzichten zu wollen, nur mit der militärischen Entfernung des Husein-Regimes zu erklären sei.
Tatsächlich hat die amerikanische Machtdemonstration am Golf die politischen und intellektuellen Eliten der arabischen Welt gezwungen, ihr Verhältnis zu den USA und manche ihrer politischen Handlungsstrategien neu zu durchdenken. Bestimmte Entwicklungen sind dadurch beschleunigt worden. Der syrischen Führung etwa war sehr daran gelegen, Washington und der Welt zu zeigen, dass nicht Damaskus für die Blockade des israelisch-syrischen Teils des Friedensprozesses verantwortlich sei. Man bemühte sich auch, das direkte Verhältnis zu den USA in Ordnung zu bringen, das aufgrund der recht deutlichen politischen Unterstützung, die Syrien dem Irak vor und während des Krieges geleistet hatte, schweren Schaden genommen hatte.12 Wer Asads Friedensfühler allein der neuen geopolitischen Lage zuschreibt übersieht, dass die syrische Führung unter dem jungen Präsidenten auch in den Jahren zuvor immer wieder betont hat, dass Syrien den Frieden braucht, um sein eigenes wirtschaftliches Modernisierungsprogramm durchzuführen. Auch das libysche Abrüstungsangebot kam nicht ganz plötzlich, sondern war das Ergebnis mehrjähriger Bemühungen Libyens, sein Verhältnis zu den USA und dem Westen in Ordnung zu bringen, und dreijähriger stiller Verhandlungen über das Rüstungsthema zwischen Vertretern der libyschen Führung und britischen Diplomaten.
Immer noch gilt, dass innere Reformen in den arabischen Staaten langsam, oder richtiger: zu langsam, vonstatten gehen, um den wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ansprüchen zu genügen, die ihre überwiegend junge Bevölkerung zu stellen begonnen hat. Bestimmte Ansätze politischer und gesellschaftlicher Erneuerung, die dieses Buch beschreibt, sind mittlerweile bereits deutlicher hervorgetreten. So stimmte das marokkanische Parlament nach längerem Widerstand konservativer Kräfte letztendlich einem vom König eingebrachten Gesetz zur Reform des Familienrechts zu, mit dem Männer und Frauen gleichgestellt wurden: Mütter und Väter erhalten damit erstmals die gemeinsame Verantwortung für die Familie, Eheverträge über Gütertrennung werden möglich, Frauen können die Scheidung verlangen, ohne das Erziehungsrecht über ihre Kinder zu verlieren. Auch in einem anderen Bereich setzte Marokko Zeichen: So wurde eine »Kommission für Gerechtigkeit und Versöhnung« eingesetzt, die zur Aufgabe erhielt, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu rehabilitieren und gegebenenfalls zu entschädigen - ein wichtiger Schritt, zweifellos, um die Tradition der »geheimen Gärten« dieses Landes zu überwinden.
Am anderen Ende der arabischen Welt, in den Golfmonarchien, gab es vorsichtige Schritte in Richtung größerer politischer Beteiligung und innerer Reform. So nahm man in Saudi-Arabien die wachsende amerikanische Kritik am saudischen Erziehungswesen und seiner Kontrolle durch die Religiös-Konservativen zunehmend ernst; die saudische Regierung akzeptierte sogar die Unterstützung amerikanischer Experten, um eine Überarbeitung der Curricula auf den Weg zu bringen. Das wäre aber wohl kaum der Fall gewesen, wenn nicht auch lokale Kräfte, insbesondere die saudische Unternehmerschaft, immer häufiger ein effizienteres und moderneres Erziehungssystem verlangt hätten. Allgemein versuchten die Königreiche und Emirate am Golf, eine neue Formel wirtschaftlicher und politischer Beteiligung zu finden. So fanden in Bahrain im Herbst 2002, erstmals seit den siebziger Jahren, wieder Parlamentswahlen statt; in Oman wurden ein Jahr darauf die ersten allgemeinen Parlamentswahlen abgehalten - an frühere Wahlen hatten sich nur ausgewählte Bürger beteiligen dürfen. In beiden Fällen gaben die Monarchen ihre Macht nicht ab - sie betrachteten es aber offensichtlich als notwendig, eine breitere Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Interessen zu ermöglichen. In Saudi-Arabien kündigte die Regierung aus demselben Grund an, erstmals Kommunalwahlen durchführen zu lassen. In der Abschlusserklärung einer »Nationalen Dialogveranstaltung« unter der Schirmherrschaft des Kronprinzen, an der Religionsgelehrte sowie männliche und weibliche Intellektuelle teilnahmen, wurde unter anderem auch dazu aufgerufen, die Mitglieder der beratenden Versammlung (Shura) zukünftig zu wählen.
Bei diesem internen Dialog waren die weiblichen Teilnehmer per Videoübertragung zugeschaltet. Dass gleichzeitig bei einer Wirtschaftskonferenz in Djidda, einer traditionell sehr viel stärker auf die Außenwelt gerichteten Hafen- und Handelsstadt, Männer und Frauen im selben Saal saßen - eine überschaubare Barriere sorgte allerdings für die physische Trennung der Geschlechter -, dass zudem auch noch eine saudische Unternehmerin die Eröffnungsansprache hielt, führte dann jedoch zu einer harschen Reaktion der Konservativen: Der Bruch etablierter sozialer Regeln - eben der im Königreich sonst praktizierten strikten öffentlichen Geschlechtertrennung -, erklärte der oberste Rechtsgelehrte des Landes, Sheikh Abdel Aziz Al Sheikh, sei die Wurzel allen Übels und Verbrechens. Politische Veränderung ist gerade im saudischen Königreich ein mühsamer Prozess. Wenn der saudische »Supertanker« sich zu bewegen beginnt, ist solche Bewegung auch in anderen Staaten der Region aber nicht mehr leicht aufzuhalten.
Erster Teil
Der Nahe und Mittlere Osten erfindet sich neu
Elemente des Wandels Einleitung und Übersicht
»Mon rhythme est celui du Maroc«, sein politischer Rhythmus sei der seines Landes, erklärte Marokkos junger König einem französischen Reporter ein gutes Jahr nach seiner Inthronisierung. Und dies sei nicht der Rhythmus, den bestimmte ausländische Beobachter ihm und Marokko »mit Arroganz und Ignoranz« aufdrücken wollten.1
Die arabische Welt wandelt sich, befindet sich in einer Phase historischen Umbruchs. Aber sie wandelt sich nicht unbedingt so rasch, so tiefgehend und so umfassend, wie große Teile der jungen Generation, die quer durch die Region, von Marokko im Westen bis zum Irak im Osten, die Mehrheit der Bevölkerung stellt, sich das wünscht, wie ausländische Experten oder Partner es für nötig halten und wie manche Repräsentanten eingesessener Eliten es befürchten. Die Botschaft des Königs ist eindeutig, und sie steht nicht nur für Marokko, sondern für fast alle arabischen Staaten - für die, in denen ein Machtwechsel gerade stattgefunden hat, wie für die, in denen seit fünfzehn, zwanzig oder dreißig Jahren dieselbe Gruppe oder ein und derselbe Mann regiert.
Muhammad VI., Marokkos junger König, mag den »geheimen Garten« Hassans II., seines 1999 gestorbenen Vaters und Vorgängers, geöffnet haben. »Le jardin secret«, der geheime Garten des Königs: mit diesem Euphemismus sprach Hassan II. von den Gefangenenlagern, in die er Regimegegner einsperren ließ; der Ausdruck kann somit auch als Metapher für den Despotismus autoritärer arabischer Herrscher stehen. Muhammad VI. und die anderen jungen Herrscher, die in den letzten Jahren die Führung einzelner arabischer Staaten übernommen haben - Abdallah II. in Jordanien, Hamad bin Isa in Bahrein, Bashar al-Asad in Syrien -, machten deutlich, dass sie als Vertreter einer neuen Generation auch zu politischer Reform oder »Öffnung« bereit waren, und sie setzten entsprechende Zeichen. Sie ließen politische Gefangene frei, machten versöhnliche Gesten gegenüber Regimegegnern, schlossen einzelne berüchtigte Gefängnisse oder ließen politisch Verfolgte aus dem Exil zurückkehren und erlaubten in der Regel ein größeres Maß an Diskussion und Widerspruch. Gleichzeitig ließen sie keinen Zweifel daran, dass sie die politischen Systeme, die sie geerbt oder übernommen hatten, nicht umkrempeln oder abschaffen wollten. Sie strebten nach einer Erneuerung und Modernisierung von Wirtschaft und Politik in ihren Ländern, jedoch nicht nach Systemveränderungen solch tief greifender Art, wie es die Länder des ehemaligen Ostblocks nach der Zeitenwende von 1989 erlebt hatten.
Die wirtschaftlichen und politischen Strukturen der arabischen Staaten unterscheiden sich stark von denen der kommunistischen Regime. Aber wenn es eine Lehre gab, die die Führungseliten der arabischen Welt, die alten genauso wie die jungen Herrscher, aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion gezogen haben, dann die, dass sie der Stabilität ihrer Systeme im Zweifelsfall immer Vorrang vor potenziell destabilisierenden Reformen geben würden. Vor allem würden sie sich Tempo und Ausmaß innerer Reformen, insbesondere politischer Liberalisierungs- oder Demokratisierungsmaßnahmen, von niemandem, schon gar nicht vom westlichen Ausland, vorschreiben lassen. Wenn arabische Politiker sich in diesem Zusammenhang gegen arrogante und ignorante Einmischungsversuche verwahren, können sie auf einige Zustimmung hoffen. Die Gesellschaften der arabischen Staaten mögen ihren eigenen Führern misstrauen, aber sie haben, soweit lässt sich verallgemeinern, sicherlich noch weniger Vertrauen in die Politik des Westens. Dafür war und ist vor allem die amerikanische, aber auch die europäische Nahostpolitik und in geringerem Maße die amerikanische Politik am Golf verantwortlich sowie die vermeintlich oder tatsächlich negative Haltung des Westens gegenüber dem Islam oder den Muslimen. So wie in der westlichen Öffentlichkeit häufig ungenügend differenziert wird, wenn es um arabische oder muslimische Staaten geht, so erscheint auch arabischen Betrachtern der Westen oft als einheitlicher Block mit überwiegend unfreundlichen Ambitionen.
Der Generationswechsel an der Spitze, der in einigen arabischen Staaten in den letzten Jahren stattgefunden hat und in mehreren anderen Staaten ansteht, ist nur ein Element des Umbruchs, den die Region gegenwärtig erlebt. Diese Umbruchsphase wird auch durch wirtschaftliche und soziale Entwicklungen charakterisiert, die gern unter dem Stichwort »Globalisierung« zusammengefasst werden. Die Staaten der arabischen Welt und des Nahen Ostens, bemühen sich wie - und in Konkurrenz zu - Staaten anderer Regionen, insbesondere Osteuropas oder Südasiens, sich als attraktive Investitionsstandorte zu präsentieren, öffnen dafür ihre Finanzsysteme und Märkte, verhandeln untereinander und mit internationalen Akteuren, insbesondere mit der Europäischen Union (EU), über Freihandel und Zollabbau. Im Ergebnis werden die Grenzen auch der arabischen Staaten durchlässiger, vorerst eher für Waren und Kapital als für die Menschen. Elemente einer tendenziell globalen Kultur des alltäglichen Konsums verbreiten sich, mehr oder weniger schnell, auch in den meisten Staaten des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas. Das gilt für die rätselhafte Attraktivität von Fast-Food-Produkten amerikanischen Ursprungs, für verkehrt herum aufgesetzte Baseballkappen oder für die Verbreitung marktgängiger Produkte der Popmusik über internationale Satellitenkanäle. Konservative arabische Stimmen sprechen in diesem Zusammenhang oft von einer westlichen »kulturellen Invasion«. Tatsächlich wird die Dynamik dieses Einbruchs amerikanischer Konsumkultur weniger durch politische Widerstände - gegen die Auflösung kultureller Authentizität - begrenzt als vielmehr dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung in den meisten arabischen Staaten sich einen »westlichen« Lebensstil gar nicht leisten kann. Die Teilhabe an der Globalisierung ist nicht zuletzt eine Frage der materiellen Möglichkeiten. Das gilt auch, wenngleich in geringerem Maße, für das politisch und gesellschaftlich vielleicht wichtigste Element der Globalisierung: die Entgrenzung der Informationsverbreitung und der Kommunikation. Die aktive Nutzung bestimmter Medien wie des Internets oder des Mobiltelefons ist nach wie vor nur einer Minderheit möglich. Sehr viel allgemeiner verbreitet ist der Zugang zu Fernsehen und Satellitenprogrammen; Zehntausende von Satellitenschüsseln haben die Dachlandschaften auch der ärmeren Viertel von Kairo, Gaza und Sanaa genauso verändert wie die von Damaskus, Riad oder Rabat.
Nur in Bagdad, wo das Regime sich bemüht, die eigenen Bürger von ausländischen Nachrichten abzuschotten, finden sich Satellitenschüsseln eher an versteckten Plätzen. Aber Palästinenser und Israelis, Syrer oder Tunesier erfahren Nachrichten über wichtige Ereignisse in ihren Ländern oft eher durch CNN oder durch dessen arabisches Pendant, den Sender al-Jazeera aus Qatar, als aus den lokalen Medien. Fast alle arabischen Zeitungen sind im Internet abrufbar; unzählige Websites bieten unzensierte politische Informationen. Anders als noch zu Beginn der neunziger Jahre steht den Menschen in der Region damit ein umfassendes und zunehmend einheitliches Informationsangebot zur Verfügung, dessen Wahrnehmung eher von Sprachkenntnissen sowie vom Zugang zu Computer und Internet abhängt - und somit nicht zuletzt auch von der finanziellen Möglichkeit, sich einen eigenen Computer anzuschaffen - als von der Nationalität oder von der physischen Anwesenheit innerhalb bestimmter Staatsgrenzen.
Von einem Umbruch kann man schließlich mit Blick auf die Beziehungen und die Konflikte auch innerhalb des regionalen Staatensystems sprechen. Wenn in diesem Buch vereinfachend von der Region gesprochen wird, dann meine ich damit die arabische Welt, also die arabischen Staaten des Mittleren Ostens (Arabische Halbinsel und Persischer Golf), des Nahen Ostens und Nordafrikas, sowie Israel. Israel ist zwar kein arabischer Staat, es liegt aber geographisch in der arabischen Welt, ist - egal, ob es selbst das will und ob die arabischen Staaten und Gesellschaften dies wünschen - ein Teil des regionalen Staatensystems, ein zentraler Teilnehmer regionaler Konflikte und tatsächlich auch, obwohl viele Israelis und viele Araber dies bestreiten, kulturell ein Teil seiner regionalen Umgebung. Das wichtigste Element der Veränderung regionaler Politik im Nahen und Mittleren Osten stellt zweifellos, trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge, der nahöstliche Friedensprozess dar, oder präziser: die Phase des Friedensprozesses, die 1991 mit der Nahostkonferenz von Madrid begann. Dieser Prozess hat zusammen mit anderen Entwicklungen und Ereignissen dazu beigetragen, dass sowohl die Strukturen wie auch die Spielregeln nahöstlicher Politik sich über die neunziger Jahre bis zu einem gewissen Grad geändert haben. Vom Frieden mag die Region noch einige Jahre entfernt sein; die Konturen zukünftiger Friedensabkommen, insbesondere zwischen Israel und dem palästinensischen Gemeinwesen, sind allerdings den meisten Beteiligten klar.
Ich beginne dieses Buch mit einer kurzen Darstellung der veränderten Realitäten der regionalen Politik. Die Bedeutung heutiger Ereignisse lässt sich allerdings kaum ohne eine historische Darstellung begreifen, die die diplomatischen und politischen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Ostens seit Mitte der vierziger Jahre schildert, als das regionale Staatensystem in seiner heutigen Form entstand. Das folgende Kapitel gibt deshalb einen Überblick über die regionale Politik in diesen fünfeinhalb Jahrzehnten - eine gelegentlich verwirrende Abfolge politischer und militärischer Konflikte, wechselnder Allianzen, eingebildeter und tatsächlicher Verschwörungen von regionalen und internationalen Akteuren. Dabei wird klar, wie sehr der arabisch-israelische Konflikt die Entwicklung in der gesamten arabischen Welt beeinflusst hat. Die historische Darstellung zeigt auch, dass es keinem der regionalen Staaten und keiner außerregionalen Großmacht je gelungen ist, die Verhältnisse in der Region ihren Vorstellungen oder Interessen gemäß zu ordnen.
Es folgt eine kurze Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Faktoren, die heute für die Entwicklungschancen der arabischen Welt besondere Bedeutung haben. Daran anschließend richte ich den Blick auf die neue Führungsgeneration der arabischen Staaten und frage auch nach der Bedeutung des politischen Islam.
Der zweite Teil des Buches bringt einen Wechsel der Perspektive. Ich betrachte hier die arabische Welt nicht mehr im Querschnitt, sondern richte den Blick auf die einzelnen Länder: auf wichtige Akteure in diesen Ländern und auf aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen und Probleme, mit denen die einzelnen Staaten sich zu befassen haben. Dabei gehe ich bewusst selektiv vor und lege den Schwerpunkt auf die Staaten im klassischen Nahen Osten: Ägypten, Israel und Palästina, Syrien, den Libanon, Jordanien, den Irak, die arabischen Golfstaaten und die Staaten des Maghreb. Für viele Staaten spielt der Nahostkonflikt eine zentrale Rolle. In anderen stehen wirtschaftliche und soziale Probleme, innenpolitische Auseinandersetzungen bis hin zum Bürgerkrieg oder der Umgang mit den Folgen von Bürgerkriegen im Vordergrund. In allen Ländern steht neben der Generationenfrage auch die Frage der Herrschaftsverhältnisse auf der Tagesordnung.
Letzteres wird zum Schluss noch einmal aus einer Querschnittsperspektive aufgegriffen. Wird es in den arabischen Staaten zu einer Überwindung der autoritären, ja despotischen Elemente kommen, werden die »geheimen Gärten« der Herrscher sich öffnen, wird es in absehbarer Zeit mehr Demokratie geben? Diese Fragen stellen sich tatsächlich nicht nur für die beteiligten Akteure in der arabischen Welt, sie haben letztlich auch etwas mit den Beziehungen der Region zu ihren internationalen Partnern - vor allem in Europa und Nordamerika - zu tun.
Die arabische Welt und der Nahe Osten Neue Spielregeln, alte Politik?
Seit Beginn der neunziger Jahre haben sich in der regionalen, arabischen und nahöstlichen Politik einige wesentliche Entwicklungen vollzogen, die einem allein auf tagespolitische Ereignisse fixierten Beobachter entgehen können. Nur wenn wir uns erinnern, wo etwa die arabisch-israelischen Beziehungen 1991 standen, wird deutlich, dass sich hier tatsächlich etwas getan hat. Ansatzweise zumindest sind neue Spielregeln regionaler Politik entstanden, und auch die Strukturen des regionalen Spielfelds haben sich ein Stück weit verändert. Befördert worden sind diese Veränderungen vor allem durch die Auswirkungen der irakischen Invasion Kuwaits und des zweiten Golfkriegs (1990/91) sowie durch die arabisch-israelischen Friedensbemühungen der vergangenen Dekade. Noch nicht vollständig abschätzbar, aber zweifellos von erheblicher Bedeutung werden zudem die Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 sein.
Pragmatische Nationalstaaten
Die irakische Niederlage im Krieg um Kuwait hat nicht nur die Kräfteverhältnisse in der arabischen Welt verschoben und eine, wie es scheint, dauerhafte Stationierung amerikanischer Truppen am Golf bewirkt. Sie bedeutete auch, dass die allgemein akzeptierten Spielregeln - die Prinzipien und Normen - innerarabischer Beziehungen so überdacht und revidiert wurden, wie es den Interessen der arabischen Sieger des Krieges entsprach. Dazu gehörte vor allem, dass das souveräne Recht der einzelnen arabischen Nationalstaaten, ihre außen- und sicherheitspolitischen oder wirtschaftlichen Interessen selbst zu bestimmen, einen sehr viel höheren Stellenwert erhielt als zuvor. Das hieß, dass bestimmte, ihrem Ursprung nach panarabische (also an der Einheit aller arabischen Länder orientierte) Konzepte und Forderungen, mit denen der Irak und dessen Unterstützer bis zum Golfkrieg Politik gemacht hatten, zumindest auf der Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen nicht mehr akzeptiert wurden. Dem Slogan etwa, dass das »arabische Öl« allen Arabern gehören müsse, wurde eine klare Absage erteilt. Auch die in den innerarabischen Debatten oft wiederholte ideologische Behauptung, dass es keine separaten Sicherheitsinteressen einzelner Staaten, sondern nur »gesamtarabische Sicherheit« gebe, überzeugte nicht mehr. Natürlich hatten Saudi-Arabien, Kuwait, der Irak oder Algerien ihre Ölpreisund -förderpolitik auch früher schon den eigenen Interessen gemäß gestaltet, hatten bei ihren Finanzhilfen für andere arabische Staaten eher politische als entwicklungspolitische Kriterien berücksichtigt und bei ihrer Rüstungspolitik vor allem die eigene Sicherheit und die eigenen regionalpolitischen Interessen im Blick gehabt. Nur hatten die meisten Staaten sich eben genötigt gefühlt, ihre Politik in irgendeiner Form gesamtarabisch zu legitimieren. Dies änderte sich nun. Wenn Saudi-Arabien, Kuwait oder andere Staaten bilaterale Bündnisse mit den USA eingingen oder eher Syrien und Ägypten, die im Golfkrieg an der Seite Kuwaits gestanden hatten, als Jordanien und den Jemen, die eine formal neutrale, insgesamt aber eher pro-irakische Haltung eingenommen hatten, finanziell unterstützten, dann taten sie das offen mit Verweis auf ihre Souveränität. Mit Unterstützung anderer Staaten setzten sie durch, dass dies im gesamtarabischen Rahmen auch akzeptiert und legitimiert wurde. So wurde das souveräne Recht jedes einzelnen arabischen Staates, nach eigenem Ermessen über seine Ressourcen zu verfügen, in mehreren Dokumenten der Arabischen Liga ausdrücklich bestätigt.2
Letztlich wurde hier auf der normativen und ideologischen Ebene nur nachvollzogen, was lange schon Realität geworden war: dass nämlich die arabische Welt aus leidlich gefestigten einzelnen Nationalstaaten bestand. Die Völker der arabischen Welt haben auf Grund ihrer gemeinsamen Sprache, Kultur und Geschichte sehr enge Bindungen zueinander. Man kann deshalb davon sprechen, dass die Araber vom Golf bis Nordafrika auch eine, die arabische Nation bilden. In der politischen Realität aber ist ein arabisches Staatensystem entstanden,
1
Vgl. Powells Interview im Wall Street Journal, 4.2.2004.
2
Vgl. al-Hayat vom 12.08.2003.
3
United Nations Development Programme, The Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations, New York, 2002; United Nations Development Programme, The Arab Human Development Report 2003: Building a Knowledge Society, New York, 2003.
4
Samir al-Khalil (d.i. Kanan Makiya), The Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq, Berkeley, 1989.
5
Zu den Strukturen des Systems siehe u.a. Charles Tripp, »After Saddam«, Survival, 44 (Winter 2002-03), 4, S.22-37.
6
Gezählt wird die aufs Jahr umgerechnete monatliche Zahl von Morden auf je 100 000 Einwohner. Diese wurde im Dezember 2003 für Bagdad auf 70 bis 120, für Washington auf 43 geschätzt. Quelle ist der wöchentliche »Iraq Index« der Brookings Institution in Washington.
7
Abd al-Latif Ali al-Miyah, »al-masar al-dimuqrati fi al-ìraq. al-afaq wa-l-l-mustaqbal« [Der demokratische Weg im Irak: Horizonte und Zukunft], undatierte 16-seitige Flugschrift (Bagdad, Dezember 2003).
8
Eine deutsche Übersetzung des Abkommenstextes wurde in Kurzfassung veröffentlicht in: Die Genfer Übereinkunft. Entwurf eines Abkommens über den endgültigen Status der israelisch-palästinensischen Beziehungen (Auszüge), in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Bd. 48 (2003) Nr. 12, S. 1511-1519 und findet sich in vollständiger Version z. B. in: http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/Nahost/genf-deutsch. html. Der englische Text ist in vollem Umfang z. B. zugänglich in: http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/Nahost/genf.html oder als pdf-Datei zum Download in: http://www.meretzusa.org/doc_genevainitiative.pdf.
9
Vgl. The Jerusalem Post, 27. Mai 2003.
10
Vgl. etwa »A safety measure or a land gab?«, in: The Economist, 11. Oktober 2003.
11
Yoel Marcus, »Sharon’s plan: 20 settlements to go within a year or two«, Ha‘aretz Internet Edition, 3. Februar 2004.
12
Vgl. ausführlich: Volker Perthes, Syria under Bashar al-Asad. Modernisation and the Limits of Change, London (International Institute for Strategic Studies) 2004.
Umwelthinweis:Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.
Der Goldmann Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
2. Auflage Vollständige, mit einem neuen Vorwort ergänzte Taschenbuchausgabe Juli 2004 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
© 2002 der Originalausgabe Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Sibylle Wenzel Karten: Peter Palm, Berlin Umschlagfoto: Mauritius/Torino (01.656.099) Verlagsnummer: 15274 KF · Herstellung: Sebastian Strohmaier
eISBN : 978-3-641-01065-2
www.goldmann-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de