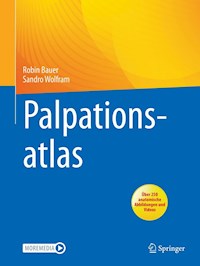Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Geißel der Nacht
- Sprache: Deutsch
Endlich raus aus diesem tristen Dorfleben, nie wieder auf den Feldern arbeiten und keine überfürsorglichen Eltern mehr, das wünscht sich Jaron sehnlichst. Gemeinsam mit seiner Freundin wird er demnächst aufbrechen - am besten gleich morgen, und dann Königreiche durchqueren und sagenhafte Abenteuer erleben. Doch der Tag der Abreise kommt anders als gedacht und Jaron spürt zum ersten Mal die volle Härte des Lebens. Der Fürst der Unterwelt kehrt zurück - schrecklicher denn je! Die erste Saat des ungeteilten Chaos. Schon bald findet er sich in einer Gruppe wieder, die unterschiedlicher nicht sein könnte - sie alle verfolgen andere Ziele und sind doch aufeinander angewiesen. Was Schmerz und Trostlosigkeit mit einem anrichten, kann man erst wirklich verstehen, wenn man durch die Hölle geschleift wird. Wie viele Opfer würdest du bringen, um zu überleben? Geißel der Nacht eine Mischung aus gefährlicher Heldenreise wie "Der Herr der Ringe" kombiniert mit der Brutalität aus "Game of Thrones".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
„Was ich will –
das werd’ ich“
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1: Ein Sturm zieht auf
Kapitel 2: Eine komische Konstellation
Kapitel 3: Helfer in Not
Kapitel 4: Schneewüste
Kapitel 5: Schrecken der Unterwelt
Kapitel 6: Begraben
Kapitel 7: Kältemarsch
Kapitel 8: Flauschige Nuss
Kapitel 9: Wisch das auf
Kapitel 10: Verbrannt – Bewusstlos – Gefangen
Kapitel 11: Güllestrudel
Kapitel 12: Dein Schicksal
Kapitel 13: Offenbarung
Kapitel 14: Tiefschwarze Augen
Kapitel 15: Auf der Flucht
Kapitel 16: Ein weiteres Spiel
Kapitel 17: Im Angesicht des Todes
Kapitel 18: Die Seherin
Kapitel 19: Wünsch dir was
Kapitel 20: Fremdes Land
Kapitel 21: Schmerzhafte Lehrstunde
Kapitel 22: Eine Krabbe, die spricht
Kapitel 23: Durch die Lüfte
Kapitel 24: Ein Leben voller Vielfalt
Kapitel 25: Sechs-Gänge-Menü
Kapitel 26: Steinregen
Kapitel 27: Dritter im Bunde
Kapitel 28: Kampf der Titanen
Kapitel 29: Liebe Qual
Kapitel 30: Abschied nehmen
Epilog
Prolog
Noch ein Stück höher zielen, dann würde er bestimmt treffen, fokussiert auf den roten Apfel, der auf dem Strohballen liegt. Die Sehne ist bis zum Anschlag gespannt. Seine Hände zittern – den richtigen Moment abzuwarten, ist gar nicht so leicht. Er kann seine Muskeln spüren und wie ihm langsam, aber stetig die Kraft schwindet. Lange kann er diese Anspannung bestimmt nicht mehr halten. Mit zugekniffenem Auge späht er den Holzpfeil entlang – er muss jetzt schießen. Vaters Langbogen, den dieser immer zum Jagen für die Hasen benutzt, hat er noch nie zuvor in seinen Händen gehalten. Viel wuchtiger – ganz anders als ein normaler Bogen – liegt er in seinen Armen. Aber eine Wette ist nun mal eine Wette. Den restlichen Tag lang mit Mutter Esther Gemüse zu schneiden, dazu hat er wahrlich keine Lust. Er holt tief Luft, wartet einen letzten Augenblick, bis die Eisenspitze nahezu perfekt auf den Apfel gerichtet ist, und lässt los. Ein Surren ertönt in der Luft – TREFFER! Jubelnd, mit breitem Grinsen, springt er in die Höhe, als der Apfel zu Boden fällt.
„Jaron!“, hört er seinen Vater Osric mit stolzer, aber auch entrüsteter Stimme sprechen. „Glückwunsch, mein Sohn – doch deine Gedanken waren auch woandershin, nicht nur auf den Moment des Schusses gerichtet. Du magst zwar getroffen haben, doch Dank deiner Unkonzentriertheit hast du dir eine Wunde am Daumen zugezogen!“
Jaron blickt auf seine Hand. Der Pfeil, den er abgeschossen hatte, hat ihm eine Schnittwunde entlang seines Daumens verpasst, aus der nun Blut tropft. Anscheinend war sein Griff nicht richtig am Bogen fixiert. Sich am Pfeil zu schneiden, passiert eigentlich nur Anfängern und Jaron ist das äußerst unangenehm. „Sich ablenken zu lassen ist der größte Fehler, den ein Krieger machen kann“, fährt Vater fort. „Mit einer Verwundung durch einen eigenen Schuss wäre man im Kampf beeinträchtigt. Wenn du nun einen weiteren Pfeil setzen müsstest, würde dir das Zielen ab jetzt viel schwerer fallen.“
Vater Osric ist ein großer, schlanker, aber trotzdem muskulöser Mann. Mittlerweile zeichnet sich sein Alter am Körper ab. Die Jahre haben ihm eine Glatze verpasst. Graue Bartstoppeln und faltige Augenlider zieren sein schmales Gesicht. Mutter Esther meint immer, Jaron hätte die himmelblauen Augen seines Vaters vererbt bekommen. Egal wie hart die Arbeit am Acker auch sein mag, wenn Mutter ihre zwei Männer sieht, geht ihr jedes Mal das Herz auf. Trotz der mühseligen Tätigkeit, die die Familie jeden Tag verrichten muss, sind sie froh darüber, Essen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Seit Vaters Zeit im Krieg, wo er viel Leid und Tod sah, achtet er besonders auf seine Familie. Während des Krieges eignete er sich sogar einige Fähigkeiten im medizinischen Bereich an, um verwundeten Kameraden schnell helfen zu können – wenn nötig. Für Osric ist es nichts Neues, eine Waffe, auch im Kampf Mann gegen Mann, zu benutzen. Sein Wissen möchte er an Jaron weitergeben. Die Zeiten sind in den letzten Monaten unruhig geworden und der Winter steht vor der Tür. Der unentwegte kalte Wind lässt einen harschen Winter erahnen. Kalte Jahreszeiten bedeuten für viele Menschen Hunger, Armut und Leid. Oftmals ist das Grund genug, dass ein Königreich einem anderen den Krieg erklärt.
Jaron streicht sich verschämt durch sein kurzes, strubbeliges braunes Haar. Er kann verstehen, was Vater ihm sagen wollte. Jaron legt den Bogen beiseite und geht Richtung Strohhaufen über das Feld.
„Gewonnen habe ich trotzdem“, sagt er mit kindisch herausgestreckter Zunge und zieht die Pfeilspitze aus dem Apfel.
„Das hast du“, antwortet Vater schmunzelnd. „Vor dem Gemüseschneiden hast du dich jetzt drücken können – nicht aber vorm Pflügen des Feldes. Lass uns weitermachen, bevor die Sonne untergeht – wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.“
Osric packt die Zügel des Ochsen. Seine müden Hände schnallen den Gurt fester, an dem das Tier einen angespitzten Holzkeil nachzieht. Mit dieser Vorrichtung ist das Pflügen um einiges angenehmer. Jarons Aufgabe ist es, das Unkraut sowie Gesteinsbrocken vom Feld zu entfernen. Wahrlich keine spannende Tätigkeit, um den Tag zu verbringen. Viel lieber würde er in der Schenke mit seinen Dorffreunden eine Partie Würfel spielen oder wieder Kuhmist an die Wände des fetten Müllers werfen. Vater empfindet Arbeit stets als gut und ehrlich. Lieber Silber hart verdienen, als durch zwielichtige Methoden an Gold zu kommen, nur um vielleicht dabei seine Hand zu verlieren.
So denkt Jaron aber nicht. Er will die Welt entdecken. Nicht hier im trostlosen Emmerstal versauern. Mehr als nur das kleine Fleckchen Land sehen, wo er Tag für Tag lebt. Das Land Eunessa ist riesig, mit verschiedenen Königreichen und unterschiedlichsten Kulturen. Küstengebiete mit kristallklarem Meer, wo man in vielen Metern Tiefe den Meeresboden betrachten kann. Unendlich scheinende Wiesenflächen, soweit das Auge reicht. Inmitten des Landes – gigantische Berge, die bis zur Wolkendecke hinaufragen. Dort, wo der Winter niemals aufhört. So vieles gibt es da draußen, wonach sich Jaron in seinen Gedanken sehnt. Er wirft zwei Steine beiseite – er ist zurück in der Realität angekommen.
„Jaron, beeil dich!“, murrt Vater. „Hol den Spaten aus dem Schuppen – wir müssen mit der Hand noch einiges nachbearbeiten.“ Seufzend nickt Jaron. Ob wohl jeder in seinem Dorf so ein spannendes Leben hat wie er?
Er kehrt zum Elternhaus zurück, wo Mutter Esther nasse Wäsche über ein gespanntes Seil hängt. Aus Freude ihren Jungen zu sehen, wirft sie ihm lächelnd einen müden Blick zu. Ihre feinen braunen Haare wehen im kalten Wind. Mutter wohnte einst in der großen Stadt Kuun, bis sie sich eines Tages am Jahrmarkt in Vater verliebte und mit ihm hinaus aufs Land nach Emmerstal zog. Sie ist der Inbegriff einer herzensguten Frau. Trotz ihrer zierlichen Figur ist sie stets bemüht, ihrem Ehemann helfend unter die Arme zu greifen.
„Suchst du etwas, mein Kind?“, fragt sie freundlich.
„Ich bin kein Kind mehr“, gibt Jaron schnippisch zur Antwort. „Ich gehe in die Scheune und hole weiteres Werkzeug. Wir brauchen den Spaten, da das Feld heute besonders hart zum Umgraben ist.“
Er streicht sich erschöpft über sein Gesicht. In den letzten Tagen hat Jaron kaum Schlaf finden können. Immer wieder plagen ihn merkwürdige Albträume, die so real wirken, dass sie ihm keine Ruhe lassen. Der Schuppen befindet sich direkt neben dem Bauernhaus. Ein eher rustikal zusammengeschustertes Holzhüttchen, in dem man etliches Gerümpel finden kann. In einer Ecke des Raumes liegt ein hoher Berg an frischem Stroh für die Pferde und den Ochsen. Das Haus, in dem die Familie lebt, befindet sich etwas außerhalb des Dorfes, nahe einem Waldrand. Umringt von Feldern müssen sie sich unentwegt um die Bearbeitung und Pflege ihrer Ländereien kümmern. Kaum ist man mit einem Feld fertig, ruft schon das nächste. Ein immerwährender Trott, aus dem Jaron eines Tages ausbrechen will.
Die Sonne geht langsam unter. Er spürt den kalten Hauch des Windes bis unter seine Gewandung. Ein einfaches graues Hemd und eine dünne braunschwarze Lederhose schützen nur wenig davor zu frieren. Jaron öffnet die quietschende Holztüre und geht in Richtung der hinteren Wand. Von Besen und eingerollten Seilen bis hin zu Spaten, Sichel und Heugabel hängen dort aufgereiht allerhand Utensilien. Murrend, keine Lust mehr aufs Feld zurückzukehren, packt er das benötigte Werkzeug. Plötzlich packt jemand Jaron von hinten und zieht ihm einen schwarzen Sack über den Kopf. Kaum begreifend, was hier vor sich geht, wird eine Schnur um seinen Hals festgezogen. Mit einem Fußtritt in den Allerwertesten wird er in den Strohhaufen geworfen.
„Hey, was soll das!“, schnauft Jaron erschrocken auf.
Als er panisch versucht sich von der Kopfbedeckung zu befreien, kann er ein leises Kichern vernehmen.
„Das hört sich doch an wie…?“, überlegt er und beginnt zu strahlen.
Jaron entfernt den Lumpen und sieht in das Gesicht einer bildhübschen, jungen Dame.
„Dhara! Was machst du denn hier?“, sagt er mit verliebt stotternder Stimme.
Ihre rehbraunen Augen verzaubern beim bloßen Anblick Jarons Sinne. Blondes, leicht gewelltes langes Haar schmiegt sich an ihre sanften Gesichtszüge. Sommersprossen, als würde das Licht sie küssen, schmücken ihre Nase und Wangen. Wie eine Prinzessin steht sie mit ihrem bunten, selbst zusammengeflickten Kleid vor ihm. Er hat in seinem Leben noch nie ein schöneres Mädchen gesehen! Vor allem, weil sie nicht nur hübsch, sondern obendrein auch noch klug ist. Umso glücklicher ist er, dass sie sich mit ihm abgibt. Ihr Abenteuerdrang scheint genauso groß zu sein wie Jarons. Gemeinsam haben sie sich schon oft überlegt, einfach von hier fortzulaufen. Leider kam es nie dazu – bis jetzt.
Sie will schon lange von hier verschwinden. Ihre Mutter ist vor Jahren dem Fieber erlegen und ihr Vater ist öfter betrunken als nüchtern. Im Vollsuff ist ihm bereits des Öfteren die Hand ausgerutscht, weil er Dhara die Schuld am Tod ihrer Mutter gibt. Es ist an Jaron zu entscheiden, wann die zwei endlich aufbrechen. Doch wie so oft kann Jaron seine Eltern nicht einfach im Stich lassen und so vergeht ein Mond nach dem anderen.
„Wann?“, fragt Dhara mit abenteuerlicher Neugierde.
„Was wann?“, antwortet Jaron verdutzt, steht auf und klopft sich seine Kleidung zurecht.
„Wann du mir das Stricken beibringst“, grinst sie spöttisch. „Natürlich nicht, du Doofi – sondern wann wir endlich von hier verschwinden? Vater hat schon wieder zu tief in den Krug… oder besser gesagt in die Krüge gesehen. Ich kann einfach nicht mehr nach Hause! Kommst du nun mit oder muss ich ohne dich gehen?“
Jaron kratzt sich verlegen am Hinterkopf. „Mhm… das meinst du also.“
Er sieht sich im Gehöft um, ob Mutter oder Vater in der Nähe sind. Von ihrem jugendlichen Herumturteln halten seine Eltern nicht wirklich viel.
„Diesmal wirklich – zumindest für ein paar Tage.“ Dhara schüttelt Jarons Schultern. „Es macht mich noch wahnsinnig, ständig dieselben Gesichter sehen zu müssen!“
Jaron blickt grübelnd auf den Heuboden. Eine Mischung aus Angst und Schuldgefühlen macht sich in ihm breit. Vater und Mutter wären zutiefst traurig, wenn er sie verlassen würde. Das will er ihnen nicht antun – er liebt seine Eltern. Aber er hasst auch sein Leben und den Umstand, dass er tagtäglich raus aufs Feld muss. So will er einfach nicht alt werden – da muss es noch mehr geben! Also was tun? Sein Kopf wird schwer vom Nachdenken.
„Nur für ein paar Tage“, meint Dhara. „Mehr nicht – nur mal ein kleines Stück weiter als nur bis zur Kreuzung von Ghumfeld. Was kann da schon schiefgehen?“
Ihr einfühlsames Lächeln ist für Jaron wie ein Sonnenaufgang an einem warmen Frühlingstag. Er ist wahrlich bis über beide Ohren in sie verliebt.
„Überredet“, gibt Jaron leise zur Antwort. „Aber nicht sofort. Ich will mich noch verabschieden – ein letztes Abendessen. Morgen bei den ersten Sonnenstrahlen treffen wir uns oben am Hügel.“
Dhara beginnt vor Glück und Abenteuerlust zu hüpfen. Sie war schon immer die neugierigere und taffere von den beiden. Sie beugt sich nach vorne und gibt Jaron einen dicken Kuss auf die Wange. Dieser läuft sofort knallrot an. Sie schubst ihn in den Strohhaufen und wirft sich süß kichernd neben Jaron. An der Holzdecke der Scheune fehlen an einer Stelle zwei Bretter. Beide sehen, in Gedanken vertieft, den weißen Wolken zu, wie sie langsam vorüberziehen.
„Was uns dort draußen wohl alles erwartet?“, fragt Dhara mit verträumter Stimme. „Vielleicht sind wir mal Teil einer Mannschaft an Bord eines riesigen Schiffes? Einer Fregatte, der der Ruf der tapferen Männer und Frauen, die an Bord sind, vorrauseilt. Oder womöglich lernen wir Feen und Gnome kennen – ich würde so gerne mal einem Gnom begegnen. Witzige kleine Kerlchen. Vielleicht sind wir mal Gefangene einer Goblinbande und müssen uns den Weg aus einem unterirdischen Schloss freikämpfen. Auf alle Fälle möchte ich so viel wie möglich erleben! Dort draußen steckt hinter jedem Stein das pure Leben – nicht so wie bei uns in diesem langweiligen Dorf.“
Jaron gibt darauf keine Antwort. Nicht, weil er anders denkt als Dhara, sondern weil ihm trotz allem etwas unwohl bei dem Gedanken ist. Er weiß von Vater, dass die Wirklichkeit oft davon abweicht, was man sich erhofft. Meist ist die Realität viel schlimmer. Die letzten Sonnenstrahlen streichen über Jarons Haut. Als er seine Augen wieder öffnet, stellt er erschrocken fest, dass die Zeit wohl rascher verstrichen ist als gedacht. Nervös springt er auf. Dhara scheint ebenso wie er eingedöst zu sein.
„Ich muss zurück – Vater wird mir jetzt ziemlich den Hintern versohlen.“ Er schluckt betrübt. „Wir sehen uns.“
„Bei Sonnenaufgang“, fügt Dhara hinzu und klopft sich das Stroh vom Kleid.
„Bevor du gehst, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich“, sagt sie reizend. „Streck einen deiner Arme aus – welcher ist egal.“
Jaron hält ihr seine linke Hand entgegen und ist gespannt, was passiert. Dhara greift in ihre Tasche und holt ein Armband hervor. Ein mit schwarzem Leder verzurrtes Band, auf dem in der Mitte ein runder silberner Talisman zu sehen ist. Darauf ist ein Berg abgebildet.
„Das habe ich für dich gemacht“, sagt sie und bindet das Band um Jarons Handgelenk. „Egal was passieren mag – damit sind wir auf ewig miteinander verbunden.“
Fast schon in Tränen verändert sich Dharas Stimme plötzlich. Kurz bevor ihr eine Träne die Wange hinunterläuft, kann sie sich noch fangen. Ein Lächeln kehrt auf ihre Lippen zurück.
„Bis morgen, mein Held!“
Sie dreht sich um und klettert geschickt aus einer der Fensteröffnungen.
„Bis morgen“, seufzt Jaron tief.
Er ist sich noch immer nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Doch wie in allen Geschichten werden Helden nicht als Helden geboren.
„Es ist schon sehr spät geworden – ich sollte zurück ins Haus gehen“, denkt er, als er die Scheune verlässt. „Nur für ein paar Tage – mehr nicht.“
1
Ein Sturm zieht auf
Auf Zehenspitzen versucht Jaron unbemerkt durch ein Fenster in sein Zimmer zu schleichen. Das Haus, in dem sie leben, ist nicht gerade groß, aber groß genug, um darin halbwegs angenehm auszukommen. In der Mitte der Holzhütte, gleich nach der Eingangstür, befindet sich die Küche. Ein wuchtiger, kohlenschwarzer Steinofen thront als Herzstück in der Ecke. Dann ein kleiner Arbeitsbereich, an dem die Familie das Essen zubereitet. Davor steht ein Tisch mit vier klapprigen Stühlen. Darauf eine Kerze, die den Raum erhellt. Zwei schmale Schränke neben der Tür des Elternschlafzimmers, in denen sich allerlei Dinge befinden. Daneben eine Eisentruhe, in der Osric das Ersparte aus der Landwirtschaft und andere Wertgegenstände der Familie aufbewahrt. Die nächste Tür führt in Jarons kleines Reich. Ein schmaler Gang trennt sein Zimmer von den anderen.
Leise wie eine Maus drückt er sich mit den Beinen voran durch die schmale Fensteröffnung. In der Hoffnung, dass sein zurechtgelegter Plan funktioniert, schleicht er sich in sein Bett. Ihm ist einfach während der harten Arbeit übel geworden und er musste sich kurz ausruhen. Leider ist er dabei eingenickt. Jarons Zimmer gleicht eher einer Abstellkammer: Gerade noch so passt ein schmales Bett in den Raum. Es besteht aus zusammengezimmerten Brettern, ein Leinentuch und jede Menge Stroh als Polsterung machen es ein wenig angenehmer darin zu liegen. Eine Truhe, in der sich seine raren Besitztümer befinden. Ein kleiner Schrank mit wenig Kleidung und ein Holzregal über dem Bett. Geschwind wie ein Wiesel kriecht Jaron unter die Decke.
„Puh – ging ja nochmal gut“, seufzt er erleichtert.
Plötzlich ertönt eine Stimme aus der Küche – es ist Vater Osric.
„Jaron“, hört er ihn dumpf rufen. „Jaron komm her – halte deine Mutter und mich nicht für dumm.“
„So ein Mist!“, flucht Jaron zähneknirschend. „Ja, komme schon.“
Wie ein Prügelknabe schleicht er ertappt in die Küche. Osric und Esther sitzen beide am Tisch und schlürfen eine Gemüsesuppe. Mutter merkt man nichts an, ihr Blick ist starr auf den Eintopf gerichtet. Sie konnte das schon immer gut – diplomatisch sein. Doch Vater ist sichtlich erzürnt über das, was heute passiert ist.
„Jaron – setz dich und iss deine Suppe!“, gibt er in befehlendem Ton von sich.
„Du hast dich wieder mit diesem Mädchen getroffen – ich konnte euch in der Scheune reden hören. Wie heißt sie nochmal?“ Vater sieht Mutter fragend an.
„Das Mädel heißt Dhara“, antwortet Esther.
„Ja stimmt – Dhara“, meint Osric.
„Du machst ihr ganz schön lange den Hof“, beendet er lächelnd den Satz. „Genau wie ich damals bei Mutter.“
Kurz klingt das für Jaron so, als würde ihm eine Standpauke erspart bleiben – falsch gedacht. Vater nimmt den letzten Rest der Suppe zu sich und wischt sich mit einem Tuch den Mund ab.
„Pass mal auf, junger Mann“, beginnt er den Satz mit erzieherischem Ton.
„Du kannst mit Dhara liebäugeln, so viel du willst – Tag und Nacht. Sie ist ja auch eine nette, hübsche Dirn. Aber erst, wenn deine Arbeit am Feld getan ist. Ohne unseren Ertrag würden wir den bevorstehenden Winter nicht überstehen. Verstehst du das, Kind?“
Jaron schiebt erbost seinen Suppenteller beiseite. Diese ständigen Vorgaben, was und wie er seinen Alltag zu gestalten hat, nerven ihn zunehmend. Er ist alt genug, um selbstständig entscheiden zu können, welchen Weg er in Zukunft gehen möchte.
Manche in seinem Alter haben bereits geheiratet und erwarten ihr erstes Kind. Er versteht also diese ständige Bevormundung nicht.
„Nennt mich nicht Kind – das bin ich schon lange nicht mehr!“, faucht Jaron zu Vaters Predigt.
„Doch, sehr wohl!“ Osric hämmert mit der Faust auf die Tischplatte. „Ein naives und hochnäsiges obendrein. Du willst nicht begreifen, wie hart das Leben mit einem leeren Magen ist. Oder wie erbarmungslos dort draußen außerhalb unseres Dorfes Menschen und andere Rassen sein können. Geh in dein Zimmer und überlege dir mal für einen Moment, wie gut es dir hier bei uns geht!“
„Hab sowieso keinen Hunger.“ Jaron steht auf und trampelt in sein Zimmer.
„Nur noch ein paar Stunden, bis zu den ersten Morgenstrahlen, dann bin ich endlich weg von hier!“
Er legt sich in sein Bett und schließt die Augen. Leider fällt ihm das Einschlafen schwer. Nicht wegen des Streits mit seinen Eltern, sondern wegen der Träume, die ihn verfolgen. Er sieht immer und immer wieder ein Feuer, in dem er gefangen ist. Lodernde, meterhohe Flammen, die das ganze Land zu Asche verbrennen. Eine vermummte alte Frau, die unentwegt auf einen schwarzen Kessel zeigt. Eine violette Substanz scheint darin zu brodeln. Schweißgebadet wacht Jaron auf. Schreie haben ihn mitten in der Nacht geweckt. Ist er noch in seinem Albtraum gefangen? Erneutes Geschrei von draußen ertönt.
„Wach auf, Jaron! Komm her! Schnell! WACH AUF!“
Er schreckt auf und stößt mit voller Wucht mit dem Kopf gegen das Holzregal. Das hat sich wie Mutter angehört – ist wohl doch kein Traum!
Schmerzerfüllt reibt sich Jaron den Kopf. „Aua.“
Der Vollmond steht noch hoch am Himmel und erhellt den Raum so, dass sich Jaron in seinem Halbschlaf etwas besser orientieren kann.
„Jaron! Um Himmels willen! Steh verdammt nochmal auf und komm endlich in die Küche“, hört er Mutter erneut von draußen rufen.
Jaron springt auf und eilt den Flur entlang in Richtung Küche. So panisch laut hat er Mutter noch nie schreien gehört. Auf einem Stuhl lehnt Vater nach vorne gebeugt, gestützt von Mutter, die vor ihm kniet und ihm gut zuredet. In seiner linken Schulter steckt ein kurzer rostiger Pfeil, der eine klaffende Wunde verursacht hat und Osric mit Sicherheit enorme Schmerzen bereitet.
Sein hellbraunes Leinenhemd ist bereits zur Hälfte blutrot gefärbt. Schweißperlen laufen ihm übers Gesicht, vorbei an seinen Wangen und verschwinden in seinem grauweißen Bart.
„Oh Liebster, das sieht nicht gut aus“, sagt Esther besorgt. „Wir müssen schnell einen Arzt holen, der dir diesen Pfeil aus der Schulter entfernt. Wie ist das überhaupt passiert?“
Vater nimmt, um seine Schmerzen zu lindern, einen großen Schluck Schnaps zu sich. Er atmet ein paar Mal tief ein und aus – Ruhe zu bewahren, ist nun wichtig.
„Verdammte Gors griffen mich plötzlich aus dem Nichts an… Ich hörte, wie draußen im Gehöft die Pferde unruhig wurden, und wollte nachsehen, was da vor sich geht. Ich habe meine Fackel genommen, bin rausgegangen und kaum war ich draußen, haben mich zwei von diesen Biestern attackiert. Hässliche Bastardkreaturen! Erschrocken habe ich wie wild mit der Fackel um mich geschlagen und plötzlich habe ich diesen stechenden Schmerz in meiner Schulter gespürt. In Panik habe ich noch stärker herumgefuchtelt. So konnte ich sie zum Glück vertreiben.“
„Was sagt Vater da? Gors?“, denkt Jaron. Verdutzt sieht er ihn und seine fürchterlich blutende Wunde an.
„Wie kann das sein – ist er sich da wirklich sicher?“
Gors werden auch oft Tiermenschen genannt. An sich ist der Körperbau dieser Wesen dem des Menschen ähnlich. Meist sind die Kreaturen 1,50 Meter groß. Sie haben dunkelbraune bis graue Haut und sind am gesamten Leib stark behaart. Das Prägnanteste ist ihre Gesichtsform. Die meisten von ihnen haben eine Schädelform wie die einer Ziege. Pferde- oder Kuhköpfe sind jedoch auch nichts Außergewöhnliches. Manche von ihnen haben auch Hörner auf dem Kopf oder Hufe statt Füßen. Tiermenschen sind eigentlich äußerst scheue Wesen, die tief in den Wäldern leben und eher in Ruhe gelassen werden wollen, als Kontakt mit anderen Völkern zu haben. Zur Gefahr werden Gors nur, wenn man mehreren gleichzeitig begegnet. Aber dann hilft es meist schon, laut herumzuschreien oder mit einem Gegenstand herumzufuchteln. Manche von den Kreaturen, meist der Häuptling, können einige wenige Menschenwörter sprechen. Zumindest genug, um manchmal Handel mit den umliegenden Dörfern zu betreiben, was aber nur äußerst selten geschieht.
„Was machen Gors so nahe im Landesinneren?“, fragt sich Jaron und eilt zu seinen Eltern, um zu helfen. „Der Wald ist ein paar Tagesmärsche entfernt. Es ergibt keinen Sinn, dass sie hier ihr Unwesen treiben. Gors können vor allem in der Nacht nicht gut sehen. Wieso greifen sie dann Vater nachts an?“
Jaron ist kurz in seine Gedanken vertieft, sodass er nicht mitbekommt, was um ihn herum geschieht – ein Schreien von draußen reißt ihn zurück in die Gegenwart.
„Kann das sein? War das etwa gerade Dhara?“
Als würde man einer lauthals kreischenden Person den Mund zuhalten, hört man ein Wimmern aus Richtung Scheune. Jaron schrickt auf, sieht zum Fenster und bemerkt, dass es zwar im Tal noch Dunkel ist, doch der erste Sonnenstrahl über die Bergspitze leuchtet.
„JARON! HILF MIR!“
Eindeutig – das ist Dhara und sie scheint in Gefahr zu sein! Er läuft rasch zur Eingangstüre und schiebt den Eisenriegel beiseite. Als er die Türe öffnen will, kracht sie ihm mit voller Wucht gegen die Stirn. Benebelt am Boden liegend, sieht Jaron hoch. Im Türrahmen steht plötzlich eine Kreatur mit glühend feuerroten Augen. Ein widerliches Blöken hallt in der Finsternis. Einen Atemzug später erblickt er das gelbweiße Gebiss eines Ziegenkopfes, das sich sabbertriefend zum Kampf bereit macht. Blitzschnell reißt die Kreatur das Maul auf und stürmt mit unglaublicher Aggressivität auf Jaron zu. Hilflos, in Angststarre versetzt, kann er sich nicht mehr bewegen – viel zu furchteinflößend springt der schwarzbraune Tiermensch auf ihn und beißt Jaron mit voller Kraft in die rechte Schulter. Ein markerschütternder Schrei entfährt seiner Kehle. Mit Armen und Beinen strampelnd, versucht Jaron das Vieh von sich zu drücken. Wie eine glitschige Qualle haftet es jedoch an ihm. Mit seinen Hörnern hat sich der Tiermensch am Boden verkeilt, um mehr Halt zu finden. Seine Klauenhände versuchen unentwegt, Jarons Gesicht zu erwischen. Nur noch kurz und die Kreatur würde Jaron aufschlitzen.
„VATER!“, fleht Jaron tränenüberströmt und voller Verzweiflung, dass diese abartige Kreatur nach seinem Blut lechzt. Osric macht zwei große Schritte nach vorne. Vorbei an seiner weinenden Frau, fokussiert auf das Ungeheuer, das seine Familie gerade bedroht. Seine Gesichtszüge zeigen für Jaron eine noch nie dagewesene Wut. Er stellt sich in Windeseile über den Gor und greift mit beiden Händen, seine Wunde ignorierend, nach dem dreckigen Fell. Vater packt so fest er kann zu, zerrt ihn mit aller Kraft von seinem Sohn herunter und drückt den Tiermensch gegen die Wand des Hausganges. Der Gor grunzt laut kreischend auf. Er versucht sich zu wehren – keine Chance. Wie gewaltige Hammerschläge prallen die Fäuste des Mannes gegen den Kopf der Kreatur.
„Stirb, du abscheuliches Geschöpf!“, brüllt er aus vollem Halse.
Das Wichtigste im Leben dieses Mannes sind seine Frau und sein Kind und diese würde er bis zum Schluss mit seinem Leben verteidigen. Wutentbrannt lässt er immer weiter wuchtige Fausthiebe gegen den Gor krachen, der nach jedem Treffer schrille Schreie ausstößt.
„Schnell, hol das Schwert aus deinem Zimmer“, ruft Mutter Jaron entgegen.
Panisch greift Esther nach dem längsten und schärfsten Messer, das sie in dieser Notsituation finden kann. Ihrem Ruf folgend, eilt Jaron sofort den schmalen Flur entlang zum Schrank. Seine Hände beginnen zu zittern. Das Atmen wird von Mal zu Mal schwerer. Er spürt ein gewisses Schwindelgefühl. Kalte Schweißperlen laufen ihm über die Stirn und Jaron muss sich für einen Moment mit einer Hand am Kasten abstützen, damit er nicht gleich umkippt. Er kneift zwei-, dreimal die Augen stark zusammen.
„Ich darf jetzt bloß nicht schlapp machen – komm schon, streng dich an!“
Nervös dreht sich Jaron um und sieht, wie Mutter dem Vater zu Hilfe eilt. Wegen des Bisses des Tiermenschen schmerzt Jarons Schulter arg. Blut quillt durch seine Finger, als er nach der Wunde greift. Plötzlich hört man von draußen ein lautes Poltern, das sich wie viele wuchtige Schritte anhört. Es klingt, als würde der Lärm bedrohlich schnell immer näherkommen. Vater löst seinen Griff vom Hals der Kreatur – leblos sinkt sie zu Boden. Er macht drei Schritte zur Eingangstüre und verkeilt diese mit einem dicken Holzklotz.
„Jaron – hast du schon dein Schwert? Es scheint noch nicht überstanden zu sein!“, zischt Osric.
Die Familie horcht auf. „Was, zum Teufel, geht da draußen vor sich?“
Jaron rennt in sein Zimmer, seine Hände zittern noch mehr als zuvor. Er kniet sich hin, greift nach seiner Truhe, klappt den Deckel nach hinten und holt sein Schwert hervor. Er hat die Waffe vor drei Jahren von Vater geschenkt bekommen, als sie gemeinsam das erste Mal im Wald jagen waren. Es ist eine Einhandwaffe, gut geeignet für den Nahkampf. Jaron erinnert sich an die ersten Lehrstunden im Umgang mit dem Kurzschwert.
„Wenn es hart auf hart kommt, muss man sich verteidigen können“, belehrte ihn Vater. „Aber vergiss niemals, dass auf Gewalt immer noch mehr Gewalt folgt. Setze also deine Waffe behutsam und klug ein – du bist zwar nicht der Stärkste, jedoch flink wie ein Wiesel und das musst du im Kampf ausnutzen.“
Jaron ballt seine Faust fest um den Griff des Schwertes, steht auf und hält es vor sich. Der tierische Schrei eines Stiers ist zu hören. Dann ein wuchtiger, dumpfer Schlag und die hölzerne Eingangstüre reißt es in mehreren Stücken aus der Halterung. Ein Gor hat mit seiner Zweihandaxt wie ein Rammbock die Türe durchschlagen. Die Kreatur ist über zwei Meter groß. Sie hat am Körper hellgraues Fell und einen Stierkopf, der mit unzähligen Narben übersäht ist. Die Bestie macht einen großen Schritt in Richtung Küche, auf seinen Vater zu, der ihr als erstes entgegentritt. Mit der Axt im Anschlag stürmt das Ungeheuer brüllend und schnaufend auf Osric zu. Schwarzen Speichel sabbernd, kommt der Tod über die Familie. Hinter dem Fleischberg von Monster folgt sofort ein weiteres halbes Dutzend von den Viechern in das Haus.
„Verdammter Mist, wie viele von den Dingern kommen denn da noch? Kommt doch her – ich reiße euch die Scheiße aus dem Leib!“, brüllt Vater ihnen entgegen. Der große Stier setzt zum Hieb mit der Axt an, doch der erste Schlag verfehlt Osric. Die Klinge landet in der Hauswand. Binnen Sekunden entbrennt ein hitziges Gerangel zwischen den beiden. Osric versucht mit kräftigen Schlägen die Kreatur auszuschalten. Diese Bestie scheint jedoch anders zu sein als seine Artgenossen. Normalerweise sind diese Viecher viel kleiner als ein ausgewachsener Mann. Dieser Stier jedoch überragt von der Statur her den Vater und ist nicht so leicht kleinzukriegen. Sein stinkendes, blutbesudeltes Fell betäubt Osrics Sinne. Gegen so etwas hat er noch nie kämpfen müssen. Wie in Wahn versetzt, schlägt das Ungeheuer seine mächtigen Pranken gegen ihn. Ein weiterer kleiner Tiermensch mit pechschwarzer Haut und borstigen rötlichen Haaren schleicht sich geschickt an dem Kampf zwischen dem Menschen und dem bulligen Stier vorbei. Wie ein listiger Fuchs windet er sich um die zwei und rammt genau im richtigen Augenblick, als Vater kurz seine Deckung vernachlässigt, einen alten, rostigen Dolch zwischen seine Rippen. Osric in seinem Kampfrausch verspürt erst nur ein kurzes Ziehen und bemerkt im ersten Moment nicht, wie schwer er gerade verletzt wurde und was die Wunde für ihn zur Folge haben kann. Keuchend vor Schmerzen wegen des blitzartigen Brennens in seinem Bauchbereich, zieht er reflexartig das Messer heraus. Er sieht das mickrige, kümmerliche Vieh unter sich und sticht vor Zorn die Klinge in den Hals des Angreifers, der Blut vergießend zu Boden geht.
„Alle sofort raus hier!“, hört Jaron seine Mutter schreien.
Sie versucht, ihrem Ehemann zu helfen und sticht mit dem Küchenmesser auf den grauen Stier ein. Die Klinge durchdringt sein Fleisch. Der Bulle scheint davon aber nur wenig beeindruckt zu sein. Mit einem Schwung seiner tödlichen Klaue schleudert er Esther zurück gegen den Esstisch. Die Angreifer sind alle auf Vater konzentriert und stehen mit dem Rücken zu Jaron, der gerade mit seiner Waffe im Anschlag aus dem Zimmer rennt. Er sammelt all seine Entschlossenheit und sticht seine Klinge in den Brustkorb des ersten Ungeheuers. Schon seit Kindestagen an war Jaron jemand, der, wenn es ernst wurde, sich zuerst geistig sammeln musste, um dann besser auf eine Situation reagieren zu können.
„Einer weniger“, sagt er zu sich selbst und zieht das Schwert aus dem Rücken des Monsters. Ein fast schon menschlich aussehendes Ungetüm hat den Angriff von hinten mitbekommen und dreht sich brüllend zu Jaron um. Mit nichts außer seinen scharfen Krallen als Waffe setzt es zum Sprung an. Der große Stier, der noch immer mit Osric im Kampf auf Leben und Tod ist, zieht kraftvoll seine Axt aus der Holzwand und schwingt sie schnaubend gegen Vater. Man kann deutlich seine angespannten Muskeln und geschwollenen Adern erkennen, die sich mit jeder Faser nach dem Kampf sehnen. Vater macht sich keuchend zur Verteidigung bereit. Der Stich des Dolches hat ihm übler zugesetzt, als er anfangs angenommen hat.
„So ein… so ein verdammter Mist“, flucht er mit zusammengekniffenen Augen.
Die Axt saust auf ihn herab und in dem Moment, als er dem Hieb ausweichen will, versagt Osrics Körper. Die Wunden in seiner Schulter und den Rippen sind zu schmerzhaft, um solch einem Schlag entgehen zu können.
Ein Flimmern vor den Augen und der Ohnmacht nahe, stützt er sich mit dem linken Arm an der Wand ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Vater neigt seinen Kopf und blickt für einen Moment zu Boden. Schweißperlen laufen über seine Nase und tropfen auf die Holzbretter. Er ist völlig erschöpft. Plötzlich hört Osric ein eisernes Brausen direkt neben seinem Ohr und spürt einen Atemzug später ein starkes Ziehen in seinem linken Arm, mit dem er sich für einen kurzen Wimpernschlag abgestützt hat. Sekunden später, ohne genau zu wissen, was eigentlich passiert ist, öffnet er, am Boden liegend, die Augen. Sein Körper ist blutüberströmt und, als er sich aufrichten will, um die Lage neu einschätzen zu können, sieht er, dass sein linker Arm ungesund weit von ihm entfernt liegt. Der Koloss hat Osric mit der Axt voll getroffen und ihn entzwei geteilt. Ein Brennen zieht sich durch seinen gesamten Körper, so heiß, als würde er in einem Schmelzofen liegen. Vater dreht seinen Kopf besorgt zu seiner geliebten Esther, die alles mitverfolgt hat und ihm weinend etwas zurufen will. Tausend Nadelstiche am ganzen Leib hindern Osric daran, noch klar bei Sinnen zu sein. Krampfhaft versucht er, seiner Frau ein paar Worte zu sagen, doch seinen Lippen entweicht kein einziger Ton. Die qualvolle Pein ist einfach zu groß. Ein dumpfes, kraftvolles Knirschen neben seinem Gesicht lässt ihn nach oben blicken, und er sieht, wie der Gor zum finalen Schlag gegen ihn ansetzt. Vater holt tief Luft, sammelt seine Gedanken und presst mit letzter Kraft ein paar Worte aus seinen Lungen.
„Flieht ihr beiden… flieht nach Furtwind! Unser König wird euch helfen, das zu überstehen! Sucht dort nach Schutz!“, krächzt er ihnen beschwörend zu.
„Lauft Richtung Fluss – dort seid ihr in Sicherheit.“
Er spürt, wie die Wucht der Axt knackend in seinen Brustkorb eindringt. Blut spritzt aus Osrics Mund. Leblos sackt sein Körper zusammen. „Liebster!“, fleht Esther verzweifelt. „Nein, bitte nicht… bitte lass das alles nur ein Albtraum sein!“
Übermannt von Schock und Trauer schreit Esther tränenüberströmt auf und sinkt zu Boden. Jaron köpft mit einem geschickten Hieb den nächsten Tiermensch. Auch wenn er schon etwas länger nicht mehr mit dem Schwert gekämpft hat, war es doch gut, früher so viel mit Vater im Wald trainiert zu haben. Als der Pferdeschädel des kleingeratenen Gors vor Jarons Füße fällt, hebt er erneut seine Waffe. Jaron sieht, wie der bullige Stier am anderen Ende des Ganges gerade seine blutverschmierte Axt aus Vaters Brust herausreißt. Seine Welt bleibt in diesem Augenblick stehen. Wie ein Blatt Papier wird Jarons bisheriges Leben in zwei Hälften gerissen. Der Mann, der immer wie ein unüberwindbarer Berg hinter ihm stand, ist tot! Das kann nicht wahr sein – das darf es einfach nicht! Jeder Atemzug ist schwer wie ein Ziegelstein, der gegen seine Brust hämmert. Am liebsten würde Jaron auch sterben, nur um diesen Anblick nicht weiter ertragen zu müssen. Eine nie dagewesene Trauer überkommt ihn – voller Verzweiflung und Hilflosigkeit schreit er aus voller Kehle nach seinem Vater. Tränen laufen unaufhaltsam über sein Gesicht. Sein ganzer Körper bebt vor Wut, Trauer und Hass. Jaron ist einer Ohnmacht nahe.
Doch er verspürt etwas tief in seinem Inneren, das ihn trotz des schrecklichen Todes seines geliebten Vaters stark bleiben lässt. Sein Geist gibt noch nicht auf – nicht jetzt, Mutter braucht ihn.
Es fühlt sich an wie eine versteckte Energie, die unbedingt nach draußen entweichen möchte. Ein Kribbeln, das die Seele anstachelt weiterzumachen. Seinen ganzen Zorn brüllt Jaron den Gors entgegen. Absolut ohne Kontrolle über seine Emotionen muss er dieser befremdlichen Energie in seinen Adern freien Lauf lassen. Er verspürt, wie ein gewaltiger Druck durch seine Brust, dann durch seine Arme und anschließend durch seine Hände entweicht. Kleine weiße Blitze, fast wie kurz aufflackernde Funken, gleiten über seine Haut. Der Boden bebt unter seinen Füßen. Eine magische Druckwelle, so brachial wie ein Donnerschlag, prescht durch das Haus. Ein grelles Licht schnalzt durch den Gang und fegt alles fort, was dem Blitz entgegensteht. Die Gors werden durch die Luft geschleudert. Die Eingangstüre sowie das Elternschlafzimmer werden weggerissen. Holzbalken und Trümmerteile zersplittern in alle Himmelsrichtungen und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Aufgewirbelter Staub, so dicht, dass man kaum noch etwas erkennen kann, umgibt das zerstörte Haus. Jaron wird von der Druckwelle einige Meter weit nach hinten durch die Hauswand katapultiert.
Halb verdreht im Matsch liegend, kommt Jaron wieder zu sich. Fassungslos, was da gerade passiert ist, rappelt er sich langsam auf. Sein gesamter Körper schlottert vor Panik. Er ist übersäht mit Schnitten und Schrammen.
„Was zum ... war… war das etwa gerade ich?“
Verblüfft, ohne auch nur den blassesten Schimmer einer Ahnung zu haben, wie oder was das gerade war, sieht er sich um. Jaron torkelt durch die dichte Staubwolke, um vielleicht Mutter oder Dhara zu finden. Vorsichtig wagt er sich mit zittrigen Beinen ein paar Schritte nach vorne.
„Mutter – wo bist du?“, ruft Jaron verzweifelt.
Soweit das Auge reicht, liegen nur die Trümmer seines einstigen Zuhauses vor ihm. Als wäre ein Orkan über das Haus hinweggefegt, befindet sich kein Möbelstück mehr an seinem Platz.
„Was, verflucht nochmal, war das gerade?“ Jaron schüttelt ungläubig den Kopf.
Er sieht seine Hände an, die sich wie paralysiert und taub anfühlen. Wenn er genau hinschaut, kann er noch weiße Funken zwischen den Fingern tanzen sehen. Schwer vor Angst schluckend, schlurft Jaron weiter durch das ehemalige Haus.
„Irgendwo hier sollte eigentlich unsere Küche sein“, murmelt Jaron vor sich hin. „Das Haus kann jede Sekunde einstürzen – ich muss mich beeilen.“
Dicke Dachbalken krachen von oben herab und wirbeln erneut Staub auf. Das Einzige, das von der Küche noch übriggeblieben ist, ist der wuchtige schwarze Ofen in der Ecke des Raumes.
„Hallo! – Mutter, Dhara! Kann mich jemand hören?“, ruft Jaron erneut im trüben Morgenlicht nach ihnen. Sekunden der Stille. Plötzlich eine leise Antwort links von Jaron, außerhalb des Hauses.
„Ich bin hier draußen Jaron! Lauf zum Fluss, dort treffen wir uns!“ Der Stimme nach muss es Mutter sein. Jaron atmet einmal kurz und erleichtert auf, dann klettert er über das restliche Trümmerfeld, das verteilt im Vorhof liegt. Heute Nacht ist es bitterlich kalt. Der Winter scheint rasch näher zu kommen. Jaron kann bereits seinen Atem in der frischen Luft erkennen, als er über den letzten zerstörten Holzbalken klettert. Aus der Staubwolke entkommen, blickt er sich schnell um und erspäht Mutter am anderen Ende des Hofes – zirka 30 Meter westlich von ihm. Sie deutet Jaron mit hektischer Handbewegung, dass er sich schnell aufmachen soll, um zum Fluss zu gelangen. „Geht es dir gut Mama?“, ruft Jaron ihr zu. „Wo ist Dhara? Hast du sie gesehen?“
Plötzlich ertönt das Posaunen eines Schlachthornes in der schwarzen Finsternis.
Mehrere winzige Lichter, die in der Ferne anfangs wie kleine Kerzen aussehen, stellen sich als ein Meer aus Fackeln dar. Unzählige Gors marschieren über eine Hügelkuppe in Richtung des zertrümmerten Hauses. Allesamt Bestien mit glühenden Augen und mit angespitzten Knochenresten verzierten Körperteilen, stolz die Schädel anderer Lebewesen als Schmuck tragend.
In der rabenschwarzen Nacht, kombiniert mit dem dichten Staub, hat Esther die nahende Gefahr zu spät erkannt und kann nicht mehr rechtzeitig flüchten. „Hinter dir! Lauf weg!“, brüllt Jaron seiner Mutter noch entgegen, doch vergebens. Mehrere der Tiermenschen haben sie bereits umzingelt und mit geschickten Knüppelschlägen außer Gefecht gesetzt. Esther verliert das Bewusstsein und ein Gor mit Ziegenschädel hievt sie sich auf die Schulter. Zuerst will Jaron ihr zur Hilfe eilen, doch sein innerer Instinkt mahnt ihn zur Vorsicht. Ein ähnliches Kitzeln wie jenes, bevor die Druckwelle durch das Haus fuhr, kann er wieder spüren. Wie ein sechster Sinn, der ihn zu warnen versucht, dorthin zu gehen. Er würde sich damit nur selbst opfern, ohne wirklich helfen zu können. Jaron ballt seine Hände zu Fäusten. Er fühlt sich in diesem Moment so schwach und hilflos wie ein Kind. Vielleicht hatte Vater ja doch Recht und er ist noch eines. Gar nicht bereit für die weite Welt.
„Was soll ich nur machen, ich kann sie doch nicht einfach im Stich lassen?!“
Ein Blick zur Seite und er sieht, dass die Tiermenschen noch mehr Menschen aus den umliegenden Dörfern gefangen haben. Die Bestien schleifen mindestens zwei Dutzend Menschen, die gefesselt winseln und jammern, hinterher. Erschrocken über das, was sich vor seinen Augen abspielt, gefriert das Blut in Jarons Adern. Er setzt einen Schritt zurück. Jaron kennt einige dieser Menschen.
„Jaron, verschwinde!“, ruft ihm jemand zu.
Es ist Dhara. Sie wird gerade von einem der Kuhschädelviecher zu Boden gedrückt und an Armen und Beinen gefesselt. „Lauf, verdammt nochmal, endlich weg!“
Mit einem kräftigen Knüppelschlag gegen ihren Kopf wird sie handlungsunfähig gemacht. Bewusstlos verschwindet sie in einem großen Sack. Ein Surren reißt Jaron aus seinen Gedanken. Ein rostiger Pfeil eines Gors verfehlt nur knapp seine Hüfte. Gleich darauf schlagen zwei weitere vor seinen Füßen ein. Die Tiermenschen haben begonnen, einen Pfeilhagel auf Jaron zu richten.
„So eine elendige Scheiße! Wie konnte das nur alles passieren…?“ Jaron weicht zurück. Er muss Abstand gewinnen, sonst wäre er der nächste.
„Ich kann doch nicht Mutter und Dhara im Stich lassen – was soll ich nur tun? Ich muss nach Furtwind und Hilfe holen. Wie Vater sagte – mir bleibt nichts anderes übrig!“
Jaron nimmt seine Beine in die Hand und läuft so schnell wie möglich zum Fluss, vorbei an mehreren großen Felsen und geschickt durch die dichten Sträucher. Er kennt hier jeden Winkel und die besten Abkürzungen. Die Gors werden Mühe haben, ihn zu verfolgen. Vater hat gewusst, dass die Tiermenschen Wasser hassen und nicht schwimmen können. Deshalb wollte er, dass wir in Richtung des Flusses fliehen. Während Jaron wie ferngesteuert zum rauschenden Fluss sprintet, laufen ihm Tränen übers Gesicht. Er hat gerade alles in seinem Leben verloren – einfach alles! Seine zerschundenen Beine pochen vor Schmerzen. Dutzende Schürfwunden machen jede Bewegung zur Qual.
Man kann das Brausen des Flusses bereits hören. Es ist nicht mehr weit. Wieder reißt Jaron blitzartig ein Surren aus seinen Gedanken. Ein Pfeil rast knapp an seinem Kopf vorbei. Erschrocken stolpert er über eine Wurzel.
„Es kann doch nicht sein, dass die mir immer noch so knapp auf den Fersen sind. Was ist bloß in diese Kreaturen gefahren?“, flucht Jaron und rappelt sich wieder auf. Er beginnt, wie ein Hase im Zickzack zu rennen.
„Da ist der Fluss – wenn ich es ans andere Ufer schaffe, bin ich in Sicherheit…“
Jaron nimmt Anlauf und springt in einem weiten Bogen auf den ersten Felsen, der aus dem Wasser ragt.
„Jetzt ja nicht das Gleichgewicht verlieren“, redet er sich aufmunternd zu. Der Fluss ist in etwa fünfzehn Meter breit und nahe dem Ufer auch relativ ruhig, jedoch wird die Strömung in der Mitte so stark, dass selbst die geschicktesten Schwimmer Schwierigkeiten hätten, sollten sie hineinfallen.
Jaron hüpft panisch von Stein zu Stein. Wieder ertönt hinter ihm dieses Schlachthorn. Ein dumpfes Grölen mit einem unverwechselbaren, markerschütternden Klang. Jaron dreht sich um und erkennt, dass sich bereits mehrere Tiermenschen am Ufer aufgereiht haben und ihn amüsiert anstarren. Unter der Meute ist auch das bullig graue Ungetüm, das Vater mit der Axt erschlagen hat. Jarons Zorn brodelt auf, als er den Stier sieht. Eines Tages wird er sich rächen! Ein Grunzen und Schreien ist von der Masse der Gors zu hören. Kurz darauf prasseln unzählige Pfeile dicht neben Jaron ins Wasser. Er ist bereits in der Mitte des Flusses angekommen. Das Wasser spritzt ihm ins Gesicht. Nur noch unter allergrößter Anstrengung kann sich Jaron auf dem Felsen halten. Der nächste Sprung ist entscheidend. Wenn er den schafft, ist die Strömung nicht mehr so stark und Jaron kann den Rest in Sicherheit schwimmen. Auf den Stein fokussiert, stößt Jaron sich mit aller Kraft ab. Da rutscht ihm plötzlich sein linkes Bein auf dem glitschigen Boden weg und er knallt mit voller Wucht mit dem Gesicht voran gegen einen scharfkantigen Felsen. Als er im Fluss landet, zerrt ihn die starke Strömung immer wieder unter Wasser. Bilderfetzen von seiner Familie flimmern durch seinen Kopf, bevor er allmählich das Bewusstsein verliert. Der Fluss drückt ihn unter Wasser, wie ein Sog, aus dem es kein Entkommen gibt. Jaron kämpft um jeden Atemzug. Jede Bewegung entscheidet über Leben und Tod. Letztendlich verliert Jaron den Kampf. Seine Kraft schwindet. Der tosende Fluss ist einfach zu stark. Stille und Dunkelheit umhüllen Jaron. Er fühlt sich leicht wie eine Feder – schwerelos treibt er ins Nichts…
Jaron sieht eine alte, in verschiedenfarbige Stoffe gehüllte Frau vor ihm stehen. Manche neue – vieles aber zerlumpte Fetzen. Sie zeigt auf etwas ... etwas Undeutliches. Alles ist so verschwommen und unklar. Dann ein pechschwarzer Kessel. Darin befindet sich giftig violettes Gebräu. Dann ein schwarzes Nichts .... Sehr, sehr lange ein Nichts…
Blendende Strahlen, die sich langsam zu etwas formen. Sieht aus wie ein – Amulett. Stille. Weit und breit nur eine bedrückende Leere.
2
Eine komische Konstellation
Schwer nach Luft ringend, Wasser und Speichel spuckend, öffnet Jaron am Boden liegend, den Kopf noch halb im matschigen Sand vergraben, die Augen.
Der Kopf dröhnt vor Schmerzen, ein Pochen wie hundert Trommelschläge, Arme und Beine sind schwer wie ein Sack Kartoffeln.
„Was war das eben? Ein Traum? Dafür schien es schon fast zu echt ... Lebe ich überhaupt noch? Der Fluss hat mich mitgerissen .... Wo bin ich?“, fragt er sich und dreht sich langsam auf den Rücken, um den Himmel sehen zu können. Mittlerweile ist es hell geworden – um die Mittagszeit ist es, stellt er grübelnd fest, da die Sonne gerade am höchsten steht. Jaron hat es in eine kleine Flussmündung geschwemmt. Die starke Strömung spülte ihn glücklicherweise an Land. Um ihn herum ist ein dichter Nadelwald. Große Tannen, die einen kaum mehr als zehn Meter sehen lassen. Mühsam rappelt er sich auf und bemerkt eine etwas dickere, gräuliche Wolldecke, die auf ihn gelegt worden ist. Verwundert hebt er die Decke hoch und sieht sich in der Gegend um. Da hört er hinter sich eine Frauenstimme.
„Willkommen zurück, Kleiner. Hast es wohl wieder zurück zu den Lebenden geschafft – gratuliere.“ Jaron dreht sich erstaunt um und erblickt ein paar Meter weiter eine Elfin, die vor einem Lagerfeuer sitzt und dabei irgendwelche merkwürdigen Handbewegungen gegen das Feuer macht. Jedes Mal, wenn sie gewisse Handzeichen vollführt, flackern die Flammen mal mehr mal weniger auf und ab. Kleine weiße Blitze zwischen ihren Fingern sind zu sehen, die wie wild hin und her springen.
„So was nennt man Magie, Kleiner. Kennst du aber bestimmt schon, du spürst es schließlich auch“, hört Jaron sie sagen, während sie ihren Blick starr ins Feuer richtet.
Er steht langsam und vorsichtig auf, reibt sich den Sand aus den Augen und sieht die fremde Person musternd an. Die Elfin hat langes, etwas zerzaustes hellbraunes Haar mit für Elfen typischen Spitzohren, die hindurch schimmern.
Sie ist um die 1,70 Meter groß, schlank und jede Bewegung, die sie macht, sieht so aus, als würde sie genau darauf achten, wie sie mit ihrer Umgebung, der Natur, umzugehen hat. Die Elfin trägt mehrere Schichten von Stofflumpen in allen möglichen Braun- und Grautönen und einen dickeren schwarzen Pelz um den Rücken. Um ihren Bauch hat sie ein Seil gebunden, an dem mehrere kleine Stoffbeutel befestigt sind.
„Magie? Ich habe davon gehört, nur bin ich ganz bestimmt kein Zauberer“, erwidert Jaron.
„Nein – das bist du ganz bestimmt nicht, Kleiner“, lacht die Elfin und sieht Jaron an. „Um ein Zauberer zu sein, müsstest du die Grundlehren der hellen sowie der dunklen Magie kennen und das tust du bestimmt nicht. Jedoch sehe ich, wenn jemand eine gewisse Begabung hat. Jetzt sag mir, was du da vorhin geträumt hast. Irgendwas hast du von einem Kessel und einem Amulett gestottert, richtig?“ Der freundliche Gesichtsausdruck der Elfin verwandelt sich in eine ernste Mimik.
„Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Da war eine alte Frau, die auf etwas gezeigt hat ... und ein pechschwarzer Kessel. Nur war alles zu verschwommen“, antwortet Jaron, ohne weiter in Frage zu stellen, wieso sie das so genau wissen will.
„Ich muss zurück“, hustet er, sein Mund dabei noch von Sand umrandet. „Ich muss zurück und sie finden…“ Benommen blinzelt er den Fluss entlang und überlegt, wie lange er wohl davongetrieben ist. Er muss sich beeilen, die Gors könnten schon längst weitergezogen sein. Seine Chancen, Mutter und Dhara zu befreien, werden mit jeder Minute, die verstreicht, geringer.
Der starre Ausdruck der Elfin wandeln sich wieder zurück zu einem leichten Schmunzeln.
„Du scheinst noch etwas verwirrt zu sein, aber so wie du aussiehst, wundert mich das auch nicht. Hast dir wohl ziemlich den Kopf angestoßen. Egal, sei es drum. Leistest du mir Gesellschaft und setzt dich zu mir ans Feuer? Dann kannst du mir berichten, woher du kommst. Du bist bestimmt hungrig und der Fisch, den ich heute Vormittag gefangen habe, müsste gleich fertig sein. Mein Name ist übrigens Lilith. Sehr erfreut, Kleiner.“
Sie streckt die Hand in Richtung eines freien Platzes aus. Jaron nickt und setzt sich mit knurrendem Magen zu ihr. Erschöpft und hungrig wie er ist, kann er gerade noch aufrecht sitzen, ein Happen zwischen seinen Zähnen kommt ihm da nur gelegen.
„Ich heiße Jaron, freut mich, dich kennen zu lernen. Nur nenne mich bitte nicht mehr Kleiner. Ich bin größer als du und recht viel älter als ich wirkst du auch nicht“, brummt er zu Lilith.
Scheinbar amüsiert von Jarons Aufmüpfigkeit antwortet sie entrüstet.
„Sieh an – sieh an! Der Herr hat Ansprüche, wie ich mich zu verhalten habe.
Nun gut … ‚Kleiner‘ ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck – bitte verzeih mir. Ich taufe dich besser auf den Namen ‚Jüngchen‘, denn ich bin 162 Jahre alt und du bist bestimmt jünger als ich – oder liege ich da etwa auch falsch?“ Auf eine Diskussion hat Jaron jetzt keine Lust. Viel zu schlimm sitzt ihm der Schock des gestrigen Abends noch in den Knochen. Betrübt von all dem Schrecklichen, das letzte Nacht passiert ist, sieht Jaron wie in einer Art Trance versunken ins Feuer. „Was soll ich jetzt nur machen? Vater schrie in seinen letzten Atemzügen, dass wir nach Furtwind fliehen sollen. Aber wieso ... wir haben dort keine Verwandten oder Freunde. Vor allem ist das hoch in den Bergen – da ist es arschkalt! Vielleicht wegen des dort herrschenden Königs Ulrik? Er soll ein geselliger Herrscher sein und sehr großzügig in Sachen Hilfe für die ärmeren Leute.“
Jaron überlegt, was er über die Stadt weiß, und stellt schnell fest, dass es nicht gerade viel ist. Furtwind ist eine Handelsstadt hoch in den Bergen, umringt von eisiger Kälte und permanentem Schnee. Die Route über die Kleinstadt ist der kürzeste, aber auch gefährlichste Handelsweg zwischen den zwei Großmetropolen Gurreth im Westen und Aggamar im Osten. Man sagt, die Leute dort seien von harscher Natur, doch stets gastfreundlich gegenüber Fremden. Seit unzähligen Jahren herrscht dort eine Königsfamilie, an deren Spitze König Ulrik thront.
Die Baumkronen über Jaron und Lilith bewegen sich im Wind hin und her, als würden sie mit ihnen sprechen oder im Takt tanzen wollen. Man hört Vögel zwitschern und den nahen Bach plätschern.
„Ey, das war doch nur ein Scherz, Jüngchen. Brauchst nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielen. Ihr Menschen seid doch echt ein komisches Völkchen.“ Liliths Faust klopft leicht gegen Jarons Schulter.
Er wendet seinen Blick zur Elfin.
„Nein, keine Sorge. Mein Kummer kommt von woandersher.“ Er seufzt ein weiteres Mal. „Gestern Nacht wurden wir ohne Vorwarnung von Gors angegriffen. Mein Vater starb beim Versuch uns zu beschützen. Meine Freundin und meine Mutter wurden von den Bestien entführt. Nur ich konnte es knapp schaffen zu fliehen.“
Seine Augen und Mundwinkel werden schwer – diese Leere ist unerträglich.
„Ach, du heilige Elmytia, das tut mir leid für dich.“ Lilith sieht Jaron besorgt an und rückt ein Stück näher zu ihm. „Was hast du jetzt vor? Irgendeinen Plan? Kennst du vielleicht Leute, die dir helfen könnten?“
Jaron antwortet mit zittriger Stimme, kaum sich selbst glaubend, einen richtigen Plan zu verfolgen. „Nach Furtwind will ich – oder muss ich. Dort suche ich nach Hilfe. Ich wüsste nicht, wo ich sonst hingehen könnte.“
Lilith legt aufmunternd ihren Arm um seine Schulter. „Eine Person als Unterstützung hast du schon. Ich werde dich begleiten. Muss ohnehin in die Stadt. Hab’ dort was zu erledigen und da kann ich dich ja begleiten. So ein Jüngchen wie du, vor allem in deinem Zustand, würde die Reise in 100 Jahren nicht schaffen. Lass uns in ein kleines Dorf, einen halben Tagesmarsch von hier, gehen. Dort übernachten wir und organisieren uns etwas Proviant und Ausrüstung für unsere Reise.“
Lilith holt den Fisch aus dem Feuer, wickelt ihn aus den Blättern, breitet diese wie einen Teller aus und überreicht Jaron das Essen. Müde lächelnd bedankt er sich mit einem Kopfnicken und stürzt sich auf das Essen wie ein Rudel hungriger Wölfe.
„Ja – lass uns das so machen“, antwortet Jaron, mit vollem Mund schmatzend.
„Nur, was musst du in Furtwind erledigen – wenn ich fragen darf? Du siehst mir nicht wie eine Händlerin oder dergleichen aus. Vor allem wirkt es, als würdest du schon lange hier in den Wäldern leben. Jetzt freiwillig in die eisigen Berge zu gehen, erscheint mir etwas waghalsig.“
Nun sieht Lilith, wie zuvor Jaron, betrübt ins Feuer und antwortet nach einer kurzen Pause. „Ich lebte lange Zeit unter den Menschen. Genauer gesagt, in einem reichen Dorf nahe der Stadt Gurreth. In der Dorfmitte gab es ein kleines Schloss. Dort arbeitete ich am Hof und war für alles Mögliche zuständig. Angefangen vom Empfang Adeliger und Reisender, die dem Gold hinterherjagten, bis hin zum Aushelfen in der Küche – falls dort Not am Mann war. Ab und zu musste ich sogar auf Kinder aufpassen, wenn deren Eltern eine Geschäftsbesprechung hatten. Ich war dort quasi Mädchen für alles. Immer wieder fielen mir die Machtkämpfe der Leute auf. Einer hatte angeblich das bessere Reittier, der nächste das schönere Haus und der dritte besaß sowieso das meiste Gold und Silber. Den juckten materielle Dinge nicht mehr und er sammelte daher nur noch magische Artefakte. Diese Machtdemonstrationen schwankten irgendwann in boshafte Intrigen über. Niemand vertraute mehr dem anderen. Jeder schaute voll und ganz auf sich selbst, um irgendwie noch reicher und mächtiger werden zu können. Zwerge wurden mit diversen Kräutern im Bier noch betrunkener gemacht, damit sie Verträge unterschrieben, die sie anschließend ruinierten. Orks wurde gegen eine stattliche Anzahlung Gold eine Schatzkarte verkauft, die sie in die Höhle einer Chimäre lockte, wo sie lediglich ihr Ende fanden. So ging das Ränkespiel Tag für Tag – Monat auf Monat. Ich konnte das irgendwann nicht mehr mit ansehen und entschied mich ein Leben als Einsiedlerin im Wald zu führen. Schön ruhig, weit weg von all dem Mist der Adligen. Einfach nur im Einklang mit der Natur leben. Um deine Frage von vorhin zu beantworten, warum ich nach Furtwind möchte – wieder unter das ganze Gesindel der Handelsleute, die ich mittlerweile so sehr verabscheue. Seit einigen Wochen gibt es dort in der Stadt angeblich eine Gruppierung an Elfen, die im Besitz eines magischen Artefaktes sind. Ich belauschte Wanderer, die darüber sprachen. Angeblich sei dieser Gegenstand ein Amulett mit einem eingepressten roten Stein in der Mitte und dieses Amulett sehe ich seit Wochen in meinen Träumen. Ich spüre, wie es mich von Tag zu Tag stärker zu sich ruft. Diese Träume, die ich habe, sind mehr als das. Etwas Magisches steckt dahinter und ich muss herausfinden, was das bedeutet.“ Lilith wirft ihren Blick auf Jaron, der seinen Fisch bereits fertig verschlungen hat. „Als du bewusstlos warst, hast du von demselben Amulett gesprochen, das mich die ganze Zeit über in meinen Nächten verfolgt. Es kann kein Zufall sein, dass wir heute aufeinandergetroffen sind – deshalb werde ich dich begleiten.“ Jaron nickt Lilith entschlossen zu, auch ein klein wenig erleichtert, dass er den Weg nicht allein meistern muss.
„Lass uns aufbrechen“, meint Jaron Mut fassend. „Einen halben Tagesmarsch bis zum nächsten Dorf hast du gesagt? Wenn wir jetzt losgehen, schaffen wir es womöglich noch vor Einbruch der Dämmerung.“
Lilith löscht das Feuer, indem sie ihre Hand über die Flammen hält und mit einer für Jaron komisch aussehenden Bewegung wegwischt. Er sieht, wie kleine blauweiße Blitze zwischen ihren Fingern herumhüpfen, als einen Wimpernschlag später das Feuer erlischt. Fasziniert und gespannt, beobachtet Jaron das Geschehen. „Du musst mir unbedingt mal zeigen, wie das geht.“
„Ist gar nicht so schwer, Jüngchen. Ist nur ein bisschen Übung. Nun komm, wir haben einen weiten Weg vor uns“, lacht die Elfin und wischt mit ihren Füßen Sand auf die letzten Glutreste.
Der Himmel ist wolkenlos. Gar nicht zu glauben, dass es schon Mitte Herbst ist und der Winter nicht mehr in allzu weiter Ferne. Die beiden wandern einen breiten Waldweg entlang, wo Kutschen des Öfteren entlangfahren. Auf beiden Seiten des Weges sind tiefe Radspuren im Matsch zu erkennen.
„Nicht mehr lange“, meint Lilith, „bald werden wir beim Dorf ankommen. Es müsste gleich da hinter diesem Hügel sein.“
Jaron hört unter seinen Füßen das Knacken morscher Äste. Es erinnert ihn an den Moment, an dem er sein halbes Haus mit einer Druckwelle weggerissen hat. Er ist noch immer verblüfft, wie er das angestellt haben könnte. Jaron hebt seine Hände und konzentriert sich nochmal ganz stark auf dieses komische Gefühl, das er verspürte, bevor er die Kontrolle verlor.
„Ja, Jüngchen – du hast zwei kindlich schöne Hände. Du kannst jetzt aufhören, sie anzustarren, sonst bekomme ich noch Angst vor dir, weil du vielleicht doch nur ein verwirrter Mensch bist“, verspottet Lilith Jaron und streckt ihm die Zunge heraus. „Haha, sehr witzig, Fräulein“, antwortet Jaron. „Halte doch lieber Ausschau nach irgendwelchen Kräutern oder so. Ich versuche zu verstehen, wie das mit der Magie funktioniert.“
Die Elfin beginnt lauthals zu lachen. „Man kann Magie nicht einfach so verstehen. Du musst sie tief in deiner Seele spüren. Dein Körper und Geist müssen vollends dafür bereit sein. Manche suchen und üben dafür jahrelang ohne Erfolg. Magie ist in gewisser Weise etwas Unerklärliches. Manche können es und manche nicht. Vielleicht wirst du eines Tages ein mächtiger Zauberer oder du hast nur einen einmaligen Schub, der sich nicht mehr wiederholt. So ist das nun mal mit der Magie – alles sehr ungewiss.“
Die beiden gehen den Weg immer weiter entlang. Vorbei an den zerfallenen Ruinen alter Könige, deren Namen längst vergessen wurden. Sie klettern über riesige, umgestürzte Bäume, die ihnen den Weg versperren, bis sie zu einer freien Wiese kommen, an deren Horizont sie ein Dorf umringt von Feldern sehen können.
„Bald geschafft, mir knurrt schon der Magen“, meint Lilith.
Jaron nickt zustimmend, als er links aus dem Wald jemanden wüst fluchen hört.
„Halt deine Schnauze, Madenwurm! Elendiger Bastard einer Prostituierten! Ich reiße dir die Zunge raus, du absolut hässlicher Mensch!“ Verblüfft von dem Geschrei, drehen sich die beiden zum Waldrand und versuchen zu erspähen, was dort vor sich geht. Sie erkennen einen Wicht, der mit Armen und Beinen wild herumfuchtelt und der mit einem älteren Herrn mit langem weißem Bart vor einer heruntergekommenen Holzhütte energisch diskutiert. Der alte Mann hebt schützend beide Hände und deutet immer wieder eine beruhigende Geste an.
„Bitte beruhigen Sie sich doch, werter Gnom. Ich versichere Ihnen, dass ich niemanden gesehen habe, der auf Ihre Beschreibung passen könnte.“
„Hast du mich etwa gerade Gnom genannt!?“, faucht der Wicht mit angeschwollenem, knallrotem Kopf, als würde er gleich explodieren. „Sehe ich etwa wie ein scheiß verfickter Gnom aus? Ich bin ein Zwerg mitten in der Blüte seines Lebens und du bist ein alter Sack, der, wenn er nicht aufpasst, nicht an Altersschwäche, sondern an einer von mir herausgebissenen Gurgel stirbt! Würde dir das gefallen?“
Erstaunt, wie ohrenbetäubend so ein kleines Wesen fluchen kann, gehen Jaron und Lilith auf die beiden zu. Der Herr wirkt offensichtlich komplett mit der Situation überfordert. Er versucht immer wieder, die Lage zu beruhigen und erklärt, dass man normal darüber sprechen könne, doch dabei verfällt der Wicht nur noch mehr in Raserei. Auf der Stirn des Herrn bilden sich Schweißperlen, die über seine Schläfe hinunterlaufen, die Stimme wird immer banger. Der Wicht ist kaum größer als ein Schäferhund, so klein, dass man ihn übersehen könnte, wenn er nicht so laut brüllen würde. Ein äußerst untypischer Zwerg, wenn man ihn mit seinen Artgenossen vergleicht. Er hat keinen stämmigen Körperbau mit dickem Bauch, sondern eine eher schmächtige, fast schon magersüchtig wirkende Hühnerbrust, auch keinen dichten, langen, mit Runen geschmückten Bart, sondern eher ein kurzes, fusseliges Gestrüpp, das im Gesicht irgendwie fehl am Platz wirkt. Borstige, dunkle Augenbrauen, die die eingefallenen Augenhöhlen hervorheben, dominieren sein Gesicht. Er hätte zwar eine relativ schöne Gewandung an, Lederhose kombiniert mit einem grauen Baumwollshirt und dazu passende braune Stiefel, wenn sie nicht von oben bis unten dreckig und zerlumpt wäre.
„Ähm – können wir euch vielleicht irgendwie helfen, werte Herren?“, fragt die Elfin, schmunzelnd über den Anblick. „Wir haben euch vom Wegesrand aus gehört. Ist alles ok bei euch?“ Sie ist ein wenig belustigt von dem Schauspiel, das sich gerade hier auftut, und blickt bei der Frage, ob alles gut sei, eher in Richtung des alten Mannes.