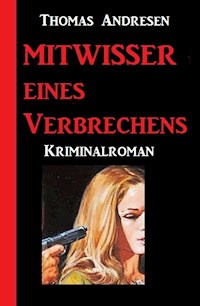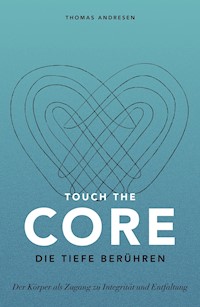5,99 €
Mehr erfahren.
Maximilian Beltz, ein junger Millionär, soll ermordet werden. Das jedenfalls hat irgendwer aus seinem engsten Familienkreis beschlossen. Es gibt Beweise dafür...
Aber wer?
Seine schwerkranke Frau? Seine Geliebte? Die herrschsüchtige Mutter? Der Obermedizinalrat, Hausarzt und Freund der Familie Beltz?
Es gibt mehr mögliche Täter und Motive, als Maximilian Beltz glaubt...
»Dieser Autor kann sich mit international bekannten Namen messen.«
(Abendzeitung, München)
Der Roman Geisterstunde des Schriftstellers und Arztes Thomas Andresen (* 19. September 1934 in Flensburg; † 20. Januar oder 20. Oktober 1989 ebenda) erschien erstmals im Jahr 1972.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der deutschen Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
THOMAS ANDRESEN
Geisterstunde
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
GEISTERSTUNDE
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Maximilian Beltz, ein junger Millionär, soll ermordet werden. Das jedenfalls hat irgendwer aus seinem engsten Familienkreis beschlossen. Es gibt Beweise dafür...
Aber wer?
Seine schwerkranke Frau? Seine Geliebte? Die herrschsüchtige Mutter? Der Obermedizinalrat, Hausarzt und Freund der Familie Beltz?
Es gibt mehr mögliche Täter und Motive, als Maximilian Beltz glaubt...
»Dieser Autor kann sich mit international bekannten Namen messen.«
(Abendzeitung, München)
Der Roman Geisterstunde des Schriftstellers und Arztes Thomas Andresen (* 19. September 1934 in Flensburg; † 20. Januar oder 20. Oktober 1989 ebenda) erschien erstmals im Jahr 1972.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der deutschen Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
GEISTERSTUNDE
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Der Mord geschah noch nicht am Heiligabend. Aber das Geschehen, das sich bis dahin im Verborgenen abgespielt hatte, wurde entdeckt. Onkel Hubert schaute seinem Neffen Maximilian Beltz fest in die Augen und flüsterte: »Mäxi, du sollst ermordet werden!«
Mäxi wehrte ärgerlich ab. Ja, Ärger und Abwehr waren seine ersten Reaktionen. Ich, Maximilian Beltz, soll ermordet werden?
»Ach, Unsinn, du alter...« Quatschkopf, hatte er sagen wollen. Aber seine vielgerühmte Liebenswürdigkeit bremste noch rechtzeitig. Er schaffte die Kurve zu einem netteren Wort: »...Kriminalist! Du alter Kriminalist, du!«
Onkel Hubert lächelte kurz, aber geschmeichelt. Alter Kriminalist. Ich alter Kriminalist. Ich, der große, alte Kriminalist. So vollendete er wahrscheinlich Mäxis nette Anrede. Mit dieser selbstgefälligen Reaktion hatte Mäxi gerechnet, obgleich es ihn immer wieder wunderte, dass Onkel Hubert derart dünne Schmeicheleien überhaupt noch annahm. Denn nach seiner Meinung hatte der 78jährige pensionierte Polizeibeamte mit seiner Angeberei bereits das Niveau des Größenwahns erreicht.
Dem kurzen Lächeln ließ Onkel Hubert eine wichtige Geste folgen. Er hob den Zeigefinger. »Unsinn, sagst du?«
Widerspruch, der sich zum Zerpflücken anbot, ermunterte ihn. Mäxi fiel auf, dass dem erhobenen Zeigefinger nicht die Spur eines vergreisten Zitterns anzumerken war. Die Sensation eines greifbaren Mordverdachts schien Onkel Hubert zu verjüngen.
In der Tat schüttelte Mutters Bruder Hubert, der angebliche Kopf einer legendären Berliner Mordkommission, nun alle Symptome der senilen Verblödung ab und führte den Beweis.
»Mein lieber Mäxi, lass es dir beweisen! Punkt eins: der Martini. Stellen wir die Flasche sicher! Komm mit! Aber sei leise! Noch darf niemand etwas merken. Klar?«
Mäxi nickte.
»Gut so!«, lobte Onkel Hubert leise. »Also, Punkt eins: der Martini. Wohin hast du die Flasche getan, nachdem du dir deinen Schlaftrunk eingeschenkt hast?«
»Zurück in den Kühlschrank«, hauchte Mäxi.
»Finger weg von der Türklinke!« mahnte Hubert Leipzig, bereits ganz Chef einer gerade wieder ins Leben gerufenen Mordkommission. »Denk an die Fingerabdrücke! Der Täter muss hier im Kriminalmuseum gewesen sein. Möglich, dass wir seine Fingerabdrücke auf der Türklinke finden. Warte, bis ich mir meine Seidenhandschuhe übergezogen habe, die ich bei der Spurensicherung stets trage. Jetzt macht es sich bezahlt, dass ich all das alte Gerümpel hier oben aufgehoben habe.«
Das alte Gerümpel! Dass Onkel Hubert plötzlich zu einer solchen Distanzierung von seinem eigenen sogenannten Kriminalmuseum fähig war, erschreckte Mäxi. War Onkel Hubert tatsächlich verwandelt? Wie unwirklich! Konnte dies alles nicht ein Alptraum sein? Musste es nicht ein Traum sein, wenn Onkel Hubert das Zentrum seiner heutigen Welt, dieses lächerliche Wahngebilde eines Kriminalmuseums, als Gerümpel bezeichne te?
Onkel Hubert hatte den mittleren Glasschrank geöffnet und streifte sich nun die Seidenhandschuhe über.
»Folge mir in die Küche!«, befahl er.
Nein, es war kein Alptraum. Es war eine unfassliche Wirklichkeit. Onkel Hubert öffnete die Tür und lauschte. »Die anderen scheinen zu schlafen«, flüsterte er, »bis auf den Mörder. Der wird wach liegen und auf deinen Tod warten. Aber das können wir ihm nicht beweisen. Wir werden ihn auf andere Weise überführen.«
»Wollen wir nicht bis nach Weihnachten warten?«, schlug Mäxi verstört vor.
»Was versprichst du dir davon?«
»Versprechen? Glaubst du, dass ich mir von allem etwas verspreche? Für mich heißt Weihnachten immer noch schenken! Und lieben! Vergeben der Sünden! Am Heiligabend schweigen selbst im Krieg die Waffen. Heute ist Heiligabend!«
»Das ist nett von dir, Mäxi. Großmütig. Aber dein Mörder hat sich nicht an Weihnachten gestört. Außerdem ist der Heiligabend nun vorbei. Es ist null Uhr achtundvierzig Minuten.«
Sie standen nun vor dem Kühlschrank. Onkel Hubert öffnete ihn bedächtig.
»Nur eine Flasche Martini rosso«, stellte er fest. »Kannst du sie identifizieren? Ist das die Flasche, aus der du dir deinen Schlaftrunk eingeschenkt hast?«
Mäxi nickte.
»Auf Fingerabdrücke werde ich die Flasche später untersuchen«, erläuterte Onkel Hubert, »jetzt gilt es zu klären, ob das tödliche Gift in die Flasche getan wurde oder ob der Mörder es dir direkt ins Glas schüttete.«
»Sag doch nicht immer Mörder! Noch lebe ich. Noch gibt es keinen Mörder.«
»Du hast recht. Wir werden ihn Täter nennen. Vorerst.«
Er schraubte die Verschlusskappe ab und hielt sich die Flaschenöffnung unter die Nase.
»Reiner Martini!«, urteilte er. »Die Analyse können wir uns sparen. Auf meine Nase ist Verlass. In der Unterwelt hieß es immer: Hubert Leipzig hat die beste Nase von ganz Berlin!«
Trotzdem holte er sich einen Teelöffel, goss sich darauf eine Probe Martini, schloss die Augen und tippte seine Zunge hinein.
»Wie ich schon nach der Riechprobe sagte: reiner Martini! Das Gift, mit dem die berühmte Mörderin Maria Pöhlmann zwischen neunzehnhundertneununddreißig und neunzehnhunderteinundvierzig vier Menschen tötete, hatte einen ganz schwachen formaldehydähnlichen Geschmack, den allerdings nur absolute Kenner wahrnahmen.«
»Ich habe ihn schließlich auch wahrgenommen«, bemerkte Mäxi.
»In gewisser Weise hast du recht, obgleich du natürlich im Prinzip unrecht hast. Was du herausgeschmeckt hast, war lediglich, dass der Martini anders schmeckte. Ich habe den Geschmack identifiziert als schneeglöckchenähnlich und damit... Also, mein lieber Mäxi, wir müssen schließlich differenzieren zwischen den echten Tropfen der Maria Pöhlmann, die nach Formaldehyd schmeckten, und den Herztropfen des Doktor Schlintwein, mit denen ich das leider bei einem Bombenangriff zerstörte Originalfläschchen beim Wiederaufbau meines Kriminalmuseums ersetzen musste. Schlintweins Tropfen im Martini schmeckt selbst ein Banause! Damit meine ich natürlich nicht dich. Du weißt, dass ich dich für einen Feinschmecker halte. Möchtest du dich selber überzeugen, dass der Martini rein ist?«
»Danke. Ich empfinde im Augenblick einen Widerwillen gegen Martini.«
»Fassen wir zusammen: Das vermeintlich tödliche Gift wurde nicht in die Flasche getan. Es wurde dir also entweder vorher in das noch leere Glas geträufelt, oder man tat es dir erst ins Glas, als du dir deinen Schlaftrunk schon eingeschenkt hattest. Woher nahmst du das Glas?«
»Hier aus dem Schrank. Das Glas war leer.«
»Nicht so eilig mit deiner Aussage! Drei Tropfen von Maria Pöhlmanns Gift genügten. Das wusste der Täter. Drei Tropfen im Boden eines Glases kann man übersehen! Hattest du deine Brille auf?«
»Nein.«
Onkel Hubert hatte den Schrank geöffnet und betrachtete die Gläser.
»Noch sechs gleiche Gläser«, stellte er fest. »Nimmst du immer ein bestimmtes Glas?«
»Nein, nicht dass ich wüsste. Ich nehme das erstbeste.«
»Also nicht immer das erste von links oder das erste von rechts?«
»Ich glaube nicht.«
»Rekonstruieren wir die Szene! Du trittst vor den Schrank, du öffnest ihn. Hattest du schon die Martiniflasche in der Hand?«
»Das weiß ich nicht mehr.«
»Das weißt du nicht mehr? Du bist mir ein schöner Zeuge! Also nehmen wir an, du hättest die Flasche noch nicht in der Hand gehabt. Also bitte, tritt an den Schrank, öffne ihn... Sehr schön! Ja, du öffnest den Schrank mit der rechten Hand, du greifst mit der linken Hand zu... Interessant! Das erste Glas von links! Nehmen wir an, du nimmst unbewusst immer das erste von links. Der Täter kann dich wochenlang beobachtet haben, monatelang, vielleicht jahrelang. Er studiert deine Gewohnheiten. Er stellt fest, dass du immer das erste Glas von links nimmst. Wenn diese Hypothese stimmt, dann haben wir den Täter eingekreist. Dann scheiden Obermedizinalrat Schlintwein, Fräulein Melanie Moll, Nikolaus Capablanca und Su aus. Aber wir müssen auch mit der Möglichkeit rechnen, dass der Täter in jedes der sieben Gläser drei Tropfen des aus meinem Kriminalmuseum gestohlenen Giftes tat.«
Er nahm ein Glas aus dem Schrank und hielt es prüfend gegen das Licht.
»Die Gläser sind sauber«, sagte er, »aber der Täter kann sie ausgespült haben, nachdem du mit deinem Martini auf dein Zimmer gegangen bist.«
Mäxi hatte sich erschüttert auf einen Küchenstuhl gesetzt. »Wie kommst du auf Fräulein Moll?«, fragte er. »Das ist doch alles Blödsinn! Das klärt sich bestimmt alles ganz harmlos auf.«
»So, meinst du? Armer Mäxi! Reiß dich mal zusammen und versuche, mir zu folgen. Du hast eines noch gar nicht gemerkt! Im Augenblick stehen sechs Gläser dieser Sorte im Schrank. Ursprünglich waren es zehn Gläser. Zwei hat Su zerbrochen. Blieben noch acht. Eins hast du genommen. Macht sieben. Ein Glas fehlt also.«
»Woher weißt du, wie viele Gläser wir von dieser Sorte haben? Ich weiß es nicht.«
»Ein guter Kriminalist beobachtet immer scharf und interessiert sich für alles.«
Du interessierst dich für Su, du alter Bock, dachte Mäxi. Deswegen bist du so oft in der Küche.
Su, das war Susanne Friedrichsen, das junge, schwarzhaarige Hausmädchen.
»Ich sehe, du verstehst!«, schloss Onkel Hubert hintergründig.
»Keine Spur. Was folgerst du denn aus der Tatsache, dass ein Glas fehlt?«
»Das behalte ich vorerst für mich. Wenden wir uns einer anderen Frage zu! Hatte der Täter Gelegenheit, dir das Gift in den Martini zu schütten? Hast du das Glas zu irgendeinem Zeitpunkt aus dem Auge gelassen?«
»Ja, natürlich, jetzt fällt es mir ein! Ich hatte mir gerade das Glas Martini eingeschenkt, da rief Annette nach mir. Ich hörte, dass sie schon im Schlafzimmer war. Ich ging sofort zu ihr. Das Glas ließ ich in der Küche stehen. Du weißt, dass ich nicht mit einem vollen Glas zu Annette gehen würde. Jetzt nicht mehr.«
»Sehr feinfühlig«, lobte Onkel Hubert.
Annette war Mäxis Frau. Sie litt seit drei Jahren an einer multiplen Sklerose. Aus Kummer über ihre Krankheit war sie zur Trinkerin geworden. Mäxi hatte sie erst vor zwei Wochen aus dem teuersten und besten Spezialsanatorium nach Hause geholt. Damit sie das Weihnachtsfest nicht in der Trinkerheilanstalt erlebte. So hatte er es Melanie erklärt. Melanie. Fräulein Moll. Fräulein Melanie Moll. Ein süßer Gedanke. Seine Sekretärin. Die hilfsbedürftige Waise.
»Und was wollte Annette von dir?«, fragte Onkel Hubert unpassend.
»Wieso? Was hat das mit meinem Martini zu tun?«
»Aha!« folgerte Onkel Hubert.
»Sie wollte noch ein bisschen mit mir sprechen. Ich habe ihr auch zugehört, habe selber was gesagt, ganz ruhig...«
»Du willst sagen, dass ihr keinen lauten Streit hattet.«
»Streit? Melanie liebt mich... Unsinn, Annette liebt mich, meine ich natürlich. Annette liebt mich, und ich liebe sie. Nenn mir mal einen Mann, der in dieser Situation so viel Verständnis für seine Frau hat! Soviel Mitleid, soviel Fürsorge, soviel Aufopferung! Da kannst du lange suchen.«
»Sie hat nicht zufällig wissen wollen, warum du Fräulein Moll mitgebracht hast?«
»Quatsch! Und wenn? Ich habe es ihr schon zehnmal erklärt. Vorher. Ich habe sie schließlich nicht mitgebracht und gesagt: Hier ist Fräulein Moll, du hast hoffentlich nichts dagegen, dass sie mit uns Weihnachten feiert. Ich habe Annette aufgeklärt. Ich habe ihr gesagt: Ich habe eine Sekretärin, die Vollwaise ist. Sie kann bei niemandem Weihnachten feiern, sie ist ein armes, gottverlassenes Wesen. Außerdem habe ich über die Weihnachtstage einiges zu diktieren. Praktisch hat Annette Fräulein Moll eingeladen.«
»Annette hat dich aber bestimmt vorher gefragt: Ist sie hübsch?«
»Mag sein. Wie kommst du darauf?«
»Ich bin Kriminalist.«
»Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe«, beteuerte Mäxi.
»Nein, hast du gesagt.«
»Woher weißt du das? Sag bloß nicht wieder, du seist Kriminalist!«
»Ich habe Augen im Kopf, und ich kann kombinieren. Natürlich bin ich Kriminalist. Wie konntest du so dumm sein und Annette versprechen, dieses Fräulein Moll sei gar nicht hübsch!«
»Findest du sie denn hübsch?«
»Mäxi, nun wirst du geschmacklos! Dieses Fräulein Moll ist die schönste Frau, die du seit Annette gehabt hast.«
»Die ich - was? Nun mach mal einen Punkt! Ich schwöre dir: Ich bin noch nicht mit ihr... ich habe noch nicht mit ihr geschlafen. Nicht ein einziges Mal.«
»Das wird sich ja heraussteilen«, sagte Onkel Hubert ruhig.
»Wieso? Was hast du vor?«
»Ich werde den Fall aufklären. Mein Gott, Mäxi! Versteh doch endlich, worum es geht! Jemand wollte dich ermorden! Er will es wahrscheinlich immer noch. Wir müssen den Täter finden! Sonst ermordet er dich am Ende wirklich.«
»Du musst dich irren! Es muss ein Versehen sein, ein Irrtum, irgendein ganz blöder Zufall, eine Täuschung!«
»Hör zu, Mäxi! Gestern Nachmittag habe ich alle Personen, die sich zurzeit hier in deinem Haus befinden, durch mein Kriminalmuseum geführt. Ich habe ihnen unter anderen Kostbarkeiten auch das Fläschchen mit dem Gift der berühmten Massenmörderin Maria Pöhlmann gezeigt. Ich habe allen erklärt, dass drei Tropfen davon einen Menschen töten. Niemand außer mir wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich das Gift vor zwei Jahren durch die Herztropfen unseres Obermedizinalrats Doktor Schlintwein ersetzen musste, da mir das Originalfläschchen unglücklicherweise aus der Hand gefallen und zerbrochen war.«
»Vorhin sagtest du noch, es sei bei einem Bombenangriff zerstört worden.«
»Weich nicht vom Thema ab! Dieses Gift wurde dir ohne jeden Zweifel von bisher unbekannter Hand - ich sage das, obwohl ich schon einen ganz bestimmten Verdacht habe -, von bisher unbekannter Hand also, wie ich es vorerst nennen will, in den Martini geschüttet. Ergo: Du solltest ermordet werden. Quod erat demonstrandum!«
»Onkel Hubert! Wer sollte mich ermorden wollen? Und das am Heiligabend!«
»Wie lange warst du bei Annette?«
»Na, vielleicht zehn Minuten. Oder eine halbe Stunde.«
»Also bitte, ich brauche genaue Angaben. Zehn Minuten oder eine halbe Stunde?«
»Eher eine halbe Stunde. Ich bin wie immer auf ihre Probleme eingegangen. Ich bin ihr noch nie weggelaufen.«
»Eine halbe Stunde! Hm. Dann kommen vorläufig bis auf Annette alle Personen hier im Haus als Täter in Frage. Vielleicht sogar Annette! Lass mich nachdenken!«
»Annette? Du bist ja verrückt! Sie ist meine Frau! Sie liebt mich!«
Onkel Hubert zog sein Notizbuch hervor. »Ich werde eine Liste aufstellen«, erklärte er. »Annette schreibe ich an erster Stelle, was nicht bedeutet, dass sie im Verdacht an erster Stelle steht. Ihr gebührt als Dame des Hauses der erste Platz. Der zweite Platz gehört deiner Mutter, meiner lieben Schwester Auguste.«
»Mutter? Eine Mutter soll ihren eigenen Sohn ermorden wollen?«
Onkel Hubert fuhr ungerührt fort: »Drittens: deine Schwester Rosemarie.«
»Rose? Erlaube mal! Du kannst doch nicht meine ganzen Verwandten für Mörder halten! Sind wir eine Familie von Mördern?«
»Viertens: Bertram.«
»Hör mal, Onkel Hubert! Lass wenigstens die Kinder aus dem Spiel! Bertram ist gerade fünfzehn Jahre alt! Er ist mein Sohn. Er könnte keinen besseren Vater haben als mich.«
»Ich kenne dich! Fünftens: Nikolaus Capablanca, mit dem sich deine Schwester Rose zu Silvester verloben will.«
»Jetzt verdächtigst du schon Pianisten! Ha, einen Pianisten verdächtigst du!«
»Sechstens: deine Sekretärin Fräulein Melanie Moll.«
»Also, wenn jemand keinen Nutzen aus meinem Tod zöge... Ach, Quatsch! Alles Quatsch!«
»Siebtens: unser guter Obermedizinalrat Doktor Schlintwein!«
»Dem traue ich’s zu! Aber der alte Schleimscheißer hat kein Motiv.«
»Achtens: Su, unser Hausmädchen.«
»Su? Die hat doch nicht einmal die Nerven, einen Kriminalroman zu lesen!«
»Und neuntens, last not least: meine Wenigkeit, Hubert Leipzig, Leiter der legendären Berliner Mordkommission Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre, schlachtengehärtet.«
»Sag mir ehrlich, Onkel Hubert, was könntest du gegen mich haben?«
»Mäxi, du musst selbst am besten wissen, wer von den neun Verdächtigen etwas so Böses gegen dich haben könnte, dass er dich ermorden will.«
»Niemand, Onkel Hubert! Ich schwöre dir: Niemand! Mein Gott, ohne mich wärt ihr doch alle aufgeschmissen!«
Zweites Kapitel
Mäxi hatte gar nicht unrecht. Die neun tatverdächtigen Personen waren mit starken Unterschieden, aber ohne Ausnahme Nutznießer seiner Tüchtigkeit. Und wenn das Glück im großen, weißen Haus am Sankelmarker See eine Seele hatte, dann war Mäxi ihr Schöpfer. Sie hatten es schön in dem Luxus, den er ihnen geschaffen hatte. Und am schönsten war es zu Weihnachten. Da versammelte sich die Familie hier mit ihren intimsten Freunden zu einem üppigen und stimmungsvollen Fest. In diesem Jahr sollten die Weihnachtstage zu einer besonderen Feier werden. Mäxis zwölf Jahre jüngere Schwester Rosemarie, Rose genannt, verlobte sich zu Silvester mit dem hochbegabten, erst zwanzigjährigen Pianisten Nikolaus Capablanca, einem gebürtigen Argentinier mit deutscher Mutter. Mäxis generöses Verlobungsgeschenk war bereits am Tag vor Weihnachten ins Haus gebracht worden, denn es wurde schon für die Festwoche zwischen Weihnachten und Silvester gebraucht. Ein Steinway-Flügel, trefflich platziert in der großen Halle mit dem Blick auf den See. Vorgestern Nachmittag, in der hereinbrechenden Dämmerung, hatte man sich voller Freude und Erwartung zum ersten Mal um das junge Genie und sein Prachtinstrument versammelt. Feuer im Kamin, Kerzen auf dem Flügel, Eis auf dem Sankelmarker See. Niki, so nannten sie ihn schon alle, denn wenn Mäxi eingriff, brach steife Förmlichkeit in wenigen Sätzen. »Spiel uns was, Niki! Sei so nett!«
Niki hatte zunächst nur zu einem geklimperten Morgen kommt der Weihnachtsmann in die Tasten gegriffen und auf heiteren Protest ein sehr klangvolles Morgen, Kinder, wird’s was geben gespielt (Makaber, wenn man das auf den Mordversuch bezieht, dachte Mäxi jetzt). Dann hatte Mäxi ihn zur wahren Kunst umstimmen können. Schüchtern-ungeschickt hatte Niki noch eine kleine Peinlichkeit heraufbeschworen. »Also gut, etwas Ernstes«, hatte er gesagt, »aber was? Ich bitte um Wünsche!« Für viele Sekunden hatte man nur das Knacken der Buchenscheite im Kamin gehört, dann Schlintweins Räuspern und sein Vorschlag: »Franz Liszt!«
»Und was, bitte, von Franz Liszt?«, hatte Niki gefragt. Schlintwein hatte gehüstelt. Mehr hatte er wohl nicht sagen können. Mäxi hatte schadenfroh gedacht: Der Kerl ist bereits stolz, dass er einen Komponisten weiß!
Mäxi mochte nicht mehr von Musik verstehen als der Obermedizinalrat, aber er hatte das bessere Gedächtnis. Er hatte schließlich mit sicherer Stimme bestellt: »Prelude cis-Moll von Sergej Rachmaninow!«
Mäxi hatte in diesem Jahr seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert. Er hatte schon mit sechzehn Jahren angefangen, eine Kanone zu sein. Auf dem schwarzen Markt jener Jahre hatte er phantastische Geschäfte gemacht. Zucker war damals seine Spezialität gewesen. Die Schieberkönige von damals sprechen heute noch mit Hochachtung von dem Jungen. Heute gehörten ihm zwölf Selbstbedienungsläden, acht Tankstellen und eine lukrative Luxussauna in Berlin. Wer tüchtig ist, verdient auch Geld. Wo käme unsere Wirtschaft hin, wenn es anders wäre? Diese Stellung musste er in jüngster Zeit beziehen. Es kam nämlich vor, dass Linksintellektuelle - Gäste seines Hauses - ihn nötigten, seinen Reichtum zu rechtfertigen.
Maximilian Beltz. Genannt Mäxi. Ein zärtlicher Kosename für einen so starken Mann. Aber niemand fand das widersinnig. Er war eben so nett. Selbst einem Fußtritt - und darauf verstand er sich, muss man ja auch bei der Härte des heutigen Existenzkampfes - konnte er den Anschein einer hilfreichen Geste verleihen. »Wir bleiben Freunde! Wenn ich mal irgendwas für dich tun kann, komm zu mir!« Schon mancher, den er mit diesen Worten zum Teufel gejagt hatte, hatte sich Tränen aus den Augen wischen müssen.
»Du kennst mich doch, Onkel Hubert!«, beschwor er nun den entsetzlich eifrig werdenden alten Detektiv. »Ich habe für jeden ein Ohr! Ich helfe, wo ich helfen kann! Halt mich bitte nicht für eingebildet, aber ich habe schon gehört, dass man mich als Wohltäter bezeichnet hat. Sag du mir also: Wer sollte mich nicht leiden können?«
Er war hinter Onkel Hubert hergelaufen, zurück ins Kriminalmuseum, in die kalte Mansarde oben unter dem Dach. Onkel Hubert konzentrierte sich gerade auf das Anzünden seiner Pfeife. Er gab keine Antwort. Er nannte keine Namen. Er wusste wohl auch nicht, wer Mäxi nicht leiden können sollte.
»Geschäftsfreunde vielleicht«, räumte Mäxi schließlich ein. »Aber die scheiden ja aus. Keiner der neun tatverdächtigen Personen ist ein Geschäftsfreund von mir.«
»Sei still!«, befahl Onkel Hubert. »Ich bin durchaus in der Lage, allein logisch zu denken.«
»Aber ich kann es einfach nicht fassen! Es muss ein Irrtum sein! Eine unglückliche Verkettung von Zufällen! Vielleicht galt der Mordanschlag jemand anders, der auch Martini als Schlaftrunk nimmt! Natürlich, da fehlte doch ein Glas! Da muss sich außer mir noch jemand einen Martini genommen haben! Hörst du überhaupt zu?«
»Du brauchst mich nicht zu belehren, mein Junge! Ich habe alle logischen Schlüsse, die man in diesem Stadium der Ermittlungen ziehen kann, bereits gezogen.«
»Ich will dir ja nur helfen!«
»Im Augenblick störst du mich bloß. Am besten, du gehst jetzt ins Bett!«
»Na schön, du hast vielleicht recht. Man muss das wohl alles erst mal überschlafen. Kannst du mir eine Schlaftablette leihen?«
»Nein«, sagte Onkel Hubert geizig.
Mäxi nahm es ihm nicht übel. Sparsame Naturen, wie Onkel Hubert eine war, werden im Alter geizig. »Vielleicht ist ein doppelter Whisky besser«, lenkte er rasch ein. »Der Kerl wird doch nicht alle alkoholischen Getränke im Haus vergiftet haben?«
»Und wenn schon«, sagte Onkel Hubert. »Ich kann dir versichern, dass Doktor Schlintweins Herztropfen völlig unschädlich sind.«
Mäxi hatte übrigens noch nie eine Schlaftablette gebraucht. Er schämte sich, dass er Onkel Hubert gefragt hatte. Ein Kurzschluss, sagte er sich. Jetzt gibt es bei mir schon Kurzschlüsse.
Ein doppelter Whisky war für ihn nicht viel, als Schlafmittel allenfalls der halben Tablette eines leichten Mittels vergleichbar. Trotzdem schlief er rasch ein. Nicht, dass er sich im Bett keine Gedanken gemacht hätte! Was kann ich Böses getan haben? hatte er sich sogar gefragt. Er hatte keine Antwort gefunden. Wem kann ich im Wege sein? Eine lächerliche Frage. »Ohne mich wärt ihr doch alle aufgeschmissen!«, hatte er zu Onkel Hubert gesagt. Er hatte angefangen, sich alle neun möglichen Täter noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Was wären sie ohne mich? Was wären sie gewesen, wenn ich ermordet worden wäre? Annette? Eine Witwe, die niemand mehr heiraten würde, wenn nicht ein Erbschleicher, der auf ihren baldigen Tod spekuliert. Chefin eines Millionenunternehmens, das nur ein Mann wie ich führen kann. Eine Überforderung, an der sie zugrunde gehen würde. Sie hat ja ohnehin nur noch ein paar Jahre übrig. Annette ohne mich? Ohne mich, der gutmütig lächelt, wenn sie ihre hysterischen Anfälle bekommt?
Und Mutter? Wie würde sie wohl den Kopf tragen, wenn sich die geschäftlichen Verluste einstellen? Wenn die stolzen Geschäfte, die ihr Sohn aufgebaut hat, auf die Pleite zusteuern? Wenn es die Feste in unserem Haus nicht mehr gibt, nicht mehr die Empfänge, auf denen sie sich aufspielen kann!
Und Bertram, mein Sohn? Der weiche Bertram ohne Vater! Der arme Junge!
Melanie? Sie ist über beide Ohren in mich verliebt. Nicht ausgeschlossen, dass sie sich das Leben nimmt, wenn sie von meinem Tod erfährt. Mindestens ein Versuch mit Schlaftabletten!
Er hätte sich auch über die anderen fünf Gedanken gemacht, wenn er nicht darüber eingeschlafen wäre. Vielleicht war es langweiliger für ihn, über Rose, Niki, Schlintwein, Su und Onkel Hubert nachzudenken. Vielleicht war es auch mühsamer.
Aber er schreckte nach kurzem Schlaf aus einem Alptraum wieder hoch. Er saß am Frühstückstisch. Es war zum köstlichsten Frühstück des Jahres gedeckt, der wunderbare Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages. Als Kind hatte er nur am ersten Weihnachtsfeiertag Bohnenkaffee trinken dürfen. Und die Erinnerung an Mutters Christstollen, der feierlich angeschnitten wurde, war noch immer märchenhaft. Damals war Krieg gewesen. Der Charakter der Schlemmerei war heute verblasst, auch schien Mutters Backkunst nachgelassen zu haben. Trotzdem hatte das Frühstück am ersten Festtag seinen Zauber behalten. Su schenkte ihm den Bohnenkaffee ein. Genüsslich schnupperte er. Er schnupperte zweimal, dreimal. Kein reines Kaffeearoma. Formaldehyd. Er blickte auf, sah in die Runde. Neun Menschen starrten ihn erwartungsvoll an. Ein Zwang befiel ihn. Er musste den Kaffee trinken. Der schmeckte nach Formaldehyd. Ekelhaft. Dann brach er zusammen, Sekunden nach dem ersten Schluck. Tot lag er am Boden. Aber obgleich er tot war, konnte er noch wahrnehmen, wie es weiterging. Neun Menschen beugten sich über ihn, der ganze traute Kreis. Alle lächelten schadenfroh.
Schweißnass fuhr er aus den Kissen. Gott sei Dank, ich lebe noch! Gott sei Dank, es war nur ein Traum.
Fast stieß er das Lämpchen vom Nachttisch, so ungeschickt tastete seine Hand. Seine sonst so sichere Hand.
Er blickte auf die Uhr. Halb drei erst. Mehr als ein paar Minuten kann ich nicht geschlafen haben, dachte er.
Der Traum war eine Warnung aus meinem Unterbewusstsein, sagte er sich. Ich muss ihn ernst nehmen. Auf mein Unterbewusstsein ist Verlass. Ich habe schon oft unbewusst richtig gehandelt.
Ich bin in Gefahr. Noch hofft der Mörder, dass ich hier tot in meinem Zimmer liege. Er wird erschrecken, wenn ich morgen am Frühstückstisch erscheine. Aber wird ihn der Fehlschlag entmutigen? Wird er nicht einen zweiten Versuch wagen? Und wird er es beim zweiten Versuch nicht besser machen?
Ich darf ihn nicht ein zweites Mal zuschlagen lassen. Ich muss ihn vorher unschädlich machen. Am besten, bevor er merkt, dass ich noch lebe. Die Polizei müsste ihn wecken. »Wir verhaften Sie wegen Mordversuchs an Maximilian Beltz.«
Die Polizei. Ein angenehmer Gedanke war das nicht. Gott, ich habe keine Scheu vor der Polizei, sagte sich Mäxi. Nicht, dass ich mir einen Skandal nicht leisten kann. Vielleicht wäre das sogar eine gute Reklame. Aber fein wäre das nicht.
Fein wäre das nicht. Mäxi konnte sein Unbehagen um das Eingreifen der Polizei nicht beschreiben. Im Unterbewusstsein saß noch etwas Ungedachtes. Das spürte er. Das machte ihn unruhig. Das trieb ihn wieder aus dem Bett.
»Und ich liege hier im Bett und schlafe sorglos«, murmelte er vor sich hin. »Onkel Hubert hat die Fingerabdrücke bestimmt schon identifiziert. Der Narr kommt vielleicht gar nicht auf den Gedankten, dass wir nicht abwarten können. Ich kann mir vorstellen, dass er schon zufrieden eingeschlafen ist. Es sieht ihm ähnlich, dass er den Täter erst persönlich verhören will!«
Er könnte es schon getan haben. Er könnte ihn mitten in der Nacht geweckt haben. Mein Gott, vielleicht ist er dabei ermordet worden! Der einzige, der den Täter kannte, ist vielleicht schon beseitigt worden!
Mäxi schlüpfte schnell in einen gefütterten Hausmantel und öffnete behutsam die Tür. Ich habe sie nicht mal abgeschlossen, dachte er. Ich bin zu leichtsinnig.
Er lauschte ins Haus. Totenstille.
Eine witzige Idee: Ich könnte meinen Mörder ermorden. Eine Art Notwehr. Präventivkrieg, könnte man es auch nennen. Ich bin der Stärkste im Haus. Ich könnte jeden mit bloßen Händen erwürgen.
Er schlich zu Onkel Huberts Zimmer. Er klopfte mit der Kuppe des Zeigefingers, so leise, dass Onkel Hubert es nur hören konnte, wenn er noch hellwach war.
Keine Antwort.
Klinke und Tür ließen sich ungewöhnlich geräuschlos bewegen. Onkel Hubert sorgte wahrscheinlich dafür, dass Schloss und Scharniere stets perfekt geölt waren. Damit der. alte Schleicher und Schnüffler lautlos ausschwärmen kann, dachte Mäxi. Um an der Tür zu lauschen, wenn zwei sich nachts streiten. Um durchs Schlüsselloch zu gucken, wenn Rose einen ihrer Freunde eingeladen hatte. Um Schlintwein zu beschatten, wenn er einen nächtlichen Besuch bei Mutter macht. Bei Mutter oder bei den Getränken. Nichts darf ihm entgehen, dem Kriminalkommissar a. D. Hubert Leipzig. Die Katze, die das Mausen nicht lassen kann. Der krankhaft neugierige Schnüffler.
Sein Bett war unberührt. Das Zimmer war leer.
War er wirklich schon ein Opfer des Täters geworden?
Mäxi nahm diesen Verdacht nicht länger ernst, als es ein wacher, vernünftiger Mann tut. Mäxi schwankte unter der Aufregung, aber er stürzte nicht. Er kam auf dumme Gedanken, aber er verfiel ihnen nicht.
Er schlich weiter, die Treppe zum Boden hinauf.
In der Mansarde, in Onkel Huberts Kriminalmuseum, brannte Licht.
Wieder klopfte Mäxi nur mit der Kuppe des kleinen Fingers. Diesmal erhielt er Antwort. »Komm rein!« hörte er Onkel Hubert sagen.
Onkel Hubert sah nicht einmal auf, als Mäxi eintrat. Er starrte konzentriert mit dem rechten Auge ins Okular seines alten Mikroskops.
»Du bist noch immer bei der Arbeit?«, flüsterte Mäxi. Er gab seiner Stimme einen bewundernden Klang. Es war jetzt wichtig, Onkel Hubert zu umschmeicheln.
»Das siehst du doch«, sagte Onkel Hubert undankbar.
»Frierst du denn gar nicht?«
Eine überflüssige Frage, auf die Onkel Hubert sich jede Antwort ersparte. Es war hinreichend bekannt, dass Onkel Hubert nie fror. Er protzte mit seiner Unempfindlichkeit gegen die Naturgewalten. Einen Schal trug er nie, einen Mantel nur zur Dekoration. »Ein Kriminalbeamter muss auch bei Regen und Kälte oft stundenlang auf seinem Beobachtungsposten bewegungslos ausharren«, erklärte er. Mäxi hatte sich von dieser Zurschaustellung übermenschlicher Unerschütterlichkeit bisher immer lächelnd abgewandt, er hatte sie als komische Variante der Biologie abgetan. Diesmal wurde es zur Bewunderung. Ein bemerkenswerter Mann, dieser alte Hubert Leipzig! Hockte dort mit Seidenhemd und Fliege stundenlang in einer ungeheizten Mansarde, und das in einer Winternacht! Es war nicht einmal vorstellbar, dass er morgen einen Schnupfen haben würde.
Ehrfürchtig trat Mäxi neben ihn. Er wartete, bis Onkel Hubert sich vom Mikroskop abwandte und ihn ansah.
»Weißt du schon, wer es ist?«, fragte Mäxi.
Onkel Hubert antwortete leise und bedächtig: »Ja, ich weiß schon, wer es ist.«
»Wer?«
»Das wirst du zum richtigen Zeitpunkt erfahren.«
»Du hast seine Fingerabdrücke identifiziert?«
Onkel Huberts Blick wurde verächtlich.
»Auch ein Laie sollte sich in deiner Situation um kriminalistisches Denken bemühen. Ich habe interessante Fingerabdrücke gefunden, gut. Aber damit kann ich doch noch nicht den Täter identifizieren! Ich brauche die Fingerabdrücke aller verdächtigen Personen zum Vergleich. Die muss ich mir erst besorgen. Das werde ich tun, ohne dass es einer bemerkt. Aber da müssen wir uns noch zwanzig Stunden gedulden, mein Junge!«
»Du hast doch gesagt: Ich weiß schon, wer es ist!«
»Ich weiß es auch schon. Aber ich muss die Indizienkette noch schließen.«
»Und dann? Ich meine: Was machst du, wenn du die Indizienkette geschlossen hast?«
»Dann werde ich das Material der Staatsanwaltschaft übergeben.«
»Nein, Onkel Hubert! Nein, nein! Jetzt weiß ich plötzlich, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich, warum ich noch einmal aufgestanden bin, warum ich noch einmal mit dir sprechen wollte. Ich bin schließlich das Opfer. Ich habe auch noch mitzureden. Die Psychologie dieser Tat, verstehst du, die Psychologie dieser Tat fasziniert mich. Da sind neun Menschen, die mich alle lieben müssten. Aber einer von ihnen ist ein Judas. Entschuldige, dass ich mich so geschwollen ausdrücke. Judas ist natürlich übertrieben. Aber du verstehst doch, was ich meine. Es ist ein psychologisches Mysterium. Ich habe keinem etwas getan, und dennoch will mir einer etwas tun. Einer scheint zu glauben, dass ich ihn nicht mag. Einer scheint überzeugt zu sein, dass er durch meinen Tod etwas gewinnen kann. Das muss doch ein Irrtum sein! In einem dieser neun Köpfe muss sich ein Missverständnis festgesetzt haben. Ich muss mit ihm reden. Mit ihm oder mit ihr. Willst du mir nicht wenigstens sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist?«
»Nein.«