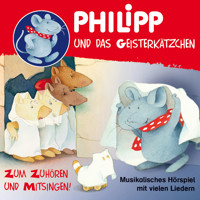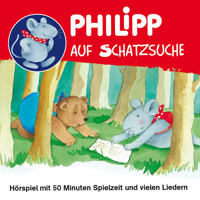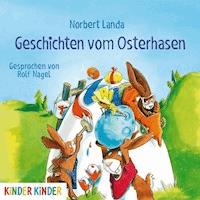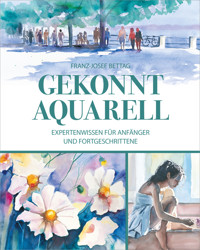
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: kimverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Profi-Wissen für Hobbykünstler Papier, Pinsel, Farbe: Für die ersten Schritte reichen eine ansprechende Motividee und etwas Erfahrung. Mehr Freude am Malen (und an Ihren Bildern) erleben Sie, je besser Sie die Grundtechniken verstehen und die Eigenschaften der Materialien kennenlernen. Das ist das erste Ziel meines Buchs: Ich will Ihnen eine solide Basis vermitteln, auf der Sie gut aufbauen können. Das soll Sie motivieren, mehr aus Ihrem künstlerischen Talent zu machen. Dabei kommt auch Expertenwissen ins Spiel. Dafür bietet sich das Buch als Ratgeber an – als Wegweiser in die facettenreiche Welt der Aquarellmalerei. Wie und mit welchen Mitteln gelingen mir auch anspruchsvolle Bilder und künstlerische Effekte? Welches Papier, welche Pinsel und Hilfsmittel brauche ich für welchen Malstil? Welche Malschritte führen zum gewünschten Ergebnis? Wie bringe ich Farben und Motive am besten zur Wirkung – und umgekehrt: Woran kann es liegen, wenn sich der Erfolg nicht so recht einstellen will? Zum einen kommt es erfahrungsgemäß – und erstaunlich oft – auf das Material an. Beispielsweise eignet sich längst nicht jedes (auch teures) Aquarellpapier für eine bestimmte Technik. Der gewählte Pinsel passt nicht, oder bestimmte Farbtöne unterscheiden sich von Marke zu Marke. Meine Produktempfehlungen sollten Sie sicher durch den Dschungel der Angebote führen. Andererseits lassen sich auch die Grundtechniken – Lasieren und Malen nass in nass – kreativ erweitern und mit anderen Medien kombinieren. Franz-Josef Bettag zeigt Ihnen im Detail, mit welchen Hilfsmitteln und Kunstgriffen Sie überraschende Effekte erzielen können. Und weil schließlich nicht jedes Bild gelingen kann, erfahren Sie auch, wie man Malfehler reparieren kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
EXPERTENWISSEN FÜR ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE
FRANZ-JOSEF BETTAG
2
Farbe und Wasser, Pinsel und Papier: In diesem Sinne ist Aquarellmalerei einfach. Wenn man sich jedoch künstlerisch und materialtechnisch näher mit der Aquarellmalerei befasst, betritt man ein wahres Zauberreich an Möglich-keiten, Ideen und erstaunlichen Details. Deshalb geht es mir hier nicht um Schrittanleitungen zum Malen bestimmter Motive. Vielmehr möchte ich Sie sozusagen hinter die Kulissen der professionellen (und auch historischen) Aquarellmalerei blicken lassen und Ihnen zeigen, wie Sie dieses Experten-wissen erfolgreich für eigene Werke umsetzen können.
So erfahren Sie zum einen, wie typische und, darauf aufbauend, auch die speziellen Aquarelltechniken funktionieren, mit denen Aquarellkünstler zu begeistern wissen. Welche Geheimnisse verbergen sich dahinter? Wie entste-hen diese Effekte? Ein Teil der Erklärung liegt oft im speziellen Zusammen-wirken bestimmter Papiere und Farben und in der gezielten Verwendung von Hilfsmittel. Mehr als bei anderen künstlerischen Medien bestimmt die Wahl der Materialien über das Gelingen – oder Misslingen – eines Aquarells mit. Das theoretische Grundwissen um ihre Eigenschaften und Möglichkeiten ist bisweilen wichtiger als das maltechnische Können.
Die praktischen Hinweise, Anleitungen und Ratschläge sind das Ergebnis meiner langjährigen künstlerischen Praxis, Erprobungen und Experimente mit den Materialien von zahlreichen Papier- und Farbenherstellern. Dabei fließen auch die Erkenntnisse vieler anderer Experten mit ein. All dies soll Ihnen frustrierende Fehlversuche ersparen. Solche Enttäuschungen können schlimmstenfalls dazu führen, die Aquarellmalerei als zu kompliziert und anspruchsvoll abzutun. Was, wie Sie auch in den Bildbeispielen sehen wer-den, keineswegs der Fall ist. Nur sollte man sein Handwerkszeug kennen, um vielleicht auch eine persönliche aquarellistische Handschrift entwickeln zu können.
Also: Wie mache ich das Beste aus Farbgründen, wie nutze ich zusätzliche Hilfs- und Malmittel, mit welchen Tricks und Kunstgriffen erreiche ich gezielt professionelle Effekte, wie kann ich das Erscheinungsbild auch nachträglich noch verbessern? Und wenn Pinsel und Farbe nicht das tun, was man will: Wo liegen Fehlerquellen verborgen? In diesem Buch hoffe ich, auch sehr spe-zielle Fragen beantworten und praktikable Lösungen anbieten zu können.
Sie werden sehen, wie viel Freude es macht, sich auf die fantastische Welt der Aquarelle einzulassen – ein Erlebnis, wie es schöner kaum sein könnte!
Herzlichst, Ihr
Franz-Josef Bettag
Über dieses Buch
Franz-Josef Bettag
Über den Autor
Franz-Josef Bettag, Jahrgang 1959, ist eine der prominentesten Persönlichkeiten inder deutschsprachigen Hobbykunst-Szene. Er studierte Fotografie, Illustration und Buchgestaltung und zeichnete schon als 18-Jähriger Covers unter anderem für Playboy und Perry Rhodan.
Später wandte er sich der Vermittlung von Mal- und Zeichentechniken in Kursen und bisher insgesamt 50 Anleitungsbüchern für Hobby- und professionelle Künstler und liefert maßgebliche Beiträge für Zeitschriften, vor allem für Freude am Zeichnen & Malen sowie Dessin Passion. Als Berater und Produktentwickler ist Bettag zudem für namhafte Hersteller von Künstler-material tätig.
3
Inhalt
Über Aquarell
Aquarellmalerei – damals und heute4
Licht und Farben 6
Die Farben
Aquarell: Farbe und Wasser7
Klassiker und Spezialisten9
In die Tube und ins Näpfchen11
Näpfchen oder Tuben?12
Die Grundfarben13
Altmeisterliche Farben15
Eigenschaften und Wirkung17
Bezeichnung und Erscheinungsbild18
Das Papier
Aufs Papier kommt es an19
Der Papierton 20
Oberfläche und Struktur21
Von fein bis rau23
Farbe und Fasern25
Traditionelle Künstlerpapiere im Überblick27
Die Pinsel
Welche Pinsel? 29
Spezielle Pinsel31
Pinselsprache33
Das Papier vorbereiten
Bitte keine Wellen!35
Nicht zu empfehlen!37
Farbe trocknen lassen38
Die Farben mischen
Aquarellfarben mischen39
Hautfarbe anmischen41
Schwarze Kunst45
Grautöne mischen47
Die Grundtechniken
Nass in nass und Lasur49
Nass in nass50
Die Lasur53
Das Weiß und das Papier
Weiß im Aquarell57
Malen mit Papierweiß60
Flüssig maskieren61
Ölpastell und Aquarell63
Löschpapier und Brot65
Das Papier vorbehandeln
Aquarellpapier präparieren67
Grundieren mit Gummi arabicum68
China Clay für leuchtende Farben72
Dextrin für matte Farben73
Reisstärke für pastellige Farben74
Die Malmittel
Hilfsmittel76
Gezielt lavieren77
Drehen statt malen78
Schaumstoff statt Pinselhaar 80
Salzige Muster82
Texturen erzeugen84
Granulierte Texturen86
Aquarell wird wasserfest88
Entspannt malen90
Die Nachbearbeitung
Farbe entfernen96
Feuchte Farbe entfernen98
Trockene Farbe entfernen100
Auskratzen, Radieren und Abschaben102
Zur Not: Reparaturarbeiten103
Spezielle Effekte
Sgraffito104
Bleistiftzeichnung kolorieren108
Linien mit dem Batikkännchen110
Aquarelle auf Leinwand112
Problemlösungen
Fragen und Antworten114
Impressum116
4
Aquarellmalerei – damals und heute
Das Malen mit Wasserfarben hat eine sehr lange Geschichte, die weit in die frühen Hochkulturen zurückreicht. Unsere heutigen Aquarellfarben und die Aquarellmalerei als eigenständiges künstlerisches Ausdrucksmittel gibt es allerdings erst seit etwa 200 Jahren.
Seit der Antike und besonders im Mittelalter waren Aquarellfar-ben das Mittel der Wahl zum Kolorieren von Zeichnungen und Handschriften etwa in den klösterlichen Ateliers, wo die Buchma-ler ihre Illustrationen mit Aquarellfarben ausgestalteten. Lange Zeit blieb es bei solchen farbigen Hilfsdiensten. Ansonsten hat-ten Aquarellfarben im Bereich des Malens keinen besonderen Ruf: prima für Farbskizzen und Vorstudien für Ölgemälde, perfekt auch zum Kolorieren von Grafiken, aber längst nicht das künst-lerische Medium. Erst durch Albrecht Dürer (1471–1528) und sei-ne Landschafts-, Tier- und Pflanzenskizzen erhielt das Aquarell einen eigenständigen Charakter, blieb aber dennoch eine Aus-nahmeerscheinung: Die Dominanz der Ölfarben blieb ungebro-chen, obwohl nun mit Entwicklung und Verbreitung von Papier der ideale Malgrund zur Verfügung stand.
Das änderte sich mit dem Auftreten des englischen Aquarellisten William Turner (1775–1851). Mit ihm wurde die Aquarellmalerei (in seiner innovativen Nass-in-Nass-Technik) zu einer anerkann-ten Kunstform. Bei ihm spielte die Zeichnung allenfalls als Skizze oder Vorzeichnung noch eine Rolle – das Motiv selbst entstand rein aus Pinselstrichen. Seine Kompositionen aus Licht und Farbe, aus Himmel, Land und Wasser zeigten auf noch nie da gewesene Weise, was Aquarellfarben leisten konnten.
Zudem hatten es Aquarellmaler einfacher als ihre mit Ölfarben malenden Kollegen. Pinsel, trocken gepresste Farben, Wasser und Papier statt Leinwand, das war schon sehr viel praktischer – besonders als es möglich wurde, Aquarellfarben industriell und damit preisgünstig herzustellen. Auch konnten sich Künstler hi-naus in die Natur begeben, um dort nicht mehr nur Vorskizzen für die Ausarbeitung im Atelier anzufertigen, sondern ganze Bilder zu malen. So waren sie in der Lage, interessante und wechselnde Lichtstimmungen einzufangen. Oftmals wurden die Gemälde in der Künstlerwerkstatt vervollständigt.
Ab nun galt Aquarell als künstlerisch gleichberechtigt. Mit der Gründung der British Society of Painters in Watercolour (heute Royal Watercolour Society) im Jahr 1804 erfuhr die Aquarell-malerei ihre sozusagen offizielle Anerkennung und verbreitete sich von England aus nach Amerika und dann weltweit. Am populärsten ist die Aquarellmalerei nach wie vor im englischen Sprachraum.
Namen wie Miles E. Cotmann, John Singer Sargent, Winslow Homer, Thomas Girtin bestimmen bis heute das Bild der angel-sächsischen Aquarellmalerei. Weniger bekannte Künstler präg-ten ihre eigenen Stilrichtungen. Joseph Crawhall malte mit Aquarellfarben auf Leinwand, Edward John Pointer schuf altmeis-terliche Porträts, die an Ölbilder erinnerten, Evelyn De Morgan (1855–1919) malte Bilder im Stil der Präraffaeliten. Ihre Technik war so speziell, dass sie bis heute niemand nachvollziehen kann. Heerscharen von Restauratoren und Kunsthistoriker versuchen bisher vergebens, das Rätsel zu lösen. So sind viele alte Techniken auf dem Weg in die Moderne verloren gegangen und harren der Wiederentdeckung.
Im deutschen Sprachraum entwickelte die Aquarellmalerei mit Emil Nolde und August Macke eine eigene Stilrichtung, die manchmal im expressionistischen Farbenrausch gipfelte. Einer der interessantesten neuzeitlichen Aquarellmaler war Oskar Koller (1925–2004), dessen Bilder sich durch die genaue Erfas-sung von Form und Farbe auszeichnen – und durch die Kunst des Weglassens. Prägend und vielfach kopiert ist auch Bernhard Vogel, der mit seinen Landschaften und Stadtansichten weltweit Beachtung findet und wie kaum ein anderer Künstler im Aquarell seine Bestimmung findet.
5
Porträt von Natalya Yakunchikova, 1882
Kopie eines Bildes von Vasily Polenov, 34 x 46 cm
6
„Aquarellmalerei ist vier Fünftel Technik und ein Fünftel Talent. Und irgendwo dazwischen findet man seine eigene Handschrift.“
Das sagte mir vor vielen Jahren einmal die Künstlerin Christel Abresch, eine wunderbare Lehrerin, der ich viel verdanke – nicht nur diese Einsicht, die mich anfangs etwas ernüchterte. Talent, so viel wusste ich, hatte ich reichlich, zumal ich als Illus-trator schon ziemlich etabliert war. Aber dann – so viel Technik? Keine künstlerischen Höhenflüge vom ersten Pinselstrich an, sondern Maltechniken? Ist das nicht mühsam?
Ist es nicht. Denn erstens macht es Freude zu erleben, wie sich das Talent entfaltet, wenn man es sachgerecht einzusetzen weiß. Die Aquarelltechnik – besser: die Techniken – sind Leitplanken auf dem Weg zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Man bleibt so-zusagen auf guten und vielfach bewährten Wegen, vermeidet Irrwege und erspart sich unnötige Enttäuschungen.
Zum anderen ist es ermutigend zu erfahren, dass es in der Aqua-rellmalerei so entscheidend auf den technischen Umgang mit den Farben ankommt. Talente kann man fördern, Techniken kann man erlernen, üben und schließlich beherrschen.
Das bedeutet nicht, dass Sie nicht auch frisch und fröhlich drauf-losmalen können. Ein simples Motiv, das Sie mit direkten Malstri-chen formen, ist etwas Schönes – ebenso wie eine mit Pinsel und Aquarellfarben kolorierte Zeichnung. Anders liegt der Fall, wenn Sie die fantastischen Möglichkeiten der Aquarellmalerei zum Bei-spiel für realistische und detailreiche Darstellungen ausschöpfen wollen.
Das Papier als Beleuchter
Und da es sich sozusagen um eine Lichttechnik mit dem Papier als Beleuchter handelt, sind Methoden, die etwa mit Acrylfarben gut funktionieren, fürs Aquarellieren unbrauchbar. Hier gibt es keine weiße „Lichtfarbe“ – die Helligkeit kommt vom Papier. Also kann man keine Lichter auftragen. Man muss Licht sozusagen zu-lassen und ihm dadurch Raum und Kraft geben.
Ohne Licht würden die Farben nicht leuchten, und ohne Licht würde die Technik nicht leben. Es intensiviert oder verändert nicht nur die Farbtöne, sondern auch die Tonwerte (Helligkeits-werte) und bringt damit Spannung ins Spiel von Licht und Schat-ten. Schließlich bestimmt das Licht auch die Farbtemperatur mit. Das ist die subjektive Empfindung, ob und wie sehr eine Farbe als warm oder kalt empfunden wird. Es geht also um die Wahrneh-mung und die Wiedergabe von Lichtverhältnissen, um eine be-stimmte Atmosphäre (oder Lichtstimmung) ins Bild zu bringen. Und eben weil sich das Licht nicht direkt „aufmalen“ lässt, son-dern nur indirekt zur Erscheinung gebracht werden kann, muss der Farbaufbau – die Reihenfolge, in der die Aquarellfarben auf-getragen werden – gut geplant sein.
Licht und Farben
Nach dem Tanz
36 x 52 cm, Aquarellpapier Fabriano Artistico
7
Eigentlich ist Aquarell ein einfaches Medium in dem Sinne, dass man zum Malen neben guten Farben eigentlich nur noch Wasser braucht – und zwar ebenfalls gutes …
Wasser ist das Medium, das die Farbe trägt. Die Farbe selbst be-steht im Wesentlichen aus den aufs Feinste vermahlenen, licht-echten Pigmenten und wasserlöslichem Gummi arabicum. Die-ses Bindemittel hält zum einen die Farbe zusammen und beständig, zum anderen macht sie die Wasserfarbe gut vermal-bar. Das „gefärbte“ Wasser wird mit dem Pinsel auf dem Papier verteilt, färbt das Papier und formt dabei das Motiv mit transpa-renten Malstrichen und Farbschichten. So weit, so einfach. Doch gerade die wässrige Konsistenz macht es zu einer großen (und schönen) Herausforderung, die Farbe zu beherrschen, also den Farbfluss zu kontrollieren. Wasser ist nun einmal flüssig. Anders als etwa Acrylfarbe oder Gouache hat es keinen dickflüssigen „Körper“, der sich dem Pinselstrich anpasst. Das gefärbte Wasser fließt bisweilen, wie es will. Die Aufgabe besteht darin, den Farb-fluss in der richtigen Menge in die richtige Richtung zu leiten und ihm an gewünschter Stelle Grenzen zu setzen.
Dieses Eigenleben der Aquarellfarben führt oft zu unvorhergese-henen Ergebnissen. Zufallsergebnisse sind in der Aquarellmalerei an der Tagesordnung und bisweilen durchaus willkommen, weil sie auch beim realistischen Malen Frische und Leben ins Bild brin-gen können. So wie sich der Farbfluss mit dem einen oder ande-ren Trick steuern lässt, so kann man auch Zufallseffekten den Bo-den bereiten, etwa um die Farben stellenweise sich selbst zu überlassen und ihnen beim Blühen und Gedeihen zuzusehen.
Man könnte das eine kontrollierte Spontaneität nennen. Das bedeutet, dass sich auch bei bester Beherrschung der Aquarell-technik kaum ein Bild genau so wiederholen lässt.
Aquarell: Farbe und Wasser
Auch aufs Wasser kommt es an
Wenn Sie an gutes Material denken, dann an die Qualität der Farben, der Pinsel und des Papiers, das Sie verwenden – weniger an das Wasser. Doch dessen Härtegrad und damit auch die Fließ-eigenschaften spielen beim Aquarellieren keine geringe Rolle.
Je nach Wohnort hat das Wasser bestimmte Eigenschaften. Kalk und Chlor verändern das Verhalten der Pigmente, die Farbe fließt unterschiedlich zusammen. Einige Farben neigen bei zu kalkhal-tigem Wasser zum Granulieren, andere werden körnig oder perlen aus. Ein deutliches Zeichen für zu hartes Wasser ist die Pfützenbildung auf dem Papier und die Konzentration der Farbe an den Rändern. Bevor Sie wegen wiederkehrender missliebiger Effekte die Papiersorte wechseln, wechseln Sie zunächst lieber das Wasser aus!
Ideal ist weiches, nicht oder kaum chloriertes Wasser. Wenn Ihr Leitungswasser zu hart ist, also zu viel Kalk enthält, helfen ein paar Tropfen Ochsengalle. Das vermindert die Oberflächenspan-nung, die Farbe fließt weicher und verhindert die Bildung von unerwünschten Pfützen und Rändern. Nicht geeignet ist Ochsen-galle bei stark chloriertem Wasser.
Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie Ihr hartes Leitungs-wasser abkochen oder gleich destilliertes Wasser verwenden, das zuverlässig ohne Chlor, Kalk und andere Mineralien ist. Sehr weiche Übergänge lassen sich mit destilliertem Wasser erzielen. Ich selbst benutze übrigens das Restwasser aus dem Wäsche-trockner. Ein weicheres Wasser gibt es kaum. Kleiner Nebenef-fekt: Es riecht auch noch angenehm.
8
Dieses Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen destilliertem Wasser (oben) und Wasser aus der städtischen Wasserversorgung (Bild rechts). Mit destilliertem Wasser ergeben sich weiche Pinsel-striche, die Farbe wirkt in sich geschlossen.
Hier mit Leitungswasser wirkt die Farbe nach dem Trocknen fast schmutzig, sie sammelt und konzentriert sich an den Rändern. Chlor und Kalk verändern die Fließeigenschaften des Wassers und somit auch der Farbe.
Das Gelb wurde mit reinem destilliertem Wasser angemischt und vermalt. Der Farbton ist brillant und beim Trocknen bleiben keine unwillkommenen Farbränder zurück.
Das hier verwendete gechlorte Wasser verändert den Farbton überraschend deutlich. Die Farbe sammelt sich an den Rändern und erzeugt deutliche Konturen.
… und hart
Weich …
9
Klassiker und Spezialisten
Weltweit gibt es ca. 70 Hersteller von Aquarellfarben, die mitei-nander um Anfänger, Freizeitkünstler und professionelle Aqua-rellisten konkurrieren und selbst in ihrem eigenen Programm entsprechend Sorten in unterschiedlicher Qualität bereitstellen.
Für Hobbymaler und kleinere Skizzen können Studien- und Aka-demiefarben ausreichen. Wenn Sie jedoch ambitioniert ans Werk gehen wollen, kommen Sie um die teuren Künstlerqualitäten nicht herum. Wobei „teuer“ das falsche Wort ist. Denn Aquarell-farben sind ungeheuer ergiebig, mit einem Malkasten können Sie jahrelang Ihre Freude haben – und einzelne Näpfchen gege-benenfalls nachkaufen. Das macht auch hochpreisige Aquarell-farben letztlich äußerst preiswert und das Aquarellieren zum sparsamen Vergnügen.
Bei Künstlerqualitäten beruhen die jeweiligen Farben meist auf einem einzigen Pigment. Daher lassen sie sich problemlos mi-schen oder in reinen Lasuren verarbeiten. Dennoch unterschei-den sie sich von Marke zu Marke in mancher Hinsicht, etwa im Hinblick auf ihre Fließfähigkeit, Leuchtkraft oder die Trocknungs-eigenschaften. Manche Aquarellkünstler benutzen immer nur eine Sorte, andere wechseln für bestimmte Farbtöne die Marke.
Meine Übersicht auf der nächsten Seite zeigt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die wichtigsten von professionellen Aqua-rellisten verwendeten Sorten und Marken. Diese Künstlerqualität bedeutet natürlich nicht, dass sie nur für Künstler geeignet sind. Im Gegenteil: Mit richtig guten Farben kommen Sie einfach besser ans Ziel.
Klassische Aquarellfarben
Das sind die herkömmlichen Aquarellfarben, die auf traditionel-len natürlichen Ingredienzien aufbauen. Sie enthalten neben den Pigmenten weiter nichts als das Bindemittel Gummi arabicum, als Verlaufsmittel meist Ochsengalle und bei einigen Marken auch Honig zur Verstärkung der Brillanz.
Hier gibt es auch bei Künstlerqualitäten von Marke zu Marke etli-che Unterschiede, am auffälligsten bei sehr seltenen und außer-gewöhnlichen Pigmenten, wie sie etwa bei Schmincke oder Da-niel Smith im Programm sind. Auch der Feinheitsgrad der Pigmente ist unterschiedlich. Das wirkt sich auf die Frage aus, wie gut sich mit der Farbe lasieren lässt, ob sie granuliert oder schnell Ränder bildet. Wenn Sie sich intensiv auf Aquarellfarben einlas-sen, werden Sie im Hinblick auf Stil und Technik sicher bald eige-ne Vorlieben entwickeln – und dann auch entdecken, mit wel-chen Produkten Sie sich am wohlsten fühlen.
Spezielle Aquarellfarben
Einige Hersteller haben Malmedien im Angebot, in denen sich Vorzüge von Aquarellfarben mit den praktischen Eigenschaften anderer Farbtypen verbinden sollen. Das „Aqua“ im Namen weist auf die Vermalbarkeit mit Wasser hin – doch Vorsicht: Da es sich nicht um „echte“ Aquarellfarben handelt, unterscheiden sich Anwendung und Resultate ziemlich deutlich vom Aquarell.
• Dazu gehört beispielsweise das „Aquacryl“ von Lascaux, das nach Art von Acrylfarben wasserfest auftrocknet. Beim Lasieren bleiben die unteren Farbschichten unversehrt und behalten ihre Brillanz.
• Flüssige Aquarelltuschen (im Fläschchen) sind sehr farbintensiv und lagern sich tief in das Papier ein. Nachteil: Die Farben nei-gen zum Ausbluten oder hinterlassen ausgeprägte Ränder.
• Sogenannte Aquarellsticks sind interessant für Experimente und Spezialeffekte, nicht jedoch für die eigentliche Aquarell-malerei. Mit den Sticks wird die Farbe trocken aufgetragen und später mit dem Pinsel und Wasser vermalt, ähnlich wie mit den wasserlöslichen Farbstiften oder Aquarellfarbstiften. Allerdings enthält die Farbe wasserlösliche Wachse und andere Zusätze, die den Farbfluss behindern und den Pinsel verkleben können. Zudem lassen sich die Farben nicht mehr auswaschen oder abschwächen.
• Bei Aquarellmarker fließt die Farbe beim Malen vom Tank in die Spitze und wird also direkt aufgetragen. Mit ihnen verhält es sich ähnlich wie mit den Aquarellsticks: Zwar lassen sich span-nende Effekte erzielen, doch können die Marker keinesfalls Aquarellfarben ersetzen. Man wird auch sehen müssen, ob die angepriesene Lichtechtheit der extrem feinen Tuschepigmente den Tatsachen entspricht. Ein anderer Nachteil: Die Malspitze der Marker ist recht robust und kann daher die delikate Ober-fläche mancher Aquarellpapiere beschädigen.
Woher die Farben kommen …
Nur wenige Hersteller, zu nennen sind hier Schmincke, Old Holland und Sennelier, fertigen ihre Farben noch im Ursprungs-land in Handarbeit mit traditionellen Methoden. Die englische Traditionsmarke Winsor & Newton stellt die Farben in Frankreich her, Lukas – das Synonym für Made in Germany – lässt die Farben in England von Daler Rowney produzieren. Die Globalisierung macht auch vor der Herstellung der Farben nicht halt. Etliche große Künstlermarken haben die Fertigung wenigstens teilweise in Billiglohnländer ausgelagert, was allerdings keine Einbußen an Qualität bedeutet: Die Hersteller setzen auf ihren guten Ruf und auf penible Qualitätskontrollen.
10
Hersteller
Sorte
Anzahl der Farbtöne
Gebinde
Besonderheiten/Bindemittel
Schmincke
Deutschland
HORADAM
139
Napf & Tube
Besonders feine Pigmentteilchen
Optimal für Lasuren und Lavuren
Sennelier
Frankreich
l’Aquarelle
98
Napf & Tube
Honig für Leuchtkraftverstärkung
Für Nass-in-Nass-Technik und Lasuren
Mijello
Südkorea
Mission Gold
126
Tuben
Für Lavuren und Lasuren
und Nass-in-Nass-Technik
Lukas
England
Aquarell 1862
70
Napf & Tube
Gute Nass-in-Nass-Eigenschaften
Talens
Niederlande
Rembrandt
131
Napf & Tube
Gute Nass-in-Nass-Eigenschaften
Golden
USA
QoR
56
Napf & Tube
Polymerbinder zur Leuchtkraftverstär-kung. Optimale Mischeigenschaften. Lassen sich schlecht auswaschen
Winsor & Newton
Frankreich
Professional Water Colour
109
Napf & Tube
Granulierende Pigmente
Optimal für Lasuren und Lavuren
Daniel Smith
USA
Extra Fine Watercolor
217
Tube
Historische Farbtöne mit granulieren-den Effekten. Bindemittel nur Gummi arabicum. Für alle Techniken
White Night
Russland
Künstler Aquarellfarbe
66
Napf & Tube
Gummi arabicum und Honig
Für Nass-in-Nass-Techniken
Maimeri
Italien
Maimeri Blue
90
Napf & Tube
Für Nass-in Nass und Lasuren
Besonders leuchtende Blautöne
ShinHanArt
Südkorea
PWC
Extra Fine Water Color
104
Tube
Für alle Techniken geeignet,
besonders aber für feinste Lasuren.
Old Holland
Niederlande
Classic Watercolours
168
Napf & Tube
Historische Farbtöne mit granulieren-den Effekten. Für alle Techniken
Daler Rowney
England
Professional Artists
Water Colour
80
Napf & Tube
Standardfarbtöne, die sich schwer ent-fernen lassen und leicht ausbluten
Bloxx
Belgien
Extra-Fine with Honey
72
Napf & Tube
Honig für Leuchtkraftverstärkung
Leicht klebriger Auftrag
Empfehlenswerte Künstlerfarben
Studien- oder Akademie-Aquarellfarbenwerden meist aus preisgünstigen Pigmenten oder deren Mischungen hergestellt und lassen sich kaum oder gar nicht lasieren oder mischen. Gut brauchbar sind diese Farben nur für kleinere schnelle Farbskizzen oder im schulischen
11
Aquarellfarben bestehen hauptsächlich aus Pigmenten, Binde-mitteln und Konservierungsstoffen, die in Wasser aufgelöst wer-den und zu einer weichen Paste angerührt werden. Zur Stabilisie-rung und Konservierung der Pigment-Gummi-Mischung werden weitere Stoffe beigemischt. Glyzerin verbessert die Klebefähig-keit, verändert die Konsistenz der Farbe und hält sie länger feucht – früher nahm man dafür Honig. Ochsengalle verbessert die Fließfähigkeit der Farbe. Diese Mischung wird in die Tuben ab-gefüllt oder in Näpfchen gegossen, wo sie zu einer kompakten Masse trocknet.
Farben in Künstlerqualität
Aquarellfarben in Künstlerqualität herzustellen, ist selbst eine Kunst. Denn die Pigmente sind allesamt unterschiedlicher Art und Herkunft. Um eine stabile brauchbare, leicht vermalbare Far-be zu ergeben, braucht jedes Pigment seine eigene Rezeptur.
Die Farben in den Näpfchen dürfen nicht eintrocknen und brü-chig werden, umgekehrt aber auch nicht zu viel Feuchtigkeit auf-nehmen. Das könnte zur Schimmelbildung führen, weshalb alle Hersteller Konservierungsmittel beimischen.
Große Unterschiede gibt es zwischen den feinen Künstler-Aqua-rellfarben und den preisgünstigen Farben, meist Studien- oder Akademiefarben genannt. Der Pigmentanteil von Künstlerfarben ist hoch, in der Regel kommt nur Kordofan-Gummi arabicum zum Einsatz. Dahingegen werden in Studienfarben meist Dextrin (Stärkegummi) und Glyzerin als Binder eingesetzt. Da Dextrin eine gewisse Mattigkeit im Farbfilm erzeugt, wirken die Studien-farben weniger brillant als die Künstlerfarben.
In die Tube und ins Näpfchen
Gestern und heute
Die heute erhältlichen Aquarellfarben unterscheiden sich in vie-lerlei Hinsicht von jenen, die z. B. ein William Turner im 19. Jahr-hundert verwendet und mit denen er die Aquarellmalerei zur ei-genständigen Kunstform geführt hat. Damals benutzte man Pucks oder Blöcke aus reinem Pigment, das mit Gummi arabicum angemischt wurde. Man nannte diese Blöcke auch harte Aqua-rellfarbe oder Body Colour. Die Farbe wurde mühsam von Hand zusammengemischt und angerieben. Die Mischungen waren individuell und nicht immer stabil. Die getrocknete Farbe auf dem Papier konnte leicht übermalt werden, ohne dass sich die darunterliegende Schicht anlöste oder verschmierte. Die Pig-mente waren gröber vermalen als heutige, sie granulierten sehr stark, ließen sich robuster vermalen und manche waren auch de-ckend – vergleichbar mit Gouache. In früheren Zeiten hatten die Künstler nur wenige stabile Pigmente, sprich: Farbtöne zur Verfü-gung, umso bemerkenswerter sind die fantastischen Ergebnisse, die sie mit vergleichsweise primitiven Mitteln erzielen konnten.
Die modernen Farben werden mit sehr fein vermahlenen Pig-menten hergestellt und so mit Zusatzstoffen vermischt, dass sich auch eine getrocknete Farbschicht wieder etwas anlösen lässt. Zudem sind Nass-in-Nass-Techniken mit zartesten Abstufungen möglich. Und vor allem aber kann man heute bequem aus einer reichhaltigen Palette hochwertiger Farben wählen.
Hell und beiläufig auf Aquarellpapier Hahnemühle Cornwall 450 g/m2gemalt: die Uferpromenade am Bodensee. Die Per-sonen und die rechten Baumstämme bleiben beim lavieren-den Anlegen des Hintergrundes ausgespart und werden erst nach dem Trocknen gemalt.
12
Für die meisten Anfänger und Hobbymaler stellt sich die Frage zunächst gar nicht: Erste und intuitive Wahl ist der Aquarellkas-ten, der die trockenen Farben im Näpfchen enthält und mit dem Deckel zugleich die Mischpalette mitliefert. Diese Metallkästen sind aus den Reise-Aquarellkästen des 19. Jahrhunderts entstan-den und auch heute noch unersetzlich für das Malen im Freien. Die besonders von professionellen Aquarellisten hoch geschätz-te Alternative sind die flüssigen und höher pigmentierten Aqua-rellfarben aus der Tube. Welche Sorte man lieber verwendet, hängt von den persönlichen Vorlieben, Erfahrungen und Ansprü-chen ab. Hier ein paar Hinweise.
Trocken im Näpfchen
Zur Herstellung der Napffarben gibt es zwei unterschiedliche Verfahren. Einige Produzenten gießen die Farben in komplizier-ten Prozeduren in die Näpfe. Die anderen pressen die Farben in lange Stränge, zerschneiden sie in kurze Stränge und setzen die-se „Pucks“ in die Näpfe ein.
Jedes dieser Verfahren hat seine Vor- und Nachteile: In der Strang-pressung sind die Pigmente dichter gepackt und man erhält sehr konzentrierte Farbtöne. Nachteil diese Methode: Die Farben lassen sich beim Abnehmen vom Näpfchen etwas schwerer an-lösen als gegossene. Diese sind zwar weniger dicht pigmentiert, doch erzeugt das Gießverfahren weichere und transparente Farbtöne. Angeboten werden die Farben in halben und ganzen Näpfchen – die halben sind, wenig erstaunlich, in der Anschaf-fung günstiger, aber in der praktischen Anwendung wenig sinn-voll. Denn mit einem großen Pinsel kann man kaum genug Farbe aufnehmen und verschmutzt dabei auch noch die Nachbar-farben im Kasten. Das zwingt dazu, kleine – oft zu kleine – Pinseln zu nehmen, was ein großzügiges, unverkrampftes Malen er-schwert. Besser sind also ganze Näpfe. Sie sind leichter zu hand-haben und die größere Oberfläche gibt mehr Farbe frei.
Flüssig in der Tube
Die Aquarellfarbe in Tuben kommt schon in flüssiger Form und wird mit Wasser zur gewünschten Konsistenz verdünnt. So kön-nen auch größere Quantitäten angemischt werden, besonders praktisch bei großen Bildformaten. Die Pigmentkonzentration ist bei einigen Sorten wesentlich höher als bei Napffarben. Zum großzügigen Anmischen braucht man eine hinreichend große Palette. Obwohl die Farben darauf nach wenigen Stunden ein-trocknen, lassen sie sich, ähnlich wie Napffarben, immer wieder bequem mit Wasser anlösen; es geht also nichts verloren.
Näpfchen oder Tuben?
Umfüllen!
Für die künstlerische Arbeit haben die vergleichsweise kräftigen und brillanten Tubenfarben erhebliche Vorteile; bestimmte In-tensitäten lassen sich nur mit ihnen erreichen. Andererseits ist es auch praktisch, die Farben aus einer Vertiefung zu nehmen, wo-für es spezielle Aquarellpaletten gibt. Genauso gut kann man auch Leernäpfchen mit Tubenfarben befüllen, diese darin trock-nen lassen – und hat damit das Beste aus beiden Welten. Vorsicht: Einige Farbtöne aus den Tuben neigen beim schnellen Antrock-nen zum Zerbröseln. Deshalb sollte man die befüllten Näpfchen oder Vertiefungen in den ersten beiden Tagen mehrmals mit de-stilliertem Wasser besprühen. So bleiben Farben geschmeidig.
Tubenfarben retten
Bei langer Lagerung kann es vorkommen, dass die Farbe in der Tube eintrocknet. Sie wird dann hart und kann nicht mehr he-rausgedrückt werden. Die Farbe selbst ist allerdings nach wie vor gut brauchbar, kann also wiederverwendet werden. Am besten schneiden Sie die Tube vorsichtig auf und entfernen die einge-trocknete Farbe. Dann wird die Farbe in einem Schälchen mit de-stilliertem Wasser eingeweicht. Das Wasser verdunstet, und nach zwei bis drei Tagen sollte eine leicht cremige Konsistenz zurück-bleiben – falls nicht, muss man eben warten und gegebenenfalls leicht umrühren. Schließlich können Sie die aufgelöste Farbe in ein Näpfchen umfüllen und wieder trocknen lassen.
Hier sehen Sie die üblichen Gebindegrößen für Aquarellfarben. Die größte Tube hat 15 ml Inhalt; es gibt allerdings auch Her-steller, die Tuben mit 21 ml oder sogar 37 ml Inhalt anbieten. Dann die Tube mit 5 ml – der Inhalt entspricht dem von zwei ganzen Näpfchen. Halbe Näpfchen sind recht klein und werden in der Regel nur für seltene Farbtöne gekauft. Das ganze Näpf-chen ist die meist verwendetet Gebindegröße. Darüber hinaus gibt es auch extragroße Näpfe aus Porzellan, gedacht für professionelle Aquarellisten.