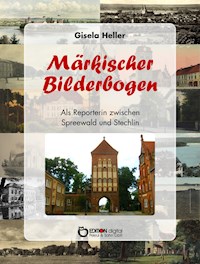9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Veröffentlichungen zur Biografie Fontanes erfährt man über seine Frau Emilie kaum mehr als die Tatsache, dass sie das freie Schriftstellerdasein ihres Mannes nicht besonders guthieß, da sie sich um den regelmäßigen Lebensunterhalt der Familie Sorgen machte. Selten wird dagegen erwähnt, dass sie ihrem Mann über Jahrzehnte zur Seite stand und dass Fontane in ihr auch eine wichtige Kritikerin seiner Texte sah. Aus diesem Schattendasein darf Emilie nun endlich heraustreten. Gisela Heller beschreibt ihr Leben mit viel Engagement und großer Detailkenntnis, und man entdeckt auf diese Weise völlig neue Facetten im Leben Theodor Fontanes, die zugleich auch eine bisher kaum bekannte Sicht auf das literarische Werk des Schriftstellers eröffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Gisela Heller
„Geliebter Herzensmann …“
Emile und Theodor Fontane
Biografische Erzählung
ISBN 978-3-95655-723-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1998 in der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Die Autorin dankt allen, die ihr freundlich und uneigennützig bei der Findearbeit behilflich waren: Peter Schäfer vom Fontane Archiv Potsdam; Frauke Franke, die die dort lagernden handschriftlichen Briefe und Wirtschaftsbücher Emiliens hütet; und vor allem Dr. Manfred Horlitz, dessen reichem Fontane-Wissensschatz sie jederzeit vertrauen konnte.
Vorwort
»Meine liebe Frau ... Du reizt mich bis aufs Blut und wunderst Dich hinterher, wenn ich heftig und bitter werde. Du machst ein böses Gesicht und wunderst Dich, wenn ich Dir aus dem Wege gehe; Du verhältst Dich ablehnend und wunderst Dich, wenn ich nicht zärtlich bin. Natürlich bin ich auch zu Zeiten unzärtlich, ohne vorher einer Nüchternheit begegnet zu sein, aber das ist nicht zu ändern, weil es ebenso in der menschlichen Natur wie ganz besonders in unsern Lebensverhältnissen liegt. Wenn ich bei meiner Arbeit nicht von der Stelle kann oder das Gefühl des Misslungenen habe, so bedrückt das mein Gemüt, und aus bedrücktem Gemüt heraus kann ich nicht nett, quick, elastisch und liebenswürdig sein. Aber das müsstest Du auch, wenn Du Dich ein bisschen auf meine Art verstündest, gar nicht von mir fordern. Dass ich Dich liebe, weißt Du; dass ich es Dir tausendfältig gezeigt habe, wirst Du wohl nicht bestreiten können; an diesem schönen Bewusstsein müsstest Du genug haben und als kluge Frau wissen, in 24 Stunden ist das alles vorüber. Stattdessen zeigst Du Deine ganz und gar unberechtigte Verstimmung, die mich nun erst wirklich verdrießlich und aus dem tristen Tag eine triste Woche macht. Wenn Du doch all dies einsehen wolltest ... Die einzige Gefahr liegt bei Dir. Nimm mir die Stimmung, und ich bin verloren. Ich beschwöre Dich, dass Du dessen eingedenk bist und das Deine tust, mich schwimmfähig zu erhalten.«
Dieser Brief gehört eigentlich in die unterste Schublade der Ehekommode; aber fast alle späteren Literaturhistoriker - und sogar so souveräne Männer wie Sebastian Haffner - haben gerade diesen einen unter Tausenden auf die Goldwaage gelegt, um nachzuweisen, wie kleinstirnig Emilie gewesen ist, ein Klotz am Bein des Dichters.
Betrachten wir den Zusammenhang: Dieser Brief wurde 1876 geschrieben, als Fontane den gerade erst bezogenen Posten des 1. Sekretärs der Akademie der Künste wieder aufgab. Emilie hatte 26 Ehejahre lang von der Hand in den Mund leben müssen und dabei ihre Gesundheit ruiniert; endlich, in seinem 58. Lebensjahr (!) war Aussicht auf festes Jahresgehalt mit Altersversorgung; und da sagt Theo: »Mir ist die Freiheit Nachtigall, den andern Leuten das Gehalt.« Man kann ihren Nervenzusammenbruch verstehen und auch ihre Vorwürfe. Fast alle Freunde standen auf ihrer Seite. Selbst diese seufzten: »Genies haben für ihre Angehörigen zuweilen recht schwer zu ertragende Einfälle!« Aber war er denn überhaupt ein Genie? 1876 war das noch nicht zu erkennen. Niemand konnte wissen, dass das, was nach Tollkühnheit oder Verantwortungslosigkeit aussah, die richtige Entscheidung sein sollte. Hinterher ist natürlich jeder klüger, vor allem Kritiker. Wenn sie mit dem Skalpell eigener Unfehlbarkeit darangehen, fremde Ehen zu sezieren, bekomme ich eine Gänsehaut - oder die Wut. Und so habe ich aus etwa tausend Briefen Theos, aus seinen Tagebüchern und annähernd zweihundert Briefen Emiliens Mosaiksteinchen gesammelt, ergänzt durch Briefe und Aufzeichnungen ihrer Kinder, Enkel und Freunde, um mir ein Bild zu machen, das ihr gerecht wird. Zehn Jahre habe ich mit Fontane gelebt, das letzte Jahr mit Emilie; Theo wurde ein bisschen kleiner, Emilie größer. Ich bin hineingekrochen in ihre Gedanken- und Gefühlswelt und darf getrost sagen: So wie sie hier vor Ihnen erscheint, war sie wirklich. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall eine Frau, die ihren geliebten Herzensmann schwimmfähig hielt, damit er der große Dichter und Romancier werden konnte.
Gisela Heller
Das Malheur
In den Augen des Großvaters war Emilie ein Malheur. Das ist eigentlich verwunderlich, denn Jean Pierre Barthélemy Rouanet hatte ein abenteuerliches Leben hinter sich mit allen Höhen und Tiefen. Weil er nicht katholischer Priester werden wollte, war er dem Jesuitenseminar und seiner hoch angesehenen Toulouser Kaufmannsfamilie entflohen und, neunzehnjährig, nach mancherlei Irrwegen von preußischen Werbern aufgegriffen und in Handschellen nach Potsdam gebracht worden; von da weiter nach Schlesien, das gerade begann, sich von den Schrecken des Siebenjährigen Krieges zu erholen.
Bei einer Inspektion der schlesischen Armee geriet unser stattlicher Zweimetermann ins Visier Friedrichs des Großen, der ihn als Französischlehrer an die Pagenschule in Potsdam beorderte. Vor allem die Damen der Gesellschaft fanden dort Gefallen an dem schönen Franzosen mit den gewandten Umgangsformen; bald ließen sie ihre Söhne und Töchter privat bei ihm unterrichten. So gelangte er langsam, aber beständig zu Gunst und Ansehen bei Hofe. Der alt gewordene König schanzte ihm schließlich die Stelle des Stadtkämmerers von Beeskow zu. Die Beeskower wehrten sich: ein Franzose! Unerfahren in preußischer Kanzleisprache und Buchführung - niemals! Eine königliche Kabinettsorder brachte sie schnell zur Raison. Insgeheim versuchten sie aber noch lange, dem Unerwünschten Fallen zu stellen und zu intrigieren; doch er setzte sich durch und überzeugte mit der Zeit durch Umsicht und Ideen. Als er nach dem Tode seiner zweiten Frau die Tochter des Beeskower Apotheker-Arztes Horn heiratete, gehörte er vollends zum kleinstädtischen Honoratiorenkreis. Den Gipfel seines Ansehens erreichte er in der Franzosenzeit. Als die napoleonischen Truppen kamen und den Leuten das Letzte abverlangten, erwies sich Rouanet oft genug als Retter in höchster Not: Mit List, Charme und Zivilcourage handelte er die Forderungen des jeweiligen Kommandanten nach Geld, Hafer, Wein und Ochsenfleisch auf ein erträgliches Maß herunter. Das vergaßen ihm die Beeskower nicht. Sie bewilligten ihm das Jahresgehalt von 1000 Talern auf Lebenszeit (Vielleicht hofften sie, nicht allzu lange zahlen zu müssen, denn Rouanet war zu der Zeit schon 66 Jahre, doch er schlug ihnen ein Schnippchen und wurde sogar 90 Jahre alt).
Er führte ein gastfreundliches Haus und herrschte darin als Patriarch. Niemand hätte gewagt, ihm zu widersprechen. Zu seiner großen Familie gehörten, aus zweiter Ehe, ein Sohn, der im Sächsischen Apotheker geworden war, und zwei Töchter, die längst verheiratet waren; dann die dritte, die Beeskower Ehefrau und ihre gemeinsame Tochter Thérèse, Vaters Liebling, denn sie hatte so gar nichts »Beeskowisches« an sich; vielmehr glaubte er in ihr alle guten Eigenschaften seines südfranzösischen Temperaments wiederzufinden: Lebensfreude, leichten Sinn, Begeisterungsfähigkeit und Esprit.
Ausgerechnet Thérèse hatte Pech in der Liebe. Sie geriet an einen bigotten Prediger namens Müller aus Müllrose, der nach siebenjähriger Ehe das Zeitliche segnete und sie mit einer schmalen Pension und drei kleinen Kindern zurückließ. Sie kehrte, wie es schien erleichtert, ins elterliche Haus zurück, wo keine sauertöpfische Kleinlichkeitskrämerei herrschte wie im Müllroser Predigerhaus, sondern musenfreundliche Geselligkeit. Die angesehensten Leute der Umgebung verkehrten hier, auch die Herren Offiziere der in Beeskow stationierten Husaren-Eskadron. Und damit ist für Thérèse, noch nicht 30 und voll erblüht, das Schicksalsmotiv angeschlagen: Sie verliebt sich in den Bataillonsarzt George Bosse; man tauscht Blicke, Verse, Nocturni ... Ganz Beeskow nimmt Anteil an dieser reizenden Romanze. Doch eines Tages wird der Herr Eskadronchirurgus versetzt. Von Hochzeit keine Rede mehr. Just in diesem Augenblick merkt Thérèse, dass sie schwanger ist. Was als Romanze begann, droht als Tragödie zu enden.
Nicht der Gedanke an schadenfrohe Kleinbürger, sondern die Sorge um die Zukunft seines armen Lieblings (denn welcher ehrenwerte Mann würde schon eine Witwe mit vier Kindern, darunter einem unehelichen, heiraten?) bewegt den Alten zu dem Entschluss: Niemand dürfe etwas von dem »Unfall« erfahren. Thérèse würde für ein paar Wochen oder Monate zu Verwandten nach Dresden fahren, um sich von all den Aufregungen zu erholen. Danach werde man sehen.
An einem spätsommerlichen Septembertag fährt sie also nach Dresden; zum Weihnachtsfest trifft sie zu Besuch im Beeskower Elternhaus ein: rank und schlank, gut erholt, nur nicht mehr so sprühend und munter wie früher. »Sie trauert wohl noch immer um ihren Chirurgus«, heißt es; und damit ist der Klatschsucht auch schon Genüge getan.
Niemand weiß von dem kleinen Mädchen, das am 14. November 1824 auf den Namen Georgina Emilie Caroline ins Geburtenregister der Stadt Dresden eingetragen wird. Um das Taufbecken stehen neben Thérèse nur deren Mutter und Johann Ferdinand Wilhelmi, engster Freund der Rouanets. George Bosse taucht lediglich als Name im Register auf. Von ihm wird nie mehr die Rede sein.
Eine gute Amme wird gefunden und Wilhelmi zum Vormund für das kleine, schreiende Bündel benannt; danach begleitet er Thérèse ins Schlesische, wo sie mit ihren drei Müller-Kindern bei Verwandten wohnen, bis ein guter und verständnisvoller Ehemann für sie gefunden ist.
So scheint alles geregelt. Der Erdenweg der kleinen Emilie kann beginnen. Als sie auf tapsigen Füßchen die ersten Schritte unternimmt, bringt man sie ins Haus ihres Onkels nach Wermsdorf bei Oschatz. Dort besitzt er die Apotheke, eine eifersüchtige Frau und drei Kinder, wie die Orgelpfeifen: drei, fünf und sieben Jahre alt. Wie selbstverständlich gehört Emilie nun dazu; sie ist lebhaft, lustig, ein Kind zum Liebhaben. Aber gerade das ist es, was der Apothekerfrau die Stimmung verdirbt. Sie fühlt ihre eigenen Kinder benachteiligt, wirft ihrem Mann vor, er verzärtele das fremde Kind, als ob es seins wäre, vielleicht sei er gar nicht der Onkel, sondern der leibliche Vater ... Unfrieden breitet sich aus in dem sonst so fröhlichen Haus. Als Wilhelmi wieder einmal zu Besuch kommt, liegt sie ihm in den Ohren, sie sei des Versteckspielens leid und er möge endlich Klarheit schaffen und »richtige« Eltern suchen, die das Kind adoptieren. Schweren Herzens berät Wilhelmi sich mit Thérèse.
Wenig später erscheint in der »Vossischen Zeitung« unter »Vermischtes« folgende Anzeige: »Sollte ein kinderloses Ehepaar geneigt sein, ein 3-jähriges, gesundes, wohlgebildetes Kind (Mädchen) an Kindes Statt anzunehmen, so würde dasselbe, unter Zusicherung einer namhaften Summe, unter Chiffre S 42 zu erfragen sein.« Es melden sich überraschend viele, Wohlhabende und solche, die von der »namhaften Summe« verlockt sein mochten. Wilhelmi entscheidet sich für einen Mann, der seinem Wunsch nach einem Töchterchen besondere Herzlichkeit verlieh: Es ist der aus Dresden gebürtige, nun in Berlin wohnende Rath Karl Wilhelm Kummer, Pappmachéfabrikant.
Die kleine Emilie freut sich zuerst, dass sie mit dem guten, spendablen Onkel Wilhelmi verreisen darf, doch als sie merkt, dass sie von Papa, Mama und den Geschwistern getrennt werden soll, weint sie so herzzerreißend, dass Wilhelmi unterwegs in den Verdacht gerät, das Kind entführt zu haben. »Morgen werden wir bei deinem richtigen Papa, deiner richtigen Mama sein«, tröstet er sie. Das Mädchen beruhigt sich, denn es bedeutet für sie die Rückkehr ins freundliche Apotheker-Haus.
Stattdessen betreten sie in Berlin ein großes, düsteres Gebäude in der Burgstraße. Hier wohnt, zwei Treppen hoch, der Mann, dessen Namen sie künftig tragen wird: Kummer. Alles ist fremd hier und unheimlich. Das Kind verkriecht sich in Wilhelmis weitem Predigerrock. Er bittet die Eheleute Kummer, liebevoll und sorgsam mit dem Mädchen umzugehen, was sie glaubhaft geloben. Die Kleine ermahnt er, artig und gehorsam zu sein. Sie antwortet nicht. Noch ehe sie begreift, was geschieht, ist der letzte Freund ihrer kleinen Welt verschwunden.
Das sollen nun also ihre »richtigen« Eltern sein: Herr Rath Kummer, ein Mann in den Vierzigern, halb Künstler, halb Handwerker, seinem Naturell nach mehr zum Künstler neigend, und seine Frau, eine liebenswürdige, feinfühlige Russin. Die beiden geben sich Mühe, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen, doch es dauert eine Weile, bis sich der Zustand trauriger Benommenheit verliert und der Neugier auf die völlig andere Umwelt weicht. Zentrum dieser neuen, fremden Welt ist das große Berliner Zimmer, in dem allerlei merkwürdige Gegenstände herumstehen: Folianten, Bilder, Kugeln ... In der Mitte prunkt ein riesiger achteckiger Tisch, an dem viele Esser Platz finden könnten, doch es kommt selten jemand. Eine schwere, fransenbesetzte Tischdecke reicht bis zur Erde und bildet eine Art Höhle, in die die Kleine flüchtet, wenn zu viel Unverständliches auf sie einstürzt.
Die Vorhänge an den Fenstern sind meist zugezogen. Frau Kummer kann das grelle Sonnenlicht nicht ertragen. Sie leidet, verbringt viele Stunden müde und kraftlos im Schaukelstuhl. Kein Arzt kann herausfinden, was ihr eigentlich fehlt: Ist es nur die Sehnsucht nach den fernen Weiten Russlands? Oder eine »wirkliche« Krankheit? Kummer hofft, seine Frau durch das Kind ans Leben zu binden, doch Emilie ist nicht das zärtliche Schmusekätzchen, das er sich vorstellte; sie ist wild und ungebärdig wie ein Junge. Als Mama Kummer sich eines Morgens aufrafft und zum Markt geht, findet sie bei ihrer Heimkehr die Kleine auf dem Fensterbrett sitzend, verwegen mit den Beinen baumelnd und mit den Kindern der Nachbarschaft, die sich im Hofe versammelt haben, schwatzend. Starr vor Entsetzen, besitzt sie so viel Geistesgegenwart, die Treppe hinaufzueilen, leise das Zimmer zu betreten und das Kind vom Abgrund zurückzuholen. Emilie strampelt, sie fühlt sich um ihr Vergnügen betrogen. Sie erschrickt, als die Mama plötzlich, kreidebleich vor Aufregung und Erschöpfung, ohnmächtig zusammenbricht. Instinktiv holt sie aus der Küche ein Töpfchen mit Wasser, gießt es der am Boden Liegenden über den Kopf. Danach sitzen beide auf dem bunten Plüschteppich, umarmen einander und freuen sich, alles überstanden zu haben.
Während die Kleine beginnt, ihre Umgebung zu erobern, wird Mama Kummer immer schwächer. Sie schenkt der nunmehr fünfjährigen Emilie fromme Bücher mit bunten Bildern, um sie von dem wilden Treiben da draußen abzulenken. Und so lernt das Kind lesen, lange bevor es zur Schule kommt.
Es betrübt sie zwar, dass die arme Mama so leiden muss, aber deswegen empfindet sie das Leben in der Burgstraße noch lange nicht als trübsinnig. Ist Papa zu Haus, gibt es immer Spaß, vor allem, wenn er die Fransendecke zwischen die Türpfosten spannt und so eine Puppenbühne schafft, auf der sich Teufel und Harlekin um die Prinzessin prügeln. Auf Wunsch der Mama spielt er auch mal das Märchen von Rapunzel oder die Legende von der heiligen Genoveva. Emilie ist felsenfest davon überzeugt, dass eines Tages ein Prinz auf weißem Ross kommen wird, um sie aus ihrer Fransenburg zu befreien.
Sie gleitet mühelos von der Realität in eine Märchenwelt und auch wieder zurück. Begünstigt wird diese Begabung durch Kummers Hang zum Theaterbetrieb. Sein schier unerschöpflicher Erfindergeist ist vor allem hinter den Kulissen gefragt. Er kann Götter herniedersteigen lassen, auch Hexen und Feuer speiende Drachen herbeizaubern. Er kann einfach alles machen, was die Fantasie der Theaterleute sich ausdenkt. »Tausendsassa« nennt man ihn. Noch weiß das Kind nicht, welch fataler Beiklang da mitschwingt. Tausendsassa, das heißt alles können, aber nichts richtig. Die so denken, vergessen freilich, dass dem Herrn Rath bei seinen vielfältigen Aktivitäten auch manches Hervorragende gelungen ist: Geografen und Generalstäbler zum Beispiel schätzen ihn als Erfinder der Reliefkarten und -globen. Das große Geld haben freilich andere damit verdient. Kummer ist leider viel zu sehr Bohemien, um sich mit aller Kraft hinter eine Sache zu setzen und sie beharrlich zum Erfolg zu führen. Solche ideenreichen Allotris haben oft Glück bei den Damen, und so war auch die reiche Russin seinem Charme erlegen. Ihre Mitgift ermöglichte ihm ein relativ sorgloses Leben und genügend Spielraum für die Befriedigung seiner kleinen Schwächen und Eitelkeiten.
Eines Nachts wacht die Kleine auf von dem Ruf »Feurio!«. Die hölzerne Remise steht in Flammen. Der ganze Hof ist taghell beleuchtet. Alles springt aus den Betten, rafft, ziemlich kopflos, irgendetwas zusammen, was im Moment wichtig erscheint, stürzt ins Treppenhaus. Aber das Feuer hat schon Vorder- und Hintertreppe erreicht, kein Fluchtweg mehr. Man kann nichts sehen, nicht atmen. Alles schreit durcheinander. Das Kind will in seiner Angst zur Lieblingspuppe, in die Geborgenheit der Fransenhöhle, da fühlt es sich von starken Armen gepackt, emporgehoben und - verliert die Besinnung. Als es wieder zu sich kommt, liegt es, in Decken gewickelt, auf dem Sofa der Portiersloge in der benachbarten Kriegsschule. Ein junger Offizier hatte es im letzten Augenblick mithilfe einer Rettungsleiter geborgen.
Die Ängste dieser Nacht werden sie jahrelang bis in die Träume verfolgen, und noch als erwachsene Frau wird sie beim Ertönen eines Feueralarms von hilflosem Zittern befallen.
Da die vorderen Zimmer vom Feuer verschont geblieben sind, kehren Kummers wieder in ihre Wohnung zurück, doch Mama erholt sich nicht mehr vom ausgestandenen Schrecken. Sie siecht dahin und hegt nur noch den Wunsch, das Kind um sich zu haben. Mit ihrem weichen, russischen Akzent erzählt sie schöne Geschichten von Wundern, die Christus vollbrachte; Kranke habe er geheilt und sogar Tote wieder auferweckt, und zuletzt sei er ans Kreuz geschlagen worden und für uns alle gestorben. Emilie versteht nicht den Sinn dieser Geschichten, aber sie spürt den Trost, der davon ausgeht. Sterben ist für sie gleichbedeutend mit Erlöstwerden. Darum bleibt sie seltsam gefasst, als die Mama eines Morgens bleich und stumm aufgebahrt liegt. Aus Kamillenblüten windet sie einen Kranz, den legt sie auf die gefalteten Hände. Der Gedanke, dass die gute Mama nun keine Schmerzen mehr erleiden muss und auf dem Wege zum lieben Gott ihre schützenden Hände über sie halten wird, beruhigt sie.
Der Papa findet seinen »Trost« anderwärts; beim Wein, in seiner Experimentier- und Bastelkammer, im Klub oder in der Gegenwart gefälliger, nach billigem Parfüm duftender Vorstadt-Schauspielerinnen. Zu Hause ist er nur noch selten. Unfähig, mit Geld umzugehen, verpfändet er Honorare, die ihm in Aussicht gestellt und dann doch nicht gezahlt werden; er gerät immer tiefer in die Bredouille. Die fünfjährige Emilie ist häufig Dienstboten überlassen, die das Chaos des Kummerschen Haushalts ausnutzen und in der reichlich bemessenen Freizeit in einer weit draußen liegenden Kaserne zweifelhaften Vergnügungen nachgehen. Das Kind ist ihnen natürlich im Wege. Es wird in einer Ecke des Kasernenhofes abgestellt; da muss es bei Wind und Wetter warten, stundenlang, und niemand erbarmt sich seiner. Im Gegenteil, aus den Fenstern des gegenüberliegenden Traktes glotzen rohe, grinsende Gesichter, und es ist nur ein Glück, dass die Kleine den Sinn der obszönen Reden nicht begreift. Zu Hause darf sie nichts verraten, sonst drohen Essensentzug und Schläge.
Endlich ist sie alt genug, um in die Schule zu gehen. Sie lernt leicht, und wenn sie wegen ihrer vernachlässigten Kleidung gehänselt wird, wehrt sie sich tapfer, findet bald heraus, dass es wirkungsvoller ist, statt zu knuffen und zu beißen, ihre geistige Überlegenheit auszuspielen. Niemand erfährt von ihrem Zwangsaufenthalt in der Kasernenecke, während andere Hausaufgaben erledigen.
Zu Martini pflegten die Dienstmädchen zu wechseln. Das neue verlegt ihre amourösen Abenteuer in die Abendstunden, so bleiben dem Kind die grinsenden Soldatenfratzen erspart, dafür wird es in die dunkle Schlafkammer eingeschlossen, Als Papa Kummer einmal ungewöhnlich früh heimkommt, findet er Emilie dort, in Tränen aufgelöst, »abgestellt«. Er beschließt sofort: Diese Dienstbotenwirtschaft muss ein Ende haben! Wirft seine Angel aus und zieht eine schon etwas ältliche, aber wohlhabende Witwe an Land, wie sich bald herausstellt, eine rohe, herzlose Person. Es bleibt ihr nicht verborgen, dass Herr Rath es nur auf ihr Geld abgesehen hat. Das erbittert sie maßlos. Kummer entflieht der häuslichen Kommandowirtschaft ins geliebte Theatermilieu, so entlädt sich der Zorn über dem Kind. Von allen Schimpfwörtern ist ihm »angenommener Panker« das schrecklichste, weil es die Bedeutung nicht versteht.
Wenn sie hungrig aus der Schule kommt, hat Madame bereits gespeist und verweist Emilie auf den Hundenapf, in dem noch die Reste des Mittagessens dampfen. Genauso perfide verhält sie sich ihrem Noch-Ehemann gegenüber, je mehr er von ihr gekränkt, beleidigt und gedemütigt wird, desto mehr fühlt sich das Kind zu dem armen Papa hingezogen. Es weiß nicht, wie viele der Anschuldigungen zu Recht bestehen, will es auch nicht wissen. So oft es geht, nimmt Kummer die Kleine mit, ins Theater, zu Proben oder zu Schauspielern nach Haus. Als stille, aber aufmerksame Beobachterin bekommt sie manches von dem inszenierten Privatleben der Komödianten mit, die sich über Miseren mancher Art oder über abwesende Gefühle hinwegtäuschen. Das schärft ihr Gehör für echte und falsche Töne. Unbewusst begreift sie wohl auch, dass es ohne eine gewisse Inszenierung des häuslichen Lebens wahrscheinlich gar nicht geht.
Endlich wird die Scheidung ausgesprochen. Rath Kummer atmet auf und fährt mit der nunmehr neunjährigen Emilie nach Dresden zu Verwandten. Dort lernt sie Tante Auguste kennen. Blind geboren, lebt sie im Kreise ihrer großen Familie und ist doch allein. Sie spürt bei dem Wildfang den heimlichen Hunger nach Zärtlichkeit. Tante Auguste ist für das Kind eine Offenbarung und eine gemeinsame Reise nach Teplitz das schönste Geschenk. Um so trauriger wird der Abschied.
»Mächen mitte Eierkiepe«
Rath Kummer kehrt nach Berlin zurück mit den besten Vorsätzen, sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken; gibt die Wohnung in der Burgstraße auf und zieht als Trockenwohner in die Große Hamburger. »Trockenwohnen« ist eine typisch berlinische Erscheinung: Arme Leute bekommen Gelegenheit, so lange in einem Neubau zu wohnen, bis das Mauerwerk getrocknet ist. Sie zahlen nur einen geringen Mietzins und nehmen dafür das Risiko in Kauf, sich Bronchitis, Rheuma oder Schwindsucht zu holen.
Für das Geld, das er an der Miete einspart, meldet er Emilie an einer guten Schule an. Für eine solide Haushälterin reicht es allerdings nicht.
Aber es findet sich, wie immer, eine überraschende Lösung: Wenig später zieht sein Freund und Jeu-Genosse August Fontane ins Nachbarhaus. Ihre Wesensart ist ähnlich: Beide haben sich bei vielfältiger künstlerischer Veranlagung verzettelt, beide leben mit charmanter Unbedenklichkeit in den Tag hinein, beide haben zur gleichen Zeit einen Anfall von Sparsamkeit, das heißt, sie beschließen, zusammen eine Zeitung zu halten. Jeden Tag nach der Schule trägt Emilie die gelesene Zeitung zu Fontanes. Meist öffnet Rosa, das artige, hübsch herausgeputzte Töchterchen, und führt sie ins Wohnzimmer. Dort sitzt am Nähtischchen Frau Philippine, eine zierliche Schönheit, den Kopf wie eine Neapolitanerin in ein mit goldenen Nadeln zusammengestecktes Spitzentuch gehüllt; am Klavier Herr Fontane. Er schmettert zur Begrüßung eine Arie aus dem Figaro, wirft der atemlos lauschenden Emilie eine Kusshand zu und lässt einen reizenden Pudel über seinen gekrümmten Arm springen. Der Pudel, der natürlich auch Figaro heißt, vollendet die entzückende Inszenierung dieses Familienidylls. Eine Welt wie aus dem Bilderbuch oder wie auf dem Theater.
Erst sehr viel später wird sie erfahren, dass alles Leben in dieser Familie nur Komödie war, Komödie am Rande des Abgrunds.
Dieses Idyll, oder was sie dafür hält, steht im krassen Gegensatz zu der Welt da draußen, in der sich Emilie behaupten muss. In der Schule gefällt es ihr gut, sie glänzt durch rasche Auffassungsgabe und originelle Antworten, aber so sehr sie sich danach sehnt - sie findet keine Freundin. Und ganz schlimm treiben es die Kinder aus der Großen Hamburger. Zwanzig bis dreißig von ihnen versammeln sich zur Spielzeit im Hof am Wäschetrockenplatz, und wenn sie sich dazugesellt, bläken sie: »Mächen mitte Eierkiepe! Mächen mitte Eierkiepe!« Der Spott entzündet sich an ihrem Mantel aus rotem Merino mit einem Muster aus schwarzen Käfern; dazu trägt sie einen nach hinten verschobenen Strohhut. Zugegeben, ein sonderbarer Aufzug, doch Emilie ist Kostümierung gewöhnt; außerdem besitzt sie nur diesen einen Mantel, diesen einen Hut, dieses eine Paar Stiefeletten. Da ihr sowieso nichts anderes übrig bleibt, trägt sie es eben mit Stolz.
Hatte die blinde Tante Auguste sie nicht getröstet, alles, was einem widerfährt, Schlimmes und Trauriges, würde sich irgendwann im Leben einmal als sinnvoll und nützlich erweisen? Ermutigt hat sie das Kind, sich nicht vor den Widrigkeiten des Alltags zu verstecken, sondern ihnen aufrecht entgegenzutreten und für ihr Poesiealbum den Spruch diktiert: »Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, / Niemals sich beugen, / Kräftig sich zeigen / Rufet die Arme der Götter herbei.« Ein ungewöhnlicher Stammbuchvers für ein knapp zehnjähriges Mädchen, aber Tante Auguste ist ja auch eine ungewöhnliche Frau, an die sie denken muss, als die Bengels gerade wieder »Mächen mitte Eierkiepe!« schreien. »Nun, also!«, sagt sie sich, holt tief Luft und tritt tapfer dem lautstärksten Brüller entgegen. So schnell deckt sie ihn mit Fausthieben und Tritten ein, dass er erschrocken das Weite sucht. »Wer ist der nächste?!« Niemand meldet sich.
Fortan provoziert sie sogar das Kräftemessen mit ihren Widersachern. Die Fluchtburg unter der Fransentischdecke hat ausgedient.
Die Selbstbehauptungs-Ringkämpfe bescheren ihr allerdings auch eine herbe Enttäuschung. Da hat sie endlich eine Freundin gefunden, wird sogar zum Geburtstag eingeladen, kann vor Aufregung die ganze Nacht nicht schlafen, endlich, endlich ist sie von den netten, gesitteten Mädchen aus der Klasse als ihresgleichen angenommen! Doch am Morgen des großen Tages gesteht Elise kleinlaut, Emilie dürfe doch nicht kommen, die Mama habe zufällig aus dem Fenster gesehen, wie sie sich mit den Jungen herumprügelte. Und nun dürfe sie nicht mehr mit ihr spielen. Sie ahnt nicht, was sie Emilie antut. Diese schmachvollbittere Zurücksetzung wird sie noch Jahrzehnte später kränken.
Wenn ich eine richtige Mama hätte, so wie die kleine Rosa, dann wäre das nicht passiert, denkt sie.
Es bleibt ihr verborgen, dass auch Rosa nur ein Pflegekind ist, angenommen im Hinblick auf die »namhafte Summe«. Fontanes ergreifen jede Gelegenheit, um zu Geld zu kommen; so leben denn in ihrer Parterrewohnung auch zwei Pensionäre, Schüler der Klödenschen Gewerbeschule: Theodor (dessen Vater ist Halbbruder August Fontanes und Apotheker in Swinemünde) und Hermann Scherz, Sohn eines märkischen Gutsbesitzers. Die beiden, 15 und 16 Jahre alt, sind seit den Neuruppiner Kindheitstagen befreundet.
Die kleine Tragödin
Da Emilie von den Familien der braven, wohlerzogenen und aus dem Ei gepellten Mädchen ihrer Kasse ausgeschlossen und oft allein zu Hause ist, geht sie öfter zu Fontanes. Zum Vergnügen von Frau Philippine, die aus einer Schauspielerfamilie stammt und, wie es heißt, nur ihrem Mann zuliebe eine großartige Karriere aufgegeben habe, spielt Emilie ganze Szenen der Dramen vor, die sie mit Papa Kummer gesehen hat: Die Jungfrau von Orleans, die wahnsinnige Lady Macbeth und vor allem Romeo und Julia. Rosa fällt dabei die jeweilige Schweigerolle zu. Alles, was zu spielen und zu sprechen ist, übernimmt Emilie, natürlich mit eigenen Worten. Als Romeo leert sie die Phiole, sinkt tot zu Boden, springt wieder auf, um als Julia, mit der Stickschere in der Hand, seufzend und Augen rollend zu sterben. Dem leidenschaftlichen Spiel hingegeben, bemerkt sie nicht, dass Hermann und Theodor in den »Salon« gekommen sind; Hermann etwas verwirrt, weil er den Sinn der Sache nicht erfasst, Theodor dagegen hingerissen. Er wirft die Kleine in die Luft und sagt ihr eine glänzende Zukunft voraus. »Und wenn du dann in zehn Jahren als Star auf der Bühne stehst, werde ich dir Blumen und Kränze schicken!«
Ach, schön wär’s! Schauspielerin zu werden - natürlich dramatisches Fach! - ist Emiliens herzinnigster Wunsch. Und dass ausgerechnet Theodor sie darin bestärkt ... Eigentlich mochte sie Hermann lieber; der ist zu jeder Herumtoberei bereit, während sein Freund sich meist kopfschüttelnd zurückzieht und geräuschvoll die Tür hinter sich schließt. Wie oft hat sich Emilie darüber geärgert, »humorlos und Spielverderber« hat sie ihn heimlich genannt; nun weiß sie, wie sie seine Aufmerksamkeit erringen kann. Noch lieber und aufmerksamer begleitet sie nun Papa Kummer ins Theater und wartet nur darauf, dass irgendwann Theodor aus seiner mit Büchern und Herbarien vollgestopften Stube kommt und fragt: »Nun, Mademoiselle, was steht heut’ auf dem Spielplan?«
Aber es ist wie immer in Emiliens Leben: Was schön beginnt, endet jäh. Dem unruhigen Geist August Fontanes gefällt es, weit nach draußen in Liesens Sommerfrische zu ziehen. Und sein Neffe Theodor muss mit.
Am 20. Mai 1836 sieht sie ihn noch einmal, als Konfirmand in der Kirche der Französischen Kolonie. Seine Vorfahren gehören zu den Hugenotten, die im 17. Jahrhundert in der Mark Brandenburg heimisch wurden. Zum ersten Mal begegnet Emilie Theos Eltern, die aus Swinemünde angereist sind: dem gemütlich-sanguinischen Papa, von dem Theo stets mit großer Zärtlichkeit, und der etwas strengen, schmallippigen Mama, von der er mit großer Hochachtung spricht.
Wie wird es sein, wenn Emilie da vorn steht, um den Segen zu empfangen? Ob man sich danach anders fühlt? Eben erwachsen?
Sie möchte Theodor danach fragen, aber er ist in eine andere Welt eingetaucht, seine Lehrzeit in der Roseschen Apotheke hat begonnen.
Eines Sonntags fasst sie sich ein Herz und besucht ihn mit Rosa. Da ist sie zwölf, er siebzehn Jahre alt. Er scheint nicht sonderlich erbaut von ihrem Anblick, oder ist er nur befangen? Zum Abschied schenkt er ihnen Gerstenzucker und bunte Pillenschachteln, als ob sie noch kleine Kinder wären ... Sie beschließt, nicht wieder hinzugehen.
August Fontane und seine Frau Philippine ziehen zwar fort aus Berlin (wie man sagt, nicht ganz freiwillig), aber sie hinterlassen Madame Sohm, eine schillernde Erscheinung und das Absurdeste, was Emilie widerfahren kann. Monsieur Sohm war Hoftheaterdirektor bei »König Lustick«, dem westfälischen König von Napoleons Gnaden, und sie war sein Liebling. An ihrem 14. Geburtstag schenkte sie ihm ein kleines Mädchen: Philippine: Als Napoleons Stern erlosch, standen sie vor dem Nichts.
Sie tourten von Stadt zu Stadt durch alle deutschsprachigen Lande, Madame Sohm spielte und trällerte sich durch das gesamte Bühnenrepertoire und von Mäzen zu Mäzen, Pinchen immer im Schlepptau. Mit 30 verheiratet sie ihr sechzehnjähriges Töchterchen an August Fontane, der versprechen muss, dem Theater zu entsagen und mit einer Mal-Utensilienhandlung sesshaft zu werden.
Nun, da Madame Sohm auf die 50 zugeht, unternimmt sie den letzten Versuch, der Lustigen-Salome-Rolle zu entsagen und sich gutbürgerlich zu etablieren. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, Frau Rath Kummer zu werden. Zunächst lässt sie sich als Haushälterin engagieren, gibt sich mit ihrem urwüchsigen Humor abwechselnd häuslich oder verführerisch, sogar mütterlich, entspricht ideal der Kummerschen Erwartungshaltung. Anfangs findet es Emilie lustig, wenn Madame wie in der Operette mit Schürzchen und Häubchen den Staubwedel schwingt und dabei eines ihrer frivolen Liedchen schmettert; sie überlegt, ob es nicht vielleicht von Vorteil wäre, wenn sie Madame Kummer würde. Doch dann erwischt sie die Komödiantin bei heimlichen Küssen mit diesem und jenem, und das möchte sie Papa denn doch nicht zumuten. Mit überlegener Ironie gibt sie ihr zu verstehen, dass sie ihr Spiel durchschaut. Sie bastelt eines Tages ein Papiermännchen (nach Art der Papiertauben), das unverkennbar Kummers Künstlermähne trägt, wirft es in die Höhe und fängt es mit einem Schmetterlingsnetz wieder ein. Was der Unsinn solle, fragt Madame Sohm; Emilie drückt ihr das Fangnetz in die Hand und meint ironisch: »Für dich! Damit kannst du Papa einfangen! Viel Glück! Aber ohne mich!«
Von da an sind die Trällertage vorbei. Madame Sohm sieht ihren Plan gescheitert und speit Gift und Galle. Nur in der Schule noch hat Emilie eine gute Zeit. Rath Kummer ist zunächst geneigt, ihr und ihrem unbotmäßigen Benehmen die Schuld für die Vereisung des Klimas zuzuschreiben. Erst als Madame in einer groß angelegten Eifersuchtsszene die Contenance verliert und die Katze aus dem Sack lässt, begreift er, was gespielt worden ist. Er gibt Emilie in eine gute Pension und, heilfroh, den Kopf gerade noch rechtzeitig aus der Schlinge gezogen zu haben, fährt er in seine Heimat nach Dresden. Seine Verwandten sind mit der Herrnhuter Brüdergemeinde verbandelt und daher von dem missionarischen Eifer beseelt, sich um Tugend und Seelenheil der Mitmenschen zu kümmern. Sie werden ihren gutherzigen, aber leider allzu labilen Karl Wilhelm unter ihre Fittiche nehmen, das heißt, ihn wieder verheiraten, und sie wissen auch schon, mit wem: Bertha Kinne ist genau die Richtige für ihn: gesund, ordentlich und zielstrebig; zwar schon ein bisschen angejahrt, aber schließlich ist Kummer auch schon 55.
Wer ist Rouanet, und wer bin ich?
Er ergibt sich seinem Schicksal. Emilie, die gerade beginnt, sich in ihrem Pensionat wohlzufühlen, erfährt, dass der Papa sich in Dresden verlobt hat und zu heiraten gedenke. Sie findet die Zukünftige mild und freundlich, aber sie kann sich lange Zeit nicht überwinden, Mama zu ihr zu sagen. Nein, nicht schon wieder eine neue Mama, die doch keine richtige ist. Aber wer ist die Richtige? Das Schimpfwort von dem »angenommenen Panker«, längst vergessen, spukt erneut in ihrem Kopf. Im September 1839 wird sie eingesegnet. In den Papieren taucht zum ersten Mal der Name Rouanet auf. Wer ist Rouanet? Rath Kummer druckst herum, macht Andeutungen, weiß selbst nichts Genaues. Überlässt Emilie völliger Verunsicherung: Wer bin ich? fragt sie sich. Woher komm’ ich? Und wo gehöre ich eigentlich hin? Drei Jahre quält sie sich mit diesen Fragen, drei Jahre, die sie mal in Berlin, mal bei den Kummer-Verwandten in Dresden verbringt.
Dank Frau Berthas strengem Regiment scheinen sich die finanziellen Verhältnisse zu konsolidieren, besonders glücklich ist der Hausherr aber nicht. Heimlich versucht er, wahrscheinlich über den damaligen Vermittler Wilhelmi, die Fäden zu Emiliens leiblicher Mutter zu knüpfen; gerade im rechten Augenblick, denn Thérèse, geborene Rouanet, hat nach sechsundzwanzigjähriger Witwenschaft in dem bejahrten Oberförster Triepke ein spätes Glück gefunden und lebt nun in Dammersdorf bei Liegnitz. Er willigt ein in die geheime Abmachung, die Thérèse mit der nunmehr achtzehnjährigen Tochter trifft: Sie wird als Cousine in den vielköpfigen und weitverbreiteten Kreis der Verwandtschaft eingeführt. Selbst Hermann, Clara und Marie, die längst erwachsenen »Kinder« aus der Prediger-Ehe, wissen nicht, dass Emilie ihre Halbschwester ist. Zu Marie fasst Emilie eine besonders herzliche Zuneigung. Als Frau des Oberstabsarztes Moritz Fels führt sie in der Garnisonstadt Liegnitz ein gastfreundliches Haus. Hier findet Emilie eine echte Heimat.
Fels ist stolz auf seine Ahnengalerie, die sich bis zu den Kreuzrittern zurückverfolgen lässt; dementsprechend distinguiert und würdevoll ist die Atmosphäre in der Familie. Würdig, aber nicht steif. Steifleinen ist eher die Kummer-Verwandtschaft in Dresden mit ihrem Hang zum Moralisieren. Und wieder anders ist das Klima in Berlin, wo Bertha Kinne mit eisernem Besen Rath Kummers Hang zur Boheme so gut wie ausgetrieben hat. Zwischen diesen drei extremen Eckpunkten spielt sich nun Emiliens Leben ab. In Liegnitz lernt sie alles, was eine junge Dame braucht, um später einem eigenen Haushalt vorzustehen: Wirtschaftsführung, Kochen, Backen, Braten, feine Handarbeiten, Klavierspielen und gediegene Umgangsformen. Konversation. Austausch über Bücher, Konzerte, Schauspiele. Das setzt voraus, dass man sie auch wirklich gelesen, gehört und gesehen hat. Theater war in Berlin unbewusster Fluchtort, Flucht in eine Welt des schönen Scheins, weil daheim nichts stimmte; in Dresden oder Liegnitz ist es gesellschaftliches Ereignis, freudig wahrgenommene Abwechslung. Für Emilie bedeutet es mehr, sie erlebt jede Tragödie auf der Bühne aus tiefstem Herzen mit, ist manchmal Stunden danach kaum ansprechbar. Aber merkwürdig: die Sehnsucht, selbst auf der Bühne zu stehen, ist verblasst. Nun träumt sie von einer eigenen Familie, einem liebenswerten Mann und Kindern.
Und wo blieb der junge Mann, der ihr Blumen und Kränze überreichen wollte? Er hat seine Apothekerlehre beendet, in Burg, Leipzig und Dresden als »Defektar« gearbeitet, hat flammende Verse im Herwegh-Stil verfasst und mit rebellischen Studenten verkehrt, deren Namen wenig später als »Vaterlandsverräter« auf Fahndungslisten stehen werden.
Aber davon erfährt Emilie nichts. Jahrelang hört sie überhaupt nichts von ihm. Das einzige ist ein Vers, den er ihr im Mai 1840 ins Stammbuch schrieb:
»Ich habe oft, wenn mich geblendet
Der Sonne zauberhafte Pracht,
Und ich mich von ihr abgewendet
In meinem Herzen dein gedacht.
Wie ohne Sonne mir die Erde
Nur schien ein grabesdunkler Schacht,
Gleicht, - wenn ich von dir scheiden werde,
Mein ganzes Leben einer Nacht.«
Unterschrieben: »Zur Erinnerung an einen wahrheitsliebenden deutschen Jüngling.«
Allzu ernst scheint der wahrheitsliebende Jüngling die Sache nicht genommen zu haben, denn zwei Jahre später, in Dresden, lässt er sich von einer anderen Sonne blenden. Zwar gesteht er seinem Freund Wilhelm Wolfsohn nach wenigen Monaten: »So oft mich ein liebesverwandtes Gefühl beschlichen, ward es plötzlich öde und leer in meiner Seele, die Lippen, die eben noch von begeisterten Worten, vom Ausdruck tiefster Empfindung übergeströmt waren, unterdrücken mühsam ein Gähnen, und das Bewusstsein, dass alles eitel, wohl gar schal und abgeschmackt sei, gewann mehr und mehr Leben in mir. - Es ist traurige Wahrheit, was ich Dir bekenne; wie leicht ist es möglich, dass die Täuschung statt weniger Stunden mondelang währt, dass ich ein Band fürs Leben knüpfe und dann erwachend schmerzlich meinen Irrthum gewahre.« Mit diesem »Bekenntnis einer unschönen Seele«, wie er es selbst nennt, offenbart er dem Freund die schwächste Stelle seines Gefühlslebens: Unfähigkeit zu dauerhafter Liebe. Ein Defizit, das ihm Emilie in 48 Jahren ihrer Ehe immer wieder vorwerfen wird.
Der »Dresdner Irrthum« erweist sich als kostspielig, denn er hat Folgen, und Theodor muss heimlich einen Kredit aufnehmen, um »Ablösegeld« zu zahlen. Auch davon weiß Emilie natürlich nichts, als sie sich im Jahre 1844 in Berlin wiederbegegnen. Sie ist für ein paar Wochen bei Kummers zu Besuch, er steht gerade als Einjährig Freiwilliger für das Gardegrenadierregiment »Kaiser Franz« Unter den Linden auf Wache. Sein Selbstbewusstsein ist noch gestiegen, seit er in verschiedenen Blättern teils rebellische, teils gefällige Gedichte publizierte, der Glaube an seine Berufung als Dichter ist unangefochten; vor allem, seit ihn sein Vorgesetzter und Freund, Gardeoffizier Bernhard von Lepel, in den literarischen Sonntagsverein »Tunnel über der Spree« einführte, wo er mit Liedern auf den alten Dessauer und den alten Derfflinger erste Bravos erntet.
Theodor in seiner Grenadiersmontur ist verblüfft über die Wandlung Emiliens von dem »Mächen mitte Eierkiepe« in eine elegante, junge Dame, und er macht aus seiner Bewunderung keinen Hehl. Der frühere Unbefangenheitston stellt sich rasch wieder her, sie erzählt, als handele es sich um einen fremden Novellenstoff, die verworrene Geschichte ihrer Familie, die Entdeckung ihrer leiblichen Mutter und dreier Halbgeschwister; »und denken Sie sich, Herr Theodor, auch mein Großvater stammt, wie der Ihre, aus Südfrankreich. Aus Toulouse. Erst vor wenigen Jahren ist er als Stadtkämmerer von Beeskow gestorben, hochbetagt.«
»Nun, da hatte ich also gar nicht so unrecht, wenn ich Sie damals in Ihrem roten Merinomäntelchen mit den schwarzen Käfern, mit dem unsäglichen Strohhut und den nassen, abgeklappten Stiefeletten mit einem Ciocciarenkind aus den Abruzzen verglichen habe.« - »So, haben Sie das?« Emilie schaut ihn aus unergründlich grauen, fast schwarz wirkenden Augen an und zieht mokant die feinen Brauen hoch: »Mais Abruzzen et Toulouse, mon ami, c’est une petite différence!«
Oh, là, là, denkt Theodor, Mademoiselle ist ein ausgesprochen kapriziöses Persönchen geworden, da muss er doch gleich seine alte Überlegenheitsrolle wieder aufnehmen. Und er berichtet von seiner jüngsten Englandreise. Zwei Wochen. Mit Hermann Scherz übrigens. Er als Dolmetscher. Großartig, einfach großartig. Eben Weltstadt. »Denken Sie, London hat allein 12 000 Nachtwächter, das sind mehr als das Königreich Sachsen an Soldaten unter Waffen hat!« Emilie muss lachen, weil sie sich eine Armee von 12 000 Pelerinenmännern mit Pike und Laterne vor Buckingham Palace vorstellt, Theodor missversteht dies Lachen und meint gekränkt: »Nun ja, von Liegnitz aus kann man sich das schwer vorstellen, man muss es eben mit eigenen Augen sehn ... Das ist Leben! Das ist Welt!«
Emiliens Ansprüche an Leben und Welt sind weniger hoch gegriffen; sie kann sich an kleinen Dingen herzlich freuen: über die erste Christrose im Schnee, den ersten Schmetterling, an einem dickpummeligen Kind, das gerade seine ersten Schritte meistert, oder über die Rose, die ihr Theodor zusammen mit einem Gedicht dediziert.
Um die Approbation zum Apotheker erster Klasse und damit die Berechtigung zum Führen einer eigenen Apotheke zu erlangen, muss man mindestens fünf Jahre als Refektar vorweisen; Fontane fehlen noch zwei Jahre. Darum tritt er zu Johanni 1845 in die Dr. Schachtsche Apotheke in der Berliner Friedrichstraße ein. Er fühlt sich wohl, der Prinzipal ist ein gebildeter Mann, und mit dem zweiten Lehrling Friedrich Witte kann er echte Freundschaft schließen. Auch Onkel August und Tante Pinchen hat es nach einem unfreiwilligen Leipziger Gastspiel wieder nach Berlin zurückgezogen; doch Theo ist ihnen gegenüber vorsichtiger geworden. Man sieht sich nur selten. Die neuen Bekanntschaften aus dem literarischen Sonntagsverein »Tunnel über der Spree« sind ihm wichtiger und ersprießlicher. Von ihnen kann er lernen.
Verlobung auf der Brücke
Am 8. Dezember 1845 feiert Onkel August seinen 41. Geburtstag. Natürlich ist sein alter Whistpartner Kummer eingeladen. Theodor lässt sich entschuldigen; er weiß nicht, dass auch Emilie mit von der Partie ist. Am Nachmittag erhält er ein zierlich gefaltetes Briefchen, in dem sie »ihren lieben Freund Theodor« bittet, sie auf dem Nachhauseweg von Onkel August zu Kummers Wohnung in der Oranienburger Straße zu begleiten. Das ist Ehrensache, schließlich kann man eine junge Dame in der Dezemberdunkelheit nicht allein gehen lassen. Pünktlich um 22 Uhr endet sein Spätdienst, pünktlich um 22 Uhr liefert Onkel August Emilie vor der Apotheke ab. Für den Rest des Weges, die ganze Friedrichstraße hinunter bis zum Oranienburger Tor und in die Oranienburger Straße hinein, übernimmt Theodor die Schirmherrschaft. Man plaudert, man neckt sich wie immer, und plötzlich, wenige Schritte vor der Weidendammer Brücke, kommt ihm der Gedanke: »Emilie ist die Frau, mit der ich ein ganzes Leben verbringen könnte!« (Noch fünfzig Jahre später wird er in seiner Autobiografie bestätigen, dies sei der »glücklichste Gedanke seines Lebens« gewesen.)
Mitten auf der Brücke fallen die entscheidenden Worte: »Willst du meine Frau werden?« Emilie hat diesen Satz insgeheim schon lange herbeigesehnt, aber dass er so beiläufig, im wahrsten Sinne des Wortes im Vorübergehen ausgesprochen wurde, enttäuscht sie. Nun ja, wenigstens der Ort der Handlung, die Brücke, hat etwas Symbolträchtiges, tröstet sie sich. Wie die Brücke die beiden Ufer der Spree verlässlich verbindet, so werden auch sie für alle Zeit miteinander verbunden sein.
Nach dem einzigen, kalten Dezemberkuss meldet sich bereits der Zweifel: Wie, wenn er sich nur einen Scherz erlaubt hätte? Zuzutrauen wäre es dem notorischen Spötter. Aber vor Kummers Haus nimmt er noch einmal ihre Hand und sagt eindringlich, mit ungewohnter Herzlichkeit: »Wir sind aber nun wirklich verlobt?!«
Das sind sie. Und sie sollen es fünf lange Jahre bleiben.
Der unterkühlten Verlobungsszene auf der Brücke folgt der Ring und - natürlich - ein Verlobungsgedicht, in dem von jungem Liebesrausch, von schäumender Lebensfreude und unversehrter Treue die Rede ist. Behüt dich Gott!, das fünf Jahre durchzuhalten ist schwer.
Onkel August, Pinchen und Kummers gratulieren von Herzen, sie haben schon seit Langem gewittert, dass sich zwischen den beiden etwas anbahnt. Alle anderen sind weniger erbaut. Wenn man es in Emiliens Verwandtschaft auch nicht ausspricht, aber man denkt doch: Hätte es nicht ein Stabsarzt sein können wie bei Marie, oder ein Offizier wie bei Clara? Emilie hatte in Liegnitz doch so viele Chancen; warum einen dichtenden Apotheker - ohne Apotheke?
Ausgerechnet die so streng wirkende Mutter Fontanes ist von Emiliens Herzlichkeit und Frische entzückt: »Du hast Glück gehabt, Theodor«, sagt sie, »sie hat genau die Eigenschaften, die für dich passen.«
Mit mütterlichem Instinkt fühlt sie, dass Emilie neben Esprit und gesundem Selbstbewusstsein auch die notwendige Anpassungsfähigkeit besitzt, um ihrem Theo eine echte Stütze zu sein. Ihr selbst hat es oft genug daran gefehlt. Sie hat sich bei Louis Henri Fontane immer gefragt, wie weit die Anpassungsbereitschaft einer Frau gehen darf: bis zur Selbstaufgabe? Mit allen Mitteln der Diplomatie und des ständigen Raisonierens hat sie versucht, ihren leichtsinnigen Mann zu zügeln. Vergebens. Er will auf das Jeu und andere noble Liebhabereien nicht verzichten, obwohl er damit die Familie ruiniert. Denn immer, wenn ein Bankrott vor der Tür stand, vertauschte er seine Apotheke mit einer kleineren, die natürlich auch weniger abwarf, um von dem Verkaufserlös wieder eine Weile drauflos zu leben. So sind sie aus der stattlichen Neuruppiner Löwen-Apotheke in das romantisch-abenteuerliche Swinemünde gekommen und schließlich im Oderbruch gelandet, der »letzten Station vor Sibirien«, wie sie es nennt.
Theodor, das liebste und begabteste ihrer fünf Kinder, hat, bei aller Strebsamkeit, doch etwas von der verhängnisvollen Veranlagung seines Vaters geerbt. Er ist kein Whistspieler, im Gegenteil, das schlechte Vorbild Louis Henris hat ihm beizeiten jeglichen Spaß an Karten und Glücksspielen vergällt, aber er ist in ihren Augen ein Spieler anderer Art, denn er träumt von der Existenz eines Dichters, der allein von seiner Feder lebt. Das ist ebenso gefährlich. Wird Emilie klug und stark genug sein, ihn zu einer gutbürgerlichen Lebensweise zu bekehren? Aufgrund ihrer eigenen Ehe ist Mutter Fontane davon überzeugt, dass nur diese die Voraussetzung schafft für ein Glück auf Dauer - oder wenigstens für ein wohltemperiertes Leben ohne aufregende, nervenzehrende Turbulenzen. Gutbürgerliche Existenz ist für sie gleichbedeutend mit dem Besitz einer eigenen Apotheke. Doch wovon will Theodor sie erwerben? Auch wenn er es nicht wahrhaben will: Vaters Vermögen ist längst verspielt. So viel Realitätssinn besitzt Theodor immerhin, um sich zu sagen: Zuerst das Staatsexamen, alles Weitere wird sich finden.
Im März 1847 besteht er es. Nun hat er es schriftlich: Er darf in allen preußischen Landen eine eigene Apotheke erwerben. In Frankfurt an der Oder weiß er eine, die ihm zusagen würde. Doch nun kommt für Louis Henri Fontane die Stunde der Wahrheit; er muss zugeben, dass er ihm nicht helfen kann, er steht selbst wieder einmal vor dem Bankrott.
Theodors bester Freund Lepel erklärt sich spontan bereit, eine alte, wohlhabende Tante »in den Skat zu legen« und um ein Darlehen anzugehen, aber Fontane, sonst nicht zimperlich, bei Lepel zu borgen, will es doch nicht so weit treiben. Aus der Traum von einer eigenen Offizin.
Für die Mutter ist dies der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt; sie kratzt den kläglichen Rest ihrer einst stattlichen Mitgift zusammen, nimmt die kleine nachgeborene Elise an die Hand und trennt sich von dem Mann, der immer in guter Hoffnung und nie in gesegneten Umständen lebt.
Ein trauriger Sommer für alle. Der einzige Lichtblick: Drei Balladen, die im »Tunnel« schon positive Resonanz gefunden hatten, werden im »Morgenblatt für gebildete Leser« abgedruckt. Das Honorar reicht gerade, um für ein paar Tage nach Liegnitz zu fahren, denn Emilie wird langsam unruhig. Die Herren Offiziere und Assessoren, die sie ausschlägt, erkundigen sich diskret, wann denn der Herr Bräutigam sein Wort einzulösen gedenke. Sie glaubt, einen hämischen Unterton herauszuhören, und kontert souverän; doch drinnen sieht’s anders aus. Dann zieht sie sich in ihre stille Kemenate zurück und liest - zum wer weiß wievielten Male - das Gedicht, das ihr Theo zum ersten Jahrestag ihrer Verlobung schenkte:
Meiner lieben Emilie
zum
8. Dezember 1846.
Dass ich als Meine Dich umfangen,
Und Dich geherzt, wie nie, so warm,
Heut ist ein Jahr seitdem vergangen,
Und liegt nun da, so reich, so arm;
So arm an allem eitlen Streben
Nach eines Namens Schellenkleid,
Doch überreich an innrem Leben,
An höchstem Glück und tiefstem Leid.
Denk ich, wie wechselnd, bald die Freude
Bald mich der Schmerz in Händen hielt,
So ist mir s fast, als hätten Beide
Mit meinem Herzen Ball gespielt,
Dies Werfen mich und wieder Fassen
Nahm oft der Freude selbst den Werth,
Und »möchten sie mich fallen lassen!«
Hab’ ich manch liebes Mal begehrt.
(...)
Schon sprichst Du: »Welche Leichenrede
Statt eines frohen Festgedichts!«
Doch meiner Klagen all und jede,
Drum lächle nur, zerfällt in nichts;
Denn sprächst Du je: »Dein Weg ist offen,
Sei wieder frei, um froh zu sein;«
So stünd’ ich wie vom Blitz getroffen
Und riefe weinend: »Bleib doch mein!«
Ich liebe Dich, und bin geborgen,
Wenn Du mir Lieb’ um Liebe gibst;
Das aber sind all meine Sorgen:
Ob Du so recht mich wieder liebst?
O könnt ich doch zu dieser Stunde
In Deine lieben Augen schaun.
Ich schöpfte wohl aus ihrem Grunde,
Wie immer Hoffnung und Vertraun.
Welcher Braut in Liegnitz ist je ein solches Gedicht gewidmet worden? Selbst ihre liebste Freundin Johanna muss das neidlos zugeben. Ihr Treutler, von dem Theodor herablassend meint, er sei ein komplett ausgestatteter Bourgeois, verwöhnt seine Braut mit allerlei nicht unerheblichen Geschenken, meist praktischer Art; aber solche Verse und Briefe zu schreiben wäre er außerstande. Hat er auch gar nicht nötig, denn Treutler besitzt Gut Neuhof, ganz in der Nähe; eine halbe Stunde zu Pferde, und er ist am Ziel seiner Wünsche.
Emilie aber muss sich mit drei Briefen in der Woche trösten, nun schon das zweite Jahr. Im Sommer hat Theodor die »Schöne Rosamunde« geschrieben, eine altenglische Liebesgeschichte in hundert Gesängen. Im »Tunnel« wurde sie gelobt, im »Morgenblatt für gebildete Leser« abgelehnt: zu lang für eine Zeitschrift.
Um überleben zu können, ist Fontane wieder als Rezeptar in Apothekerdienste getreten, diesmal in die Jungsche Apotheke nahe dem Alexanderplatz, einem Arme-Leute-Viertel mit vielen schwindsüchtigen und skrofulösen Kindern. Lebertran wird kostenlos abgegeben, doch die Eltern holen ihn nur, um ihn daheim auf die Lampe zu gießen und damit ihre Stube zu erhellen.
Er selbst wohnt, wie er seinem Freund Wilhelm Wolfsohn schreibt, »in einem Hundestall, einer Räuberhöhle mit noch zwei anderen deutschen Jünglingen«, er fühlt sich »wie ein Salzhering in der Tonne«; nicht einmal seine besten Freunde Lepel und Wolfsohn kann er dort empfangen, geschweige denn seine Braut, die in Liegnitz erfolgreich alle Stationen zu einem kultivierten Erwachsensein absolviert hat.
So trifft man sich bei Kummers und schmiedet Pläne für die Zukunft. Das einzige, was dabei herauskommt, ist ein Gedicht: »Winterabend«. Darin heißt es:
»Nun aber komm, nun lass uns plaudern
Vom eignen Herd, von Hof und Haus!
Da baust du lachend, ohne Zaudern,
Bis unters Dach die Zukunft aus;.
Du hängst an meines Zimmers Wände
All meine Lieblingsschilderein,
Ich seh’s und streck danach die Hände,
Als müss’ es wahr und wirklich sein.« (...)
Eifersucht, Revolution und Lebertran
Es ist eine Zeit, in der Theodor von einem so tiefen Liebesgefühl ergriffen - und gebeutelt - wird wie später wohl nie mehr. Wolfsohn gesteht er im November 1847: »Du hast das junge Mädchen bei deinem Hiersein gesehen. Das Hervorstechende ihres Wesens ist, körperlich und geistig, das Interessante, sie wird mich auch da zu fesseln wissen, wo mir größere Schönheit, umfassenderes Wissen und selbst tieferes Gefühl auf meinem Lebensweg begegnen sollten. Mit einem Wort, sie ist liebenswürdig, sie hat jenes unerklärbare Etwas, was allem einen Reiz verleiht; die Schwächen selbst werden so zu Tugenden gestempelt; Unkenntnis gibt sich als herzgewinnende Natürlichkeit; launenhafte Wünsche und Einfälle kleiden sich in das Gewand des Eigentümlichen ... Meine Braut, die sonst in meinen dichterischen Gelüsten nur eine verhasste Nebenbuhlerin sah, hat diese plötzlich von Herzen lieb gewonnen. Ich habe in meiner Liebe viel Kämpfe durchgemacht; ich habe (ohne deshalb meine Braut je minder geliebt zu haben) meine Verlobung wie eine Übereilung betrachtet, ich habe mir die Befähigung abgesprochen, je ein Weib glücklich machen zu können, und ich habe gleichzeitig meinen eigenen Untergang als eine Gewissheit vor Augen gesehen; zu dem allen habe ich den Höllensoff brennender, verzweifelnder Eifersucht gekostet oder richtiger, meine Seele monatelang damit getränkt. Diese Zeiten sind vorüber; unter all diesen Stürmen hat sich meine Liebe bewährt.«
Er meint es zweifellos ernst und weiß nicht, welchen Stürmen er noch ausgesetzt sein wird.
Alle Briefe, alle Gedichte, die irgendwo in Journalen erscheinen, bewahrt Emilie wie Reliquien auf. Aber längst nicht alles, was er schreibt, kommt unter ihre Augen. 1848 gärt es in Paris, Wien und auch in Berlin. In Liegnitz bemerkt man nichts oder will nichts bemerken. In der feinen Garnisonstadt gehört es zum guten Ton, fest und treu zum Hause Hohenzollern zu halten und am Gottesgnadentum des Königs nicht zu zweifeln.
Fontane gehört jedoch zu den überzeugtesten Zweiflern, und als am 10. März die ersten Schüsse auf dem Schlossplatz fallen und in Windeseile Barrikaden errichtet werden, lässt er Apotheke Apotheke sein und eilt zur nahen Georgenkirche, um, wie es einem Dichter ziemt, die Sturmglocken der Revolution zu läuten. Leider ist die Kirche verschlossen. So gesellt er sich zu einer Gruppe, die lautstark zum Alexanderplatz zieht, um im Requisitenfundus des Königstädtischen Theaters nach Waffen zu suchen. Auch Fontane erwischt einen Schießprügel, merkt aber sehr schnell, dass er sich damit höchstens selber in die Luft jagen würde, eine Operettenflinte ist eben ungeeignet für eine echte Revolution. Er erkennt, dass die ihm gemäße Waffe die Feder ist; damit schreibt er flammende, spandaureife Artikel für die radikal-demokratische »Berliner Zeitungshalle«, die sich zum Glück niemals in ein gewisses Liegnitzer Patrizierhaus verirrt.
In bewegten Worten tritt Fontane für ein vereinigtes, demokratisches Deutschland ein, das mit 48 Fürsten nicht zu erreichen ist. Er will keine Einheit der Kabinette oder der Polizei, er fordert nicht Einheit um jeden Preis, sondern Freiheit um jeden Preis. Wie das funktionieren soll, weiß er nicht. Weiß es überhaupt jemand zu dieser Zeit?
Drei Tage bevor Generalfeldmarschall Wrangel in Berlin einmarschiert, um den letzten Funken der Revolution auszutreten, bittet Fontane seinen Freund Lepel um einen Muskedonner aus väterlicher Rumpelkammer; was er damit konkret anfangen will, ist ihm schleierhaft, aber: »Schande Jedem, der zwei Fäuste hat mit Hand ans Werk zu legen, und sie pomadig in die Tasche steckt ... denn alles ist faul und muss unterwühlt werden, um im ersten Augenblick die Mine springen lassen zu können.« Welche Zumutung, so etwas ausgerechnet von einem königlichen Gardeoffizier zu verlangen!
Aber Fontane ist es gewohnt, ausnahmslos alles, was ihn bewegt, mit Lepel zu besprechen; bei aller Verschiedenheit sind sie doch ein Herz und eine Seele, der Dichter, der Pillen drehen muss, und der Gardeoffizier, der Verse schmiedet und mit »gewaltigen« Dramen schwanger geht.
Sie haben sich geschworen, der edlen Dichtkunst zu leben und alles, was an sie herantritt, nur danach zu beurteilen, ob es einen dichterischen Stoff abwürfe; nur daran sollten Wert und Bedeutung gemessen werden. In lebenslanger Freundschaft haben sie diesen Schwur - bis auf wenige Ausnahmen - gehalten. In zahllosen vielseitigen Briefen nehmen Liebesaffären, Herzenskummer, berufliche Einbrüche und andere Katastrophen weit weniger Raum ein als die Beurteilung einer Ballade oder das Gliedern eines Dramenstoffes.
Ja, ideal wäre es, wenn er dergleichen Resonanz auch bei Emilie fände, wenn es gewissermaßen eine Synthese gäbe von Lepel und Emilie. Oder wenn er wenigstens, wie der thüringische Graf von Gleichen, mit seiner Frau und seiner Geliebten (Dichtkunst) zusammen glücklich leben könnte. Aber man muss Menschen und Dinge nehmen, wie sie sind. Und manchmal fällt ein Sonnenstrahl des Glücks auch ins bescheidenste Pillendreherleben: Während draußen Revolution und Konterrevolution hohe Wellen schlagen, landet Fontane in einem Idyll. Mama Fontane hat einen guten Freund, Pastor Schultz von der Königlichen Krankenanstalt Bethanien; er bietet Theodor an, für 20 Taler im Monat zwei Diakonissen in Pharmazie auszubilden. Kost und Logis frei. Hinter hohen Backsteinmauern und im liebenswürdigen Umgang mit den beiden feinsinnigen Damen gewinnt er nach und nach die Überzeugung, dass sich der ganze reaktionäre Schandstaat auf einem Pulverfass befände und demnächst sowieso zum Mond fliegen würde, darum sei sein kämpferisches Engagement überflüssig. In aller Ruhe beginnt er mit intensiven Studien zu einem historisch-politischen Drama über Karl Stuart. Und dreimal in der Woche gehen Briefe nach Liegnitz, in denen er Emilie mitteilt, was alles um ihn herum passiert, was im »Tunnel« vorgetragen und wie es beurteilt wurde; er gibt (meist karikaturenhafte) Porträts gemeinsamer Bekannter, erzählt Anekdoten - nur von einem Brief aus Dresden berichtet er nichts. Lepel gegenüber gesteht er jedoch kleinlaut »zum zweiten Mal unglückseliger Vater eines illegitimen Sprösslings« zu sein. »Meine Kinder fressen mir die Haare vom Kopf, eh’ die Welt weiß, dass ich überhaupt welche habe. >O horrible, o horrible, o most horrible<, ruft Hamlets Geist und ich mit ihm.«
Zu allem Unglück läuft auch der Vertrag mit Bethanien aus. Fontane steht gänzlich im Regen. Er muss Geld beschaffen, nicht auf irgendwelchen windigen Wegen wie Onkel August, nein, er will es ehrlich verdienen. Hektisch sucht er nach Schülern, denen er in Deutsch, Englisch, Geografie und Geschichte Nachhilfeunterricht geben kann, er bewirbt sich sogar bei der Eisenbahn als Kutschenschlagaufmacher (!). Lepel winkt ab: Auf diese Weise sei bis heute noch niemand zu Geld gekommen. Zunächst müsse er aus seinem melancholischen Brüten herausgerissen werden; er schlüge vor, zusammen für ein halbes Jahr nach Italien zu gehen, um dort Stoffe zu sammeln und in historische Dramen umzusetzen. (Lepel hat gut reden, von Hause aus begütert, kennt er sich in Italien gut aus, hat Geld und Beziehungen, ist bereit, sie mit Fontane zu teilen.) Wenn er allein wäre, vielleicht, antwortet er, aber wie sollte er das vor Emilie rechtfertigen? »Ein Mädchen verlobt sich doch nicht, um eine altjüngferliche Braut zu werden, und wenn die Meinige auch Gott sei Dank zart genug ist, mich mit solchen Anfragen nicht zu quälen, so weiß man doch am Ende, was in solchen Herzen vorgeht ... Ich hätte in der That nicht den Muth, auf ein halb Jahr in die weite Welt zu gehn und Stoffe zu sammeln, während das Mädchen, das ich zu lieben vorgebe, das vierte Jahr schwinden sieht, ohne dem Ziel näher zu sein wie am ersten Tag. Man muss dann wenigstens gemeinschaftlich tragen; aber lachen und Terzinen baun, während ein liebend Herz weint und bricht, das geht nicht.«
Es ist erstaunlich, dass er, dem doch rundherum alles schiefging, noch dichten kann:
Du darfst missmutig nicht verzagen,
In Liebe nicht noch im Gesang,
Wenn mal ein allzu kühnes Wagen,
Ein Wurf im Wettspiel dir misslang.
Wes Fuß wär’ niemals fehlgesprungen?
Wer lief nicht irr’ auf seinem Lauf?
Blick hin auf das, was dir gelungen,
Und richte so dich wieder auf.
Vorüber ziehn die trüben Wetter,
Es lacht aufs neu der Sonne Glanz,
Und ob verwehn die welken Blätter,
Die frischen schlingen sich zum Kranz.
Um ihn mit Heiterem zu erfreuen, erzählt Emilie von den freundlichsten Seiten des Liegnitzer Lebens, vom Gastspiel der Meininger (Kabale und Liebe), das ein großes gesellschaftliches Ereignis gewesen, und dass sie 40 Gläser Aprikosenkonfitüre eingekocht und zweimal ein Dutzend Servietten mit den Initialen E und F bestickt habe, sie sehe dabei in Gedanken einen achteckigen Tisch vor sich mit fröhlichen Essern und Diskutanten und Theodor als Maltre de Pläsier ... Ein harmloser Nachsatz, die letzte Redoute sei wieder recht vergnüglich gewesen, trifft den erfolglosen Bräutigam an der empfindlichsten Stelle: Sie amüsiert sich also, während er ums Überleben ringt. Und wie von selbst fließen grimmige Zeilen aus seiner Feder:
Leichtes Herz und leichter Pfennig,
Morgen zu Gebrüder Hennig,
Leutnant Idler, Leutnant Fidler,
Leutnant Brause, Leutnant Krause;
Immer lustig, immer Tanz
Mit den lieben Leutenants.
Er gibt ihr gegenüber zu, »wahnwitzig in seinem Argwohn« zu sein und bittet sie dafür um Verzeihung: »Rede mir zu, streichle mich, blicke mich fest und freundlich an - ach, Du kannst alles auch mit Worten, wenn Du mir fern bist - thu es, und zu meiner Liebe gesellt sich mein wärmster Dank. Ich will ein Mann sein, Dein Mann sein, und bitte Dich: behandle mich wie ein Kind. Wie bin ich Dir gegenüber doch ein andrer Mensch geworden! Jedes Liebeswort machte mich sonst lachen, und jetzt les’ ich die zärtlichen Stellen Deiner Briefe oft zwanzigfach, und klammre mich an sie ...«
Dieser Herbst 1849, also nach seiner Zeit in der Königlichen Krankenanstalt Bethanien, wartet mit einem Wechselbad der Gefühle auf. Fontane hat offensichtlich die Nerven verloren, entwirft die widersinnigsten Pläne: einmal will er sich im Oderbruch, in der Nähe des Vaters einmieten, um das Karl-Stuart-Drama zu beenden, das selbst bei Gelingen erst in Monaten ein paar blanke Heller einbringen könnte; dann wieder lässt er sich von Onkel August und Tante Pinchen den Kopf verdrehen, die im Begriff sind, nach Südamerika auszuwandern. An Emiliens Adresse reimt er:
Liebchen, komm, vor dieser Zeit, der schweren,
Schutz zu suchen in den Kordillieren;
Aus der Anden ew’gem Felsentor
Tritt vielleicht noch kein Konstabler vor (...)
Ohne Wühler dort und Agitator
frisst uns höchstens mal ein Alligator (...)
Komm, o komm, den heimatlichen Bettel
Werfen wir vom Popokatepettel,
Und dem Kreischen nur des Kakadu
Hören wir am Titicaca zu.
Flüchtet er, wie oft in verzweiflungsvollen Momenten, in Ironie und Satire, oder nimmt er die Sache doch von der ernsthaften Seite? Immerhin sind etliche seiner rebellischen Freunde aus der Leipziger und Dresdner Sturm-und-Drang-Zeit vor deutschen Konstablern ins Ausland geflüchtet. In London soll es von deutschen Emigranten nur so wimmeln. Auch Georg Günther, bis 1848 Redakteur der Leipziger Zeitschrift »Die Eisenbahn« und danach Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, ist im Begriff, in Nordamerika sein Heil zu finden und fordert Fontane auf, mitzukommen; der heimatliche Bettel, dieses Kriechen vor der immer anmaßender werdenden Reaktion sei doch unerträglich für jeden aufrechten Demokraten.
Allein wäre er dem von ihm hochgeschätzten Günther vielleicht gefolgt, aber Emilie kann er den weiten Weg ins Ungewisse nicht zumuten. Außerdem: Günther ist nicht nur Publizist, sondern Arzt, er würde überall ein Auskommen finden; anders als ein Mann der Feder. Darum antwortet er, vor wenigen Monaten wäre er dazu wohl bereit gewesen, doch nun gedenke er auszuhalten; »einmal, weil ich noch hoffe, dann aber auch, weil ich, übersiedelnd in die neue Welt, Bande zerreißen müsste, die mich mit meinem eigentlichsten Leben an unsre deutsche Erde fesseln. Wir sind nicht alle gleich in dem, was das Herz begehrt; und die Freiheit und Unabhängigkeit, die der Eine draußen in der Welt sucht, findet der Andere in dem Freistaat der Kunst und Wissenschaft. Ich liebe die deutsche Kunst. Das ist mein eigentliches Vaterland, und es aufgeben, sie aufgeben, hieße, mich selbst aufgeben. Jeder zieht seines Weges - ich den meinen. So scheiden wir denn. Meine besten Wünsche geleiten Sie übers Meer.«
»Ein Fisselchen für die Unsterblichkeit«
Was ihn wieder hoffen lässt, ist ein Angebot seines Freundes Wilhelm Wolfsohn, als Berlinkorrespondent für die radikal-demokratische Dresdner Zeitung zu arbeiten. Dort gilt noch die in Berlin längst über Bord geworfene halbwegs liberale Verfassung von 1848; darum auch hat sich der russisch-jüdische Literaturhistoriker Wolfsohn, der sich mit ganzem Herzen dem kulturellen Austausch zwischen Russen und Deutschen widmet, dort niedergelassen.
Schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft, in der Vormärz-Zeit, schwebte Wolfsohn, der nicht nur übersetzt, sondern auch selbst Gedichte schreibt, eine Art Seelenfreundschaft: mit Fontane vor; doch er sollte sich nur in seltenen Augenblicken von ihm wirklich verstanden fühlen.
Fontane ist kein leidenschaftlicher Mensch, er gibt sein Innenleben niemandem so leicht preis (Lepel vielleicht ausgenommen). Emilie wird ihm ein Leben lang vorwerfen, alle Guttaten seiner Freunde als selbstverständlich anzunehmen, sich ihnen gegenüber aber oft zu kühl und gedankenlos zu verhalten. Theo widerspricht zwar jedes Mal auf das Entschiedenste, beweist jedoch im Falle Wolfsohns wieder einmal mehr, wie recht Emilie hat.
Fontane verdankt Wolfsohn also die Mitarbeit an der Dresdner Zeitung. Dass sie sich nur über knapp 30 anonym erscheinende Korrespondenzen hinquält, politisch unerfreulich und finanziell unergiebig ist, liegt gewiss nicht an Wolfsohn, der ja nur vermittelte; dennoch fühlt er sich für Fontanes Enttäuschung verantwortlich und will es auf andere Weise wiedergutmachen. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um einen Verleger für die »Schöne Rosamunde« zu finden. Endlich ist er mit den Gebrüdern Katz in Dessau übereingekommen: drei Louisdor für den Autor, und das Buch wird, schön ausgestattet, zu Weihnachten bei den Buchhändlern sein.
Macht Fontane bei dieser Nachricht Freudensprünge? O nein, er mault, drei Louisdor wären ein Quark. Wolfsohn gibt zu verstehen, dass andere Dichter, die erst am Anfang ihres Weges stünden, sich sogar an den Druckkosten beteiligen müssten und gar nichts bekämen außer ein paar Freiexemplaren. Das erbost Fontane: Er sei schließlich nicht irgendeiner, und Katz sei ein notorischer Knicker, und Wolfsohn möge im Vertrag aushandeln, dass dieses schäbige Honorar nur für die erste Auflage gelte, dann wolle er die Rechte zurückhaben. Außerdem wünsche er eine Widmung, die er nachliefern werde. Wolfsohn kann Katz von allem überzeugen. Kaum ist Fontane der Sache sicher, fängt er an zu drängeln: Bis 21. Dezember müsse er die ersten Exemplare haben, er wolle sie am 23. Emilie überreichen. Man kann ja verstehen, dass er nach so langer Darbezeit seiner wartenden Braut etwas auf den Gabentisch legen möchte, aber wie unbedenklich fordernd er zur Eile antreibt, mutet doch seltsam an.
Als er am 21. Dezember 1849 abends in Dresden eintrifft, kann ihm Wolfsohn tatsächlich die druckfrischen Exemplare überreichen. Am anderen Morgen kündigt die »Dresdner Zeitung« (auch Wolfsohns Werk) die »Schöne Rosamunde« als passendes Weihnachtsgeschenk an. Nun ist Fontane wie ausgewechselt, heiter, euphorisch, übermütig, so, als könne es mit dem Ruhm ab morgen losgehen. Wolfsohn nimmt lebhaften Anteil an seiner Freude, schleppt ihn mit zu einer Teegesellschaft bei dem in Dresden geradezu schwärmerisch verehrten Schauspieler Emil Devrient, hat auch bei dem Porträtmaler Adolf Kindermann einen Zeitpunkt ausgehandelt, an dem der den überglücklichen Fontane skizzieren wird. (Es soll eine Überraschung für Emilie sein und wird die Hälfte des Rosamunde-Honorars verschlingen.) Theodor schwebt von Gastmahl zu Gastmahl, nimmt nicht allzu viel davon wahr, seine Gedanken eilen voraus nach Liegnitz.
Endlich wird er der honorigen Familie seiner Braut schwarz auf weiß und mit Goldschnitt beweisen, dass er ein wirklicher Dichter ist, und der Herr Oberstabsarzt wird sich abgewöhnen müssen, von dem Dichter stets in hörbaren Anführungsstrichen zu sprechen.
Emilie ist erwartungsgemäß selig, vor allem über die gedruckte Widmung:
An Emilie.
Liebe dacht es, Liebe schrieb es,
Und wie viel ihm immer fehle,
Auch mit seinen Fehlem lieb es
Als den Spiegel meiner Seele.
Die schönen Tage trauter Zweisamkeit vergehen wie im Fluge. Anfang Januar 1850 ist er wieder in Berlin und liest im Feuilleton der »Nationalzeitung« über seine »Schöne Rosamunde«, es sei »ein artiges Gedicht ... ein kleines Epos, das die traurige Geschichte der schönen Tochter Cliffords und König Heinrichs erzählt. Der frische Volkston in dem Gedicht, die wechselnden Bilder vom verborgenen Liebesleben des Königs, die Eifersucht der Königin und ihre Rache sind eingehend, lebhaft und verdienen die Anerkennung des jungen Dichters, der Kraft der Darstellung, Fantasie, Leichtigkeit ... und ein poetisches Talent besitzt, das über die Reflexion hinausreicht.« - »Das ist eine Kritik, wie wenn Einer ausspuckt!«, mokiert sich Fontane bei Wolfsohn. Ja, was hat er denn erwartet?
Jedes Jahr zu Weihnachten wird der Büchermarkt mit Neuerscheinungen überschwemmt; glaubt er wirklich, die Leute würden seinen romantischen Gesang den Buchhändlern aus den Händen reißen? Ach, nur für den Dichter selbst ist der Erscheinungstag seines ersten Buches allerhöchster, allerheiligster Feiertag, für alle anderen ist er ein Tag wie jeder andere. Als wenig später seine Preußenlieder unter dem Titel »Männer und Helden« bei Hayn in Berlin erscheinen, stellt sich die hochfliegende Dichter-Euphorie schon nicht mehr ein. Er überrechnet nur, dass er von dem Honorar wenigstens einen Teil seiner Schulden abtragen kann.
»Wieder ein Fisselchen für die Unsterblichkeit getan«, spottet er Lepel gegenüber. Er ahnt nicht, dass er damit der Wahrheit nahe kommt, denn Jahrzehnte später werden einige seiner Preußenlieder in allen Schullesebüchern stehen.
Für die nächsten Monate verschwindet Wolfsohn aus Fontanes Gesichtskreis, statt seiner schreibt Emilie ihm einen Brief aus tiefstem Herzen; »Lieber Wolfsohn! Ich danke Ihrer Güte viel ... Theodors Porträt und den Druck seiner >Rosamunde< habe ich mit Freudentränen empfangen und innig Ihnen gedankt, der Sie diesen ersten Schritt in die Öffentlichkeit geleitet haben.« Es ist das erste Mal, dass sie als Briefschreiberin für ihren Theodor in die Bresche springt. Es wird lebenslang dabei bleiben.