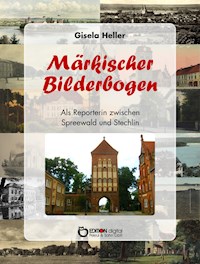9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
100 Jahre nach Fontane scheint es aktueller denn je, auf seinen Spuren „von der Ostsee bis zur Donau zu wandern, die von ihm beschriebenen Wege nachzuvollziehen. Die Autorin führt den Leser nach Swinemünde, Rügen, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Dänemark, Friedrichsruh, Hamburg, Niedersachsen, in die Altmark, nach Burg, in den Harz, nach Sachsen, Thüringen, Bayern, Wien, Böhmen, ins Riesengebirge, nach Küstrin, Sonnenburg und Tamsel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorwort
Swinemünde
Heringsdorf und das Usedomer Hinterland
Rügen
Mecklenburg
Neubrandenburg – Augustabad
Waren an der Müritz
Dobbertin
Vollrathsruhe
Rostock
Warnemünde
Seebad Doberan (Heiligendamm)
Güstrow
Schwerin
Schleswig–Holstein
Der Weg vom Dannewerk bis Düppel– heute
Danevirke – Dannewerk
Schleswig
Gottorf – Luisenlund
Missunde
Oeversee
Flensburg
Aus dem Sundewitt
Kiel
Husum
Wyk auf Föhr
Dänemark
Kopenhagen
Friedrichsruh
Hamburg
Niedersachsen
Hannover
Lütetsburg
Norderney
Transitstationen
Marienhafe
Oldenburg
Altmark
Stendal
In Gardelegen
Aus Salzwedel,
Arendsee
Scharteuke
Redekin
Wust
Schönhausen
Von Quitzöbel bis Eldenburg
Tangermünde
Burg
Harz
Thale
Ausflug von Thale nach Altenbrak
Ausflug von Thale nach Quedlinburg
Bad Harzburg
Wernigerode
Ausflug von Wernigerode nach Ilsenburg
Sachsen
Leipzig
Dresden
Herrnhut
Thüringen
Bayern
Bad Kissingen
Bayreuth
München
Wien
Bad Vöslau
Böhmen
Karlsbad
Eger
Riesengebirge
Das Hirschberger Tal
Jenseits der Oder
Küstrin
Sonnenburg
Tamsel
Zwischen Kunersdorf und Zorndorf
Editorische Notiz
In eigener Sache
Register
Gisela Heller
E-Books von Gisela Heller
Impressum
Gisela Heller
Unterwegs mit Fontane von der Ostsee bis zur Donau
ISBN 978–3–95655–867–2 (E–Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1995 in der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung Beuermann GmbH, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2018 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E–Mail: rial",sans-serif'>verlag@edition–digital.de Internet: rial",sans-serif'>http://www.edition–digital.de
Vorwort
Wer den Namen Fontane hört, denkt zweifellos zuerst an Berlin und die Mark Brandenburg, denn in Neuruppin wurde er geboren, und in Berlin verbrachte er die längste Zeit seines Lebens; hier erlernte er den Beruf des Apothekers, stand 1848 hinter der Barrikade und erlebte hautnah – nicht nur im Widerschein der Lese-Cafés – wie Berlin „vernebelte“. Besonders nach den Londoner Presse-Jahren schätzte er Berlin als „ein Zentrum, wo entscheidende Dinge geschehn“, hier spürte er das Schwungrad der Geschichte rotieren und nahm in Kauf, dass es „gelegentlich zu dem bekannten Mühlrad“ wurde. Seismografisch genau erfühlte er die an Schwung- und Mühlrad gebundenen Menschenschicksale von feinsinnigen oder verknöcherten Adelsdamen, liebenswerten Nähmädchen, schwadronierenden Gardeoffizieren, Fabrikanten und Lebe-Baronen. So wie Balzac für Paris steht, Dickens für London, Dostojewski für Petersburg, so bewahrte Fontane in seinen Romanen das Berlin des 19. Jahrhunderts für alle Zeiten auf. Und die Mark Brandenburg trat erst durch ihn als literarische Landschaft ins Bewusstsein des deutschen Lesers. Darum nannten wir Band 1 „Unterwegs mit Fontane in Berlin und der Mark Brandenburg“.
Aber es darf nicht vergessen werden, dass Fontane, der sich – ungeachtet seiner hugenottischen Herkunft – selbst „ein in der Wolle gefärbter Preuße“ nannte, wie kaum ein anderer seiner schreibenden Zeitgenossen europäisch empfand, und dass es über Berlin-Brandenburg hinaus viele Orte und Landschaften gibt, die für ihn bedeutsam, ja prägend waren: Denn nicht im abgezirkelten Neuruppin entfalteten sich seine Kinderträume, sondern in Swinemünde, wo er vom siebten bis zwölften Lebensjahr „in freier Wildbahn“ aufwuchs mit Abenteuern und Spukgeschichten, die bis in die späten Romane hineinspielen. Erste Liebe in Heringsdorf, Apothekers-Jahre in Burg, Leipzig und Dresden, wo die studentische Bewegung des Vormärz hohe Wellen schlug; Lieblingsplätze seiner „Wanderungen“ jenseits der Oder, Küstrin, wo er genau ausmaß, aus welchem Fenster Kronprinz Fritz mit ansehen musste, wie sein Freund und Fluchthelfer Katte enthauptet wurde, damit, wie des Königs Befehl lautete, „das Recht nicht aus der Welt käme“.
Was ist Recht? Wann darf es sich über menschlichen Glücksanspruch hinwegsetzen? Diese Frage beschäftigte Fontane nicht nur in Küstrin, in Tamsel und auf den friderizianischen Schlachtfeldern zwischen Kunersdorf und Zorndorf; auch an der Gruft der Familie Katte im altmärkischen Wust, im benachbarten Schönhausen, dem Geburtsort Otto von Bismarcks, und im Quitzow-Winkel.
Was ist Recht und wann darf man es sich nehmen, auch auf Kosten anderer? So stellte sich die Frage auch für den Berichterstatter Fontane, der die Kriegsschauplätze von Schleswig-Holstein und Böhmen bereiste. Oeversee und Düppel ließen ihn begreifen, dass Krieg kein Balladenstoff war, sondern sterbensgrauer Alltag. Die Erlebnisse und Erkenntnisse von Düppel und Alsen flackerten noch Jahrzehnte später in „Quitt“, „Graf Petöfy“, „Stine“, „Effi Briest“ und im „Stechlin“ wieder auf.
Auch als Wanderer durch die Mark geriet er bei peniblen Recherchen weit über die Landesgrenzen hinaus: Um hinter das Geheimnis der schönen, unglücklichen Krauten-Tochter zu kommen, trieb es ihn bis Ostfriesland, wo er im Familienarchiv der Grafen Knyphausen endlich Aufklärung fand. Und eine Entdeckung zog die andere nach sich: So stieß er im nahen Marienhafe auf den wehrhaften Schlupfwinkel Störtebekers und seiner Vitalienbrüder, die ihn seit Kindertagen und bis ans Ende seines Lebens beschäftigten. Wichtig, ja unerlässlich waren für ihn auch die „Sommerfrischen“, in die er regelmäßig flüchtete, wenn die Berliner Luft sich unerträglich auf die empfindlichen Magennerven legte.
Ohne diese Sommerfrischen (in die man nicht selten mit Kochtopf und Federbetten reiste) gäbe es Fontanes Romanwerk nicht. Oft lieferten Landschaften und regionale Ereignisse wieder Stoff für neue Novellen und Romane; so fand er im Riesengebirge den Stoff zu „Quitt“, in Wernigerode und Ilsenburg den Stoff zu „Ellernclip“, in Tangermünde die Chronik über „Grete Minde“; Thale, Quedlinburg, Altenbrak und Bad Harzburg wurden zu Schauplätzen für „Cecile“. Manchmal genügte ein Aufenthalt von nur wenigen Tagen, um Jahrzehnte später dort seine Romanfiguren anzusiedeln, wie in Wien den Grafen Petöfy und in Schleswig-Holstein den Grafen Holk. Drei Tage in Kopenhagen, Roskilde und Frederiksborg gaben ihm Anregung für ein Dutzend Nordischer Balladen und den Hintergrund für „Unwiederbringlich“.
Manche Stadt suchte Fontane auf, weil er ihre heilkräftigen Quellen brauchte (Karlsbad und Kissingen), andere kamen ihm nahe, weil Freunde oder Bekannte dort wohnten (Rostock-Warnemünde, Kiel und Husum). All diese Orte – und viele andere – sind in den zweiten Band aufgenommen worden. Es wird geschildert, warum und aus welcher Lebenssituation heraus Fontane dorthin fuhr, was ihm dort passierte und wie er das Erlebte in seinem Werk verwendete. Manchen Ort besuchte er nur unter einem einzigen, besonderen Aspekt, zum Beispiel Bayreuth; hier wollte er sich endlich über sein zwiespältiges Verhältnis zu Richard Wagner Klarheit verschaffen — der Aufenthalt endete mit einem ironisch beschriebenen totalen Fiasko.
In Eger (Cheb) interessierte ihn die „von der Parteien Gunst und Hass“ verzerrte Gestalt Wallensteins, über dessen Ermordung er eine Ballade geschrieben hatte; Wallenstein erinnerte ihn in frappierendem Maße – an Bismarck. Brünn (Brno) und den berüchtigten Spielberg besuchte er nur, um in seine Abhandlung über den „Deutschen Krieg von 1866“ seine Ansichten über die verfehlte Wirkung von Staatsgefängnissen einzubringen. Das mecklenburgische Dobbertin geriet in seinen Gesichtskreis, als sich die mütterliche Freundin Mathilde von Rohr als Stiftsdame dorthin zurückzog. Hier fand er nicht nur den ungestörten Platz, um unter großem Zeitdruck „Aus den Tagen der Okkupation“ niederzuschreiben, hier konnte er auch „konserviertes Mittelalter“ studieren, wo mit Samthandschuhen lebenslängliche Fehden ausgetragen wurden. Die Atmosphäre von Kloster Wutz und die versteinerten Ansichten der Adelheid von Stechlin stammen aus Dobbertin.
Der besseren Übersicht wegen ist dieser Band in Landschaften gegliedert; wo es sich anbietet, wird essayartig Fontanes Verhältnis zu Land und Leuten dargelegt (so in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Alt- und Neumark); danach folgen die einzelnen Orte, wie sie Fontane sah und wie sie zum Teil heute noch vorzufinden sind. Dem Kenner und Liebhaber Fontanes wird es sicher ähnlich ergehen wie der Autorin, die an vielen Punkten, oft unerwartet, jenen beglückenden Wiedererkennungseffekt verspürte, sei es in der Salesianergasse in Wien, auf dem romantischen Friedhof von Ilsenburg oder bei Rinkenaes, von wo man in der Ferne die Steildüne von Holnis erblickt, auf der Fontane das Schloss des Grafen Holk erstehen ließ. Es hat hier nie ein Schloss gegeben, aber wir sehen es, denn wir wissen: „Die Dinge selbst sind nicht richtig, aber wir geben den Dingen den richtigen Platz“.
Möge sich nun der Leser auf das Zauberspiel der Fantasie einlassen und Fontane und seine Romangestalten dort aufspüren, wo er sie bisher vielleicht nicht vermutete.
Gisela Heller, Mai 1995
Swinemünde
„Es giebt doch wirklich eine Art Genius Loci und während an manchen Orten die Langeweile ihre graue Fahne schwingt, haben andre unausgesetzt ihren Tanz und ihre Musik. Diese Beobachtung habe ich schon als Junge gemacht; wie spießbürgerlich war mein heimathliches Ruppin, wie poetisch das aus bankrutten Kaufleuten bestehende Swinemünde, wo ich von meinem 7. bis zu meinem 12. Jahre lebte und nichts lernte. Fast möchte ich hinzusetzen Gott sei Dank. Denn das Leben auf Strom und See, der Sturm und die Überschwemmungen, englische Matrosen und russische Dampfschiffe, die den Kaiser Nicolaus brachten, – das war besser als die unregelmäßigen Verba, das einzig Unregelmäßige, was es in Ruppin gab. Ja, Swinemünde war herrlich...“ (an Georg Friedländer, 22. 10. 1890)
Fontane sah den Ort zeitlebens in schwärmerischer, romantischer Verklärung; mit Siebzig errichtete er ihm ein literarisches Denkmal in dem autobiografischen Roman „Meine Kinderjahre“. Darin heißt es: „Von Pfahlbürgertum, von Engem und Kleinem überhaupt, existierte keine Spur. Und das gab dem ganzen Leben nicht bloß Reiz und Unterhaltlichkeit, sondern, aller Tollheiten unerachtet, doch auch etwas von einem höheren Stempel. Ich habe später in jugendlichen Künstler- und Dichterkreisen oft ähnliches erlebt, aber als stadtbeherrschendem Ton bin ich ihm nie wieder begegnet.“ (Kapitel 8)
Vater Louis Henri Fontane, „ein großer, stattlicher Gascogner, dabei Fantast und Humorist, Plauderer und Geschichtenerzähler“, schien wie geschaffen für diesen Ort. Allerlei „noblen Passionen“ huldigend, hatte er in Neuruppin ein kleines Vermögen verspielt und, um „aus der Bredouille herauszukommen“, seine dortige Apotheke gegen die wesentlich bescheidenere in Swinemünde vertauscht. Als der siebenjährige Theodor im Hochsommer 1827 – nach anstrengender dreitägiger Reise – dort eintraf, war er zunächst tief enttäuscht: Das neue Vaterhaus lag an einer Art „dörfischen Gänsewiese“, die „zugleich auch als Holzsägeplatz diente... Auf diesem völlig ungepflegten Platze ... ragte ein scheunenartiger Bau mit hohen Fenstern auf: die Kirche. Dieser gegenüber und nur durch die Straßenbreite von ihr getrennt, stand ein mit Feuerherdsrot gestrichenes Haus, dessen endlos aufsteigendes Dach wohl fünfmal so hoch war als das Haus selber.“ Alles erschien dem Knaben roh und unkultiviert. Doch muss er schon damals die Gabe besessen haben, „das Gute gut zu finden, anstatt es durch krittlige Vergleiche totzumachen“, denn auf den zweiten Blick entdeckte er durch die Hintertür des mit hässlichgelben Mauersteinen gepflasterten Hausflurs einen wild wuchernden Garten mit einer Geißblattlaube. „Dieser Anblick erfüllte mich mit etwas wie Hoffnung, und diese Hoffnung trog auch nicht. Es war ein wunderbarschönes Leben in dieser kleinen Stadt, dessen ich noch jetzt, wie meiner ganzen bunt bewegten Kinderzeit, unter lebhafter Herzensbewegung gedenke.“ („Meine Kinderjahre“, Kapitel 3)
Im Rückblick erschienen dem Siebzigjährigen diese Jahre „nicht als eine Schul- und Lernzeit voll Gequält- und Gedrilltwerdens, sondern als eine Zeit unausgesetzten Spielens...“: die wenigen Wochen in der „Pantinenschule“; die fabelhafte „sokratische Lehrmethode“ des Vaters; die Privatlehrer im Haus des Kommerzienrates Krause; Guckkastenbilder auf dem Jahrmarkt; akrobatischer Stelzenlauf; abenteuerliche Kletterpartien; zerschossene Fensterscheiben; Spukgeschichten; Vineta und Bernsteinhexe; Herbststürme und Überschwemmungen; Fahrt mit dem Boot zwischen treibenden Eisschollen zum Fährhaus, wo es – Gipfel der Wonne! – Eierpunsch und holländische Waffeln gab; bedenkliche pyrotechnische Spiele, bei denen der russisch-türkische Krieg nachvollzogen wurde; Rivalenkämpfe am Bollwerk mit Flucht von Schiff zu Schiff, Sprung übers eiskalte Wasser mit Rettung eines Spielkameraden; Seiltänzereien; Seeräuberromantik in Störtebekers Kul... All diese Bilder und Erlebnisse sanken auf den Grund einer empfindsamen Knabenseele und lagerten dort jahrzehntelang, bis sie im Alter poetisch geläutert wieder ins Bewusstsein emporstiegen.
1863, als er mit Bernhard von Lepel Swinemünde besuchte, war diese Zeit noch nicht gekommen. Aus dem Brief an seine Frau Emilie (24. 8. 1863) klang nur Enttäuschung: „Es ist alles anders geworden“, klagte er und meinte damit nicht nur die riesigen Befestigungsanlagen und den alles überragenden Leuchtturm oder ein Hotel von Berliner Ausmaßen, das sich anstelle des altersschwachen Gesellschaftshauses erhob, in dem alljährlich die Ressourcen für Alt und Jung stattfanden. „Aber auch die Stadt selbst hat sich sehr verändert, und in abermals 30 Jahren wird sie den Charakter einer kleinen Schifferstadt mit Giebelhäusern völlig verloren haben.“ Die alte Apotheke, „drin ich 5 Jahre lang gelebt, gelernt, gespielt, gelacht, geweint habe ... ist total runtergekommen ... alles ist dreckig und absolut ruppig geworden... Nur der Nussbaum steht noch, der damals seine noch jungen Zweige in das Fenster von Papas Stube ... hineinwachsen ließ. Ich bin in allen solchen Stücken so unsentimental wie möglich ... aber von leiser Wehmut, von einer gewissen Herbststimmung wird das Herz doch beschlichen... Dunkle Zypressen – / Ring dich nicht ab, / Es wird doch alles vergessen – so ähnlich sagt Storm, und er hat recht.“
Er irrte sich, glücklicherweise. Dreißig Jahre später, als er für den karrierebesessenen Landrat von Innstetten eine entsprechende Umgebung suchte, kam ihm die Szenerie von Swinemünde wieder in den Sinn. Wenn Baron Innstetten seiner blutjungen Effi das künftige Domizil schildert, so sieht dieses Kessin Swinemünde zum Verwechseln ähnlich; und auch der Ton, den er dabei anschlägt, immer belehrend und etwas von oben herab, wie man zu Kindern spricht, erinnert an Vater Fontane, wie er sich, Johanni 1827, bemühte, seinen Kindern das neue Zuhause schmackhaft zu machen:
„Was du hier landeinwärts findest, das sind sogenannte Kaschuben, von denen du vielleicht gehört hast, slawische Leute, die hier schon tausend Jahre sitzen und wahrscheinlich noch viel länger. Alles aber, was hier an der Küste hin in den kleinen See- und Handelsstädten wohnt, das sind von weither Eingewanderte ... Menschen, deren Eltern oder Großeltern noch ganz woanders saßen... Aber der Rest ist, Gott sei Dank, von ganz anderer Art... vielleicht ein bisschen zu sehr Kaufmann, ein bisschen zu sehr auf ihren Vorteil bedacht und mit Wechseln von zweifelhaftem Wert immer bei der Hand... Aber sonst ganz gemütlich...“ („Effi Briest“, Kapitel 6)
Innstetten erzählt Effi, um ihre Neugier und Fantasie anzuregen, von einem toten Chinesen, einem richtigen Schotten und von dem Wundarzt Beza, der, wie der berühmte General de Meza, aus Lissabon stammt und eigentlich nur ein Barbier ist. „Und dann haben wir flussaufwärts am Bollwerk – das ist nämlich der Quai, wo die Schiffe liegen – einen Goldschmied namens Stedingk, der aus einer alten schwedischen Familie stammt; ja, ich glaube, es gibt sogar Reichsgrafen, die so heißen...“(ebenda)
Der Spuk um den toten Chinesen, der in „Effi Briest* eine Schlüsselrolle spielt, taucht in den „Kinderjahren“ ebenso wieder auf wie der „richtige Schotte“, der McDonald hieß und, Baggermeister von Beruf, des kleinen Theodor „besonderer Gönner“ war. Der aus jüdisch-portugiesischer Familie entstammende, später die dänischen Truppen kommandierende General de Meza erscheint bereits in Fontanes Kriegsbuch von 1864, und den Namen Stedingk verwandte er in dem Roman „Graf Petöfy“ für den Vater Hannahs, der in einer kleinen „Hafen- und Handelsstadt“ Küster und Totengräber war.
Nichts ging verloren, nicht das harmlose Vergnügen auf dem Ressourcenball in dem wackligen, aber gemütlichen Fachwerkhaus, und nicht die Schaukel in dem verwilderten Garten, deren Balken schon anfingen, morsch zu werden. Wenn der übermütige Knabe Theodor seine Ehre dareinsetzte, so hoch wie möglich zu fliegen, „quietschten die rostigen Haken, und alles drohte zusammenzubrechen. Aber das gerade war die Lust, denn es erfüllte mich mit dem wonnigen und allein das Leben bedeutenden Gefühl: Dich trägt dein Glück.“ („Meine Kinderjahre“, Kapitel 4)
In „Effi Briest“ wird aus der Erinnerung eine unheimliche Kutschfahrt von Pudagla nach Swinemünde heraufgeholt, auf der Mutter Fontane mit den Kindern beinahe vom Blitz getroffen worden wäre. Im Roman ist es eine Schlittenfahrt vom Forsthaus Uvagla nach Kessin, bei der Pferde und Gefährt um ein Haar im Schloon versinken.
Auch in „Graf Petöfy“ wetterleuchtet Swinemünde aus der Ferne: Franziska Franz, gefeierte Schauspielerin am Wiener Burgtheater, wird in wohlwollenden katholischen Adelskreisen nach ihrer Kindheit befragt, und sie entwirft ein überaus heiteres Bild von dem preußisch-protestantischen Norden, mit dem der alte Graf nur die Vorstellung von Vineta verbindet: „poetisch, gruselig und ewig gefährdet“. Sie aber erzählt von frisch geweißten Giebelhäusern mit hohen Dächern, die alle so „aussehen, als wären sie gestern erst aus der Spielschachtel genommen“, und „...in jedem dieser Häuser hat ein anderes Land seinen Sitz und seinen Schutz, und während über dem einen der österreichische Doppeladler flattert, flattert über dem andern der türkische Halbmond oder der chinesische Drache. Es gibt nichts Bunteres und Lachenderes als das Flaggen einer solchen Hafen- und Handelsstadt ... die Flagge ... [ist] das flatternde Band am Hut, das dem Ganzen erst Ansehen und Charakter gibt.“ Der Schulweg, den sie mit ihrer Freundin Hannah ging, entsprach dem des kleinen Theodor: „Es war immer ein weiter Weg und ging am Strom entlang, an dem die Schiffe schräg oder auch wohl mit ihrem Rumpfe nach oben lagen... Am Bollwerk hin aber und um geschwärzte, dreibeinige Grapen herum hockten Arbeiter und alte Matrosen und unterhielten das Feuer oder rührten in dem brodelnden Pech“ oder schnitten Kartoffeln, Speck und Zwiebeln in riesige Bratpfannen über offenem Feuer.
Alljährlich im November kam der Nordweststurm und mit ihm die Angst, das Schicksal Vinetas zu teilen: „Oh, noch jetzt überrieselt’s mich, wenn ich an jene Schreckensnächte denke. Die vom First abgerissenen Hohlsteine klinkerten über das Dach hin, in dem Rauchfang ging ein Geheul, alle Läden und Türen klappten ... und wenn dann mit eins eine Pause kam, so war es am schlimmsten und zitterten wir am meisten, denn dann hörten wir durch das tiefe Schweigen hin das Gebrause des Meeres draußen, das an die Dünen und Dämme schlug und die großen eingerammten Steine wie Kiesel aus der Westermole wusch. Am Bollwerk aber, trotz der Ziegel und Fahnenstangen, die niederstürzten, war alles Geschäftigkeit, und wir sahen ... wie sie drunten die Schiffe fester an die Pfähle banden, aber doch zugleich auch die Boote von Bord her ans Ufer brachten, um eine letzte Rettung zu haben für den Fall, dass es zum Schlimmsten käme. Denn der Nordwester staute nicht nur den Strom zurück, sondern trieb auch das Flutwasser mit solcher Gewalt von draußen in den Strom hinein, dass es am Kai hin oft nur noch zollbreit unter der obersten Balkenlage stand. Und einmal ... stieg es drüber hinaus, und im Nu war die niedriger liegende Stadt ein See ... und in unsern Flur hinein stürzte die Welle. Da schrien wir auf, denn nun erfüllte sich unser Schicksal, und wir mussten untergehen, wie Vineta untergegangen war.“ Aber „was in der Nacht unser Entsetzen gewesen war, das war tags darauf unsere Lust und unsere Wonne. Die flottgemachten Boote fuhren jetzt hin und her: unser Nachbar, der Bäcker, landete mit seinen Wecken und Semmeln, und als es Tag geworden ... war, waren wir glücklich, ... zu Schiff in die Schule fahren zu können. ... Über Tonnen und Bretter hin ging der Verkehr, bis ... die große Sintflut verlaufen und ein dichter Schnee gefallen war. Und unter Schellengeläute ging’s nun durch die verschneite Stadt hin, über deren Schneedächern die Wimpel und Flaggen jetzt wieder flatterten und beinahe lustiger noch flatterten als um Johannistag und um die Sommerzeit.“ („Graf Petöfy“, Kapitel 9)
Wie Fontane, so erschien auch Franziska die Kindheit in Swinemünde wie „unausgesetzt Tanz und Musik“.
Wenn Fontane 1863 bedauerte, dass alles, was er an dieser Stadt geliebt hatte, „auf dem Punkte war, zu verschwinden“, so kann man sich vorstellen, was davon bis heute übrig blieb: eigentlich nur noch der Leuchtturm und die Kirche, die Fontane damals schon als unansehnlich empfand. Swinemünde heißt seit 1945 Swinoujsie, und nicht nur der Name änderte sich. Das Bollwerk ist ausgebaut, der Nordweststurm verlor seinen Schrecken, aber verloren ging auch der Rest von romantischer Wimpelbuntheit; geblieben ist eine gewisse Unbedenklichkeit in der Lebensweise und ein weltweit zusammengewürfeltes Jahrmarkttreiben mit pittoresken Genreszenen für den, der ein Auge dafür hat. In jüngster Zeit versucht ein rühriger Museumsleiter, die Zeugnisse der Vergangenheit aufzustöbern und auszustellen.
Heringsdorf und das Usedomer Hinterland
Wenn man Glück hat, arrangiert die Kurverwaltung der Seebäder Ahlbeck und Heringsdorf „a sentimental journey“ die Küste entlang und ins Hinterland, und dann wird man nachempfinden können, was Fontane bei seinem Besuch im Sommer 1863 in einem „Toast auf die Damen“ ausdrückte:
„So schafft weithin der baltische Strand
dem Liede viel glückliche Stunden;
Doch ein allerschönstes Balladenland,
Das haben wir hier gefunden;
Am Strand hin schreitet die Bernsteinhex,
Es klingen Vinetas Glocken,
Und die Räuberkuhle Störtebecks
Passieren wir leis erschrocken.“
(Gedichte III)
„Störtebeckers Ku[h]l“, „eine Waldstelle, nahe bei Heringsdorf“, gehörte zu dem Abenteuerrevier der Swinemünder Jungenbande, die den gewandten und einfallsreichen Theodor zum Hauptmann erkoren hatte. Es war „ein mächtiger Erdtrichter, drin der Seeräuber Störtebecker... mit seinen Leuten gelagert haben sollte. Gerade so wie wir jetzt. Das gab mir ein ungeheures Hochgefühl: Störtebecker und ich... Die ‚Kule‘ war sehr tief und bis zu halber Höhe mit Laub vom vorigen und vorvorigen Jahr überdeckt. Da lag ich nun an der tiefsten Stelle, die wundervollen Buchen über mir, und hörte, wenn ich mich bewegte, das Rascheln des trockenen Laubes, und draußen rauschte das Meer. Es war zauberhaft.“ („Meine Kinderjahre“, Kapitel 17)
Die Gestalt Störtebekers und der Vitalienbrüder, die um 1400 die Nord- und Ostsee beherrschten und zuletzt auf dem Hamburger Grasbrook allesamt hingerichtet wurden, beschäftigten Fontane sein Leben lang; nachdem er in Ostfriesland die authentischen Aufenthaltsorte besichtigt und zahlreiche Archivalien durchforstet hatte, wuchs sich der Stoff zu einem historischen Roman aus, der jedoch Fragment blieb.
Störtebekers Ku(h)l kann sich der fantasiebegabte Wanderer in dieser wundervollen Endmoränenlandschaft vielerorts vorstellen.
Aber bleiben wir noch ein wenig in Heringsdorf. So manchen Sommerferientag verbrachte der Schüler Theodor in einer der weißen Villen Am Kulm. Sie gehörte Kommerzienrat Krause, mit dessen Kindern er bereits in Swinemünde privat unterrichtet worden war. Als Schüler der Klödenschen Gewerbeschule traf Fontane Wilhelm Krause wieder. Was lag näher, als in den Ferien gemeinsam nordwärts zu fahren?
Heringsdorf war damals, um 1835, noch ein armes Dorf mit niedrigen, reetgedeckten Hütten, vor denen die Fischer Heringe einsalzten. Die ersten villenartigen Sommerhäuser nahmen sich dagegen wie unters Krähenvolk geratene weiße Raben aus. Der fünfzehnjährige Theodor genoss das gehobene, geistvolle Ambiente des Hauses: „...in dem großen Vorderzimmer hab’ ich ...oft bewundernd gestanden, wenn Eduard Devrient und seine Wirthin, die dazumal bildschöne Commercien-Räthin Krause am Clavier spielten, sangen und deklamierten. Draußen aber, nach dem Walde zu, war es noch schöner; – da lief ich stundenlang dem schönen Backfisch der schönen Frau nach, und hatte Herzschmerzen, wenn ich die Gemüthsruhe der jungen Dreizehnjährigen sah, die saure Kirschen und aus der Speisekammer gestohlne Backpflaumen aß, während ganz andres Verlangen mir die Kehle zuschnürte.“ (an Bernhard von Lepel, 21. 8. 1851) Diesem Backfisch, Minna Krause, hatte Theodor seine ersten Verse gewidmet; sie waren „nicht allzu berühmt“, doch gibt es darin Zeilen, die an Heines „Buch der Lieder“ heranreichen:
„Die hohen Himbeerwände
Trennten dich und mich,
Doch im Laubwerk unsre Hände
Fanden von selber sich...“
(„Im Garten“, Gedichte I)
Minna heiratete recht bald den Sohn des Gelehrten und Schuldirektors Carl Friedrich von Klöden. Anlässlich einer zufälligen Begegnung im Foyer des Berliner Opernhauses stürzte der junge Dichter noch einmal in helle Begeisterung: „Minna trug einen schottischen Mantel, eine Boa von Fe und einen eleganten weißen Atlashut, sah auch noch verklärt aus durch ‚O, Huon, mein Gatte‘ ... jeder Zoll eine Prinzessin, eine Fee in Fe...“ Als er sie mit Siebzig wiedersah, überfiel ihn gelindes Entsetzen: „... eine alte Backbeere, mit unglaublich wenig Zähnen und unglaublich viel Runzeln ... Dabei nannte sie mich mit der größten Unbefangenheit ‚Du‘, was mich gradezu rührte, denn man bleibt ein Schaf.“ (an Martha Fontane, 28. 8. 1889)
1851 wohnte Bernhard von Lepel in der kommerzienrätlichen Villa, wahrscheinlich wollte er sich nach einem geeigneten Bauplatz umsehen, denn Heringsdorf kam langsam „in Mode“. Das spätere Adressbuch verzeichnet tatsächlich unter Badstraße 13 den Namen „v. Lepel“. Er war es auch, der Fontane im August 1863 zum Bau eines Sommerhauses überredete. Der kleine Redakteur der „Kreuz-Zeitung“ mit höchst unsicheren Nebeneinnahmen fing Feuer und schwärmte seiner Frau Emilie am 24. August 1863 von einem solchen Haus vor: „... hier in Heringsdorf selbst ist der Grund und Boden schon zu teuer, aber ... in Ahlbeck selbst, das eine Viertelmeile von hier gelegen ist und jetzt sehr in Aufnahme kommt“, wäre es wohl machbar; es koste etwa 2000 Taler, wenn sich Zöllners beteiligten, nur noch 1000, und wenn der eine oder andere aus dem großen Freundeskreise anbisse, nur noch 500 Taler... Es war eine enthusiastische Milchmädchenrechnung. Er kam nie wieder darauf zurück.
Aber die Gegend zwischen Swinemünde und Heringsdorf-Ahlbeck, die „Usedomer Schweiz“, Mellenthin, Pudagla und Koserow, Gothensee, Großer und Kleiner Krebssee, blieb sein Sehnsuchtsland. Auch wenn er sich hier kein Haus baute, so hob er sie doch für die Nachwelt in seinen Romanen auf: Da reitet zum Beispiel Effi mit Crampas – am Ende des 16. Kapitels – an der Mühle von Utpatel und am Kirchhof vorüber: „Gleich danach passierten sie den Hohlweg zwischen dem Kirchhof und der eingegitterten Stelle, und Effi sah nach dem Stein und der Tanne hinüber, wo der Chinese lag.“ Utpatel entspricht dem traulichen Dörfchen Benz. Wer heute am Kirchhof vorbei den sandigen Hohlweg zur Windmühle hinaufstapft und zwischen Immortellen, Ginster und Windflüchtern zwei Reiter traben sieht, denkt unwillkürlich an Effi und Crampas; auch die tanzenden Bojen auf dem Meer erinnern an Effi, die darauf bestand: „da liegt Vineta, da muss es liegen, das sind die Turmspitzen...“ („Effi Briest“, Kapitel 17)
Im 18. Kapitel führt eine Schlittenfahrt zum Forsthaus Uvagla: „Zwischen Kessin und Uvagla (wo, der Sage nach, ein Wendentempel gestanden) lag ein nur etwa tausend Schritt breiter, aber wohl anderthalb Meilen langer Waldstreifen, der an seiner rechten Längsseite das Meer, an seiner linken, bis weit an den Horizont hin, ein großes, überaus fruchtbares und gut angebautes Stück Land hatte. Hier, an der Binnenseite, flogen jetzt die Schlitten hin...“
Hausherr und Gastgeber ist Oberförster Ring, „ein stattlicher, militärisch dreinschauender Herr von Mitte Fünfzig, der den ersten Feldzug in Schleswig noch unter Wrangel und Bonin mitgemacht und sich bei Erstürmung des Danewerks ausgezeichnet hatte“.
Auf dem Rückweg (Kapitel 19) wählt die durch einen kräftigen Punsch angeregte Gesellschaft den Strandweg, „der, eine Meile lang, in beinahe gerader Linie bis an das Kessiner Strandhotel und von dort aus, rechts einbiegend, durch die Plantage hin, in die Stadt führte. Der Schneefall hatte ... aufgehört, die Luft war frisch, und auf das weite dunkelnde Meer fiel der matte Schein der Mondsichel. Kruse fuhr hart am Wasser hin, mitunter den Schaum der Brandung durchschneidend, und Effi, die etwas fröstelte, wickelte sich fester in ihren Mantel...“ Sie hörte etwas wie Musik, als sängen Meerjungfrauen. „In diesem Augenblicke hielt der Schlitten ..., Kruse wandte sich halb herum und sagte: ‚Der Schloon, gnäd’ge Frau.‘
Und Sidonie, die immer alles (besser) Wissende, klärte Effi auf: „...dieser Schloon ist eigentlich bloß ein kümmerliches Rinnsal, das hier rechts vom Gothener See her herunterkommt und sich durch die Dünen schleicht. Und im Sommer trocknet es mitunter ganz aus, und Sie fahren ruhig drüber hin und wissen es nicht einmal. .. .im Winter, da ist es was anderes; nicht immer, aber doch oft. Da wird es dann ein Sog. ... und am stärksten immer dann, wenn der Wind nach dem Lande hin steht. Dann drückt der Wind das Meerwasser in das kleine Rinnsal hinein, aber nicht so, dass man es sehen kann. Und das ist das Schlimmste von der Sache, darin steckt die eigentliche Gefahr. Alles geht nämlich unterirdisch vor sich, und der ganze Strandsand ist dann bis tief hinunter mit Wasser durchsetzt... Und wenn man dann über solche Sandstelle weg will, die keine mehr ist, dann sinkt man ein, als ob es ein Sumpf oder Moor wäre.“
Der Schloon, Fallgrube der Naturelemente, in der der Unwissende versinkt – das mag Fontane schon als Kind fasziniert haben. Im Roman wird der Schloon Symbol für Effis Seelenlandschaft. Heutzutage hat er seinen Schrecken durch Melioration weitgehend verloren, doch für unkundige Wanderer kann er im Winter noch immer gefährlich werden.
Das Forsthaus Uvagla ist identisch mit dem Forsthaus Pudagla, das Fontane gut kannte. Die Schwester des Oberförsters Schröder, eine durch Blatternarben entstellte, aber herzensgute Person, besorgte die Wirtschaft der Familie Fontane in Swinemünde und der Herr Oberförster schickte dem Herrn Apotheker jedes Jahr einen selbst erlegten Hirsch als Weihnachtsbraten.
In dem Roman „Vor dem Sturm“ gibt es eine Gräfin Pudagla, deren Besitzungen auf der Insel Usedom liegen; sie gehört zum Hof des Prinzen Heinrich in Rheinsberg; der von ihr bewunderte König ist Heinrich IV. von Frankreich, le bon roi, der das Toleranzedikt von Nantes erließ. Den Grafen zieht es hingegen nach England, denn dort sieht er „das einzige Staatenvorbild, dem nachzueifern sei“.
Ein Rittergut Pudagla wird man vergebens suchen. Vorbild könnte Mellenthin mit seiner Wasserburg sein. Die mächtigen Gewölbe in der Halle mit dem eigenwilligen, frühbarocken Kamin beeindrucken noch heute. Der Besitzer ließ sich selbst in einem römischen Streitwagen darstellen, den Satan lenkt. Im Hintergrund sind die Silhouetten weltberühmter Bauwerke, wie die Hagia Sophia zu Konstantinopel, zu sehen. Dies und auch die mittelalterliche Dorfkirche mit naiven Darstellungen des Jüngsten Gerichts und einem sagenhaften Mühlenstein als Weihwasserbecken müssen die Fantasie des Knaben angeregt haben. (Es kann aber auch sein, dass ihn das Lepel-Schloss inspirierte; der Familie von Lepel gehörten ausgedehnte Besitzungen auf dem Gnietz, einer Halbinsel südlich von Zinnowitz.)
Schauplatz eines wenig bekannten, salopp-ironischen Fontanewerkes ist der Lieper Winkel, ein von der Peene und dem Achterwasser von der übrigen Insel abgeschnittener Teil Usedoms. Dorf Liepe wurde von Slawen bewohnt, die noch lange auf ihrer Eigenständigkeit beharrten. „Der letzte Liepewinkler“ nannte er sein „Trauerspiel in 5 Akten“, dessen „Helden“ sind:
„König Tier, der letzte Liepewinkler
Eulalia, seine Tochter
Kent, ein Mann von Courage
Falstaff, ein Feigling aus Instinkt
Der Narr
Packan, Prinz von Coserow
Liepewinkelsche und Coserowsche Krieger.“
Ein Heidenspaß, sehr frei nach Shakespeare. Von Rittersitzen gibt es in dieser Gegend keine Spur, doch wenn man auf der Warther Steilküste steht und übers Achterwasser und nach Koserow hinüberblickt, kann man sich „Romeo und Julia“ in Pappmaschee und auf gut Usedomsch vorstellen und ein Schmunzeln über diesen höchst ungewöhnlichen Fontane nicht unterdrücken.
Diese hemdsärmlige Shakespeareparodie erinnert an die ersten Schreibversuche des Elfjährigen. In dem festen Vorsatz, „mal Professor der Geschichte“ zu werden, begann er, in einem dicken Schulheft Geschichten von Ludwig dem Frommen bis zum Spanischen Erbfolgekrieg mit eigenen Worten wiederzugeben. Da hieß es zum Beispiel: „Heinrich vermählte sich mit der Bertha nach her vertrieb er sie sahe aber zuletzt ein das es ohne einen Weibe nicht ginge und nahm sie sich wieder.“
Just zu dieser Zeit hatte er auch seine erste Begegnung mit einem „richtigen Dichter“. Es war „auf halbem Wege nach Dorf Koserow und dem Streckelberg“, zu dessen Füßen Vineta untergegangen sein soll. „Wir hörten mit fantasiegeschärftem Ohr die ‚Abendglocken‘ klingen ... als wir eben diesen Abhang erstiegen, begegneten wir auf halber Höhe einem Herrn in jagdgrünem Rock und Gebirgshut...“ Einer der Jungen klärte Theodor auf: „Er hat unsere Villa gekauft; er heißt Häring, aber sie nennen ihn Willibald Alexis. ‚Der?‘, sagt’ ich. Ich kannte seinen Namen wohl; mein Vater war all die Zeit über ein Walladmor-Bewunderer gewesen. Ich blickte dem Dahinschreitenden nach; – der erste Dichter, den ich sah. Sein Bild ist mir deutlich im Gedächtnis geblieben. Wer mir damals gesagt hätte, dass ich vierzig Jahre später über ihn schreiben würde, über ihn und seine Bücher, die damals selbst noch nicht geschrieben waren!“ („Willibald Alexis“)
Damals, 1872, hätte ihm auch niemand gesagt, dass er selbst einmal den hochgeschätzten Verfasser historischer Romane weit überflügeln und in den Schatten stellen würde.
Rügen
Vermutlich hatte der Freund Bernhard von Lepel, der in Glutzow aufwuchs und in Stralsund zur Schule ging, so sehr von der Insel Rügen geschwärmt, dass Fontane sie gern mit eigenen Augen sehen wollte. Doch es ergab sich erst im Herbst 1884. Er reiste, was selten genug vorkam, wie er aber im Fremdenbuch des Leuchtturmwärters Schilling auf Kap Arkona eigenhändig vermerkte, nur „zum Vergnügen“.
Im Tagebuch berichtete er nur in knappen, nichtssagenden Sätzen über diese Reise vom 7. bis zum 14. September 1884: „Am ersten Tage: Stralsund (Schill), Bergen (Rügen) und spät am Abend Eintreffen in Saßnitz, wo ich im Fahrenberg-Hotel ein gutes Zimmer erhielt. ...Den zweiten oder dritten Tag Ausflug nach Stubbenkammer, Herthasee, Lohme, Arcona... Landschaftlich sehr schön, vielfach an Sorrent erinnernd ... im Detail natürlich alles arm und dürftig ... noch anderthalb Tage in Saßnitz ... dann in fünfstündiger Abend- und Nachtfahrt über Jagdschloss Prora nach Putbus ... im ‚Fürstenhof‘ unfreundlich aber gut untergebracht... Den andern Vormittag ... in Putbus, sehr hübsch.“ Von da aus fuhr er über Bergen und Stralsund zurück nach Berlin.
Die Insellandschaft wirkte auf Fontane viel stärker, als diese lapidaren Sätze vermuten lassen. So schrieb er an Mete, Rügen habe ihn sehr an Skandinavien erinnert: „Buchen, Möwen und Kreideklippen.“ (23. 9. 1895) Und seinem Freund Friedländer riet er: „...lassen Sie sich doch quer über die weite Bucht nach Arcona hinüberrudern; diese Bootfahrt ist sehr schön, außerdem Arcona selbst interessant genug.“ (29. 8. 1894)
Besonders für Fontane. In seine „Wanderungen“ durch das Havelland hatte er einen umfassenden Essay über die slawischen Volksstämme in der Mark zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert aufgenommen; darin heißt es im Unterkapitel „Rethra. Arkona“: „Rethra und Arkona repräsentierten auch die Orakel, bei denen in den großen Landesfragen Rats geholt wurde...“ Wie im antiken Griechenland die Orakel von Delphi und Dodona miteinander konkurrierten, so gab es auch zwischen Rethra und Arkona eine gewisse Rivalität. Als der Bischof Burkhard von Halberstadt im Winter 1067 auf 1068 mit seinem Heer vor Rethra erschien und das dem Radegast geweihte weiße Ross entführte, verlor der Glaube an den alten Wendengott seine Kraft, und alle Verehrung richtete sich auf den vierköpfigen Svantevit im Tempel von Arkona. Der Kult um das Orakel war ähnlich demjenigen in Rethra: „Drei Paar gekreuzte Lanzen wurden in den Boden gesteckt“, und nun entschied der Fuß des heiligen Rosses, ob dem geplanten Unternehmen Glück oder Unglück beschieden war: rechter Fuß bedeutete Glück, linker Fuß Unglück und: „Entschiedenes Heil ... wenn das weiße Pferd über alle drei Lanzenpaare mit dem rechten Fuß hingeschritten war.“
Hundert Jahre nach dem Ende Rethras eroberte der Dänenkönig Waldemar I. Rügen, besiegte die Wenden, brachte ihren florierenden Handel mit den Ost– und Nordseeländern zum Erliegen und machte auch dem Svantevitkult ein Ende. Während bis heute niemand nachweisen kann, wo Rethra lag (wahrscheinlich zwischen Rheinsberger und Tollense-See), ist die „Jaromarsburg“ als kultisches Zentrum der Westslawen auf Arkona in seiner Lage noch deutlich erkennbar: Die Tempelburg stand auf einer vierzig Meter hohen Kreidescholle, die im Laufe der Jahrhunderte von der Ostsee unterspült wurde. Der innere Erdwall, ursprünglich fast 200 Meter lang und noch immer sechs Meter hoch und fünfzehn Meter breit, ist heute noch begehbar.
Im Tagebuch notierte Fontane neben den Lageskizzen von Herthasee und Opfersteinen: „1. mit einer kleinen Rinne. Hier floss das Blut in einen unten stehenden ausgehöhlten Stein. (Alles kolossaler Schwindel.)“ Tieropfer für Svantevit, den Gott des Krieges und der Fruchtbarkeit, sind nachgewiesen, doch der Rügener Fremdenführer muss wohl, der größeren Wirkung halber, etwas von Menschenopfern geraunt haben. Das faszinierte Fontane ungemein und getreu dem Motto „Ist’s auch nicht wahr, so ist’s doch gut erfunden“ brachte er den „kolossalen Schwindel“ als Volksmund in den Roman „Effi Briest“ ein. Ohnehin entspricht die Rügen-Reise Innstettens mit seiner jungen Frau weitgehend der Fontaneschen Reiseroute: „Zunächst natürlich Stralsund, mit Schill, den du kennst, ... dann von Stralsund nach Bergen und dem Rugard, von wo man ... die ganze Insel übersehen kann, und dann zwischen dem Großen und Kleinen Jasmunder Bodden hin, bis nach Saßnitz.“ („Effi Briest“, Kapitel 24) Sie übernachteten in dem noblen Hotel Fahrenheit (was Innstetten zu dem Wortspiel veranlasse: „Die Preise hoffentlich nach Reaumur“) und machten in bester Laune „noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrande hin und sahen von einem Felsenvorsprung aus auf die stille, vom Mondschein überzitterte Bucht. Effi war entzückt. ‚Ach, Geert, das ist ja Capri, das ist ja Sorrent. Ja, hier bleiben wir.“„ Nur die Kellner in dem Hotel waren ihr zu gespreizt-vornehm, „man geniert sich, um eine Flasche Sodawasser zu bitten“, und sie hielt Ausschau nach einem geeigneten Privatquartier. Doch der nächste, reizvoll gelegene Ort hieß Crampas; der Name ließ sie zurückschrecken, und so fuhren sie weiter nach Stubbenkammer. Während man im Gasthof einen Imbiss richtete, führte sie ein Einheimischer an den nahen Herthasee: „Binsen säumten ihn ein, und auf der stillen, schwarzen Wasserfläche schwammen zahlreiche Mummeln. ‚Es sieht wirklich nach so was aus‘, sagte Effi, ‚nach Herthadienst.‘ – ‚Ja, gnäd’ge Frau... Dessen sind auch noch die Steine Zeugen.‘“ (Fontane benutzte hier offensichtlich den gestelzten Verschwörerton des ihm bekannten Fremdenführers.) „‚Welche Steine?‘ — ‚Die Opfersteine‘. „Etliche glattpolierte Steine lehnten an einer senkrecht abgestochenen Kies- und Lehmwand.“ „Und was bezwecken die?“ – „dass es besser abliefe, gnäd’ge Frau“. – „Lass uns gehen“, sagte Effi...“
Die unschuldig-schuldige Kindfrau, die sich wegen ihrer heimlichen, kurzen Liebelei mit Crampas zermarterte, war bis auf den Grund ihrer empfindsamen Seele getroffen: Die Opfersteine, das Blut, das ohne Schuld geflossen war, erschienen ihr als dumpfes Menetekel; sie strebte so schnell wie möglich fort. Anderntags fuhren sie mit dem Dampfschiff weiter nach Kopenhagen.
Die Gruselgeschichten von den Opfersteinen am Herthasee werden heute noch mit Vorliebe von Einheimischen verbreitet; nur werden sie in unserem aufgeklärten Zeitalter entweder mit wissenschaftlicher Neugier oder mit ironischem Lächeln quittiert.
Rügen mit seinen heimeligen Dörfchen, den weiten, muschelübersäten Stränden und dem berühmten Caspar David Friedrich-Bild der Kreidefelsen ist heute noch eine Reise wert. Nur sollte man sich an die kleinen Orte, die kleinen Pensionen halten, denn in den großen Hotels richten sich die Preise inzwischen „eher nach Fahrenheit als nach Reaumur“.
Mecklenburg
„Ich bin gern in Mecklenburg, wie in allen Ländern und Städten, die man in dem öden und dämlichen Berlinerthum unsrer Jugend für Plätze zweiten Ranges hielt, während sie unsrem elenden Nest ... immer überlegen waren.“ (an Wilhelm Hertz, 6. 6. 1897)
Man darf diese Apotheose auf Mecklenburg nicht allzu wörtlich nehmen; Fontane empfand es nur als wohltuend im Gegensatz zu dem in Berlin vorherrschenden Borussentum mit seinem bis ins Unterbewusstsein gedrungenen Strammstehen. Bei genauerer Betrachtung kam auch der Mecklenburger Menschenschlag nicht ungeschoren davon: „...sie haben unbestreitbar eine wundervolle Durchschnittsbegabung, werden aber ungenießbar dadurch, dass sie einem dies Durchschnittsmäßige, dies schließlich doch immer furchtbar Enge und Kleinstädtische, als etwas ‚Höheres‘, als das eigentlich Wahre aufdringen möchten. Ein Mecklenburger – wenn er nicht blos durch einen baren Zufall (wie Moltke) in Parchim oder Teterow geboren wurde – kann nie die ‚Jungfrau von Orleans‘ oder die ‚natürliche Tochter‘ schreiben; er bringt die Vornehmheit, den großen Stil nicht heraus, er bleibt bei Lining und Mining oder bei Bräsig oder bei Leberecht Hühnchen. Das sind nun alles allerliebste Figuren; aber sie rechtfertigen durchaus nicht die Dickschnäuzigkeit, womit sie einem präsentirt werden.“ (an Georg Friedländer, 19. 3. 1895)
Humor nennen sie, „wenn sie plötzlich, mit einem ziemlich unverschämten Gesicht, aus ihrem Mustopf herauskucken“, (an Georg Friedländer, 8. 1. 1895)
Zwei Mecklenburger wollte er jedoch zumindest von diesen Vorwürfen ausgenommen wissen: Heinrich Seidel, den hochbegabten Ingenieur und Dichter, dessen Autobiografie „Von Perlin nach Berlin“ Fontane mit ungeteiltem Vergnügen gelesen und mit dem er sich in Berlin sogar angefreundet hatte; und Fritz Reuter, der für ihn die Personifizierung aller liebenswerten Eigenschaften Mecklenburgs darstellte. „Ut min Festungstid“ stand seit 1863 in Fontanes Handbibliothek; in dieses Buch vertiefte er sich, wenn er Knechte, Kutscher und Diener plattdeutsch sprechen lassen wollte. In „Ellernclip“ zum Beispiel orakelt der Knecht Joost mit der Magd Grissel über die rätselhafte Herkunft Hildes, und dabei kümmt up platt all dat wunnerlich Tüch vor, „wat mi mien Oll-Großmutter all ümmer vorseggen deih“.
In „L’Adultera“ wird der treue, aber etwas begriffsstutzige Diener Friedrich „Pomuchelskopp“ genannt nach einer der Hauptfiguren in Reuters „Stromtid“.
Und in „Effi Briest“ bringt Fontane Fritz Reuter bewusst ins Spiel. Da heißt es über Effis Spielgefährtinnen in Hohen–Cremmen: „Zwei der jungen Mädchen – kleine, rundliche Persönchen, zu deren krausem, rotblondem Haar ihre Sommersprossen und ihre gute Laune ganz vorzüglich passten – waren Töchter des auf Hansa, Skandinavien und Fritz Reuter eingeschworenen Kantors Jahnke, der denn auch, unter Anlehnung an seinen mecklenburgischen Landsmann und Lieblingsdichter und nach dem Vorbilde von Mining und Lining, seinen eigenen Zwillingen die Namen Bertha und Hertha gegeben hatte.“ (Kapitel 1) Zu Effis Verlobung steuert Jahnke plattdeutsche Verse bei; und wenn es bei Mining und Lining eine „duwwelte Verlawung“ mit zwei geistlichen Kandidaten gibt, so heiraten Bertha und Hertha auf einer Doppelhochzeit „Zwei Lehrer in der Nähe von Genthin“.
Nur wenige wissen, dass Fontane 1871 das Ritterkreuz der wendischen Krone erhielt als Dank des Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz für den Autor, der im zweiten Band seines Buches „Der Deutsche Krieg von 1866“ den Einsatz mecklenburgischer Truppen unter Seiner Hoheit gewürdigt hatte. Der Dank des obersten Kriegsherrn, des Königs von Preußen, fiel dagegen ärmlich aus: Fontane erhielt für beide Kriegsbücher 1867 den Preußischen Kronenorden IV. Klasse, von dem jährlich 800 bis 1000 Stück in vier Klassen vergeben wurden. Der so Geehrte sprach geringschätzig von „Quincaillerie“: „Die ganze Ordensgeschichte wenn es nicht ordentlich kommt, hat doch wirklich etwas Kindisches.“ (an Emilie Fontane, 3. 6. 1885)
Zehn Jahre später räumte er seinem karrierebewussten Sohn gegenüber ein, dass Orden zuweilen auch ihr Gutes haben: –Ich war damals auf der Kreuzzeitung und bedurfte solcher Dekoration, um nicht ganz unterm Schlitten zu sein... Man braucht die Sache der anderen halber und – lächelt darüber.“ (an Theodor Fontane junior, 2. 11. 1895)
Zu diesem Zeitpunkt konnte er darüber lächeln oder solche altersweisen Gedichte schreiben wie „Eigentlich ist alles gleich...“ oder seine Briefe mit überspitzt pointierten Urteilen beleben wie dem Loblied auf das „im ganzen übrigen Deutschland und speziell in Preußen verspottet[e]“ altmodisch-patriarchalische Landesregiment Mecklenburgs, welches doch beweise, „dass es auf Verfassungen und Freiheitsparagrafen (die wirkliche Freiheit hat keine Paragrafen) gar nicht ankommt... Man freut sich seines Daseins, trinkt Rotwein und liest kleine Blätter.“ (an James Morris, 13. 7. 1897)
Zwölf Monate im Jahr hätte Fontane das zweifellos nicht genügt, doch für einen Sommerfrischenaufenthalt war es für den mehr und mehr Ruhebedürftigen genau das Richtige. Und so wählte er im hohen Alter nicht mehr Schlesien und Harz, nicht Wyk auf Föhr oder Norderney, sondern Waren an der Müritz und Augustabad am Tollensesee.
Und Mecklenburg bedankte sich bei ihm, indem es Straßen und Ausflugsdampfer nach ihm benannte; in Waren an der Müritz gibt es auch Fontane-Apotheke und Fontane-Buchhandlung; und in Schwerin-Krebsförden ein Restaurant Fontane, mit behaglicher Gartenterrasse, wie sie der Menschenbeobachter liebte. Beides gehört zum Hotel Arte, das zu den Schönen Künsten auch die Kunst der Gastlichkeit zählt. Dort fühlt man sich wirklich an den alten Fontane erinnert, der ja anerkanntermaßen in allen Künsten ein kritischer Feinschmecker gewesen ist.
Neubrandenburg – Augustabad
„Am Mittwoch will ich mit Frau und Tochter nach ‚Niejen Brannenburg‘ abdampfen, um Preußen zu vergessen, wozu Fritz Reuters Heimath – als eine Art Gegensatz – die beste Gelegenheit bietet. Ich stelle Rothspohn und Onkel Bräsig höher als den ganzen Borussismus, diese niedrigste Kulturform die je da war. Nur der Puritanismus (weil total verlogen) ist noch schlimmer. Im Augustabad bei Neubrandenburg, am Ufer des Tollense-Sees ... will ich auch endlich an die Correktur bez. Anordnung meiner Gedichte für die 5. Auflage gehn und bitte ganz ergebenst mir 2 Exemplare zu diesem Zwecke zur Verfügung stellen zu wollen.“ (an Wilhelm Hertz, 6. 6. 1897)
Der 77-jährlge Fontane hatte, als er am 9. Juni 1897 mit Frau und Tochter nach Neubrandenburg reiste, nicht nur die beiden Gedichtbände im Gepäck; am schwersten wogen die 500 Seiten des „Stechlin“-Manuskriptes, das er noch einmal durchsehen und zum Vorabdruck für die Illustrierte Wochenzeitschrift „Über Land und Meer“ einrichten wollte. Immer fand er noch etwas „am Stil anzuputzen“, er war und blieb „ein unverbesserlicher Tüftler und Bastler“.
Zum Glück erwies sich das eine Viertelmeile vor Neubrandenburg gelegene, eben eröffnete Augustabad als angenehmes, alle drei Fontanes gleichermaßen zufriedenstellendes Domizil, eine Art Synthese aus Hotel und Sanatorium.
Die unternehmungsfreudigen Damen fuhren öfter in die Stadt, besuchten das Reimannsche Konzerthaus am Stargarder Tor oder die Städtische Kunstsammlung, vielleicht auch das Museum am Treptower Tor, das erste im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, das allen Bürgern zugänglich war. Gelegentlich werden sie auch zu dritt einen Nachmittag in der Hofkonditorei Zanderling am Markt verplaudert haben; die meiste Zeit verbrachte Fontane auf dem Balkon des hübschen Appartements, bestehend aus zwei Schlafzimmern, einem kleinen Vorzimmer und dem Wohnraum, dessen Hauptzierde ein mit geblümtem, hellblauem Atlas überzogenes Rohrsofa darstellte; damals allerneuste Mode.
Das Schönste aber war der Rundblick von dem Balkon: Von rechts her grüßte der Turm der Marienkirche über die mittelalterlichen Backsteinmauern Neubrandenburgs, vom jenseitigen Ufer des Tollensesees blinkten die hellen Säulen des großherzoglichen Belvederes. Alle drei fühlten sich so wohl wie selten.
In diese Idylle brach die Nachricht vom Tod Karl Zöllners, dem letzten Freund aus vergangenen „Rütli- und „Ellora“-Tagen. Sein Tod kam nicht unerwartet, dennoch erschütterte er den alten Fontane so sehr, dass Mete an seiner Statt zur Beisetzung fahren musste. Er vergrub sich – ein letztes Mal – in seine Gedichtsammlung aus sechs Jahrzehnten, und unversehens flogen ihm neue Verse zu, abgeklärte, heiter-resignierte, aber auch sarkastische wie die „Neueste Väterweisheit“, in der es heißt: „Quäl dich nicht mit ‚wohlerzogen‘, / Vorwärts mit den Ellenbogen / Und zeig jedem jeden Falles: / ‚Du bist nichts und ich bin alles’.– (Gedichte I)
Er hatte nicht aufgehört, die Menschen zu beobachten.
Augustabad ist, nachdem es jahrzehntelang vom allgemeinen Leben abgeschottet war, wieder zugänglich. Erkannte man das lang gestreckte Gebäude früher an seinem imposanten Fachwerk, so ist die Fassade nun mit Schieferplatten verkleidet; unverkennbar aber sind die gläsernen Loggien zur Seeseite hin. Eine Gedenktafel für den alten Fontane gibt es nicht. Noch nicht.
Waren an der Müritz
„Waren, (Mecklenbu-Schwerin),
d. 28. August 1896
Villa Zwick.
Hochgeehrter Herr und Freund.
... Sollte ... Ihre Gesundheit einer Aufbesserung bedürfen, so kann ich Ihnen ... keinen bessern Platz empfehlen, als, um mit Storm zu sprechen, diese ‚graue Stadt am Meer’. Die Müritz ist nämlich so was wie ein Meer, wie der Viktor-Njanza oder der Tanganjika, und wenn der Michigan sein Chicago hat, so hat die Müritz ihr Waren. Sehen Sie die Dinge, je nachdem, durch ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsglas, an, so ist wirklich eine große Ähnlichkeit da, und wie Chicago Stapelplatz ist für die Produkte der Midlandstaaten, so Waren für die Produkte von Mittelmecklenburg, ein Stück Land, das sonderbarerweise den Namen der ‚mecklenburgischen Schweiz’ führt. Der Obotritengrande lagert hier sein Korn und sein Holz ab, und so ist denn die Seespitze, dran die Stadt liegt, von Mahl- und Sagemühlen umstellt, deren Getriebe zuzusehen, ein beständiges Vergnügen für mich ist.“ (an Friedrich Stephany, Chefredakteur der „Vossischen Zeitung“)
Vom 21. August bis zum 15. September 1896 hielt sich Fontane mit Frau und Tochter in Waren auf. Ein Gewaltritt lag hinter dem 76-Jährigen: die Arbeit am ersten Entwurf des „Stechlin“. Nun wollte er weiter nichts tun, als sich seines Daseins freuen, Rotwein trinken und kleine Blätter lesen. Waren mit seiner tief in die Geschichte des Slawentums reichenden Vergangenheit – daher der Name „Obotritengrande“ für den mecklenburgischen Rittergutsbesitzer – begann damals gerade, sich seiner Entwicklungsmöglichkeit zum Binnenbadeort bewusst zu werden; Fontane, der sich hier sehr wohl fühlte, suchte diese Entwicklung mit seinen Mitteln zu befördern und schloss den Brief an den Chefredakteur: „...wenn Sie mir bei meiner Rückkehr nach Berlin eine halbe Spalte zur Verfügung stellen wollen, so hab’ ich vor, den Berliner Sommerfrischler auf dies prächtige Stück Erde aufmerksam zu machen.“
Auch Karl Zöllner gegenüber schwärmte er am 30. August 1896: „Es ist sehr schön hier, eine frische Luft, eine behäbige Bevölkerung und eine feudale Verpflegung... Die hohe Sand-Düne auf der wir wohnen ... führt den Namen die ‚Eck–Tannen’ und ist zurzeit mit 3 nebeneinandergelegenen Villen besetzt, von denen die mittlere den bedenklichen Namen Villa Zwick führt. Es hat uns aber noch nichts gezwickt, weder moralisch noch physisch.“
Die Sommervilla zur Linken gehörte dem Berliner Bildhauer Thomas, dessen Tochter gleich am ersten Abend „in Huldigung des neuen Nachbarn“ „Archibald Douglas“ anstimmte. Er konnte also in Eck-Tannen, je nach Bedürfnis, Ruhe oder Geselligkeit pflegen, was mit dazu beigetragen haben mag, dass Fontane diesen Aufenthalt „eine seiner glücklichsten Sommerfrischen“ nannte. Verheißungsvoll erschien ihm das Schicksal Thomas’, „der sich, in einem kolossalen Tattrichzustande (er weinte immer), von Berlin aus hierher zurückgezogen und bei Kürbis- und Melonenzucht seine Nerven wiederhergestellt hat.“ (ebenda) Vielleicht erhofften die Fontanes für sich eine ähnlich günstige Wirkung. Ein zweiter Familienaufenthalt für Theodor und Emilie Fontane ergab sich nicht, nur Mete kehrte wenige Jahre später nach Eck-Tannen zurück.
Zwei Jahrzehnte lang hatte sie alle auftauchenden Heiratskandidaten an ihrem geliebten Vater gemessen und alle für „zu leicht“ befunden. Sie war fast vierzig, als der alte Fontane mit unverhüllter Herzensfreude Anna Witte in Rostock mitteilte: „Es geschehen Zeichen und Wunder... Martha hat sich verlobt. Der Beglückte und Beglückende ist der Architekt Fritsch, Wittwer neuesten Datums ... ein kluger und gescheidter Mann von guter Gesinnung und sogar guter Kasse, was mir persönlich nicht viel bedeutet, aber den Mann wenigstens nicht entwerthet.“ (24. 1. 1898)
Fritsch gehörte zu Fontanes weitreichendem Bekanntenkreis, er schätzte Marthas Liebenswürdigkeit und Esprit seit Langem; in ihr glaubte er eine echte Partnerin im Geiste gefunden zu haben. Mete hatte ihre ungewöhnlichen Begabungen nie in aller Fülle entfalten können, sie war sich immer vorgekommen „wie einer, der klavierspielen könne, aber kein Klavier habe“. Nun wollte sie an der Seite des sechzigjährigen Architekten und Herausgebers der „Deutschen Bauzeitung“ endlich ganz nach ihrem Gusto leben.
Die Mutter blieb der offiziellen Verlobung im September 1898 fern; ihr widerstrebte, dass das Trauerjahr nicht eingehalten worden war. Vater Fontane, der hoffte, der lebenserfahrene und leidgeprüfte Fritsch werde seine Tochter in allen Dingen wirklich verstehen, war dankbar, diesen Tag noch erleben zu können; er fühlte, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb: „Allerorten umklingt mich wie Rauschen im Wald: ‚Was du tun willst, tue bald’.“ Tatsächlich schloss er wenige Tage nach diesem „Zauberfest“ die Augen für immer.
Martha Fontane und Karl Emil Otto Fritsch heirateten am 4. Januar 1899. Im Jahr darauf kauften sie die Sommervilla des Bildhauers Thomas in Eck-Tannen, wohl in der Hoffnung, dass auch Mete von ihrem „Nervenelend“ genesen würde. Es folgte eine Zeit des Planens und Bauens, 25 000 Quadratmeter des angrenzenden Kiefernwaldes wurden erworben, dem großen Haus ein turmartiger Anbau mit Balkon angefügt, eine „kleine Villa“ aus dunklem Fachwerk und roten Ziegeln errichtet, mit Giebeln nach allen Seiten, und im gleichen Stil auch ein Gärtnerhaus. Es folgten Gewächshäuser und auf der höchsten Erhebung der Sanddüne ein Pavillon mit einem Eiskeller darunter. Es kamen viele Gäste, nicht nur um von hier aus die schönste Aussicht über die Müritz auf die Stadt Waren zu genießen. Neffen, Nichten und Patenkinder nisteten sich öfter und für längere Zeit ein; neben dem Gärtner sorgten Köchin und Dienstmädchen dafür, dass der große Haushalt funktionierte. Mete blieb leidend, Milz, Galle, Leber und Magen extrem anfällig; hinzu kamen Schlaflosigkeit, Migräne, Depressionen. Eine ausgebildete Krankenschwester war stets „als Gesellschafterin“ um sie. Den Winter verbrachte das Ehepaar in Berlin und genoss Theater- und Konzertbesuche. Auch in Waren fanden sich kulturell aufgeschlossene Menschen: Musikdirektor Köhler und Dr. Michaelis arrangierten Hauskonzerte und Matinees, an denen die musikalisch talentierte Mete, nunmehr Frau Professor Fritsch, lebhaften Anteil nahm. Auch Professor Wossidlo vom Warener Gymnasium, der sich bereits auf dem Gebiete der mecklenburgischen Volkskunde einen Namen erworben hatte, war in Eck-Tannen gern gesehener Gast. Nicht zu vergessen Tante Elise, die jüngste und Lieblingsschwester Theodor Fontanes, die dem Wanderer durch die Mark so oft bei Recherchen behilflich gewesen war; die Witwe verbrachte nun als Stiftsdame ihren Lebensabend in Waren.
1904 erfüllte Mete den Lieblingswunsch ihrer Mutter und gab das Büchlein „Von Toulouse nach Beeskow“ heraus, die Erinnerungen ihres Urgroßvaters mütterlicherseits, der sich, besonders in der „Franzosenzeit“, als Stadtkämmerer von Beeskow bleibende Meriten erworben hatte. Wesentliche Lebensaufgabe war aber die Sichtung des väterlichen Nachlasses. „Mathilde Möhring“ war noch ungedruckt, es gab eine Fülle von Entwürfen, Skizzen und eine unübersehbare Menge von Briefen, Aufzeichnungen und Notizen. Wohlweislich hatte Fontane neben dem Freund Paul Schlenther und dem Justizrat Paul Meyer auch seine Tochter Martha testamentarisch in die kleine Nachlasskommission berufen. Sie stand seinem Herzen am nächsten, besaß scharfen Verstand, großes Einfühlungsvermögen und genügend schriftstellerisches Talent, um die richtige Auswahl zu treffen. Es bedeutete eine immense Arbeit, die weit verstreuten Briefe aufzuspüren und einzusammeln; 1905 erschien der erste Band „Briefe an die Familie“, Briefe, die ihn vor aller Welt als „talent epistolaire“ offenbarten und den jungen Thomas Mann zu dem begeisterten Satz hinrissen: „Sind noch mehr da? Man soll sie herausgeben!“
Professor Fritsch, mit editorischer Arbeit vertraut, ordnete die Briefe in Abschnitte von je zwei bis drei Jahren, Mete stellte jedem Abschnitt eine kurze Darstellung der Lebensumstände des Dichters voran, die – wenn auch nur andeutungsweise – die erste Fontanebiografie ergaben. Nur sie hatte das leisten können; doch im Titel erschien allein der Name ihres Mannes.
Acht Jahre vor ihrer Heirat hatte sie einmal ihrem Vater gegenüber geäußert, man müsse, nachdem, was sie rumdum erlebe, „jede Ehe, die sich nicht in Furchtbarkeiten ergeht, eine glückliche Ehe“ nennen. Mit dieser bescheidenen Erwartungshaltung könnte ihre Ehe mit Fritsch glücklich genannt werden.
Im Winter 1913 bekannte sie in einem Brief an das befreundete Ehepaar Schlenther, das nun leider ins ferne Wien gezogen war: „Bei uns sieht es zudem so aus, dass wir am besten allein in Geduld die Tage hinnehmen. ...meinen Mann werden Sie traurig verändert finden; Gicht u. Niere haben seine schöne Rüstigkeit gebrochen, u. wir kommen aus der Krückenatmosphäre nicht mehr heraus; fast ständig haben wir eine Schwester im Haus ... u. mein Verhältnis zur Apotheke ist fast inniger als das meiner Vorfahren.“ Noch immer klingt etwas ihr Humor an, doch ist es mehr ein Lächeln, das das Weinen verbirgt.
Im Sommer 1915 starb Professor Fritsch im Alter von 77 Jahren an Herzschwäche. Mete gab die Berliner Wohnung auf; Theater und Konzerte hatten ihre Anziehungskraft verloren. Im Jahr darauf starb auch Paul Schlenther, zuverlässigster Freund ihres Vaters, der auch ihr in der gemeinsamen Nachlassarbeit unentbehrlich geworden war. Wie eigenes Abschiednehmen klingt Metes Brief an Paula Schlenther: „...dankbar gedenke ich der Stunden, wo Sie beide den Lebensabend meiner Eltern mit Glanz und Schimmer umgaben. Durch unvergessliche Zeiten immer verbunden, Ihre alte Martha Fritsch.“ (1. 5. 1916)
Acht Monate später, im Januar 1917, stürzte sich Mete in einem schwarzen, unbewachten Augenblick vom Balkon ihres Hauses in den Tod.
Sehenswertes
Die „Mecklenburgische Schweiz“, für deren Bekanntwerden Fontane sich damals sehr engagierte, ist inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel geworden und Waren so stark frequentiert, dass man großzügige Straßen, Brücken und Tunnel innerhalb der Stadt bauen musste, um den Durchgangsverkehr flüssig zu halten. Zwischen Altem und Neuem Markt jedoch, zwischen Georgen- und Marienkirche und in den engen buckligen Gassen am Katträmel, der mittelalterlichen Befestigungsanlage, kann sich der Betrachter in jenes behäbige Waren zurückversetzen, das Fontane so gut gefiel.
Noch zu Lebzeiten Professor Fritschs entwickelte sich Eck-Tannen zu einer Sommervillen-Kolonie; 28 Pensionen und Fremdenheime entstanden. Aber erst 1946 wurde die Villenstraße in Fontanestraße umbenannt. Den Häusern auf der Seeseite wurden die geraden, denen der Waldseite die ungeraden Zahlen zugeordnet. Auf dem Grundstück Nummer 4 erkennt man noch das Gärtnerhaus und das Stallgebäude, in Nummer 6 die „kleine Villa“, Metes Refugium, mit roten Ziegeln und dunklem Fachwerk. Die „große Villa“ mit dem turmartigen Anbau wurde baulich stark verändert, sodass man den Balkon vergeblich sucht.
Auf dem Friedhof fand Martha Fritsch, geborene Fontane, rechts von der Totenhalle, auf dem Feld IA ihre letzte Ruhestätte. Als die Stelle 1968 aufgelassen wurde, pflanzte dort der treue, inzwischen uralte Gärtner Ulrich Priep eine Pinus ponderosa. Dies war jahrzehntelang die einzige Erinnerung an eine hochbegabte Frau, deren Unglück darin bestand, dass ihr der Platz im Leben verwehrt wurde, auf den sie ihren Fähigkeiten nach gehörte. Erst ein Menschenalter nach Metes Tod wurden ihre Briefe an die Eltern veröffentlicht, sie offenbaren dem entzückten Leser die Geistes- und Wesensverwandtschaft mit dem geliebten Dichter-Vater.
Nach der Lektüre dieser Briefe ist Waren-Eck-Tannen der rechte Ort, ihr nahezukommen. Atmosphärischer ist nicht die Fontanestraße, sondern der Uferweg an der Binnenmüritz entlang. Wenn letzte Abendsonnenstrahlen über der weiten Wasserfläche flimmern und die Dämmerung aus dem Buschwerk der Sanddüne kriecht, wenn man über den Wipfeln der Kiefern und Tannen das Fachwerk des vielgiebeligen Hauses mehr ahnen als erkennen kann, dann glaubt man, im Plätschern der Wellen, im Rascheln des Laubwerks die Stimme des alten Fontane zu hören:
„Such nicht immer, was dir fehle,
Demut fülle deine Seele,
Dank erfülle dein Gemüt.
Alle Blumen, alle Blümchen,
Und darunter selbst ein Rühmchen
haben auch für dich geblüht.“
(„Zuspruch“, Gedichte I)
Dobbertin
„Den ganzen vorigen Monat habe ich in dem benachbarten Großherzogtum Mecklenburg zugebracht, wohin ich mich zurückgezogen hatte, um ganz ungestört arbeiten zu können. Zuerst befand ich mich in einem Fräuleinstift, ... das bis diese Stunde, trotz seines protestantischen Charakters, den Namen führt: ‚Kloster Dobbertin’. Wir haben solcher ‚Klöster’ hier sowohl, wie auch in meiner heimatlichen Provinz Brandenburg, mehrere; Stiftungen, die etwa dreißig Jahre nach der großen deutschen Kirchenbewegung, aus dem katholischen Glauben in das lutherische Bekenntnis übertraten, mit Ausnahme dieses einen Unterschiedes aber, in allem andern völlig unverändert blieben.“ (So heißt es im Dankesbrief vom 5. 10. 1871 an den Kardinal-Erzbischof von Besangon Cesaire Mathieu, der sich im Jahr zuvor für die Freilassung Fontanes aus französischer Gefangenschaft eingesetzt hatte.)
Dobbertin, das anmutig am nordöstlichen Ufer des gleichnamigen Sees gelegene Dörfchen, rückte 1869 in Fontanes Blickfeld, als Mathilde von Rohr ihren Platz im Konvent des dortigen adligen Fräuleinstiftes einnahm. Jahrzehntelang hatte sie in der Behrenstraße 70 zu Berlin einen kleinen literarischen Zirkel unterhalten, in den der junge Fontane 1852 durch Bernhard von Lepel eingeführt worden war. Anfangs fand er den dort gebotenen Tee besser als ihre Urteile über Literatur, doch mit der Zeit wandelte sich seine Skepsis und mündete in hochachtungsvolle Verehrung. Kurz nach ihrem Tode 1889 schrieb er ihr eine entzückende Huldigung, in der er sie als „... spezifisch märkisch und ... zu denen, an denen man alle guten und auch einige schwache Seiten des alten Märkertums... studieren konnte“ gehörend schilderte; „... ihre ... Sätze haben“, so gestand er, „durch ein Menschenalter hin einen großen Einfluss auf mich geübt...“ „...sie war auch persönlich ein wahres Anekdotenbuch und eine brillante Erzählerin alter Geschichten aus Mark Brandenburg, besonders in Bezug auf adlige Familien aus Havelland, Prignitz und Ruppin. Den Stoff zu meinem kleinen Roman ‚Schach von Wuthenow’ habe ich mit allen Details von ihr erhalten...“ („Mathilde von Rohr“, in: „Dörfer und Flecken im Lande Ruppin“, „Wanderungen“ VI)
In Dobbertin verfügte jede der 32 Stiftsdamen über eine eigene Wohnung mit acht Zimmern. Gäste aus dem Verwandten- oder Freundeskreis waren sehr willkommen, um „die Abgeschlossenheit des engsten Zirkels“ ein wenig aufzulockern. Auch Fontane hielt sich mehrfach dort auf. Seine Anspielungen auf adlige Fräuleinstifte in „Vor dem Sturm“, „Grete Minde“ und „Schach von Wuthenow“, vor allem aber das treffend gezeichnete Lokalkolorit des Klosters Wutz im „Stechlin“, dieses „wohlkonservierten Stück Mittelalters“, gehen auf Beobachtungen und Studien im Kloster Dobbertin zurück.
Der erste Besuch – August 1870 – fiel mit dem von Hurrageschrei begleiteten Kriegsbeginn zusammen. Emilie war mit den drei Söhnen aus der Warnemünder Sommerfrische nach Berlin zurückgekehrt, Fontane gönnte sich auf dem Heimweg noch einen ruhevollen Moment in der Dobbertiner Abgeschiedenheit. Von dort aus erschien ihm der ganze hysterische Trubel „wie eine kolossale Vision, eine vorüberbrausende Wilde Jagd, man steht und staunt und weiß nicht recht, was man damit machen soll... Es ist, wie wenn es in einem Theater heißt: ‚es brennt’; fortgerissen einem Ausgange zu, der vielleicht keiner ist, mitleidslos gedrückt, gestoßen, gewürgt, ein Opfer dunkler Triebe und Gewalten. Manche lieben das, weil es ein ‚excitement’ ist; – ich bin zu künstlerisch organisiert, als dass mir wohl dabei werden könnte.“ (an Emilie Fontane, 5. 8. 1870)
Im allgemeinen Taumel von nationalistischer Überheblichkeit und blindwütigem Franzosenhass war diese Haltung etwas durchaus Seltenes und er behielt sie, ungeachtet aller anfänglich hochtönenden Siegesmeldungen. Nach Berlin zurückgekehrt und von Lepel über die wahre Lage an den Fronten unterrichtet, schrieb Fontane am 26. August 1870 an Mathilde von Rohr: „Welche Siege, welche Verluste! Lepel, der gestern eine Stunde bei uns war, sagte sehr richtig: noch zwei solcher Siege und – wir sind ruinirt... heiter und singend ziehen Tag und Nacht immer neue Tausende hinaus, um die entstandenen Lücken zu füllen. Ohne einen gewissen Leichtsinn wäre es jetzt gar nicht auszuhalten.“
Außer diesem „gewissen Leichtsinn“ sah er keinen Sinn in den ungeheuren Blutopfern. Da er sich jedoch mit seinen Büchern über die Kriege von 1864 und 1866 bereits als „patriotischer Schriftsteller“ ausgewiesen hatte, verpflichtete ihn der Königliche Hofbuchdrucker Rudolf von Decker, ein drittes zu schreiben. So brach er – entgegen allen Bitten Emiliens – am 27. September 1870 nach Frankreich auf. Wer den Krieg beschreiben will, sagte er, der kann „nicht bloß, auf seinem Drehstuhl reitend, auszugsweise mit der Papierschere vorgehen ... wer, wenn weiter nichts, so doch wenigstens die Szenerie kennenlernen will, um hinterher sein Bild zu malen, der hat den Beruf, sich die Sache anzusehn.“ („Kritische Jahre – Kritikerjahre“, Kapitel „Parkettplatz Nr. 23“)
Merkwürdigerweise sollte dieses Kriegsbuch fast bis zum letzten Kapitel mit dem stillen Dobbertin verbunden bleiben.
Zunächst einmal gerieten Buch und Autor in höchste Gefahr: Am 4. Oktober 1870 hatte Fontane Toul erreicht, wo sich derzeit die Frontlinie befand. Ungeachtet dieser zur Vorsicht mahnenden Tatsache kutschierte er ins vierzig Kilometer entfernte Domremy, um das Geburtshaus der Jeanne d’Arc zu besichtigen, für die er schon als Schüler geschwärmt hatte; dabei wurde er von Franktireurs als „preußischer Spion“ festgenommen. Wochenlang schwebte er unter dieser Anklage in Lebensgefahr. Man expedierte ihn quer durch Frankreich in verschiedene Gefängnisse. Namhafte Persönlichkeiten aller politischen und konfessionellen Couleur setzten sich für seine Rettung ein, unter anderem der KardinalErzbischof der Festungsstadt Besancon Cesaire Mathieu.
Bei seiner Freilassung musste sich Fontane lediglich verpflichten, „gegen Frankreich weder irgendetwas sagen, noch schreiben, noch tun zu wollen.“ Dies zu versprechen fiele ihm leicht, antwortete er, „da in meinem Herzen nichts lebe, was als eine Empfindung ‚contre La France’ gedeutet werden könne.“ („Kriegsgefangen“, „Frei“, Kapitel 1)
Am 5. Dezember 1870 traf er wieder in Berlin ein. Er hatte in den drei Monaten, obwohl in großer Lebensgefahr, sorgfältig Tagebuch geführt, sodass er dank dieser Aufzeichnungen bereits am 25. Dezember 1870 in der „Vossischen Zeitung“ das erste von 32 Kapiteln über seine Kriegsgefangenschaft veröffentlichen konnte. Wenige Wochen später erschien dieser Bericht bei Decker in Buchform. Er war im Handumdrehn ausverkauft. Viele, die um ihre Angehörigen im Felde fürchteten, waren Fontane für seine vorurteilslosen Schilderungen dankbar. Das offizielle Preußen hingegen gab ihm unverblümt zu verstehen, dass er in Preußen unter solcher Anschuldigung ohne Federlesen an die nächste Wand gestellt worden wäre.
Das eigentliche Buch über den Krieg stand aber noch aus. Aus diesem Grund begab sich Fontane im April 1871 noch einmal nach Frankreich, wo er bei der Mühle von Sannois mit eigenen Augen sah, „wie die dreifarbige und die rote Republik [die Pariser Commune] miteinander rangen“. Er beobachtete und er schrieb auf. Ohne Hass und Vorbehalte. Er fühlte sich nicht nur durch seine hugenottische Herkunft dem französischen Volk wesensverwandt und litt darunter, dass Angehörige seiner Nation sich oft unmenschlich beleidigend und überheblich aufspielten; er litt auch darunter, dass ein einzelner bei allem guten Willen wehrlos und ohnmächtig war zwischen den Fronten der Kanonen und der chauvinistischen Leidenschaften. Die großen politischen Probleme darzustellen, vermied er bewusst, doch ließ er keinen Zweifel daran, dass er die Kriegsziele des jungen deutschen Kaiserstaates für bedenklich und Elsaß und Lothringen für rechtmäßige französische Provinzen hielt.
Mit Absicht wählte er für das Buch den schlichten Titel „Aus den Tagen der Okkupation. Eine Osterreise durch Nordfrankreich und Elsass-Lothringen 1871“. Es musste konzentriert und unter großem Zeitdruck geschrieben werden. Da ihn in Berlin zuviel ablenkte, bat er Mathilde von Rohr Mitte August 1871 um zwei Wochen Asyl in Dobbertin. „So viel Zeit brauche ich nämlich, um etwa ein Dutzend Kapitel für mein neues Buch zu schreiben. Ich rechne so: jeden Vormittag ein Kapitel. Derweilen plaudern und promeniren Sie mit meiner Frau, während ich oben Stuben-Arrest habe.“ Und so geschah’s.
Zu Weihnachten erschienen beide Bände; er widmete sie der mütterlichen Freundin, denn: „Die beiden letzten Kapitel des I. Bandes und die 9 ersten Kapitel des II. Bandes (bis ‚Beaumont’ inclusive) wurden in Dobbertin geschrieben... In den nächsten Tagen werde ich beide Bände, wie auch ‚Kriegsgefangen’ dem Kaiser überreichen lassen ... hier wird man es wohl wieder zu ‚franzosenfreundlich’ finden, weil ich nicht ausgesprochen habe jeder Franzose muss zur Strafe seiner Sünden lebendig gebraten werden. Daß mich dies alles wenig anficht, werden Sie glauben.“ (19. 12. 1871)
Von seinem 45. bis zum 57. Lebensjahr veröffentlichte Fontane neben den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und Theaterkritiken fast 3400 großformatige Druckseiten über militärische Ereignisse. Abgesehen vom Preußischen Kronenorden IV. Klasse wurde ihm vonseiten des Staates keinerlei offizielle Anerkennung zuteil. Schlimmer noch, als 1876 sein letzter Versuch scheiterte, sich um gesicherter Einkünfte willen als Beamter zu etablieren, war er genötigt, um eine Unterstützung aus dem kaiserlichen „Fonds für förderungswürdige Literaten“ zu bitten. Sie wurde rundweg abgelehnt. In zorniger Enttäuschung schrieb er am 30. November 1876 an Mathilde von Rohr: „Zwölf Jahre habe ich an diesen Kriegsbüchern Tag und Nacht gearbeitet, sie feiern, nicht in großen aber in empfundenen Worten, unser Volk, unser Heer, unsren König und Kaiser; ich bereiste 1864 das gegen uns fanatisirte Dänemark, war 1866 in dem von Banden und Cholera überzogenen Böhmen, und entging in Frankreich, nur wie durch ein Wunder, dem Tode. Unabgeschreckt, weil meine Arbeit das Wagnis erheischte, kehrte ich an die bedrohlichen Punkte zurück. Dann begann meine Arbeit. Da steht sie, wenn auch weiter nichts, das Produkt großen Fleißes, ihrem Gegenstände nach aber das einzige repräsentirend, dem gegenüber man eine Art Recht hat das Interesse des Kaisers, als des persönlichen Mittelpunkts, des Helden dieser großen Epopöe (ich spreche nur vom Stoff) zu erwarten. Und eben dieser Held und Kaiser, gefragt, ‚ob er einen Grund habe dem Verfasser dieses umfangreichen Werkes wohlzuwollen oder gnädig zu sein’ verneint diese Frage... Für ein einziges niederländisches Genrebild sind 140.000 Francs gezahlt worden und wenn man will, so fliegt das Geld nur so. Mir gegenüber wollte man einfach nicht. Eh bien, es muss auch so gehn.“