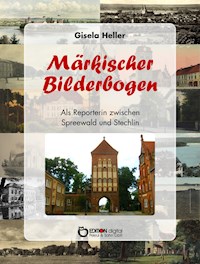9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
100 Jahre nach Fontane scheint es aktueller denn je, auf seinen Spuren durch Berlin und die Mark Brandenburg zu wandern, die von ihm beschriebenen Wege nachzuvollziehen. Was für viele Jahrzehnte als „verlorene Provinz“ galt, wird dabei als historische Landschaft (wieder) entdeckt. Dieses Buch nun führt den Leser zu den (alphabetisch geordneten) Stätten, die für Fontanes Leben und Werk von Bedeutung waren. Berlin nimmt dabei - nicht nur als geographischer Mittelpunkt - den größten Raum ein. Immer an bestimmte Örtlichkeiten geknüpft, ist hier Fontanes Lebensbogen ablesbar, seine Irrungen, Wirrungen, sein Ärger mit Chefredakteuren, Ministern, Hausbesitzern und der leidigen „Commodite“; seine Mühen bis hin zum „Eigentlichen“, dem Romanwerk, das er erst mit 60 Jahren begann. Er hat noch „das vernobelte Berlin“ kennengelemt und die Anfänge des Bombasmus; die Verwüstung erlebte Fontane nicht mehr. Von seinen 18 (!) Wohnstätten blieb keine erhalten, dennoch fand die Autorin eine Vielzahl von Plätzen, an denen man sich sagen kann: Ja, hier könnte es gewesen sein ..., hier könnte die Witwe Pittelkow, hier Effi Briest gewohnt haben ... oder auf diesen jüdischen Friedhof konnte er von seinem Fenster aus sehen ... Ein Spaziergang durch Berlin und Umgebung mit diesem Buch wird unversehens zur Entdeckungsreise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
Gisela Heller
Unterwegs mit Fontane in Berlin und der Mark Brandenburg
ISBN 978-3-95655-862-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1983 in der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung Beuermann GmbH, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2017 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Vorwort
„Wer in der Mark reisen will, der muss zunächst Liebe zu ‚Land und Leuten‘ mitbringen, mindestens keine Voreingenommenheit. Er muss den guten Willen haben, das Gute gut zu finden, anstatt es durch krittliche Vergleiche totzumachen.“ 1864 gab Fontane den Wanderern in der Mark diesen Rat. Wie gegenwärtig klingt er heute, da unzählige „Wanderer“ ausziehen, ein Land zu entdecken, das jahrzehntelang als „verlorene Provinz“ galt.
Wer dieses Land „mit der Seele suchen“, wer das Wesen von Mark und Märkern verstehen will, ist noch heute mit Fontane gut beraten, denn er hat beide „liebevoll geschildert, aber nirgends glorifiziert“. Wie ein Wünschelrutengänger berührte er den Boden und ließ historische Gestalten erstehen, und in dieses Zauberspiel der Fantasie wird der Fontaneleser auch heute hineingezogen: In Wustrau wird ihm Zieten aus dem Buch lebendig, in Rheinsberg Prinz Heinrich, in Meseberg der ‚tolle Kaphengst’; in Molchow wird er schmunzelnd bestätigen, dass der hölzerne Glockenturm wirklich so aussieht, „als habe ihn ein Schilderhaus mit einer alten Windmühle gezeugt“; eine Blumenwiese in Hankels Ablage wird ihn an Lene und Botho erinnern; und obwohl es nie ein Schloss Stechlin gegeben hat, wird man am Großen Stechlinsee, vielleicht in einer knorrigen Eiche, den alten Dubslav raunen hören: „Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig.“
Etwas von der ungeheuren Zauberkraft, die von Fontanes „Wanderungen“ und Romanen ausgeht, ist in diesem Buch eingefangen; der Leser scheint Fontane über die Schulter zu sehen, er erfährt, warum es ihn an diesen oder jenen Ort zog, was ihm dort widerfuhr und wie es sich in Leben und/oder Werk niederschlug.
„Unterwegs mit Fontane“ heißt aber nicht nur reisen zu den Stätten, die für ihn von Bedeutung waren, sondern auch reisen zum Menschen Fontane. Die Neuruppin- und Berlinkapitel ergeben so etwas wie eine Fontane-Biografie: Kinderjahre, Schulzeit, Sturm und Drang in Berlin, Reifezeit, Familienleben, Ärger mit Chefredakteuren, Ministern, Hausbesitzern und der leidigen „Commodite“, kurz, sein ganzer Lebensbogen bis zu dem großen Romanwerk, das er mit 60 begann.
Berlin nimmt verständlicherweise den größten Raum ein und ist allen anderen Kapiteln vorangestellt. Fontane erlebte, wie die Stadt sich aus provinzieller Enge befreite und „vernobelte“; er beobachtete die Anfänge kaiserlichen Bombasmus, ... die Folgen mit all den schrecklichen Verwüstungen sah er nicht mehr.
Keine seiner 18 (!) Wohnstätten blieb dort erhalten, und doch wird der Leser eine Vielzahl von Plätzen finden, an denen er überrascht innehält und sich sagt: Ja, hier muss es gewesen sein, auf diesen jüdischen Friedhof konnte er von seinem Fenster aus sehen, oder hier, in der Invalidenstraße, könnte die Witwe Pittelkow oder hier, in der Keithstraße, könnte Effi Briest gewohnt haben; und die Poggenpuhls, schwärmten sie nicht von dem Ausblick auf den stillen Matthäikirchhof? Wirkliche und Romangestalten laufen einem durcheinander, und gerade das war von Fontane gewollt.
Erich Kästner schrieb 1959 in einer Hommage à Fontane: „Er schuf Berlin zum zweiten Male. Er schenkte uns die Stadt an der Spree, wie uns Balzac die Stadt an der Seine und Dickens die Stadt an der Themse schenkten. Diese Städte und ihre Gesellschaft mögen sich wandeln, sie mögen wachsen, verfallen oder gar zerstört werden - ihr Herz und eigentliches Wesen lebt im Ceuvre der großen Romanciers fort.“
Und was die Mark Brandenburg betrifft, so hoffe ich, dass der Leser am Ende seiner Reise mit Fontane sagen kann: „Ich bin die Mark durchzogen und habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte.“ Zwar muss sich der Reisende - wie zu Fontanes Zeiten - auf manche Unebenheiten gefasst machen, aber: „Es wird einem selten das Schlimmste zugemutet“.
Mögen nun die vorliegenden Kapitel „in andern jene Empfindungen wecken, von denen ich am eigenen Herzen erfahren habe, dass sie ein Glück, ein Trost und die Quelle echtester Freuden sind“ (Theodor Fontane, November 1861).
Gisela Heller, April 1992
Berlin
„Es ist mir im Laufe der Jahre besonders seit meinem Aufenthalte in London Bedürfnis geworden an einem großen Mittelpunkte zu leben, in einem Zentrum wo entscheidende Dinge geschehn, ... ein solches Schwungrad in nächster Nähe sausen zu hören, auf die Gefahr hin, dass es gelegentlich zu dem bekannten Mühlrad wird“ (an Paul Heyse, 28. 6. 1860). Es sollte ihm reichlich zuteilwerden: Schwungrad und Mühlrad. Als er im Herbst 1833, also noch nicht vierzehnjährig, mit seinem Habseligkeitsbündel nach Berlin kam, das er bisher nur von kurzzeitigen Besuchen an der Seite seiner Eltern her kannte, ahnte er nicht, dass diese Stadt sein Schicksal werden sollte.
Zunächst sehnte er sich nach Swinemünde zurück, wo er vom siebten bis zum zwölften Lebensjahr in „freier Wildbahn“ aufgewachsen war. In einer befreundeten Honoratiorenfamilie hatte er am Unterricht durch einen Hauslehrer teilgenommen, den Rest besorgte Vater Fontane selbst nach einer eigenen, spielerischen Methode, die er kühn „die sokratische“ nannte. „Da war ich unschuldigen Herzens und geweckten Geistes gewesen, voll Anlauf und Aufschwung, ein richtiger Junge, guter Leute Kind. Alles war Poesie. Die Prosa kam bald nach ...“ Die Prosa - das waren die anderthalb Jahre auf dem Neuruppiner Gymnasium unter der Fuchtel des Schulmonarchen Thormeyer.
Dann beschloss der Vater, den Jungen auf die 1824 in Berlin gegründete Klödensche Gewerbeschule zu geben. Karl Friedrich Klöden, bekannt als Geograf und Historiker, wollte in seiner Lehranstalt vor allem „Realien“, die praktischen Fächer vermitteln. Da Theodor Apotheker werden sollte, hielten die Eltern dies für die beste Voraussetzung. So bezog der Knabe sein erstes Berliner Domizil: die Schülerpension Badtke in der Wallstraße 73.
„Das Resultat dieses unterbrochenen Schulganges war, dass ich, anstatt eine Sache wirklich zu lernen ... von links her die Gymnasialglocken, von rechts her die der Realschule habe läuten hören, also mit minimen Bruchteilen einerseits von Latein und Griechisch, andrerseits von Optik, Statik, Hydraulik, von Anthropologie - wir mussten die Knochen und Knöchelchen auswendig lernen -, von Metrik, Poetik und Kristallografie meinen Lebensweg antreten musste- („Von Zwanzig bis Dreißig“, Kapitel „Mein Onkel August“).
Immerhin ist diese „gemischte, durchaus praktikable Bildung später dem Journalisten und auch dem Romancier Fontane zugutegekommen. Das Pensionat erwies sich bald als zu lieblos und vor allem zu teuer. Deshalb zog Theodor zu seinem Onkel August, der Burgstraße 18, gegenüber dem Stadtschloss, ein Malutensiliengeschäft betrieb und selber recht ordentlich malte und musizierte. Tante Pinchen hatte, wie es hieß, ihm zuliebe eine große Bühnenkarriere aufgegeben, aber den theatralischen Lebensstil beibehalten. „Da war alles auf Schein, Putz und Bummelei gestellt; medisieren und witzeln, einen Windbeutel oder einen Baiser essen, heute bei Josty und morgen bei Stehely, nichts tun und nachmittags nach Charlottenburg ins Türkische Zelt fahren - das war so Programm. Wo das Geld dazu herkam, erworben oder nicht erworben, war gleichgültig, wenn es nur da war. Dem Knaben gefiel diese legere Art, er „glaubte an die beste der Welten“, nur manchmal mahnte ihn das Gewissen zu „solider Pflichterfüllung, mein bestes Erbstück von der Mutter her“ (ebenda).
Ostern 1835 musste die schöne, romantische Wohnung aufgegeben werden. Man zog nach der Großen Hamburger Straße 30/30 a. „Lauter gescheiterte Leute hatten hier, als Trockenwohner, ein billiges Unterkommen gefunden: arme Künstler, noch ärmere Schriftsteller und bankrotte Kaufleute ... Eine Gesamt-Gesellschaft, in die, was mir damals glücklicherweise noch ein Geheimnis war, mein entzückender Onkel August - er war wirklich entzückend - durchaus hineingehörte.“ Der sechzehnjährige Theodor bewohnte ein Zimmer im Seitenflügel, so feucht, „dass das Wasser in langen Rinnen die Wände herunterlief“ (ebenda). Auf dem gleichen Flur wohnten ein verarmter polnischer Edelmann und eine couragierte junge Witwe, die - Jahrzehnte später - vielleicht das Modell für die Witwe Pittelkow abgegeben haben mag.
Zu Onkel Augusts Whistrunde gehörte Herr Rat Kummer, „ein Tausendkünstler, Erfinder der Reliefkarten und -globen“, ebenso reich beanlagt und ebenso unbedenklich in den Tag hinein lebend. Seine Pflegetochter Emilie Rouanet wirkte auf den Jüngling Theodor wie ein „Ciocciaren-Kind aus den Abruzzen“, er war bezaubert von ihrer exotischen Wildheit und Theaterleidenschaft. Fünfzehn Jahre später wurde sie seine Frau.
Zu Pfingsten 1835 gefiel es dem Onkel, vor dem Oranienburger Tor eine Sommerwohnung zu mieten. Der Weg zur Schule dauerte nun eine Stunde. Obendrein wanderte Oberlehrer Ruthe mit seinen Schülern zweimal in der Woche zum Botanisieren nach Treptow, Britz oder zu den Rudower Wiesen. „Dann musste ich mit nur zu oft wund gelaufenen Füßen ... wenigstens anderthalb Stunden“ nach Hause laufen.“ Angekommen hatte ich noch die Pflanzen in Löschblätter zu legen und fiel dann todmüde ins Bett. Man male sich aus, mit welcher Freudigkeit ich dann am Donnerstag in die Schule ging ... Die Folge ... war denn auch, dass ich immer mehr und mehr in Bummelei verfiel“ (ebenda).
Damals begann er schon auf eigene Faust mit „Wanderungen“: „Grunewald und Jungfernheide nahmen mich auf, und wenn ich es an dem einen Tage mit den Rehbergen oder mit Schlachtensee versucht hatte, so war ich tags darauf in Tegel und lugte nach dem Humboldtschen ‚Schlösschen’ hinüber, von dem ich wusste, dass es allerhand Schönes und Vornehmes beherberge. Nebenher war ich aber wirklich auf der Suche nach Moosen und Flechten und bildete mich auf diese Weise zu einem kleinen Kryptogamisten aus“ (ebenda).
Theodor liebte den Lehrer Ruthe, der ein abenteuerliches Leben hinter sich hatte und profunde medizinische, zoologische und botanische Kenntnisse besaß. Auf seinen späteren „legitimen“ Wanderungen griff er öfter auf Ruthes „Naturgeschichte der Mark Brandenburg“ zurück. Und in dem Roman „Irrungen, Wirrungen“ erinnert die Wiese auf Hankels Ablage, auf der Lene ihrem Liebsten den beziehungsvollen Strauß bindet, an Ruthe und die Rudower Wiesen.
„An der Ecke Schönhauser und Weinmeisterstraße, will also sagen an einer Stelle, wohin Direktor Klöden und die gesamte Lehrerschaft nie kommen konnten, lag die Konditorei meines Freundes Anthieny ... Da trank ich denn, nachdem ich vorher einen Wall klassisch-zeitgenössischer Literatur ... um mich her aufgetürmt hatte, meinen Kaffee. Selige Stunden. Ich vertiefte mich in die Theaterkritiken von Ludwig Reilstab, las Novellen und Aufsätze von Gubitz...“, - und Fontane ahnte nicht, dass er einmal die Nachfolge dieser Herren antreten würde als Theaterkritiker bei der „Vossischen Zeitung“. Las auch „vor allem die Gedichte jener sechs oder sieben jungen Herren, die damals ... eine Berliner Dichterschule bildeten“ (ebenda). Angeregt durch Chamissos „Salas y Gomez“ verfasste er selbst ein Gedicht. „Natürlich waren es auch Terzinen; Gegenstand: die Schlacht bei Hochkirch“ (an Storm, 14. 2. 1854). „Hätte ich ... pflichtgemäß meine Schulstunden abgesessen, so wäre mein Gewissen zwar reiner geblieben, aber mein Wissen auch, und auf dem ohnehin wenig beschriebenen Blatte meiner Gesamtgelehrsamkeit würd auch das Wenige noch fehlen, was ich dem ‚Freimütigen’, dem Gesellschaften und dem ‚Figaro’ von damals verdanke“ (ebenda).
(Dieses „Bekenntnis“ schrieb der fünfundsiebzigjährige Dichter in seinen Memoiren, just in dem Jahr, in dem ihm die Ehrendoktor-Würde der Berliner Universität verliehen worden war. Der Weg dahin war lang und steinig, oft genug dornenvoll.)
Am 1. April 1836 trat Theodor Fontane bei Wilhelm Rose, dem Besitzer der Apotheke „Zum weißen Schwan“, seine Lehre an. Er wohnte im Seitenflügel Spandauer Straße, Ecke Heidereitergasse und durfte am Lesezirkel seines Lehrherrn teilhaben. Da Rose den von Karl Gutzkow und den Jungdeutschen herausgegebenen „Telegraf“ abonniert hatte, eröffnete sich ihm eine neue Welt.
Ungeachtet aller Bildungsbeflissenheit vertrat der Prinzipal eine ausgesprochene Geldsackgesinnung, die der junge Fontane um so lächerlicher fand, als gar kein nennenswerter Geldsack vorhanden war. Er sah in Rose den Prototyp eines Bourgeois; Jahrzehnte später brachte er seine Beobachtungen in den Roman „Frau Jenny Treibel“ ein.
Zu den angenehmsten Seiten der Ausbildung gehörte das Kochen von Queckenextrakt im Kellerlaboratorium. „Schönere Gelegenheit zum Dichten ist mir nie wieder gegeben worden; die nebenher laufende, durchaus mechanische Beschäftigung, die Stille ... alles war geradezu ideal“ (ebenda, Kapitel „Berlin 1840“). In der mittäglichen Freistunde schrieb er dann alles auf, was er sich am Braukessel ausgedacht hatte. So „leimte ich ein kleines Epos zusammen: Heinrich IV. Und das Jahr darauf schrieb ich meine erste Ballade, die ... hieß ‚Vergeltung’, behandelte ... die Schuld, den Triumph und das Ende des Pizarro und wurde unter Gratulationen von dem betreffenden Redakteur in einem hiesigen Blatt gedruckt“ (an Storm, 14. 2. 1854). Auf ähnliche Weise entstand auch die erste Novelle „Geschwisterliebe“, die im Dezember 1839 ebenfalls im „Berliner Figaro“ erschien. Dieses Sich-gedruckt-Sehen hob sein Selbstwertgefühl, sodass er ohne Murren die „letzte Waschfrauenarbeit“ verrichtete.
Seine freie Zeit verbrachte er im Platenklub oder im Lenauverein. Dort lernte er auch den gleichaltrigen Studenten der Nationalökonomie Julius Faucher und den sieben Jahre älteren Gustav Adolf Techow kennen. Zwei sprühende Feuerköpfe, die sich 1848/49 leidenschaftlich für die Revolution einsetzten. Techow wurde deswegen zu 15 Jahren Festungshaft in Spandau verurteilt, wo ihn Fontane besuchte. Faucher musste nach London emigrieren. Dort sollte ihm Fontane später wieder begegnen.
1838/39 war dies alles noch nicht abzusehen, harmlos das Geplauder in den berühmten Cafés von Stehely am Gendarmenmarkt, Josty gegenüber dem Schloss und Spargnapani Unter den Linden 50. Dennoch nannte sie Karl Gutzkow „den Revolutionsherd der vormärzlichen Zeit, wo Baisers, Spritzkuchen und Journale den Geist der Neuerung befördern halfen“. Und der junge Fontane, sooft es Zeit und Geldbeutel erlaubten, immer mittendrin.
Im Januar 1840 bescheinigte ihm Stadtphysikus Dr. Natorp „sehr gute Kenntnisse der Chemie, Pharmacie und Latinität“. Als Apothekengehilfe arbeitete er nun in Burg und Leipzig, wo er sich dem Herweghklub anschloss. Beklagte nun nicht mehr im Lenaustil die Grabesstille der vereisten Natur, sondern schmetterte mit jugendlichem Ungestüm ins Horn des schwärmerisch-revolutionären Herwegh: „Ich möcht hinaus! Umbrüllt von Sturm und Wettern ...!“und so weiter ...
Ein erster Versuch in Leipzig, vom Ertrag seiner Feder zu leben, misslang. Typhus und rheumatisches Fieber zwangen ihn für Monate aufs Krankenlager. 1842 trat er in die renommierte Salomonis-Apotheke des Dr. Struve in Dresden ein, begann den „Hamlet neu zu übersetzen und den englischen Arbeiterdichter John Prince; bereitete sich in der väterlichen Apotheke zu Letschin auf ein Studium vor, aus dem aber nichts werden sollte; begann am 1. 4. 1844 seinen Dienst als Einjährig-Freiwilliger im Kaiser-Franz-Gardegrenadierregiment Nummer 2. Bewohnte in dieser Zeit ein Zimmerchen in der Klosterstraße 64, später Jüdenstraße 55. Der Dienst muss recht kommod gewesen sein, denn der Herr Oberst bewilligte ihm vom Wachdienst weg zwei Wochen Urlaub für eine unerwartete Englandreise. Er sollte seinem Schulfreund Hermann Scherz dolmetschen. Die Tower-Bridge, Buckingham Palace, blutige Historie und weltoffene Gegenwart beeindruckten ihn stark. Zeit seines Lebens blieb ein „liking“ für diese pulsierende, imposante Riesenstadt. Es bewahrte ihn später davor, das im Vergleich zu London doch noch provinzielle Berlin als Nabel der Welt anzusehen.
Im Kaiser-Franz-Grenadierregiment diente als Berufsoffizier Bernhard von Lepel, ein künstlerisch talentierter Mann, brillierend in italienischer Sprache und Kultur, ein Meister des Bonmots und der gereimten Improvisation, leider ständig in Liebesaffären verstrickt, doch seinem Freund Fontane gegenüber treu; er half ihm über manche seelische und finanzielle Durststrecke hinweg und führte ihn in die literarische Sonntagsgesellschaft „Tunnel über der Spree“ ein.
Der „Tunnel“ war 1827, als ihn der geistreiche Hans-Dampf-in-allen-Gassen Saphir gründete, „an vielen Sonntagen nichts weiter als ein Rauch- und Kaffeesalon, darin, während Kellner auf und ab gingen, etwas Beliebiges vorgelesen wurde“. 1844, zu dem Zeitpunkt, als Fontane den Tunnel-Namen „Lafontaine“ erhielt und als ordentliches Mitglied aufgenommen wurde, stand der Verein in seiner Hochzeit. Es gehörten ihm eine Reihe in Malerei und Dichtung dilettierende Offiziere wie Bernhard von Lepel an, hohe Beamte wie der Kammergerichtsrat Wilhelm von Merckel, Architekten wie Richard Lucae, Professoren wie die Kunstwissenschaftler Franz Kugler und Friedrich Eggers; aber auch Kaufleute, Assessoren und „wirkliche Künstler“ wie Kuglers Schwiegersohn Paul Heyse, die Maler Adolph Menzel und Theodor Hosemann. Als Gäste können Emanuel Geibel und Theodor Storm genannt werden.
Fontane schrieb zwar in seinen Memoiren: „Die Tunnel-Leute waren, wie die meisten gebildeten Preußen von einer auf das nationalliberale Programm hinauslaufenden Gesinnung“, doch muss dies aufgrund ihrer Herkunft und Profession bezweifelt werden. So erlangte Merckels Pamphlet aus dem Jahre 1848 traurige Berühmtheit, das mit dem Satz schloss: „Gegen Demokraten helfen nur Soldaten!“
Der „Tunnel“ sollte ein von der Ästhetik geheiligter Bezirk sein, über der banalen Realität des Alltags stehend; Toleranz war oberstes Gebot, politische und konfessionelle Streitgespräche nicht erlaubt, ja, um des lieben Friedens willen verpönt. Durch die Tunnel-Namen sollten alle gesellschaftlichen Schranken aufgehoben werden. Man las vor, die anderen sagten ihre Meinung, begründeten sie, wurden akzeptiert oder widerlegt. Fontane lernte dabei ungemein, bildete seine Urteilsfähigkeit. Mit seinen eigenen Arbeiten, Versen und Übersetzungen des englischen Arbeiterdichters John Prince, die den schwärmerisch-freiheitlichen Impetus Herweghs nicht verleugneten, stieß er zunächst auf Kopfschütteln und Befremden. Erst mit dem volksliedhaftderben „Alten Derfflinger“ fand er genau den Ton der Tunnel-Leute und deren ungeteilte Anerkennung. Kein Wunder, dass dem Derfflinger weitere preußische Helden folgten: der alte Dessauer, Zieten aus dem Busch, Seydlitz, Schwerin und Schill. „Die große Mehrzahl meiner aus der preußischen aber mehr noch aus der englisch-schottischen Geschichte genommenen Balladen entstammt jener Zeit, und manche glückliche Stunde knüpft sich daran. Die glücklichste war, als ich ... 1853 oder 54 - meinen ‚Archibald Douglas’ vortragen durfte. Der Jubel war groß. Nur einer ärgerte sich und sagte: ‚Ja, wer so vorlesen kann, der muss siegen“ („Von Zwanzig bis Dreißig“, Kapitel „Mein Eintritt in den Tunnel“).
Fontane war 21 Jahre lang Mitglied des „Tunnels“, zeitweise sein Schriftführer - denn es wurde gewissenhaft Protokoll geführt - und ab 1859 sogar „angebetetes Haupt“, sprich Vorsitzender. Die Jahre von 1844 bis 1855 waren für ihn die intensivsten und wichtigsten, denn im „Tunnel“ lebte er sein eigenes Leben, das ihm über private und berufliche Miseren hinweghalf. Am 1. April 1845 endete sein Militärdienst. Weil für die Approbation als „-Apotheker erster Klasse“ eine bestimmte Praktikantenzeit nachgewiesen werden musste, arbeitete er eine Weile als Rezeptar beim Vater in Letschin und übernahm am 24. 6. 1845 die Stelle eines zweiten Rezeptars in der „Polnischen Apotheke“ von Dr. Julius Schacht in Berlin, Friedrichstraße 153a, Ecke Mittelstraße. Dort lernte er Friedrich Witte kennen, den späteren Reichstagsabgeordneten und Inhaber einer pharmazeutischen Fabrik in Rostock. Ihm und seinem Bruder sollte er zeitlebens freundschaftlich verbunden bleiben. Bei seinem Onkel August traf er das „Nachbarskind“ aus der Großen Hamburger Straße wieder. „Die Kleine, mittlerweile neunzehn Jahr alt geworden, war total verändert. Nicht bloß das Abruzzentum war hin ... beweglich und ausgelassen, vergnügungsbedürftig und zugleich arbeitsam war sie der Typus einer jungen Berlinerin, wie man sie sich damals vorstellte ... Wir nahmen den alten herzlichen Ton wieder auf“ (ebenda, Kapitel „Fritz, Fritz, die Brücke kommt“), und am 8. Dezember verlobten sie sich. Während eines Spaziergangs. Mitten auf der Weidendammer Brücke.
Um heiraten zu können, war „noch zweierlei vonnöten: Geld und Examen“. Ernsthaft bereitete er sich, teils in Letschin, teils in Berlin, auf das Staatsexamen vor, wohnte wieder einmal bei Onkel August - Dorotheenstraße 60 - und erwarb am 2. 3. 1847 die Approbation. Doch ihm fehlten die Mittel, um sich auf eigene Füße zu stellen. Er musste wieder als Rezeptar arbeiten. Nun in der Apotheke „Zum Schwarzen Adler“, Neue König-, Ecke Georgenkirchstraße.
Von der Armseligkeit seines Daseins zeugt ein Brief an Wilhelm Wolfsohn, den Freund aus Leipziger und Dresdener Tagen, der ihn in Berlin besuchen wollte: „Hast Du denn ... ganz vergessen, dass ein conditionirender Giftmischer ähnlich wohnt wie der Salzhering in seiner Tonne?! ... Ich bewohne eine Schandkneipe, einen Hundestall, eine Räuberhöhle mit noch zwei andern deutschen Jünglingen und habe keine freie Verfügung über diese Schlafstelle, die viel vor Erfindung dessen, was man Geschmack, Eleganz und Comfort heißt, vermuthlich von einem Vandalen erbaut wurde“ (10. 1. 1848). Unter diesen misslichen Lebensumständen entstand der Romanzenzyklus „Von der schönen Rosamunde“.
Von hier brach er an jenem denkwürdigen 18. März 1848 auf, um in der nahen Georgenkirche die „Sturmglocken der Revolution“ zu läuten. Leider war die Kirche verschlossen. Daraufhin gesellte er sich denen zu, die die Requisite des Königstädtischen Theaters am Alexanderplatz stürmten, um „Degen, Speere, Partisanen und vor allem kleine Gewehre“ zu requirieren. Die Flinten waren für ein Lustspiel gedacht und für den Ernstfall völlig untauglich.
Fontane erkannte sehr schnell, dass die ihm gemäße Waffe die Feder war, mit der er sich rückhaltlos auf die Seite der Aufbegehrenden und Unterprivilegierten stellte. Seine Artikel in der „Berliner Zeitungshalle“ waren spandaureif. Als die Revolution in Berlin bereits niedergeschlagen war, schrieb er für die radikal-demokratische „Dresdener Zeitung“ weiter.
Das offizielle Preußen hat ihm dieses Engagement in den Jahren 1848/49 nie ganz verziehen. Darum wohl versuchte der alte Fontane in „Von Zwanzig bis Dreißig“ seinen Anteil an den revolutionären Ereignissen herunterzuspielen und zu verharmlosen. Etwas wunderlich klingt danach allerdings das Bekenntnis, dass es ihm in jungen Jahren „zubestimmt war, unausgesetzt Revolutionären und ähnlichen Leuten in die Arme zu laufen: Robert Blum, Georg Günther - Schwager R. Blums - Jellinek, Dortu, Techow, Herzen, Bakunin und noch andre, die das, wofür sie kämpften, mit ihrem Leben oder mit ihrer Freiheit bezahlt haben“. Von ungefähr läuft man solchen Leuten wohl nicht in die Arme ...
Auf einem Wollboden in der Neuen Königstraße wurden Wahlmänner vorgeschlagen, die als Volksvertreter die Verfassungsgebende Versammlung wählen sollten. Als Gegenkandidaten zu dem befrackten Hohenzollern-Verfechter schlug Fontane den Bäcker Roesicke vor, von dem man wenigstens wüsste, dass er „in der ganzen Gegend die besten Semmeln hätte“. Am Ende wurde Fontane selbst gewählt und nahm nun fast täglich an den Versammlungen im Konzertsaal des Königlichen Schauspielhauses teil. „Ich zähle die Stunden, in denen diese Beratungen stattfanden, zu meinen allerglücklichsten. Es war alles voller Leben und Interesse.“ Der Prinzipal der Apotheke sah das gewiss anders, „denn solchen ‚Politiker’ um sich zu haben, der jeden Tag ins Schauspielhaus lief, um dort pro patria zu beraten, und bei dem außerdem noch die Möglichkeit einer plötzlichen Verbrüderung mit dem Blusenmann Siegrist nicht ausgeschlossen schien, hatte etwas Bedrückliches, ganz abgesehn von den ... geschäftlichen Unbequemlichkeiten, die mein beständiges ‚sich-auf-Urlaub-Befinden’ mit sich brachte“ („Von Zwanzig bis Dreißig“, Kapitel „Berlin im Mai und Juni 48“), So waren denn beide froh, dass er im September 1848 in die neu gegründeten Krankenanstalten zu Bethanien berufen wurde, um zwei Diakonissen in Pharmazie auszubilden.
„Ein Sonnenstrahl des Glücks hat mich getroffen“, schrieb er am 17. 9. 1848 an Lepel. „Ich bin in Bethanien bei freier Wohnung und Station, mit 20 rth monatlich angestellt. Nur während zweier Mittagsstunden hab ich in der Apotheke zu arbeiten; die übrige Zeit ist mein. Du kannst Dir denken wie viele Pläne und Hoffnungen ich an diese Muße knüpfe ...“ Fontane arbeitete hier nicht nur an seinem (unvollendet gebliebenen) Drama „Karl Stuart“, verfasste nicht nur die Ballade von der Ermordung Wallensteins auf Schloss Eger, er schrieb auch weiter für die „Berliner Zeitungshalle“. Bethanien „war ein Idyll, wie’s nicht schöner gedacht werden konnte: Friede, Freundlichkeit, Freudigkeit ...“ In den Ministerien aber gewannen die reaktionärsten Kräfte Oberhand, Wrangel wurde zum Oberbefehlshaber in den Marken ernannt und mit seinen Truppen nach Berlin beordert, um den letzten Funken der Revolution auszutreten. „Der Augenblick erheischt Thaten, oder doch Wort und That“, schrieb er am 21. 9. 1848 an Lepel, „Schande Jedem, der zwei Fäuste hat mit Hand ans Werk zu legen, und sie pomadig in die Tasche steckt ... Hast Du nicht auf väterlicher Rumpelkammer eine alte aber gute Büchse?“ Diese Bitte an die Adresse eines Gardeoffiziers war natürlich verfehlt. Doch taten die politischen Meinungsverschiedenheiten ihrer Freundschaft keinen Abbruch.
Am 30. September 1849 war Fontanes Aufgabe in Bethanien erfüllt. Er beschloss, sich, „auf jede Gefahr hin, auf die eigenen zwei Beine zu stelle ... So nahm ich denn meine sieben Sachen und übersiedelte nach einer in der Luisenstraße gemieteten ... Wohnung, dicht neben mir die Charité, gegenüber die Tierarzneischule“ (ebenda, Kapitel „Im Hafen“).
Am 5. Oktober schrieb er an Freund Lepel: „Da sitz’ ich denn wieder, und koste die Reize des Chambre garni. Die knarrende Bettstelle, die mitleidsvoll aus den Fugen geht, um einer obdachlosen Wanzenfamilie ein Unterkommen zu bieten, - der wankelmüthige Nachttisch, - das geviertheilte Handtuch, - die stereotypen Schildereien: Kaiser Nicolaus, und Christus am Kreuz, alles ist wieder da, mir Auge und Herz zu erquicken.“ Wie ein Verzweiflungsschrei heißt es weiter: „Kannst Du mir nicht sagen ... warum ich zu gar nichts komme? Ich mache so geringe Ansprüche ... 400 Thaler, worauf mit Recht der Spruch erfunden ist: ‚zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel‘ ersehne ich nun schon seit Jahr und Tag ... dennoch ist es nicht möglich, auch nur ein solches Minimum zu ergattern.“
Wolfsohn verhalf ihm zu einer Korrespondenz für die radikal-demokratische „Dresdener Zeitung“. In sechs Monaten entstanden dreißig Artikel. Der letzte, „Preußen - ein Militär- oder Polizeistaat?“ wurde nicht mehr veröffentlicht. Dafür erschienen „Männer und Helden“. Acht Preußenlieder bei A.W. Hayn in Berlin und „Von der schönen Rosamunde“ bei Katz in Dessau. Die lächerlichen Honorare reichten gerade, um die drückendsten Schulden zu bezahlen. In dieser ausweglos scheinenden Lage machte er sich im August 1850 auf den Weg nach Schleswig-Holstein, um in dem Unabhängigkeitskrieg gegen Dänemark als Feld-Apotheker sein Brot zu finden. Vielleicht, so hoffte er, würden auch einige Artikel dabei herausspringen. Unterwegs erreichte ihn die Nachricht, dass Wilhelm von Merckel ihn im neu gegründeten Literarischen Kabinett unterbringen könne. Ohne Zögern telegrafierte er seiner Braut: Im Oktober Hochzeit! Nach 5 Jahren Verlobungszeit, die Emilie zum größten Teil bei Verwandten in Schlesien verbrachte, ist diese Eile schließlich verständlich.
Das Paar wurde von Pastor Fournier in der Französischen Kirche getraut und bezog in der Puttkamerstraße die erste gemeinsame Wohnung. „Die Wohnung ist reizend, das tägliche Brot erscheint, gut zubereitet, als ‚Gemüse und Fleisch’ auf dem zweigedeckten Tisch, die Betten (nichts Unerhebliches im Ehestande ...) sind ... so bequem wie möglich ... an Ruhe fehlt es nicht und an Arbeit auch nicht ... sodass ich ... ein undankbarer Esel sein müsste, wenn ich nicht voller Freude und Zufriedenheit sein wollte“, schrieb Fontane am 1. 11. 1850 an Freund Witte.
Wenige Wochen später wurde die Regierung umgebildet, das Literarische Kabinett aufgelöst und Fontane entlassen. Vergebens suchte er sich zu trösten, es sei sowieso unter seiner Würde gewesen, die Soße zuzubereiten, „mit welcher das lit. Cabinet das ausgekochte Rindfleisch Manteuffelscher Politik tagtäglich zu übergießen hatte“. Dies moralische Unbehagen war er los, dafür kam die finanzielle Katastrophe. Frau Emilie nahm Schüler als Pensionisten ins Haus. Es brachte mehr Verdruss als Taler. Fontane gab Privatunterricht in Englisch und Geschichte. Freunde rieten ihm, beim König um Unterstützung aus dem Fonds für notleidende Künstler zu bitten. Nach furchtbaren inneren Kämpfen schrieb er das Gesuch. Es wurde abgelehnt. Aus politischen Gründen.
Im Mai 1851 veröffentlichte er zur Einweihung des Rauchschen Reiterdenkmals für Friedrich den Großen Unter den Linden das Gedicht: „Der Alte Fritz“. Es blieb ebenso ohne Resonanz wie die erste Sammlung seiner Gedichte. Zu Weihnachten 1851 erschien in Berlin das von Fontane herausgegebene „Deutsche Dichteralbum“ in prächtiger Ausstattung - und mit kärglichstem Honorar.
Im Herbst Umzug in eine kleinere und billigere Wohnung: Luisenstraße 35. Friedrich Witte, der sich weiter in Pharmazie ausbilden wollte und eine Unterkunft suchte, zog als Untermieter ein. Bei ihm hatten sie wenigstens nicht das demütigende Gefühl, vor dem Herrn, der für die Miete sorgte, knicksen zu müssen.
In Not und Sorge schrieb Fontane Anfang 1851 eine umfangreiche Ballade „Der Tag von Hemmingstedt“, über jenen 17. Februar 1500, an dem die Bauern von Dithmarschen ihre Unabhängigkeit erkämpften. „Ich habe neun Wochen daran gearbeitet und möchte wenigstens halb so viel Tageslohn bekommen wie ein Droschkenkutscher oder Dreckzusammenfeger“ (an Wolfsohn, 8. 3. 1851). Dementsprechend hatte er sich 10 Taler 15 Silbergroschen ausgerechnet. Das Gedicht erschien im „Deutschen Museum“, und der Autor erhielt dafür 4 Taler (!), umgerechnet 2 Silbergroschen pro Tag. (15 Jahre später sollte es Liliencron in die Sammlung „Historische Volkslieder der Deutschen“ aufnehmen.)
„Der Himmel bewahre jeden ehrlichen Menschen vor Bittstellerei, Antichambrieren und Bedientengesichtern“, schrieb er zum Jahresende an Wolfsohn. „Für heute nur die Mitteilung, dass ich seit November wenigstens wieder zu essen habe, wenn auch nicht allzu viel. Am 14. August, just im höchsten Hungerstadium, ward mir ein kleiner Junge geboren, ein liebenswürdiges, reizendes Kind ... Würmchen heißt George Emile.“ Das Wimmern des hungrigen Säuglings brachte ihn dazu, sich als Mitarbeiter am Feuilleton und/oder dem Englischen Artikel der „Neuen Preußischen“ genannt „Adler-Zeitung“ zu bewerben. Dank Fürsprache renommierter Tunnel-Freunde erhielt er die Stellung und 30 Taler Gehalt im Monat. Er empfand diesen Schritt als Kapitulation. Am 1. November, dem Tag seines Eintritts, schrieb er an Lepel: „Ich habe mich heut der Reaction für monatlich 30 Silberlinge verkauft und bin ... angestellter Scriblifax (in Versen und Prosa) bei der ... ‚Adler-Zeitung’. Man kann nun mal als anständiger Mensch nicht durchkommen ...“ Noch grimmiger klang es wenige Tage darauf: „Ich kann Dir auf Wort versichern, dass ich dieser 30 Rth. nicht froh werde und ein Gefühl im Leibe habe, als hätt’ ich gestohlen ... Es ist das Sechserbrot, das der Hungrige aus dem Scharren nimmt - aber es ist immer gestohlen. Wie ich’s drehn und deuteln mag - es ist und bleibt Lüge, Verrath, Gemeinheit ...“
Lepel begriff, dass der unglückliche Freund Abstand brauchte, Abstand von der Politik, um zu sich selbst zu finden. Es ergab sich die Möglichkeit, im Sommer 1852 als Korrespondent der „Adler-Zeitung“ nach London zu gehen. Mit geliehener Barschaft, ein armer Schlucker, gelang es ihm weder als Journalist noch als Apotheker, in der fremden Stadt Fuß zu fassen. Doch eine innere Stimme sagte ihm: Hier findest du, was du suchst ... In seinem Tagebuch steht: „Rätselhafterweise ein wahres Heimatgefühl gehabt; mir wurde die Brust weit, und das Herz schlug mir höher, als mein Cab über die schöne Waterloobrücke hinweg in das vollste Leben der Stadt zwischen City und Westend hinabrollte. Ich vergaß für einen Augenblick alles andre: Frau, Kind, Not, Sorge - der alte Zauber dieser Londongröße ward wieder lebendig und hatte mich.“
Für die „Adler-Zeitung“ schrieb er zahlreiche Feuilletons in Briefform, und diese bildeten den Grundstock für sein erstes Buch in Prosa: „Ein Sommer in London“. Fünf Monate Englandaufenthalt brachten ihm Erkenntnisse und Erfahrungen, die er in keiner anderen Großstadt hätte gewinnen können, aber er sah auch Preußen nicht mehr so durchweg negativ wie zuvor. Nur in seiner beruflichen Existenz war er keinen Schritt weitergekommen.
„Ich bin nicht sehr traurig darüber, dass es mit England nichts wurde; ich würde mich dort bei aller Bewunderung, die ich dem Ganzen zolle, nie heimisch gefühlt haben, denn der einzelne, auf den man dort zumeist angewiesen ist und in dem einzig und allein der dauernde Reiz des Lebens liegt, lässt dort viel zu wünschen übrig“ (an Friedrich Witte, 18. 10. 1852).
Das tief gefühlte Bedürfnis nach Gedankenaustausch, Geselligkeit, Kritik und Ermutigung im Freundeskreis führte zur Gründung des „Rütli“, der sich aus Mitgliedern des „Tunnel“ zusammensetzte, die einander besonders schätzten. Zu ihnen stieß im Dezember 1852 auch Theodor Storm.
Der geistige und Herzens-Beistand einzelner Rütlionen sollte Fontane über die folgenden schweren Jahre hinwegbringen. Zusammen gaben sie das belletristische Jahrbuch „Argo“ heraus. Fontane steuerte die Erzählungen „Tuch und Locke“, „James Monmouth“ und „Goldene Hochzeit“ bei, Adolph Menzel zeichnete das Titelblatt.
Der Sommer 1853 wurde überschattet von einer gefährlichen, verschleppten Lungenentzündung, damit verbunden Schwächezustände und Todesahnungen. Er versuchte sie zu bekämpfen, indem er verbissen an dem großen Aufsatz „Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848“ weiterarbeitete. Er definierte darin die Rolle des Realismus in der Kunst. Der Aufsatz erschien anonym in Karl Biedermanns „Deutschen Annalen“ und brachte ihm dennoch allerlei Ungelegenheiten ein.
Im Juli 1854 kam „Ein Sommer in London“ bei den Gebrüdern Katz in Dessau heraus. Das tägliche Brot war zwar durch seine Anstellung als Revisionsredakteur an der „Adler-Zeitung“ gesichert, allein es war ein karges Brot, das er lediglich durch einige neue Balladen aufbessern konnte, darunter „Archibald Douglas“, die später in keinem Schullesebuch fehlen sollte.
Insgesamt waren die vier Jahre in der Luisenstraße 35 leidvoll und ohne jede „fortune“. Frau Emilie schenkte drei Kindern das Leben (Rudolf am 2. 9. 1852, Peter Paul im Oktober 1853 und Ulrich am 29. 5. 1855), alle drei starben, noch ehe sie recht zu leben angefangen. Im August 1855 wurde Fontane erneut nach London geschickt, diesmal, um eine deutsch-englische Korrespondenz aufzubauen und zu leiten; eine Aufgabe, für die drei Männer nötig gewesen wären. Neben der politischen „Kärrner-Arbeit“ schrieb er Berichte über Theater und Galerien, Feuilletons über Land und Leute. Heimwehkrank holte er im Januar 1856 seine Frau mit dem kleinen George nach London. Doch an ein gedeihliches Zusammensein war bei dem überhasteten, nervösmachenden 18-Stunden-Arbeitstag nicht zu denken. Enttäuscht kehrte Emilie nach Berlin zurück, musste, weil sie die alte Wohnung aufgegeben hatte, eine neue suchen. Bellevuestraße 16. In der Nähe wohnten die hilfsbereiten Merckels. Hier wurde - im November 1856 - Theodor junior geboren. Im April 1857 konnte sie endlich mit beiden Kindern wieder nach London reisen. Diesmal unter günstigeren Voraussetzungen.
Die Jahre in England waren, was das politische Leben betraf, eine Hohe Schule, literarisch aber unergiebig. In langen, immer sehnsuchtsvolleren Briefen an seine Berliner Freunde, allen voran Merckels, beklagte er sein „kühles Amphibien-Dasein“, in dem er seine Muse zwangsläufig zur Dienstmagd herabwürdigen müsse.
In Berlin indessen geschahen entscheidende Dinge: Im Oktober 1858 übernahm Prinz Wilhelm die Regentschaft für seinen älteren Bruder, der an schweren Durchblutungsstörungen der Hirnschlagadern litt. Machtkämpfe tobten zwischen der Lobby des bedeutungslos gewordenen Königs und der Partei des neuen Herrn.
Fontane - aus London zurückgekehrt - fand als Outsider in dieser Umbruchsituation keinen Platz. Hauste eine Weile im „Hotel de Pologne“, Dessauerstraße 38 („eine höhere Räuberhöhle“!), dann in einem möblierten Zimmer, Dessauerstraße 31. Inzwischen löste Frau Emilie in London den Haushalt auf. Mit Verlust natürlich. Nachdem alle Bemühungen Fontanes, in Berlin oder in München Arbeit zu finden, fehlgeschlagen waren, mietete die Familie im April 1859 eine Sommerwohnung in der Potsdamer Straße 33. Ihr einziger Vorteil: Sie kostete nur 45 Taler im Quartal. Lose Verbindung zur Stadt durch einen Pferdeomnibus und „ächte Berliner Gartenluft: Blumen vorne und Müllkute hinten!“ (an Wolfsohn, 26. 5. 1859).
Hier vollendete Fontane seine „Londoner Skizzen“, - die Studien über englisches Theater, englische Kunst und englische Presse - und „Jenseit des Tweed“, Reisebriefe aus Schottland, das er mit Lepel bereist hatte. Angesichts von Loch Leven Castle war ihm die Erinnerung an Schloss Rheinsberg aufgestiegen, und dieses Bild gab die Initialzündung zu den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“.
Im Juli 1859 brach er nun zu seiner ersten Tour ins Rupppinsche auf, wenig später in den Spreewald. Die „Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung“ druckte die Beschreibungen dieser Ausflüge unter dem Titel „Märkische Bilder“. Es war der erste Schritt auf dem mühevollen Weg zu späteren Erfolgen.
Die Wohnung Tempelhoferstraße 51, die Fontanes im Herbst 1859 bezogen, war feucht und roch nach „Dunst und Schimmel“, was den Kindern nicht gut bekam. Frau Emilie war „etwas matt und angegriffen“, außerdem befand sie sich wieder in anderen Umständen. Der Hausbesitzer, Holzhändler Degebrodt, sah die wirtschaftlich prekäre Lage der Familie mit scheelen Blicken und setzte sich dementsprechend aufs hohe Ross. Zum 1. 6. 1860 war Fontane die Redaktion des Englischen Artikels bei der „Kreuz-Zeitung“ versprochen worden, bis dahin musste er sich irgendwie über Wasser halten. Er arbeitete an dem biografischen Lexikon „Männer der Zeit“ mit, hielt in Arnims Hotel Unter den Linden zehn Vorträge über England und Schottland, setzte seine „Wanderungen“ fort, die zum Teil als „Bilder und Geschichten aus der Mark Brandenburg“ im cottaschen „Morgenblatt“ erschienen.
Es war eine vertrackte Zeit: „George hatte die Röteln, Theochen hat das Scharlachfieber ... und meine Frau erwartet jede Stunde ihre Niederkunft.
Da heißt es denn: Ohren steif!“ (an Paul Heyse, 13. 3. 1860). Am 21. März wurde Martha geboren, endlich ein Mädchen, das zeit ihres Lebens Lieblings- und Sorgenkind bleiben sollte. Vorerst brachte sie Glück: Im Juni erschienen die schottischen Reisefeuilletons „Jenseit des Tweed“ bei Julius Springer in Berlin, im Herbst folgten die „Londoner Skizzen“ bei Ebner und Seubert in Stuttgart sowie eine Sammlung „Balladen“ bei Wilhelm Hertz in Berlin. Hinzu kam das schmale, doch regelmäßige Gehalt der „Kreuz-Zeitung“. Frau Emilie atmete auf, mussten sie doch endlich nicht mehr von der Hand in den Mund leben.
Die redaktionelle Arbeit ließ ihm wenig Spielraum für das „Eigentliche“, die „Wanderungen“. Er benutzte dafür die Wochenenden und teilte den Jahresurlaub in viermal eine Woche, um nach und nach die Grafschaft Ruppin, das Oderland, Barnim und Lebus und - Jahre später - das Land an Havel und Spree zu bereisen.
Fast generalstabsmäßig bereitete er diese Ausflüge vor: Eisenbahn- und Postkutschenanschlüsse gehörten dazu, Übernachtungsmöglichkeiten, auch Empfehlungsbriefe für Adelshäuser, ohne die er als „unbekannter Scriblifax“ sonst kaum Eingang gefunden hätte. Mathilde von Rohr, in deren kleinen literarischen Zirkel - Behrenstraße 70 - ihn Lepel eingeführt hatte, erwies sich hier wie in allen Lebenslagen als zuverlässige mütterliche Freundin, denn sie kannte Gott und die Welt und besaß bei allen unbestrittene Autorität.
Die märkischen Reisebilder fanden bei einem breiten Publikum lebhaften Anklang, und so erbot sich Wilhelm Hertz, der im Winter 1860/61 Fontanes Balladen herausgebracht hatte, auch die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ zu drucken. Die erste Ausgabe erschien zu Weihnachten 1861. Das preußische Kultusministerium erklärte sich nun bereit, dem Autor einen jährlichen Reisekostenzuschuss von 300 Talern zu zahlen.
Bei seinen Wanderungen durchs Oderland, das ihm zum Teil von Aufenthalten in der väterlichen Apotheke zu Letschin bekannt war, fand Fontane Orte, Landschaften und Biografien, die er in seinen gedanklich bereits konzipierten Roman „Lewin von Vitzewitz“ einbringen wollte. Auch Hertz zeigte für diesen Roman Interesse. Doch sollte er erst sechzehn Jahre später mit dem Titel „Vor dem Sturm“ erscheinen. Zu viele, nicht vorhersehbare Schwierigkeiten hatten sich dazwischengeschoben.
Erste unliebsame Überraschung: die Kündigung des Hauswirts. Frau Emilie war außer sich, Fontane beschwichtigte sie, die -Commodite“ sei sowieso unter aller Würde und die Vorderzimmer zu kalt gewesen. Nach einigem Suchen zogen sie in die Alte Jakobstraße 171 III. Das Wirtschaftsbuch weist 10 Taler 5 Silbergroschen Umzugskosten auf und 62 Taler 15 Sgr. an Miete für das erste Quartal. Das klingt günstig, doch Fontanes waren Trockenwohner, wie seinerzeit Onkel August und Tante Pinchen. Im Jahr darauf wurden wieder 10 Taler Umzugskosten fällig. Sie zogen in die Hirschelstraße 14 I, wo sie neun Jahre blieben. Hier erblickte am 5. Februar 1864 Friedrich Fontane, genannt Friedel, das Licht der Welt, der später einmal das Werk des Vaters sammeln und edieren sollte.
Das Haus Nummer 14, eines der ersten im sogenannten Geheimratsviertel, erhielt 1866, als die Hirschelstraße in Königgrätzer Straße umgetauft wurde, die Nummer 25. Als Fontanes hier einzogen, stand die Berliner Stadtmauer noch, und eine Verbindungsbahn hielt den Gütertransport zu den außerhalb der Stadt liegenden Bahnhöfen aufrecht. Auch alle Truppentransporte kamen hier vorüber: 1864 nach Schleswig-Holstein, 1866 auf den böhmischen Kriegsschauplatz. Mit diesem Bild vor Augen begann Fontane mit der Niederschrift seines ersten Romans: „Ich schrieb abends und nachts die ersten Kapitel ... während die österreichischen Brigaden unter meinem Fenster vorüberfuhren; und wenn zuletzt die Geschütze kamen, zitterte das ganze Haus, und ich lief ans Fenster und sah auf das wunderbare Bild: die Lowries, die Kanonen, die Leute hingestreckt auf die Lafetten, und alles von einem trüben Gaslicht überflutet ...“ (an Ernst Gründler, 11. 2. 1896).
Fontane selbst brach von hier aus - im Auftrage der „Kreuz-Zeitung“ - als Kriegsberichterstatter auf, kam bis zu den Düppeler Schanzen, erhielt dafür sogar eine Militär-Medaille; kehrte nach Beendigung der Feindseligkeiten im Herbst 1864 noch einmal dorthin zurück, besuchte Lübeck und Kopenhagen, Fredericksborg, Wisborg, Alsen und Düppel, auf dem Heimweg auch Husum, die graue Stadt am Meer, wo er die alte, wegen der unterschiedlichen Charaktere immer etwas schwierige Freundschaft mit Theodor Storm erneuerte.
Der Inhaber der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchhandlung von Decker trug Fontane an, ein Buch über den Schleswig-Holsteinischen Krieg zu verfassen, Ludwig Burger sollte es illustrieren. Fontane hoffte bei einem solchen Auftraggeber auf gutes Honorar und sagte zu. Das geliebte Roman-Manuskript musste zurückstehen zugunsten einer reinen Fleißarbeit, darin doch immer wieder feuilletonistische Karfunkelsteine aufblitzten, seien es Impressionen auf dem Marsch oder menschlich-allzu-menschliche Haltungen innerhalb eines dramatischen Gefechtes ... Der erhoffte finanzielle Erfolg stellte sich nicht ein. Das Honorar reichte gerade für eine dreiwöchige Reise zu zweit an den Rhein und in die Schweiz. Jahre später sollte die Mühe sich doch auszahlen, als er die Handlung seines Romans „Unwiederbringlich“ in die ihm nun bekannte Gegend nach Schleswig-Holstein und Dänemark verlegte. Das erste Halbjahr 1866 war trotz wochenlanger nervös-gastrischer Störungen und der üblichen Redaktionsarbeit ganz und gar Lewin von Vitzewitz gewidmet. Im Mai/Juni mietete er sich in Thale ein und kam wahrhaftig gut mit seinem Stoff voran.
Da trat der Kampf Preußens gegen Österreich um die Vorherrschaft in Europa in seine heiße Phase, und Fontane musste nun die böhmischen Kriegsschauplätze aufsuchen; denn natürlich wollte Decker ein neues Buch von ihm, und „Der Deutsche Krieg von 1866“ war ja auch genau genommen die Fortsetzung des voraufgegangenen. So landete Lewin von Vitzewitz wieder in der Schublade, weil das Kriegsbuch Fontane bis Frühjahr 1869 voll in Anspruch nahm. Es wurden immerhin zwei großformatige Bände mit zusammen 1100 Seiten.
1869 wanderte er - wieder neben der Redaktionsarbeit - durchs Havelland: Gütergotz und die Nutheburgen, Trebbin, Werder, Geltow und Schwielowsee, Fahrland, Bornstedt und Marquardt. Er las sich ein in die Zeit Friedrich Wilhelms II., der Lichtenau und des Geheimen Rosenkreuzer-Ordens, besuchte Paretz mit seinen Erinnerungen an Friedrich Wilhelm III. und die Königin Luise, war also zeitlich seinem Roman-Manuskript schon ganz nahe. Im Juni, so vertröstete er seinen Verleger, würde er mit dem Havelland abschließen und sich dann dem Roman zuwenden.
Aber es kam wieder einmal ganz anders.
Im April war Frau Emilie mit der zehnjährigen Martha nach London gefahren, wo das Kind bei Freunden ein Jahr lang englische Sprache und Sitte lernen sollte. „Da wir unsren Kindern sonst nichts hinterlassen können, so wollen wir wenigstens versuchen, ihnen eine innerliche Ausrüstung mit auf den Weg zu geben, die es ihnen möglich macht vorwärts zu kommen. Und dazu gehört beispielsweise Sprachkenntnis“ (an Mathilde von Rohr, 15. 4. 1870).
Fontane, der alle schwerwiegenden Entscheidungen meist in Abwesenheit seiner Frau traf, nahm einen belanglosen Streit mit dem Chefredakteur zum Anlass, um seine Stellung bei der „Kreuz-Zeitung“ zu kündigen. Gewiss schuldete er ihr manches: sicheres, wenn auch keineswegs üppiges Einkommen und durch den „cercle intime“ im Hause des Chefs die Bekanntschaften mit interessanten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Politik. Aber er empfand von Jahr zu Jahr belastender, dass er kostbare Lebenszeit in der Redaktion versaß. Immerhin hatte er die Fünfzig bereits überschritten. Wenn er seinen Roman (und einige Novellenstoffe, die ihm im Kopfe spukten) schreiben wollte, musste er sich von der Kreuz-Zeitungs-Fessel befreien. Er versuchte, es seiner Frau in einem Brief nach London klarzumachen: „Man hat nur den Wert eines Maschinenrades, das man mit Öl schmiert, solange das Ding überhaupt noch zu brauchen ist, und als altes Eisen in die Rumpelkammer wirft, wenn die Radzähne ... abgebrochen sind.“ Frau Emilie war entsetzt und sah den Ruin schon vor sich. Als sie jedoch, heimgekehrt, einen wie ausgewechselten, schaffensfrohen Mann vorfand, der überdies gerade einen Vertrag als Theaterkritiker bei der „Vossischen Zeitung“ unterschrieben hatte, beruhigte sie sich. Frohgemut fuhren beide nach Warnemünde in die Sommerfrische. Da brach der Krieg gegen Frankreich aus. Und Fontane, der eigentlich im stillen Dobbertin als Gast der Stiftsdame Mathilde von Rohr an seinem Roman weiterschreiben wollte, kam gerade noch dazu, am 17. August im Königlichen Schauspielhaus als Kritiker zu debütieren (man gab „Wilhelm Tell“), dann fuhr er schnurstracks im Auftrage Deckers nach Frankreich, bis dicht hinter die Hauptkampflinie. Fühlte sich wohl immer noch als „Wanderer“, jedenfalls machte er arglos einen Abstecher nach Domremy, um das Geburtshaus der Jeanne d’Arc zu besichtigen, jener Heldenjungfrau, für die er schon als Kind geschwärmt hatte. Franktireurs nahmen ihn gefangen, und unter Spionageverdacht wurde er auf die Festung Besangon und weiter bis auf die Isle d’Oleron geschleppt. In Berlin setzten sich indessen hochgestellte Persönlichkeiten für ihn ein: Sogar Bismarck verwendete sich für den Verfasser der „Wanderungen“, „preußischen Untertan und wohlbekannten Geschichtsschreiber“.
So kam Fontane kurz vor Weihnachten 1870 wohlbehalten nach Berlin zurück, und die „Vossische Zeitung“ druckte unverzüglich seinen noch im Kerker verfassten Erlebnisbericht „Kriegsgefangen“ in Fortsetzungen ab. Selbstironisch ernannte er sich zum „nine-days-wonder“. Viele Leser, die Angehörige in Gefangenschaft wussten, lasen erleichtert, dass „der Feind auch ein Mensch war“. Fontane beschrieb die Franzosen zwar als lebhaft patriotisch, manchmal eitel und ruhmredig, aber auch sanguinisch, rücksichtsvoll und nie beleidigt. „Auch ihr Bildungsstand ... hatte mindestens, bei sonst gleichen Voraussetzungen, das Niveau des Unsrigen, wie ich denn überhaupt glaube, dass wir uns nach dieser Seite hin allzu selbstgefälligen Vorstellungen hingeben.“ - Kommentar eines preußischen Generalstabsoffiziers: „Bei uns wären Sie in dieser Situation an die nächste Wand gestellt worden!“
Im April 1871 brach er abermals nach Frankreich auf. Es war die Zeit der Pariser Commune. Bei der Mühle von Sannois, nahe Paris, wurde er Augenzeuge, „wie die dreifarbige und die rote Republik miteinander rangen“. Dieser Reisebericht „Aus den Tagen der Okkupation. Eine Osterreise durch Nordfrankreich und Elsass-Lothringen 1871“, den er in einem Zuge niederschrieb, fügte sich ebenbürtig an seine „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ an, nur waren es Wanderungen unter besonderem Vorzeichen.
Seine noble, verständnisvolle Haltung allen Menschen gegenüber, denen er begegnete, bewirkte, dass „Kriegsgefangen“ 1892 von Theodore de Wyzewa ins Französische übersetzt und Germanistikstudenten an französischen Universitäten als „edles Stück deutscher Prosa und Gesinnung“ vorgestellt wurde.
In unendlicher Fleißarbeit bewältigte Fontane das von Decker geforderte Manuskript „Der Krieg gegen Frankreich 1870/71“. Insgesamt vier Bände! Es war Broterwerb, nicht Herzenssache. Und er sollte offiziell keinen Dank ernten. Er beklagte sich nicht darüber, nur einmal, in einem Brief an Mathilde von Rohr (30. 11. 1876), brach es aus ihm heraus: „Zwölf Jahre habe ich an diesen Kriegsbüchern Tag und Nacht gearbeitet; sie feiern, nicht in großen aber in empfundenen Worten unser Volk, unser Heer, unsren König und Kaiser; ich bereiste 1864 das gegen uns fanatisierte Dänemark, war 1866 in dem von Banden und Cholera überzogenen Böhmen und entging in Frankreich, nur wie durch ein Wunder, dem Tode. Unabgeschreckt, weil meine Arbeit das Wagnis erheischte, kehrte ich an die bedrohlichen Punkte zurück. Dann begann meine Arbeit. Da steht sie, wenn auch weiter nichts als das Produkt großen Fleißes, ihrem Gegenstande nach aber das Einzige repräsentirend, dem gegenüber man eine Art Recht hat, das Interesse des Kaisers, als des persönlichen Mittelpunkts, des Helden dieser großen Epopöe (ich spreche nur vom Stoff), zu erwarten. Und ebendieser Held und Kaiser, gefragt, ‚ob er einen Grund habe, dem Verfasser dieses umfangreichen Werkes wohlzuwollen oder gnädig zu sein’, verneint diese Frage.“ Der Brief schließt mit dem tapfer resignierenden Lieblingssatz Fontanes, den Yorck 1814 in der Schlacht bei Laon getan hatte, als nichts so lief, wie es sollte: „Eh bien, es muss auch so gehn!“
Aber gerade zu jenem Zeitpunkt, November 1876, hatte Fontane Aufmunterung, und sei es auch nur moralische, unbedingt nötig: Er hatte auf die dringende Bitte seiner Frau den Posten eines Sekretärs der Akademie der Künste angenommen, um seine Altersversorgung zu sichern, aber es ging nicht. Er war nicht geschaffen für einen Beamten, schon gar nicht in dieser Institution, die Langeweile mit Feierlichkeit verkleidete. „Immer die unsinnige Vorstellung, dass das Mitwirthschaften an der großen, langweiligen ... total confusen Maschinerie, die sich Staat nennt, eine ungeheure Ehre sei. Das ‚FrühIingslied’ von Uhland oder eine Strophe von Paul Gerhardt ist mehr werth als 3000 Ministerialreskripte ... Ich passe nicht für dergleichen“ (an Mathilde von Rohr, 30. 11. 1876).
Bei der Nachricht seiner Kündigung erlitt Frau Emilie einen Nervenzusammenbruch: Wie konnte ihr Mann so egoistisch handeln, er musste doch bedenken, dass sie beide nicht gesund waren und noch zwei Kinder in der Ausbildung hatten! Sein Satz, „Mir ist die Freiheit Nachtigall, den andern Leuten das Gehalt“, brachte sie aus der Fassung. Keine Krise in den 26 Ehejahren war so tiefgreifend wie diese.
Und doch sollte, was wie Leichtsinn oder Tollkühnheit aussah, die einzig richtige Entscheidung sein. Die endlich freigesetzte Quelle seiner schöpferischen Kräfte begann zu sprudeln. Nach zwei arbeitsreichen, wenn auch finanziell bescheidenen Jahren erschien - 1878 - sein „Schmerzenskind“, der Roman „Vor dem Sturm“. Ihm folgten nun in jedem Jahr ein neues Buch: 1880 „Grete Minde“, 1881 „Ellernclip“, März 1882 „L’Adultera“, der erste Berliner Roman, und „Spreeland“ als vierter Band der „Wanderungen“, November 1882 „Schach von Wuthenow. Eine Erzählung aus der Zeit des Regiments Gensdarmes“, 1884 „Graf Petöfi“, 1885 die Kriminalerzählung „Unterm Birnbaum“, 1887 „Cecile“, 1888 „Irrungen, Wirrungen“, 1889 „Fünf Schlösser“, ein Nachtrag zu den „Wanderungen“, 1890 „Quitt“ und „Stine“, 1891 „Unwiederbringlich“, 1892 „Frau Jenny Treibel“, 1894 „Meine Kinderjahre“, 1895 „Effi Briest“, 1896 „Die Poggenpuhls“, 1898 der zweite Teil seiner Memoiren „Von Zwanzig bis Dreißig“ und „Der Stechlin“.
In den „Wanderungen“ hatte Fontane die Mark Brandenburg wie mit einer Wünschelrute berührt und die Gestalten der Vergangenheit auferstehen lassen, es gelang ihm, „die märkische Lokalität wie die Prinzessin im Märchen zu erlösen“ und zu neuem Leben zu erwecken. Und die Berliner, die aufgrund der ausgebauten Bahnverbindungen mobiler geworden waren und hinausfuhren und, auf Fontanes Spuren wandernd, das Gelesene nachvollziehen konnten, dankten es dem Autor. Fontane war nun „der märkische Wanderer“ schlechthin. Das freute ihn zunächst. Doch später erwies sich dieses Prädikat als hinderlich. Selbst die professionelle Kritik - bis auf wenige Ausnahmen - maß seine Berliner Romane immer wieder mit der Elle der „Wanderungen“ und setzte sie damit in ein schiefes Licht.
In einem großen, würdigenden Aufsatz zum Tode Willibald Alexis’ (am 16. 12. 1871) heißt es: „Die Fremde ... lehrt uns nicht bloß sehen, sie gibt uns auch das Maß für die Dinge ... Sie leiht uns die Fähigkeit, Groß und Klein zu unterscheiden, und sie bewahrt uns vor jenem ebenso ridikülen wie anstößigen Lokalpatriotismus, der den Sieg der Müggelberge über das Finsteraarhorn proklamiert.“ Die Londoner Erfahrungen bewahrten ihn davor, die Gründerjahre in Preußen als Apotheose des Sieges und des Fortschritts anzusehen. „Weder das ‚ewige Gesiege’, noch die 5 Milliarden (Goldfrancs, die Frankreich an Deutschland zahlen musste) haben unsre Situation gebessert“, schrieb Fontane am 10. 8. 1875 aus Mailand an seine Frau. „Nicht nur, dass man Schritt um Schritt empfindet, wie sehr uns diese alten und reichen Kulturlande voraus sind, nein, man taxiert uns auch in diesem Sinne ... das was wirkliche Superiorität schafft, fehlt uns ... nach wie vor.“
Er selbst hatte die Kehrseite der „großen Gründerzeit“ am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Das Haus Hirschelstraße 14, in dem er neun Jahre wohnte, gehörte dem Glindower Ziegeleibesitzer Fritze; dieser verkaufte, als ihm die Grundstückspreise hoch genug erschienen, an einen Bankier, der ab dem 1. 10. 1872 das Dreifache an Miete forderte. Frau Emilie barmte, nun werde man wieder 3 Treppen hoch ziehen und 100 Taler Miete mehr zahlen müssen. Fontane, dem dies ebenso wenig recht war, wiegelte trotzdem ab: Alles in allem sei das Haus doch sehr heruntergekommen, und „der Hof sieht aus, als könne er das ganze Geheimratsviertel mit Typhus versorgen“.
Die Johanniter-Ordens-Ballei Brandenburg, für deren Wochenblatt Fontane öfter schrieb, bot der Familie in ihrem Hause Potsdamer Straße 134c eine erschwingliche Wohnung an. 3 Treppen hoch. Was den Grad der Verwahrlosung betraf, so kamen sie vom Regen in die Traufe. Friedrich Fontane, der jüngste Sohn, schrieb später darüber: „Seit Jahren aufgespeicherter Schmutz starrte den Ankömmlingen entgegen. Aber die schlimmste Hinterlassenschaft barg jener eigentümliche Schlafraum, der, Alkoven genannt, in alten Gebäuden die Verbindung zwischen Vorder- und Hinterstuben darstellt; hier wimmelte es nur so von Ungetier, hier feierte die Bettwanze ungestörte ewige Brautnacht. In allen Fugen und Ritzen war es lebendig ... dazu gesellten sich, namentlich in der Küche ... die biederen Schaben in kaum übersehbarer Heerschar. In diesem fürchterlichen Chaos galt es nun Ordnung zu schaffen ... Es kostete viele Tränen, bis es endlich unter Anwendung radikalster Mittel gelang, die Säuberung zu vollziehen, die Räume wohnlich, behaglich und besuchsfähig herzurichten.“ Kein Geringerer als „Rütlifreund Richard Lucae, inzwischen Direktor der Bauakademie, stand dem Ehepaar Fontane beim Umbau zur Seite. Der Dichter allerdings verzog sich bei dieser Radikalkur ins Rupppinsche, um für die dritte Auflage der „Wanderungen“ nachzurecherchieren.
Die Wohnung kostete nur 70 Reichstaler im Quartal, später 70 Mark im Monat, und sie sollte Fontanes Heimstatt bleiben bis zu seinem Tode. Von hier spazierte er zu jeder Premiere, jedem Gastspiel ins Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, hier erlebte er den ersten Spatenstich für die Berliner Kanalisation, dank der auch Nummer 134 c eines Wasserklosetts teilhaftig wurde; hier rollten seit 1879 die Pferdebahnen nach Schöneberg und seit 1897 die ersten elektrischen Straßenbahnen. Hier entstanden seine Romane und Novellen. Hier stellte - 1885 - der älteste Sohn das Fräulein Robert vor, seine zukünftige Frau. Der künstlerisch veranlagte, aber etwas leichtsinnige George war Lehrer an der Kadettenschule in Berlin-Lichterfelde geworden, heiratete glücklich, erbte von den Schwiegereltern eine Villa - und verstarb anderthalb Jahre später an einer zu spät erkannten Blinddarmentzündung.
Bald nach seinem älteren Bruder verlobte sich auch Theo junior. Er hatte nach dem Jurastudium zielstrebig Karriere gemacht (ganz unfontanisch, wie der Vater bemerkte) und sollte es bis zum Wirklichen Geheimen Kriegsrat bringen.
Im Januar 1898 schließlich verlobte sich in dieser Wohnung, 38-jährig, auch Fontanes Liebling, die nervlich übersensible Martha. Sie hatte den 26 Jahre älteren und verwitweten Architekten Karl Emil Otto Fritsch gewählt, weil er gebildet, gütig und tolerant war - so wie der geliebte Vater.
Schließlich ging auch Friedel, der Jüngste, der in der nahen Lützowstraße 84 seinen Verlag hatte, zuzeiten fast täglich ein und aus. Als „Sohn und Kollege“, denn Friedrich Fontane verlegte unter anderen namhaften Belletristen deutscher Sprache auch die Werke seines Vaters. Am 20. September 1898 brachte er ihm die freudige Nachricht, dass die erste Auflage des „Stechlin“ durch Vorbestellung bereits ausverkauft sei. Es war die letzte Freude, die er dem Vater bereiten konnte. Am selben Abend schloss Fontane die Augen für immer. Tags darauf trug man ihn unter lebhafter Anteilnahme unzähliger Berliner zum Friedhof der Französischen Reformierten Gemeinde in der Liesenstraße, seiner letzten Ruhestätte. 65 Lebensjahre - von denen nur die Apothekenpraktika in Burg, Leipzig, Dresden und die Englandaufenthalte abgerechnet werden müssen - verbrachte Fontane in Berlin. 65 Jahre, in denen sich die alte Residenzstadt entscheidend veränderte. Der Bogen spannte sich von Friedrich Wilhelm III. bis zu Kaiser Wilhelm II. Und was lag alles dazwischen: Vormärz, Revolution und Reaktion, drei Kriege, in denen Preußen seine Vormachtstellung in Deutschland befestigte, Gründerboom und Börsenkrach, Bismarck und Bebel ...
Fontane erfühlte dieses Spannungsfeld mehr, als dass er es erkannte. (Und das erstere war vielleicht das wichtigere.) Über einen großen Freundes- und Bekanntenkreis reichten seine Sensoren in alle Schichten der Gesellschaft. Vornehmlich durch den „Tunnel“ hatte er viele Persönlichkeiten kennengelernt. Zu seinen Freunden zählten Gardeoffiziere und Kunstwissenschaftler, Maler, Architekten und Historiker. Er verkehrte mit Prinzen, Schauspielern, Landjunkern und Landpastoren, mit dem katholischen Freiherrn von Wangenheim, dem evangelischen Hofprediger Windel, aber auch mit jüdischen Intellektuellen wie Julius Rodenberg, Moritz Lazarus und Maximilian Harden; der russisch-jüdische Literat Wilhelm Wolfsohn stand ihm genauso nahe wie die märkische Stiftsdame Mathilde von Rohr, und bis zuletzt hielt er Dr. Beta die Treue, der nach 1848 in London Asyl fand und erst spät, arm und krank, nach Berlin heimkehren durfte. Wenn es um Anregungen oder Milieustudien zu einem Fontane vorschwebenden Romanstoff ging, war ihm Graupen-Schulze oder der Klempnermeister aus der Königgrätzer Straße genauso wichtig wie der Fürst Eulenburg.
„Die Schriftstellerei hat etwas Kritisches, etwas in gutem Sinne Freigeistiges, und wem es obliegt, die Welt darzustellen, der muss darüber stehen, wenn er diese Welt darstellen will. Wer einen auf den Hochstelzen des Bürokratismus umherstolzierenden Geheimrat, einen Minister, einen Gymnasialdirektor alten Stils, einen Landbaron, einen Kürassierrittmeister in all ihren Eigentümlichkeiten, in ihren guten und schlechten Seiten, in aller Wahrheit und Lebendigkeit darzustellen versteht, der kann dies nur, nachdem er sie sich zuvor zu eigen gemacht, d. h. sie geistig sich unterworfen hat, und wer diese Herrschaft geübt und mit den Lebensformen gespielt hat, der verlernt es, diesen Lebensformen einen hohen Wert beizulegen ...“ So schrieb Fontane in seinem Aufsatz über „Die gesellschaftliche Stellung des Schriftstellers“, der am 26. 12. 1891 in der Berliner Wochenschrift „Das Magazin für Litteratur“ erschien. Er enthielt den unmissverständlichen Vorwurf an die herrschenden Kreise, die den (realistischen) Schriftsteller in eine Aschenbrödelrolle drängten oder ihn zum Tintensklaven deformierten. „Die für ‚Freiheit’ arbeiten, stehen in Unfreiheit und sind oft trauriger dran als der mittelalterliche Hörige.“
Da Fontane selbst genügend schlechte Erfahrungen gesammelt hatte, ließ er diesen Aufsatz ohne Namensnennung drucken. Er endete mit der Aufforderung an die Schriftsteller, angesichts der versagten gesellschaftlichen Anerkennung wenigstens größere Achtung vor sich selbst zu haben.
Achtung haben vor sich selbst, das ist ein zentraler Punkt in fast allen seinen Werken; handeln, nicht weil es der Sittenkodex vorschreibt, sondern weil man es sich selber schuldig ist; Mut zu haben, sich zu seinem Glücksanspruch zu bekennen, darum dreht sich schließlich alles. Darauf führte er auch alle Skandalgeschichten zurück, die man ihm berichtet hatte. „Schach von Wuthenow“ zum Beispiel, „L’Adultera“ oder „Effi Briest“ basieren auf tatsächlich geschehenen Gesellschaftsskandalen. Einige der Betroffenen lebten noch, als Fontane an den Romanen schrieb. Es kam ihm keineswegs darauf an, Moral zu predigen, im Gegenteil, er gab zu verstehen, dass das eigentlich Skandalöse in den Verhältnissen begründet lag, die solche Schicksale provozierten.
In „L’Adultera“ versucht Melanie van der Straaten ihrem selbstgerechten, zynischen Erfolgs-Mann klarzumachen, warum sie ihn verlassen wird, nämlich um sich auf die Seite derer zu schlagen, die „Menschliches menschlich“ ansehen. „Auf die hoff ich, die brauch’ ich. Und vor allem brauch ich mich selbst. Ich will wieder in Frieden mit mir selber leben, und wenn nicht in Frieden, so doch wenigstens ohne Zwiespalt und zweierlei Gesicht“ (Kapitel 16).
Melanie war die erste, weit über Ibsens „Nora“ hinausreichende emanzipierte Frau in der deutschen Literatur, die ungeachtet der Ächtung durch „die Gesellschaft“ ein ihr angemessenes Leben gestaltet. „L’Adultera“ brachte Fontane - wie er am 27. 4. 1894 an Viktor Widmann schrieb - „viel Anerkennung, aber auch viel Ärger und Angriffe ein“.
Oft vergingen vom Hören einer Geschichte bis zur Niederschrift mehrere Jahre. So im Fall des Schach von Wuthenow, den er durch Mathilde von Rohr erfahren hatte. Erst im Januar 1882, als ihm durch Vorverlegung der Tat die historische Symbolkraft deutlich vor Augen trat, bot er den Stoff Julius großer an: „‚Schach von Wuthenow’ spielt in der Zeit von 1805 auf 6 und schildert den schönsten Offizier der damaligen Berliner Garnison, der, in einem Anfalle von Übermut und Laune, die liebenswürdigste, aber hässlichste junge Dame der damaligen Hofgesellschaft becourt. So, dass der Skandal offenbar wird. Alles tritt auf die Seite der Dame, sodass sich v. Schach anscheinend freudig zur Hochzeit entschließt ... Die Kameradschaft vom Regiment Gensdarmes aber lacht und zeichnet Karikaturen, und weil er dieses Lachen nicht ertragen kann, erschießt er sich unmittelbar nach dem Hochzeitsmahl ... Alles ein Produkt der Zeit, ihrer Anschauungen, Eitelkeiten und Vorurteile. Übrigens alles Tatsache.“
Schach wurde für Fontane der Vertreter des nachfriderizianischen Offizierskorps, das auf den Lorbeeren des großen Königs eingeschlafen war und das „statt Ehre nur noch den Dünkel und statt der Seele nur noch ein Uhrwerk hatte, ein Uhrwerk, das bald genug abgelaufen sein wird“.
Die Niederlage bei Jena und Auerstedt war vorgezeichnet. Schach erschießt sich, damit seine Ehre oder das, was er dafür hält, gewahrt bleibt. Das Schicksal Victoires bleibt außerhalb seiner Überlegungen.
Alle Vertreter einer absterbenden Gesellschaftsschicht opfern bei Fontane diesem „Gesellschaftgötzen“. Pierre von St. Arnaud, ein alternder Jeu-Oberst, beobachtet gelassen die sich anbahnende Beziehung zwischen Cecile und dem welterfahrenen Gordon, aber als er meint, dieser habe die Etikette verletzt, fordert er ihn zum Duell. Er tötet ihn, nicht aus Liebe zu Cecile, sondern aus überzogenem Stolz.
Oder: Graf Haldern, ein Lebemann und Schwerenöter, findet zwar nichts dabei, sich bei der hübschen Witwe Pittelkow zu vergnügen, doch als sich sein Neffe ernsthaft in Stine verliebt, zieht der Alte sofort die Ehren-Bremse.
Oder: Baron von Innstetten verstößt Effi; obwohl er sie noch immer liebt und obwohl ihr Flirt mit dem lebenslustigen Crampas längst verjährt ist, erschießt er den Unglücklichen im Duell. Nicht aus Rache, sondern „weil es sein muss“. In dem Dialog zwischen Innstetten und seinem Standesgenossen von Wüllersdorf - nach Heinrich Mann „die größte Sprechszene des deutschen Romans im 19. Jahrhundert“ - heißt es: „Das mit dem ‚Gottesgericht‘ wie manche hochtrabend versichern, ist freilich Unsinn, nichts davon, umgekehrt unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst, aber wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt“ („Effi Briest“, Kapitel 27).
„Müssen wir das wirklich?“, fragt Fontane zwischen den Zeilen. Diese Frage überhaupt zu stellen, fanden etliche Tugendwächter schon anstößig. Als 1887 „Irrungen, Wirrungen“, eine aquarellistische Sommerliebe zwischen der träumerisch-sinnlichen Näherin Lene und ihrem Gardeoffizier, als Vorabdruck in der „Vossischen Zeitung“ erschien, bombardierten sie den Chefredakteur mit der Forderung, „endlich mit dieser grässlichen Hurengeschichte aufzuhören“. Was war daran so verwerflich? Jeder wusste um die typisch berlinischen „Herzensbünde auf Zeit“. Ungezählte brave Mädchen gingen darauf ein, weil sie sich danach sehnten, einmal aus Fabriksälen und Dienstbotenkammern herauszukommen, zum Stralauer Fischzug vielleicht, und einen feschen Kavalier zu haben, der sie ausführt und ein Essen spendiert. Nicht dass Fontane darüber schrieb, nahmen sie ihm übel, sondern dass er sich nicht darüber empörte, es im Gegenteil als etwas Natürliches schilderte.
Am 16. 7. 1887 schrieb der Autor an den Chefredakteur Friedrich Stephany: „So bin ich zum Schilderer der Demimondeschaft geworden.- Er konstatierte es halb belustigt, halb grimmig.
Wie ernst die Fronde der Tugendphilister zu nehmen war, sollte er im Jahr darauf erfahren, als er „Stine“ anbot. Zwei Jahre lang lag sie bei verschiedenen Verlegern und Chefredakteuren in den Schubladen, niemand wollte sie haben. Stine, die allzu Brave, kennt die Welt der Invaliden- und Chausseestraße, „wo Borsig und Schwartzkoppen seine Arbeiter täglich vorbeikommen, eigentlich nur aus dem verkleinernden und verhübschenden Spiegel am Fenster. Hier sitzt sie Tag für Tag und arbeitet für ein Woll- und Strickereiwarengeschäft. In demselben Hause aber hat ihre ältere Schwester, die Witwe Pittelkow, eine Wohnung, die ihr Graf Haldern bezahlt für unkonventionelle Besuche ab und an. Pauline ist die Inkarnation einer unverwüstlichen Berlinerin. Das Leben hat es mit ihr und ihrer Schulfreundin Wanda, Star am Nordend-Theater, nicht eben gut gemeint. So halten sie mit Courage fest, was sich ihnen bietet, und machen das Beste draus. Menschliche Substanz ist auf ihrer Seite eher zu finden als auf der gräflichen. Der Graf preist zwar bei jeder Gelegenheit die Heldentat seines Neffen, der 1870 in der ersten Attacke schwer verwundet wurde und seitdem dahinsiecht, - aber als der weltfremde Jüngling in der unschuldig-sentimentalen Stine den „Glanz der Abendsonne seines Lebens sieht, besteht der Onkel auf dem Haldernschen Ehrenkodex und auf Trennung. Der junge, untaugliche Mann geht freiwillig aus einem verpfuschten Leben. Auch Stine „wird nicht wieder-, erkennen die gefühlsarmen Kleinbürgerinnen der Nachbarschaft. Aber Pauline Pittelkow setzt sich durch, weil sie das Leben nimmt, wie es ist und nicht, wie es sein sollte.
Der Autor fand Stine selbst „nur soso, - aber die Witwe Pittelkow...!- „Ich glaube, sie ist eine mir gelungene und noch nicht da gewesene Figur“ (an Emil Dominik, 3. 1. 1888).
Im April 1890 erschien „Stine“ endlich im Verlag Friedrich Fontane. Als der Dichter die ersten Exemplare an Freunde verschickte, bemerkte er deutlich, was in dem Roman nur zwischen den Zeilen zu lesen war: „Mit dem Adel, hohen und niedren, bin ich fertig; er war zeitlebens ein Gegenstand meiner Liebe ... aber einer unglücklichen Liebe“ (an Georg Friedländer, 29. 5. 1890). Und: „Mir ist immer mehr und mehr klar geworden, dass diese Form in die moderne Welt nicht ganz passt, dass sie verschwinden muss und jedenfalls dass man mit ihr nicht leben kann“ (an Georg Friedländer, 2. 9.1890).
In geistiger Verwandtschaft zu Lene und Stine, Wanda und Pauline steht auch Mathilde Möhring, ein Kind der Gründerzeit. Sie wohnt bei ihrer ewig klagenden Mutter, Witwe eines Buchhalters. Mathilde will raus aus den kleinen Verhältnissen, angelt sich den labilen, willensschwachen Untermieter, verlobt sich mit ihm, hilft ihm, das juristische Examen zu bestehen. Nun steigt er auf der Karriereleiter, stirbt aber früh an der Schwindsucht. Mathilde fällt in den Augen der Wilhelminischen Gesellschaft wieder ins Nichts zurück. Sie erkennt: „Er ... hat mir eine Stellung gegeben. Denn wenn ich es auch gemacht habe, wenn er nicht da war, so ging es nicht.“ Die Gabe des Sich-Einfindens in gegebene Umstände lässt sie einen Ausweg finden: Da sie nun wenigstens finanziell in der Lage ist, wird sie Lehrerin und erlangt so aus eigener Kraft eine geachtete Position.
Leider blieb dieser Roman unvollendet.
Alle diese Frauen besitzen den „Sinn für Tatsächlichkeiten“ (den Fontane auch sich selbst bescheinigte); sie wollten (wie er!) nie mehr als das Maximum des Erreichbaren, jede auf die ihr gemäße Weise. Einen Typus, der in den Berliner Gründerjahren sich eigentlich erst ausformte, hat Fontane mehrfach zu fassen versucht: den Typus des Bourgeois. Zwei Entwürfe - „Kögels Hof“ und „Allerlei Glück“ - blieben unausgeführt, bildeten aber später eine Art Steinbruch für andere Arbeiten.
Und dann fand er plötzlich in der Familie seines Schwagers Sommerfeldt ein geeignetes Modell, ohne sich dessen gleich bewusst zu sein. Es war nach Schwester Jennys Geburtstagsfeier - 18. April 1884 -, Fontane berichtete Tochter Mete, es sei zwar alles sehr nett gewesen, aber: „Ich kann den Bourgeoiston nicht ertragen ... [es] dreht sich mir ... angesichts des wohlhabend gewordenen Speckhökerthums das Herz um. Wirklicher Reichthum imponirt mir ... und ich lebe gern inmitten von Menschen, ... die Fabrikstädte gründen und Expeditionen aussenden ... Große Schiffsreeder, die Flotten bemannen, Tunnel- und Canalbauer, die Welttheile verbinden ... Alles Große hat von Jugend auf einen Zauber für mich gehabt ... Aber der ‚Bourgeois’ ist nur die Karikatur davon, er ärgert mich in seiner Kleinstelzigkeit und in seinem unausgesetzten Verlangen auf nichts hin bewundert zu werden ... alles, was angeschafft oder wohl gar ‚vorgesetzt’ wird, wird mit einem Blicke begleitet, der etwa ausdrückt: beglückter Du, der Du von diesem Kuchen essen,von diesem Wein, trinken durftest, alles ist kindische Überschätzung einer Wirthschafts- und Lebensform, die schließlich gerade so gut Sechserwirthschaft ist wie meine eigene ... Der Bourgeois versteht nicht zu geben, weil er von der Nichtigkeit seiner Gabe keine Vorstellung hat. Er ‚rettet’ immer, und man verschreibt sich ihm auf eine Schrippe hin für Zeit und Ewigkeit.“
Von diesem Brief bis zu „Frau Jenny “ war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Und es kam ihm auch noch eine Klatschgeschichte zugute, die man sich bei Sommerfeldts Kaffeetafel erzählte: Die Enkelin aus dem Gemüseladen, die immer so schön herausgeputzt wurde und die später mit ihren „kastanienbraunen Locken“ dem Sohn des Fabrikanten den Kopf verdrehte, wurde zu Jenny Bürstenbinder, die, von dem Studenten Wilibald Schmidt angedichtet, sich doch lieber für den plumpen Treibel entscheidet. Aus Blutlaugensalz und Eisenvitriol schlägt dieser bare Münze, er produziert das Preußischblau, mit dem man Uniformen einfärbt. Sein Geschäft steigt und fällt mit dem Politbarometer, also ist er ultrakonservativ, obwohl es ihm andererseits gegen den gesunden Menschenverstand geht. Seine Welt ist einfach: in Soll und Haben, Debit und Kredit aufgeteilt. Alles andere ist Mumpitz.